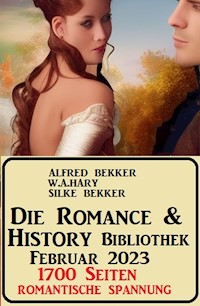
Die Romance & History Bibliothek Februar 2023: 1700 Seiten Romantische Spannung E-Book
Alfred Bekker
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die Romance & History Bibliothek Februar 2023: 1700 Seiten Romantische Spannung von Alfred Bekker, Silke Bekker, W.A.Hary Über diesen Band: Dieser Band enthält folgende Romane: Die Bernsteinhändlerin (Alfred Bekker/ Silke Bekker) Die Papiermacherin (Alfred Bekker/Silke Bekker) Die Seherin von Paris (Alfred Bekker/W.A.Hary) Wunderliche Liebesgeschichte 1914 (W.A.Hary/Alfred Bekker/Silke Bekker) Lübeck 1450: Mit einem großen Fest wird die Verlobung zwischen Barbara Heusenbrink, der Tochter des Rigaer Bernsteinkönigs Heinrich Heusenbrink, und dem reichen Patriziersohn Matthias Isenbrandt gefeiert. Obwohl Barbara Matthias nicht liebt, willigt sie in die Vernunftehe ein. Kurz darauf lernt sie jedoch den Glücksritter Erich von Belden kennen, von dem sie sich magisch angezogen fühlt. Aber beiden ist klar, dass ihre Liebe keine Chance hat. Und dann wird Barbara von Bernsteinschmugglern nach Danzig entführt, die ihren Vater erpressen wollen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2005
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Romance & History Bibliothek Februar 2023: 1700 Seiten Romantische Spannung
Alfred Bekker et al.
Published by Alfred Bekker, 2023.
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Die Romance & History Bibliothek Februar 2023: 1700 Seiten Romantische Spannung
Copyright
Die Bernsteinhändlerin
Die Bernsteinhändlerin
Copyright
Erstes Kapitel: Überfall auf der Kurischen Nehrung
Zweites Kapitel: Kalter Empfang
Drittes Kapitel: Der Ritter und die Giftmischerin
Viertes Kapitel: Lübische Intrigen
Fünftes Kapitel: Der Ritter mit dem Rosenschwert-Wappen
Sechstes Kapitel: Ein gehenkter Henker und drei schwarze Kreuze
Siebtes Kapitel: Barbaras Verlobung
Achtes Kapitel: Bernsteinschmuggler
Neuntes Kapitel: Auf dem Weg nach Livland
Zehntes Kapitel: Die Nacht des Mondes
Elftes Kapitel: Bernsteinsturm
Zwölftes Kapitel: In der Burg der roten Steine
Dreizehntes Kapitel: Ritt ins Niemandsland
Vierzehntes Kapitel: Der Mannwolf
Fünfzehntes Kapitel: Der Teufel im Dorf der Dänen
Sechzehntes Kapitel: Der Bernsteinkönig zu Riga
Siebzehntes Kapitel: Böses Erwachen
Achtzehntes Kapitel: In Riga und wieder fort
Neunzehntes Kapitel: Spuren
Zwanzigstes Kapitel: Viel Pech
Einundzwanzigstes Kapitel: Reise ins Ungewisse
Zweiundzwanzigstes Kapitel: Eingelöste Versprechen
Epilog
About the Author
About the Publisher
Die Papiermacherin: Historischer Roman
Die Papiermacherin
Copyright
Erstes Kapitel: Der Stoff, der die Gedanken trägt
Zweites Kapitel: Gefangen und verschleppt
Drittes Kapitel: Arnulf von Ellingen
Viertes Kapitel: Steppenwind
Fünftes Kapitel: Auf dem Weg in die Stadt der Bücher
Sechstes Kapitel: Am Hof des Kaisers
Siebtes Kapitel: Der Prinz von Samarkand
Achtes Kapitel: Ein Ritter aus Saxland
Neuntes Kapitel: Eine Warnung
Zehntes Kapitel: Ritt in die Eisenberge
Elftes Kapitel: Ein weiter Weg nach Westen
Zwölftes Kapitel: Nach Bagdad
Dreizehntes Kapitel: Die Heilige Stadt
Vierzehntes Kapitel: Neue Wege
Fünfzehntes Kapitel: Konstantinopel
Sechzehntes Kapitel: Li
Siebzehntes Kapitel: Belagert
Achtzehntes Kapitel: Zweikampf
Neunzehntes Kapitel: Geständnisse und Wendungen
Zwanzigstes Kapitel: Verrat und Intrige
Einundzwanzigstes Kapitel: Papiere
Zweiundzwanzigstes Kapitel: Venedig
Dreiundzwanzigstes Kapitel: Ein neuer Anfang
Vierundzwanzigstes Kapitel: Eine kalte Zeit
Fünfundzwanzigstes Kapitel: Nach Magdeburg
Epilog
Don't miss out!
About the Author
About the Publisher
Sammelband Die Seherin von Paris Teil 1-6
Sammelband Die Seherin von Paris Teil 1 bis 6
Copyright
Die geheimnisvolle Marie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Geheimnisse dunkler Gassen
1
2
3
4
5
6
7
8
Der Zirkel von Versailles
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Der Gesandte Spaniens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Der Kreis der Verschwörer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Im Zentrum der Verschwörer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Epilog
Wunderliche Liebesgeschichte 1914
Copyright
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Epilog
Die Romance & History Bibliothek Februar 2023: 1700 Seiten Romantische Spannung
von Alfred Bekker, Silke Bekker, W.A.Hary
Über diesen Band:
Dieser Band enthält folgende Romane:
Die Bernsteinhändlerin (Alfred Bekker/ Silke Bekker)
Die Papiermacherin (Alfred Bekker/Silke Bekker)
Die Seherin von Paris (Alfred Bekker/W.A.Hary)
Wunderliche Liebesgeschichte 1914 (W.A.Hary/Alfred Bekker/Silke Bekker)
––––––––
Lübeck 1450: Mit einem großen Fest wird die Verlobung zwischen Barbara Heusenbrink, der Tochter des Rigaer Bernsteinkönigs Heinrich Heusenbrink, und dem reichen Patriziersohn Matthias Isenbrandt gefeiert. Obwohl Barbara Matthias nicht liebt, willigt sie in die Vernunftehe ein. Kurz darauf lernt sie jedoch den Glücksritter Erich von Belden kennen, von dem sie sich magisch angezogen fühlt. Aber beiden ist klar, dass ihre Liebe keine Chance hat. Und dann wird Barbara von Bernsteinschmugglern nach Danzig entführt, die ihren Vater erpressen wollen ...
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker (https://www.lovelybooks.de/autor/Alfred-Bekker/)
© Roman by Author /
COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Die Bernsteinhändlerin
Die Bernsteinhändlerin
Alfred Bekker
Published by BEKKERpublishing, 2018.
Die Bernsteinhändlerin
Historischer Roman
Silke & Alfred Bekker schrieben als Conny Walden
Der Umfang dieses Buchs entspricht 481 Taschenbuchseiten.
Lübeck 1450: Mit einem großen Fest wird die Verlobung zwischen Barbara Heusenbrink, der Tochter des Rigaer Bernsteinkönigs Heinrich Heusenbrink, und dem reichen Patriziersohn Matthias Isenbrandt gefeiert. Obwohl Barbara Matthias nicht liebt, willigt sie in die Vernunftehe ein. Kurz darauf lernt sie jedoch den Glücksritter Erich von Belden kennen, von dem sie sich magisch angezogen fühlt. Aber beiden ist klar, dass ihre Liebe keine Chance hat. Und dann wird Barbara von Bernsteinschmugglern nach Danzig entführt, die ihren Vater erpressen wollen ...
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Authors
Die Originalausgabe erschien 2010 im Goldmann Verlag.
© dieser Ausgabe 2015 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
Erstes Kapitel: Überfall auf der Kurischen Nehrung
Sie mag noch sehr jung sein und überdies ist es ungewöhnlich, dass eine Frau sich in derlei Geschäften wie dem Bernsteinhandel tummelt. Aber es sollte Barbara Heusenbrink niemand unterschätzen. Nicht lange und sie wird ihrem Vater, den man nicht umsonst den Bernsteinkönig heißt, in nichts nachstehen. Jetzt, da Heinrich Heusenbrink schwach ist und sie noch keine Erfahrung besitzt, ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, ihrer beider ledig zu werden – sowohl des Vaters als der Tochter. Ob nun mit Hilfe der Natur oder durch die Unterstützung willfährigen und bewaffneten Gesindels, sei mir gleich.
Aus einem Reichart Luiwinger, dem Ältermann der Rigafahrer-Bruderschaft von Lübeck, zugeschriebenen Brief; unsigniert und undatiert; wahrscheinlich Anfang bis Mitte 1450 verfasst.
––––––––
DIE NOCH JUNGE UND unerfahrene Barbara Heusenbrink vertrat unerwarteterweise das Handelshaus Heusenbrink für ihren Vater, der in Riga unabkömmlich war und von dem ich durch Zuträger weiß, dass es mit seiner Gesundheit nicht zum Besten steht. Der Hochmeister aber sprach eine zweifache Warnung aus. Er sagte, dass noch nicht völlig sicher sei, ob die bisherigen Privilegien des Hauses Heusenbrink im Bernsteinhandel fürderhin im gleichen Umfang wie bisher garantiert werden könnten, auch wenn er selbst sich dafür einsetze und zuversichtlich sei. Und zweitens riet er davon ab, den Landweg nach Riga zu nehmen. Zwar sei man bis Königsberg unter dem sicheren Schutz des Ordens, aber man könne derzeit nur davon abraten, den weiteren und derzeit einzigen Landweg über die Kurische Nehrung zu nehmen, um mit dem Wagen zurück nach Riga zu fahren, selbst wenn dieser durch Reiter begleitet würde. Lieber solle sie die Wartezeit für ein Schiff in Kauf nehmen, denn die Nehrung sei unsicher und voller Gesindel und es sei kein Ordensritter abkömmlich, um sie zu schützen.
Sie aber sprach: „Da ich auch auf dem Herweg diese Strecke nahm und nun in großer Eile bin und geschäftliche Verpflichtungen es mir nicht erlauben, auf ein Schiff zu warten, ist es besser, ich nehme den Weg über die Nehrung, als dass ich etwa über das Land der Litauer fahre. Außerdem begleiten mich einige dem Haus Heusenbrink gleichermaßen treu ergebene und ihres Faches äußerst kundige Waffenknechte. Wenn Ihr Euch wirklich um mich sorgt, so lasst uns endlich zu einer abschließenden Einigung über den Handel mit dem Gold der Ostsee kommen!“ Damit aber meinte sie den Bernstein.
Aus den Protokollen des Melarius von Cleiwen, Leiter der Kanzlei des Hochmeisters des Deutschen Ordens auf der Marienburg; 1450
––––––––
DIE FLAMME EINER PECHGETRÄNKTEN Fackel flackerte unruhig im Wind, der vom Meer aus über die Nehrung strich. Hufschlag mischte sich in das Meeresrauschen und das Rascheln der Sträucher und Baumkronen.
„Jetzt!“, befahl eine heisere Männerstimme.
Die Lunten der Arkebusen wurden gezündet – fünf an der Zahl. Innerhalb von Augenblicken konnte man sie mindestens zwanzig Schritt weit riechen – aber nur in Windrichtung. Die Schützen hatten sich mit Bedacht so aufgestellt, dass diejenigen, auf die sie zielten, vollkommen arglos blieben, da der Wind den Geruch der glimmenden Lunten von ihnen weg trug. Fünfzig, sechzig Herzschläge - innerhalb dieser Zeit mussten die Hakenbüchsen abgefeuert werden, sonst war die Lunte abgebrannt und man musste ein neues Stück Seil an der Vorderseite des Zündhakens befestigen und zum Glimmen bringen.
Die Schützen warteten in den Büschen, während das von zwei zusätzlichen Reitern begleitete Gespann sich in voller Fahrt näherte. Die zwei berittenen Begleiter waren bewaffnet. Es handelte sich um Söldner, wie man sie in diesen Tagen überall anheuern konnte. Der Mann, der neben dem Kutscher saß, hielt eine Armbrust in den Händen und ließ unruhig den Blick in der Umgebung umherschweifen.
Die ersten beiden Schüsse krachten donnernd aus den Rohren. Eine Kugel ging dicht an dem Kutscher und seinem Beschützer vorbei und riss ein faustgroßes Loch in den Kutschbock. Die zweite traf einen der beiden Reiter. Tödlich getroffen stürzte er zu Boden und blieb regungslos liegen, während sein Pferd wiehernd davon preschte.
Weitere Schüsse fielen und als der zweite Reiter gerade sein Schwert zur Hälfte gezogen hatte, fuhr eine Kugel ihm durch das Bein und danach in den Leib des Pferdes, das daraufhin zu Boden ging. Der Schrei des getroffenen Reiters, mischte sich mit dem schrillen Wiehern des Pferdes, das wild um sich trat, während Ströme seines Blutes im sandigen, nur spärlich von sonnenverbranntem Gras bedeckten Erdreich versickerten.
Ein Dutzend Männer stürmten jetzt wild schreiend aus den Büschen. Der am Boden liegende Verletzte hob abwehrend sein Schwert, während sich sein Hosenbein bereits rot gefärbt hatte. Den Schwertstreich eines Angreifers konnte er noch parieren, dann traf ihn ein Axthieb am Kopf und setzte seinem Leben ein Ende.
Der Armbrustschütze auf dem Kutschbock hob seine Waffe und streckte einen der Angreifer nieder, bevor ihm selbst ein Wurfdolch in den Hals fuhr und er röchelnd zur Seite sackte. Der Kutscher saß wie erstarrt daneben, bleich wie ein Leichentuch, während einige der Angreifer bereits die Zügel des Gespanns gefasst und die Pferde beruhigt hatten. Dann sprang er vom Bock, doch ehe danach wieder auf die Beine kam und zu fliehen vermochte, traf ihn ein Schuss und ließ ihn wimmernd am Boden liegen. Der Schlag mit einer Axt beendete sein Leben. Noch ein weiterer Schuss krachte und fuhr ins Vorderrad, ließ das Holz splittern und den Wagen an dieser Seite ein Stück hinabsinken.
Schon kletterte jemand von hinten am Wagen empor und durchtrennte mit einem Langmesser die Schnüre, mit denen auf dem Dach die Gepäckstücke befestigt waren.
Ein Mann in fleckigem Lederwams trat von der Seite auf die Kutsche zu. Er hatte ein Loch in der Wange, das man ihm zweifellos irgendwann beigebracht hatte, um ihn als Verbrecher zu brandmarken. Der so grausam Gezeichnete benetzte Daumen und Zeigefinger mit der Zunge und löschte die Lunte seiner Arkebuse, denn es war nicht mehr anzunehmen, dass er die Waffe noch abfeuern musste und da war es besser, Pulver und Kugel zu sparen.
Er riss die Tür der Kutsche auf.
„Raus mit Euch! Und zwar sofort!“
Im Inneren der Kutsche befand sich nur eine einzige Person – eine junge Frau, die dem Gebrandmarkten überraschend furchtlos entgegensah. Meergrüne, aufmerksame Augen beherrschten ihr feingeschnittenes, von dunkelblonden Haaren umrahmtes Gesicht. Ihr entschlossen wirkender Blick stand in einem gewissen Kontrast zu den noch sehr jung wirkenden, weichen Gesichtszügen. Die Frisur trug sie hochgesteckt, aber die Strapazen der Reise hatten sie ein bisschen zerzaust, sodass sich ein paar Strähnen hervor stahlen. Mit einer beiläufigen, gleichermaßen elegant wie nüchtern wirkenden Handbewegung strich sie sich eine dieser Strähnen aus der Stirn.
Der Mann mit dem Loch in der Wange ergriff grob ihr Handgelenk und zog sie aus dem Wagen hervor. Er fasste ihr Kinn und drehte ihren Kopf zur Seite.
„Das muss sie sein!“, meinte einer der anderen Männer – ein Kerl mit einem dunklen Bart, der ihm fast bis unter die Augen wuchs.
Der Gebrandmarkte nickte. Sein Blick hing an dem in Silber gefasstem Bernsteinamulett, das die junge Frau um den Hals trug. Er griff zu und riss es ihr vom Hals. Dann hielt er es in die Sonne und sah sich die Gravur auf der Rückseite an. Lesen konnte er wahrscheinlich nicht, aber das H, das kunstvoll, fast nach Art eines Miniaturwappens gestaltet worden war, hatte er schon gesehen. „Kein Zweifel, sie ist die Frau, die wir suchen“, stellte er fest. „Barbara Heusenbrink – die Tochter des Mannes, den man in Riga den Bernsteinkönig nennt, weil angeblich jedes Stück des Ostseegoldes durch seine Hände geht!“
––––––––
BARBARA HEUSENBRINK versuchte ein Zittern zu unterdrücken. Man hatte sie sehr eindringlich davor gewarnt, den Weg über die Nehrung zu nehmen, an deren Ende man mit einer Fähre die Meerenge überqueren konnte, die das kurische Haff mit der Ostsee verband. Aber da das Land südlich des Haffs von den Litauern beherrscht wurde, war der Weg über die Nehrung die einzige Möglichkeit, auf dem Landweg nach Kurland zu kommen, ohne das Ordensterritorium zu verlassen.
Dass dies Räuber dazu einlud, hier auf Beute zu warten, lag auf der Hand.
Aber Barbara war keineswegs vor einer Woche von der Marienburg aus aufgebrochen, ohne diese Risiken zu bedenken. Die gut bewaffneten und dem Haus Heusenbrink treu ergebenen Männer, die sie begleiteten, waren normalerweise mit Leichtigkeit in der Lage, das gewöhnliche Diebesgesindel, das man auf dem Weg über die Nehrung antreffen konnte, in die Flucht zu schlagen. Es war auch keineswegs das erste Mal, dass Barbara diesen Weg nahm. Schon früher hatte sie ihren Vater auf Geschäftsreisen in den südlichen Teil des Ordensterritoriums bis in die nach Unabhängigkeit von der Oberhoheit der Kreuzritter strebenden Hansestädte wie Danzig, Elbing oder Thorn begleitet. Sie hatte geglaubt, das Risiko abschätzen zu können, zumal das gewöhnliche Diebesgesindel meistens schon Reißaus nahm, wenn es bemerkte, dass der Wagen von gut bewaffneten Söldnern begleitet wurde. Diejenigen, die sich auf der Nehrung auf die Lauer nach leichter Beute legten, waren in der Regel schlecht bewaffnete arme Hunde, die davor zurückscheuten, sich auf einen Kampf einzulassen. Wenn sie mit Widerstand zu rechnen hatten, zogen sie sich schnell zurück. Ein Schwert zu ziehen reichte oft, um sie zu vertreiben. Spätestens der Knall einer Arkebuse scheuchte sie davon und jagte ihnen einen so großen Schrecken ein, dass man nicht damit zu rechnen brauchte, denselben Halunken auf derselben Reise noch einmal an anderer Stelle zu begegnen.
Aber die Männer, denen Barbara an diesem Unglückstag in die Hände gefallen war, gehörten ganz offensichtlich nicht in die diese Kategorie. Allein ihre gute Bewaffnung sprach schon dagegen und hob sie von dem gewöhnlichen Gesindel ab.
Der Mann mit dem Loch in der Wange betrachtete noch einmal für einen kurzen Moment das Amulett und steckte es dann unter sein Lederwams. Er drehte sich zu seinen Männern um. „Holt die Pferde! Wir sollten hier so schnell wie möglich verschwinden...“
„Geht es Euch um ein Lösegeld?“, fragte Barbara und ihre Stimme hatte dabei einen so sicheren, festen Klang, dass die Verwunderung darüber dem Gezeichneten ins Gesicht geschrieben stand.
Er verzog das Gesicht und trat auf Barbara zu. „Was glaubt Ihr denn, worum es uns geht?“, grinste er.
Barbara wich seinem Blick nicht aus. „Ihr solltet nicht auf ein Lösegeld spekulieren...“
„Da Ihr die Tochter des Bernsteinkönigs seid, würde Euer Vater doch gewiss jeden Preis für Euch bezahlen!“
„Aber Ihr würdet es auch bezahlen – und zwar sehr bitter. Denn mein Vater hätte die Macht, Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, um Eure Bande ausfindig zu machen und Euch Eurer Strafe zuzuführen. Begnügt Euch mit dem Gepäck und verschwindet. Andernfalls werdet Ihr Eure Köpfe schneller auf dem Richtblock wieder finden, als Ihr es für möglich haltet...“
Das Gesicht des Gezeichneten verzog sich zu einer spöttischen Grimasse. Ihm schien eine höhnische Bemerkung auf der Zunge zu liegen, doch dann stockte er und wandte sich zur Seite, als plötzlich Hufschlag erscholl.
Ein Reiter kam über eine nahe Dünung auf einem Apfelschimmel daher geritten. Er war nach Art eines Ritters gekleidet, trug Wams, Kettenhemd und ein Übergewand, das mit einem weithin sichtbaren Wappen bestickt war. Es bestand aus einem stilisierten Schwert, das von einer Rose umkränzt wurde. Der Helm wies einige Beulen auf.
An der Seite trug er ein Rapier, während ein schwerer Beidhänder in einer links vom Sattelknauf befestigten Lederscheide steckte. Hinten am Sattel waren ein Reflexbogen und ein Köcher mit Pfeilen befestigt.
„Wer kann das sein?“ fragte der Mann, der von hinten auf den Wagen geklettert war.
„Jedenfalls kein Kreuzritter!“, knurrte der Gezeichnete und rief dann: „Los, ladet eure Büchsen!“
Er trat einen Schritt seitwärts, hob den Lauf seiner Arkebuse und blickte zu einem großen, massig wirkenden Mann in einem Gewand aus fleckigem Leinen hinüber, der die Fackel hielt. Ärger spiegelte sich in seinem Gesicht, als er sah, dass der Fackelträger das Feuer bereits im Sand gelöscht hatte und somit keine der Arkebusen zügig feuerbereit gemacht werden konnte, falls der Fremde feindliche Absichten hatte.
„Narr!“, zischte der Gezeichnete den Fackelträger an.
Der fremde Reiter zügelte seinen Apfelschimmel. Er erfasste sofort die Lage und griff zum Bogen. Ehe der Armbrustschütze unter den Wegelagerern einen neuen Bolzen in seine Waffe einlegen konnte, hatte ein Pfeil des Fremden ihm den Hals durchbohrt, sodass er röchelnd zu Boden sank.
Der Gezeichnete wollte Barbara mit sich reißen, aber nur einen Moment später steckte auch ihm ein Pfeil zitternd in der Brust, der ihn auf die Knie sinken ließ. Er ließ Barbara los und sie wich einen Schritt zurück, während ihm die Arkebuse aus der Hand glitt. Seine Finger legten sich um den Griff des kurzen Rapiers an seinem Gürtel und er riss die Waffe noch eine Handbreit hervor, ehe er zu Boden sackte und reglos liegen blieb.
Innerhalb weniger Augenblicke ließ der Fremde weitere Pfeile durch die Luft schnellen, die mit grausamer Genauigkeit ihre Ziele fanden.
Der Tod ihres Anführers hatte der Bande allerdings jegliche Ordnung genommen.
„Los, weg hier!“, hörte man einen der Männer rufen, der bereits von dannen lief.
Der Fremde schoss mit geradezu atemberaubender Sicherheit und Schnelligkeit seine Pfeile ab, von denen fast alle auch ihr Ziel fanden. Es dauerte nur Momente und die Männer des Gezeichneten lagen entweder getroffen auf dem sandigen Boden, auf dem sich oft nur mühsam etwas Gras halten konnte – oder sie waren bereits zwischen die nahe gelegenen Bäume und Büsche geflohen.
Der Fremde mit dem Rosenschwert-Wappen senkte schließlich die Waffe und entspannte die Sehne. Dann ließ er den Apfelschimmel näher herantraben.
Barbara sah kurz den Flüchtenden nach. Einem von ihnen steckte ein Pfeil in der Schulter und es war fraglich, wie weit er kommen würde. Der Reiter zügelte mit der Linken sein Pferd und stieg dann aus dem Sattel. Den Bogen behielt er in der Hand, einen Pfeil ebenfalls. Er schien seinem Sieg über die Wegelagerer noch nicht so recht zu trauen. Jedenfalls behielt er die Büsche im Auge, hinter denen die letzten von ihnen verschwunden waren. Dann schweifte sein Blick über die Toten, die auf dem Boden verstreut und teilweise in seltsam verrenkter Haltung dalagen.
Barbara Heusenbrink starrte den Ritter mit dem Rosenschwert-Wappen unterdessen ungläubig an. Ihr Herz pochte wie wild und ein dicker Kloß steckte ihr im Hals. Sie hatte das Wappen schon aus der Ferne wiedererkannt – und auch seinen Träger. Drei Jahre war es her, da dieser Ritter in ihr Leben getreten war und ihm eine völlig neue Wendung gegeben hatte.
Und nun hatte Gottes Fügung sie gerade im rechten Moment wieder zusammengeführt. Sie schluckte und konnte im ersten Moment nichts sagen.
„Erich von Belden!“, flüsterte sie schließlich. „Dass ich Euch hier und jetzt wieder sehe...“
Er deutete eine Verbeugung an. „Ihr schient mir in arge Bedrängnis geraten zu sein, und da hielt ich es für meine Pflicht als Ritter, zu Eurem Schutz einzugreifen.“
Ein verhaltenes Lächeln spielte jetzt für einen kurzen Moment um ihre vollen Lippen. „Ich habe nicht vergessen, wie Ihr mir bereits vor drei Jahren in Lübeck das Leben gerettet habt – und jetzt seid Ihr mir erneut in bedrohlicher Lage zu Hilfe gekommen! Der Herr muss Euch geschickt haben – das eine wie das andere Mal!“
„Ich tat nur, was ich für meine Pflicht hielt – aber ich verhehle nicht, dass ich sie für Euch besonders gerne tat!“
Barbara schluckte. „Jedenfalls bedanke ich mich in aller Form für Euer beherztes Eingreifen! Es im Alleingang mit einem Dutzend Gegnern aufzunehmen, erfordert sicher mehr Mut, als er selbst den meisten Eures Standes eigen ist!“
Erich von Belden machte zwei Schritte zur Seite, beugte sich über die Leiche des Gezeichneten und hob dessen Arkebuse vom Boden auf. Er hielt die Waffe empor und meinte: „Eine wahre Seuche sind diese Büchsen – und das Schlimme ist, dass jeder dahergelaufene Halunke sie benutzen kann, nachdem man es ihm einmal gezeigt hat!“ Der Ritter hob seinen Bogen. „Das hier ist hingegen eine Kunst und ein guter Schütze hat Jahre geübt, bevor er eine Wildente sicher im Flug zu treffen vermag.“
„So hat Eure Kunst über diese unchristlichen Waffen triumphiert!“, sagte Barbara.
Der Ritter nickte und warf die Arkebuse wieder zu Boden, bevor er dem Toten den Pfeil aus dem Leib zog. „Ja, diesmal“, murmelte er. „Eine Armbrust sollte eigentlich niemand gegen einen Christenmenschen verwenden – und doch war ich hundertmal Zeuge, wie das geschah. Bei Feuerwaffen würde es nicht anders sein, falls man sie genauso ächten würde... Aber wer sollte das tun? Der Papst lässt seine Engelsburg schließlich auch von Feuerwaffen verteidigen!“
Ihrer beider Blicke trafen sich für einen Moment und Erinnerungen stiegen in Barbara auf. Unwillkürlich dachte sie daran, wie sie am Fenster eines Lübecker Patrizierhauses gestanden und mit den Fingerspitzen das Fensterglas berührt hatte. Es war so glatt gezogen gewesen - klar und dabei so auffallend sauber in die Rahmen eingesetzt, wie es nur Handwerker aus Venedig zu Stande brachten. Das Treiben, das sie damals auf der Straße beobachtet hatte, wurde vor ihrem innerem Auge wieder lebendig. Bilder, Stimmen, Gestalten, Pferde, Wagen...
Ein Reiter war ihr aufgefallen - hoch gewachsen, etwa dreißig Jahre alt und wie ein Ritter gekleidet und bewaffnet. Besonders einprägsam war das Wappen mit dem Rosenschwert auf dem Waffenrock gewesen. Damals hatte Erich von Belden ein zweites Pferd mit sich geführt, das wohl als Packtier gedient hatte.
Ein Reisender, so hatte Barbara angenommen - wahrscheinlich ein verarmter Adelssohn, der sich als Söldner verdingte. Die aufblühenden Hansestädte hatten – ebenso wie viele Landesfürsten – einen ständig wachsenden Bedarf an kampferfahrenen Landsknechten, die sie dann in Lohn und Brot nahmen.
Einen flüchtigen Augenblick nur waren sich damals ihre Blicke begegnet.
Wenig später hatte sie ihn aus den Augen verloren, als er hinter der nächsten Straßenecke verschwunden war. Zwei Schicksalswege, die sich wahrscheinlich nicht wieder kreuzen würden, so hatte sie damals zuerst gedacht. Doch nur kurze Zeit später sollte er ihr bereits erneut begegnen und sie davor bewahren, sehenden Auges in ihr Verderben zu stürzen.
Die drei Jahre, die seitdem vergangen waren, erschienen Barbara im Rückblick eine Ewigkeit.
Zweites Kapitel: Kalter Empfang
[...] So bin ich sehr froh, dass wir uns über die wesentlichen Punkte einig werden konnten, die eine Verlobung und spätere Verehelichung Ihres Sohnes Matthias mit unserer Tochter Barbara, sowie die sich daraus ergebende zukünftige Verbindung der Handelshäuser Isenbrandt aus Lübeck und Heusenbrink aus Riga betreffen. In einer Zeit, in der das freie Kaufmannstum vielfältigen Bedrohungen durch den schier unersättlichen Abgabenhunger von Fürsten und Ordensrittern ausgesetzt ist, die Wegelagerern gleich die Kaufleute und Krämer auf ganz und gar unchristliche Weise auszupressen versuchen, müssen neue Wege gefunden werden, um sich unter widrigsten Umständen gemeinsam gegen diese Drangsal zu behaupten. Auf dass dieses Raubrittertum recht ungnädiger Landesherrn sich nicht weiter wie eine Galgenschlinge um die Hälse ehrlicher Hanseaten lege! Da aber die Nachfrage nach Bernstein, den man nicht umsonst das Gold der Ostsee nennt, seit Menschengedenken ungebrochen ist, sehe ich trotz aller Beschwernisse eine ertragreiche Zukunft vor uns. [...]
Aus einem Brief des Rigäer Handelsherrn Heinrich Heusenbrink – genannt „der Bernsteinkönig“ - an den lübischen Kaufmann und Ratsherrn Jakob Isenbrandt; verfasst im Dezember 1446; an seinen Empfänger überbracht nicht vor März 1447:
––––––––
LÜBECK, MÄRZ 1447 – drei Jahre vor dem Überfall auf der Kurischen Nehrung...
„Sollte mein zukünftiger Gemahl mich nicht am Hafen erwarten?“
„Sicher hat man ihm unsere Ankunft noch nicht gemeldet, Barbara.“
„Seit Stunden müht sich unsere Kogge die Trave hinauf und außerdem haben wir am Nordtor einen Boten an Land gesetzt, der uns ankündigen soll...“ Sie schüttelte den Kopf und gab die Suche auf. Am Ufer war niemand, dessen Kleidung auch nur annähernd standesgemäß gewesen wäre. Nur Hafenarbeiter, Matrosen, Salzhändler und bettelndes Gesindel, das auf die Barmherzigkeit wohlhabender Passagiere hoffte. Barbara wandte ihren Kopf, strich sich eine Strähne aus dem Gesicht und sah ihren Vater an. „Wenn ich schon keine Liebe erwarten kann, so doch wenigstens Höflichkeit und Respekt. Findest du nicht?“
Ein kalter, beißender Wind blies von Norden und wehte Barbara Heusenbrink in das ungeschützte Gesicht, während sie auf dem Achterdeck der „Bernsteinprinzessin“ stand – einer bauchigen Kogge nach hanseatischer Bauart. Kurz vor der Abreise aus Riga hatte sich der Tag ihrer Geburt zum zwanzigsten Mal gejährt, was bedeutete, dass es höchste Zeit wurde, eine standesgemäße Ehe einzugehen, die geeignet war, die Zukunft des Handelshauses Heusenbrink zu sichern.
Ihre Haltung verriet den Stolz einer Patriziertochter, die sich einer Art von Adel zugehörig fühlte, der nicht auf der Geburt und der Gnade eines Lehnsherren gründete, sondern auf der Macht des Geldes und dem Erkennen von Möglichkeiten, um es zu vermehren. Ihr kostbarer Mantel unterstrich diesen selbstbewussten Eindruck noch – aber selbst wenn Barbara im grauen Büßergewand und mit Asche bedecktem Haupt auf den Planken der „Bernsteinprinzessin“ gestanden hätte, so wäre doch der Stolz einer Kaufmannstochter nicht zu verleugnen gewesen - ein Stolz, der nicht mit Überheblichkeit zu verwechseln war, sondern auf einem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten fußte, das trotz aller Ungewissheit einen furchtlosen Blick in die Zukunft ermöglichte.
Barbara zog ihren Umhang mit Pelzbesatz enger um die Schultern, denn der eisige Wind fuhr wie ein kaltes Messer durch die verschiedenen Schichten von Gewändern. Sie hatte das Gefühl, auf schwankendem Boden zu stehen – und das galt nicht nur für ihren Aufenthalt auf der „Bernsteinprinzessin“ mit ihren rutschigen Planken, sondern erschien ihr wie ein Gleichnis ihres Schicksals. Jedenfalls war sie keinesfalls von einem Glücksgefühl erfüllt, wenn sie an die bevorstehende Verlobung mit dem lübischen Patriziersohn Matthias Isenbrandt dachte. Liebe war es sicher nicht, was sie miteinander verband; eher schon Familieninteressen, denn in dem Bestreben, durch Hochzeiten Politik zu machen, glichen sich der Geldadel des Kaufmannsstandes und der herkömmliche Adel auf erstaunliche Weise. Barbara und Matthias waren sich einmal flüchtig während eines Festes in Riga begegnet, das im Rahmen einer gemeinsamen Kaufmannstagung von Patriziern aus Riga und Lübecker Rigafahrern stattgefunden hatte. Eine höfliche Begrüßung und ein kurzer, mehr oder minder charmanter Wortwechsel - das war ihr gesamter bisheriger Kontakt gewesen. Zu behaupten, dass sie sich auch nur oberflächlich gekannt hätten, wäre schon übertrieben gewesen. Matthias Isenbrandt sah aus wie eine jüngere, noch nicht ergraute Version seines Vaters. Sein Haar war dunkelblond, die Augen grau wie ein diesiger Herbsttag an der Küste. Er war hoch gewachsen und schlank. Die nach der neuesten Mode aus Venedig oder Florenz geschnittenen Gewänder standen ihm gut und die meisten ihrer Bekannten in Riga fanden, dass Barbara mit ihm das große Los gezogen hatte. Ein Gemahl, der attraktiv, reich und gesellschaftlich hoch angesehen war – was konnte eine Kaufmannstochter aus Riga sonst noch erwarten? Ja, äußerlich schien alles perfekt zu sein...
Hier in Lübeck würde sich ihr zukünftiges Leben entscheiden. Aber Barbara hatte das Gefühl, dass die entscheidende Weggabelung bereits hinter ihr ihr lag und alles, was jetzt kam vorgezeichnet war. Und das ängstigte sie. Schon als sie in Riga die rutschigen Planken der „Bernsteinprinzessin“ betreten hatte, war ihr die das sehr schmerzhaft bewusst geworden. Und das beklemmende Gefühl, dass sie in jenem Augenblick empfand, hatte sie seitdem nicht mehr verlassen. Die in den hintersten Winkel ihrer Seele verdrängte Erkenntnis, sich auf einem falschen Weg zu befinden, drang in manchen Augenblicken mit Macht in den Vordergrund. Aber es gab kein Zurück mehr, so dachte sie.
Ein rauer, heiserer Ruf riss Barbara aus ihren Gedanken, sodass ein Ruck durch ihre schlanke, zierlich wirkende Gestalt ging.
––––––––
ES WAR EINER DER SEELEUTE, dessen Stimme sie ins Hier und Jetzt zurückgeholt hatte. Er hielt ein Tau-Ende in der Hand, hatte sich in der Nähe des Bugs rittlings über die Reling geschwungen und wartete nun darauf, dass die „Bernsteinprinzessin“ sich weit genug der Kaimauer näherte, sodass er an Land springen und das Schiff vertäuen konnte. Dessen Segel wurden inzwischen eingeholt. Die Kogge trieb auf eine freie Anlegestelle nahe des Holstentores zu. Dem Einfluss des Hauses Isenbrandt war es zu verdanken, dass die „Bernsteinprinzessin“ hier, im älteren Hafengebiet, unweit des Salzmarktes, anlegen konnte. Wenn man die Stadtmauer durch das Holstentor passierte, hatte man nur einen kurzen Weg ins Viertel der Kaufleute rund um die Kirche von St. Marien, das Rathaus und die Wechselbänke, wo Münzen aller Herren Länder in lübische Mark getauscht werden konnten – sofern ihr Gehalt an Gold, Silber oder Kupfer nicht in irgendeiner Weise zweifelhaft war.
Durch die gewählte Wegführung wurde den Passagieren der „Bernsteinprinzessin“ wurde so ein längerer Weg durch das nördliche Burgtor am Dominikanerkloster vorbei durch eine Vielzahl enger Gassen erspart.
Die gesamte Besatzung war jetzt an Deck und stand in der Nähe der Reling – darunter auch die zwanzig Bewaffneten, die das Schiff während der Überfahrt begleitet hatten. Seit ein paar Jahren war es für den Reeder jeder Handelskogge verpflichtend, mindestens zwanzig Mann unter Waffen an Bord zu haben. Mit dieser Maßnahme wollte man der grassierenden Piraterie Herr werden, worum man sich aber schon zweihundert Jahre lang mehr oder minder vergeblich bemühte. Fast ein halbes Jahrhundert war es her, dass der berüchtigte Klaus Störtebecker und seine Vitalienbrüder im benachbarten Hamburg ihr verdientes Ende gefunden hatten – aber viele andere segelten in deren Fahrwasser und fanden hier und da sogar Landesherren, die ihnen Unterschlupf oder gar Kaperbriefe gaben, weil ihnen die Hanse ein Dorn im Auge war.
Mit einem Ruck krängte die „Bernsteinprinzessin“ gegen die Kaimauer. Der Mann, der am Bug gewartet hatte, sprang jetzt an Land und kam dort sicher auf. Ein Zweiter folgte und zog sogleich sein Tau-Ende stramm, um es anschließend mit einem halben Schlag um einen der Holme an der Kaimauer zu schlingen und das Schiff damit zumindest vorläufig zu vertäuen. Auf einen Ruf hin wurde ein Fallreep herabgelassen.
„Jetzt sind wir am Ziel“, sagte eine männliche, sonore Stimme dicht hinter Barbara. Die junge Frau wandte sich halb herum und sah in das wettergegerbte Gesicht ihres Vaters, dessen Augen sich durch dasselbe meergrüne Leuchten auszeichneten, wie man es auch bei Barbara finden konnte. Sein Bart war grau geworden und in das Gesicht hatte sich bereits so manche Falte eingegraben. Heinrich Heusenbrink nannte man auch mit einer Mischung aus Respekt und blankem Neid den Bernsteinkönig. Er kaufte dieses Gold der Ostsee von den Rittern des Deutschen Ordens, die in den von ihnen beherrschten Ländern des Baltikums ein Monopol darauf hatten. Die Tatsache, dass jedes Stück Bernstein, das an den Küsten des Baltikums gefunden wurde, durch die Hände der Ordensritter ging, hatte sie reich und ihren Staat überaus mächtig gemacht. Aber der Orden verfügte nicht über die nötigen Handelsbeziehungen, um den Bernstein selbst weiter vermarkten zu können. Dafür sorgten Männer wie Heinrich Heusenbrink, der den Bernstein in großen Mengen dem Orden zu festgesetzten Preisen abkaufte, ihn schleifen ließ und ihn schließlich an seine Handelspartner weiterverkaufte.
Einer der wichtigsten dieser Partner war das Handelshaus Isenbrandt in Lübeck, von wo aus dieser wertvolle Schmuck seinen Weg in die ganze bekannte Welt fand.
„Ich habe ein flaues Gefühl im Bauch“, gestand Barbara. Schon bei der Abfahrt im Hafen von Riga hatte sie sich nicht sonderlich wohl gefühlt, aber bisher hatte sie sich keine Schwäche anmerken lassen und über ihr Befinden geschwiegen.
„Das kommt von der Seereise“, versicherte Heinrich Heusenbrink lächelnd.
„Ja, vielleicht...“, murmelte Barbara. „Vielleicht ist es ja tatsächlich nur die Seereise... Schließlich sind wir ja ganz schön durchgeschüttelt worden und außerdem noch halb erfroren!“ Aber Barbara wusste nur zu gut, woher dieses tiefe Unbehagen in Wahrheit kam. Alles in ihr sträubte sich gegen das, was ihr bevorstand, obwohl sie die logischen Argumente, die für eine Heirat mit Matthias Isenbrandt sprachen, durchaus nachvollziehen konnte und sie den Plänen ihres Vaters zunächst zugestimmt hatte.
Auf sich gestellt war das Handelshaus Heusenbrink wohl nicht überlebensfähig. Noch stand man gut da! Noch galt Heinrich Heusenbrink als der Bernsteinkönig von Riga. Aber das alles stand auf tönernen Füßen.
Barbara war das einzige überlebende Kind von Heinrich und Margarete Heusenbrink. Das bedeutete, dass sie eines Tages die Führung des Geschäfts übernehmen musste. Heinrich hatte sie darauf nach Kräften vorbereitet und sie verstand inzwischen gewiss mehr vom Bernsteinhandel als die meisten Kaufleute in Riga und Lübeck. Mit traumwandlerischer Sicherheit wusste sie beispielsweise den Wert der angebotenen Ware abzuschätzen und gerade dabei verließ sich Heinrich Heusenbrink bereits fast vollkommen auf ihre Urteilskraft. Dass sie eine Frau war, trug zwar nicht gerade dazu bei, dass man sie unter den Hanseaten von Riga sonderlich ernst nahm, aber Barbara war fest entschlossen, allen zu zeigen, was in ihr steckte. Doch das Tor zur Welt blieb Lübeck. Und so bedeutend das Handelshaus Heusenbrink auch in Riga selbst dann sein mochte, wenn es in Zukunft von einer Frau geführt wurde, so lebenswichtig war es andererseits doch auch, einen starken Partner in Lübeck zu haben, von wo aus man mit Leichtigkeit Handelsbeziehungen in die gesamte bekannte Welt knüpfen konnte. Auf sich allein gestellt würde sich das Handelshaus der Heusenbrinks auf Dauer nicht halten können.
„Lass uns an Land gehen“, sagte Heinrich Heusenbrink. Seine Frau Margarete hatte leider aus gesundheitlichen Gründen in Riga bleiben müssen. Ein Lungenleiden machte ihr schon seit langem zu schaffen und da hatte man ihr die Anstrengungen der Überfahrt nicht zumuten wollen. Hätte man Barbara als kleinem Mädchen geweissagt, dass ihre Mutter nicht an ihrer Verlobung teilnehmen würde, so wäre sie gewiss sehr traurig gewesen. Aber da sie selbst dieser Verbindung distanziert gegenüberstand, war das nicht so schlimm. Natürlich hätte sich Barbara den Rat und den Beistand ihrer Mutter gewünscht, aber die Gesundheit ging in diesem Fall vor.
Vielleicht muss ich noch lernen, das, was vor mir liegt, wie eine geschäftliche Transaktion zu betrachten!, ging es ihr durch den Kopf. Der Haken an der Sache war nur, dass es dabei nicht um den Tausch von Bernstein gegen einen möglichst hohen Betrag in lübischer Mark ging, sondern dass sie selbst das Tauschobjekt war.
Barbara und ihr Vater betraten über das Fallreep das Ufer. Zwischen dem Ufer der Trave und der Stadtmauer befand sich ein etwa dreißig Schritt breiter Streifen, auf dem die Waren umgeschlagen wurden, die man von den Schiffen entlud.
Barbara war froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Sie blickte direkt auf das Holstentor. Zahllose Bettler und Tagelöhner hatten sich bereits an der Kaimauer versammelt, um beim Entladen etwas zu verdienen – oder, falls dies nicht möglich war, wenigstens ein Almosen zu erbetteln. Die Augen dieser in Lumpen aus fleckigem Leinen gekleideten Menschen waren wie gebannt auf die Heusenbrinks gerichtet und verfolgten jede ihrer Bewegungen. Noch hielten sie gebührenden Abstand, denn sie wussten, dass sie ihrem Glück nicht durch Aufdringlichkeit nachhelfen konnten.
Zwei Gespanne näherten sich dem Liegeplatz der „Bernsteinprinzessin“ und die Menge bildete sofort eine Gasse, noch ehe die Kutscher sie ziemlich herrisch dazu aufforderten, den Weg zum Schiff freizugeben.
Der erste Wagen war für den Transport von Personen gedacht, der zweite sollte wohl Gepäck aufnehmen.
Ein Mann in einfacher, aber vornehmer Kleidung stieg aus der ersten Kutsche. Er trat vor Barbara und ihren Vater, nahm seine mit einer Fasanenfeder geschmückte Mütze ab und verneigte sich tief. „Ich bin Thomas Bartelsen, der Schreiber und Sekretär des ehrenwerten Ratsherrn Jakob Isenbrandt“, stellte er sich vor. „Und wenn mich nicht alles täuscht, seid Ihr der Herr Heinrich Heusenbrink mit seiner Tochter Barbara.“
„Das ist richtig“, nickte Heinrich.
Thomas Bartelsen verneigte sich noch einmal eigens vor Barbara, begrüßte sie mit aller zu Gebote stehender Höflichkeit und sagte dann: „Die Kunde von Eurer Schönheit und Eurem Geschäftssinn sind Euch vorausgeeilt und bis nach Lübeck gedrungen.“
„Wer so etwas berichtet hat, wollte schmeicheln“, erwiderte Barbara mit einem verhaltenen Lächeln. Derartige Komplimente waren eigentlich nicht nach ihrem Geschmack.
„... und hat doch keineswegs übertrieben!“, fügte Thomas Bartelsen ihrer Bemerkung hinzu. „Euer zukünftiger Gemahl ist für seinen guten Geschmack bei der Auswahl seiner Braut gewiss zu beneiden!“
Nur dass dies kaum seine eigene Wahl gewesen sein dürfte!, dachte Barbara, behielt diese Erwiderung aber für sich. Sie fragte sich jedoch immer mehr, weshalb Matthias ihr nicht persönlich die Ehre erwiesen und sich zum Hafen begeben hatte, sondern die Begrüßung seiner zukünftigen Braut einem Bediensteten überließ. Ein Zeichen von Respekt war das nicht und mit etwas bösem Willen konnte man darin sogar einen Affront sehen. Barbara war realistisch und erwartete von dem ihr fremden Mann kein Liebesgeflüster oder gar irgendeine falsche Schmeichelei.
Aber die Formen des Anstands und der Höflichkeit hätte er wohl wahren können!, fand sie.
Wenigstens die Achtung, die Matthias Isenbrandt sicherlich einem wichtigen Geschäftspartner entgegengebracht hätte, der mit einer Ladung Bernstein, Seide oder englischem Tuch im Lübecker Hafen angelangt wäre, hätte sie erwartet – denn welch wichtigeres Geschäft zwischen den Heusenbrinks und den Isenbrandts hatte es wohl je gegeben?
Thomas wandte sich an Heinrich. „Ich habe den Auftrag, Euch und Eure Tochter zum Haus Isenbrandt zu bringen“, erklärte er. „Es ist für alles gesorgt. Ihr mögt Euch in der Zeit vor der Verlobungsfeier wie zu Hause fühlen und es soll Euch an nichts mangeln!“
„Ich danke Euch!“, antwortete Heinrich.
„Für Euer Gepäck wird natürlich gesorgt. Ihr braucht Euch um nichts zu kümmern. Im Haus der Isenbrandts sind die Gemächer bereits für Euch gerichtet worden.“
Heinrich wollte den Bettlern noch ein paar Almosen geben, aber der Schreiber des Hauses Isenbrandt hielt ihn davon ab. „Das erledigen unsere Leute schon“, sagte Thomas Bartelsen, „und da Ihr – wie ich annehme – mit viel Gepäck angereist seid, werden viele dieser Armseligen Gelegenheit haben, sich ein paar Münzen zu verdienen.“
„Und was ist mit den Krüppeln, die dazu nicht in der Lage sind?“, mischte sich Barbara ein.
Das Lächeln des Schreibers im Hause Isenbrandt wirkte auf einmal sehr kühl. Das ist also Euer weniger galantes Gesicht, Herr Bartelsen!, ging es Barbara durch den Kopf.
„Gott hat sie gestraft – warum sollten wir sie belohnen?“, fragte Bartelsen.
––––––––
WENIG SPÄTER FUHREN Barbara und Heinrich Heusenbrink in dem offenen Wagen, mit dem Thomas Bartelsen gekommen war, durch das Holstentor.
Der Kutscher trieb die Pferde voran. Die bewaffneten Wächter der Stadtwache, die dort Posten bezogen hatten, winkten ihn einfach hindurch. Im Süden überragte der Dom die Häuser der Stadt. Nur fünfzig Schritt jenseits des Tores begann bereits das Kaufmannsviertel – deutlich erkennbar an den prächtigen Patrizierhäusern, die den Reichtum Lübecks und seiner Bürger widerspiegelten. Stimmengewirr aus mindestens einem halben Dutzend Sprachen erfüllte die Straßen. Das hanseatische Niederdeutsch, meistens Düdesch genannt, das zur Lingua Franca des Ostseeraums geworden war, und bis nach Skandinavien und ins Baltikum hinein vielfach verstanden wurde, dominierte zwar, aber man vernahm auch Englisch, Russisch und Polnisch – hin und wieder sogar Italienisch.
Händler waren mit ihren Karren auf dem Weg zu einem der Märkte und Gaukler führten an den Straßenecken und Plätzen ihre Kunststücke vor. Mit ihren bunten Gewändern bildeten sie einen starken Kontrast zu den grauen Kutten der Mönche des Johannisklosters. Der Klosterbezirk lag auf der Ostseite der Stadt am Ufer der Wakenitz, einem angestauten und dadurch auf Seebreite angeschwollenen Zufluss der Trave. Vom Händlerviertel war der Klosterbezirk durch die Wohnbereiche der Handwerker getrennt, aber man fand sie überall in der Stadt. Sowohl dort, wo die Prachtbauten der Patrizier das Bild prägten, als auch in den engen, unübersichtlichen Gassen, in denen die Familien von Tagelöhnern, Werftarbeitern oder Seeleuten hausten. Neben den Johanniter-Mönchen gab es auch noch ein Dominikaner-Kloster im Norden der Stadt, dessen Mönche zu den ersten christlichen Siedlern gehört hatten, nachdem Lübeck auf den Ruinen einer verwüsteten Slawen-Siedlung neu gegründet worden war.
Der Wagen hielt vor einem der großen Patrizierhäusern. Thomas Bartelsen half Barbara vom Wagen.
Barbara raffte dabei ihre schweren Röcke zusammen. Sie fror noch immer etwas. Zwar war sie aus Riga eigentlich zu dieser Jahreszeit noch ganz andere Temperaturen gewöhnt, wenn der eisige Ostwind blies, aber die Luft war dort trockener. Hier hingegen ließ der feucht-kalte Wind alle Gewänder nach und nach klamm werden.
„Nun folgt mir und lasst Euch von den Herrschaften des Hauses willkommen heißen“, sagte Bartelsen.
Gemeinsam mit ihrem Vater Heinrich stieg Barbara die fünf Stufen des Haupteingangs hinauf und der Saum ihres Kleides raschelte dabei über den kalten Stein. Sie raffte es etwas zusammen und als sie die vierte Stufe erreichte, wurde die zweiflügelige Tür bereits durch das Hauspersonal geöffnet.
Barbara und Heinrich schritten in einen hohen Empfangsraum. An den Wänden hingen Gemälde, die die Leichtigkeit italienischer Meister zu imitieren versuchten.
Eine breite Freitreppe führte in das Obergeschoss.
Ein Diener stand bereit, um den Gästen die Mäntel abzunehmen, während gleichzeitig ein groß gewachsener, grauhaariger Mann mit falkenhaften Augen die Treppe hinunter schritt. Das war Jakob Isenbrandt, dessen durchdringender Blick Barbara einer kurzen Musterung unterzog und ihr dann mit einem verhaltenen Lächeln begegnete. Genau genommen kannte Barbara Jakob Isenbrandt weitaus besser als ihren zukünftigen Verlobten, denn wenn Jakob in Riga mit dem Bernsteinkönig über Geschäfte verhandelt hatte, war sie in den letzten Jahren stets dabei gewesen, um zu lernen, wie so ein Handel zu betreiben war.
An Jakobs Seite schritt seine Frau Adelheid. Sie entstammte einer Kaufmannsfamilie aus Köln und man sagte ihr ein herrisches Temperament nach.
Jakobs Begrüßung war freundlich und geschäftsmäßig, so wie Barbara es von anderen Zusammenkünften mit ihm kannte. Er fand - ganz entgegen seiner sonst als nüchtern und spröde bekannten Art - sogar ein paar freundliche Worte, indem er sagte: „Mein Sohn ist gewiss zu seiner Wahl zu beglückwünschen!“ Die Tatsache, dass es letztlich gar nicht die Wahl seines Sohnes gewesen war, sondern eher seine eigene, ließ er dabei geflissentlich außer Acht. „Ohne Zweifel werdet Ihr neuen Glanz in unser Haus bringen, Barbara.“
„Ich danke Euch“, gab Barbara zurück und neigte dabei leicht den Kopf. „An Bord unserer Kogge habe ich sehr gefroren, aber Eure Gastfreundschaft wird mich sicher bald erwärmen.“
Adelheid Isenbrandt hingegen machte gar nicht erst den Versuch, eine höfliche Unterhaltung zu beginnen. Da die meisten Rigäer Kaufmannsfamilien von Auswanderern aus Lübeck abstammten und es mannigfache Familienbande zwischen beiden Hansestädten gab, hatte Barbara immer wieder etwas von Adelheid Isenbrandt gehört. Sie galt als kalt, berechnend und äußerst intrigant. Manche sagten, dass sie nicht immer so gewesen war, sondern dass erst ein hartes Schicksal sie selbst so hart hatte werden lassen. Acht Kinder hatte sie ihrem Mann geboren, von denen drei schon im Säuglingsalter verschieden waren. Eine Tochter war mit 14 an einer Entzündung des Unterbauchs qualvoll gestorben und eine weitere Tochter hatte im Kindbett das Zeitliche gesegnet, kurz nachdem sie die Frau eines wichtigen Handelspartners in Brügge geworden war. Ein Sohn namens Giselher, auf den Jakob Isenbrandt große Hoffnungen gesetzt hatte, war mit einer Kogge vor Flandern im Sturm untergegangen. Und erst im letzten Jahr war die von Anfang an sehr kränkliche Tochter Adelheid-Marie gestorben. Ein Fieber hatte sie einschlafen lassen, ohne dass die hoch angesehenen Ärzte, die von den Isenbrandts mit der Behandlung betraut worden waren, noch irgendetwas hätten ausrichten können.
Manche sagten, dass diese Folge von Schicksalsschlägen Adelheid im Laufe der Jahre verändert hatte, denn einst war sie angeblich als eine liebreizende und lebenslustige Person mit sechzehn Jahren ins Haus der Isenbrandts nach Lübeck gekommen. Doch dieses junge Mädchen aus Köln existierte wohl nur noch in den Erzählungen jener, die sie damals schon gekannt hatten.
Selbst im fernen Riga kursierten seit langem Erzählungen über die herablassende Art, mit der sie nicht nur Dienstboten behandelte, sondern bisweilen auch den einen oder anderen Geschäftspartner ihres Mannes. Über den eisigen, durchdringenden Blick, mit dem Adelheid Menschen zu mustern pflegte, hatten sich manche bei passender Gelegenheit lustig gemacht – aber wohl nur deshalb, weil sie weit genug von der Quelle dieses Übels entfernt waren und sich außerhalb ihres Einflusses glaubten!
Jetzt ruhte dieser Blick auf Barbara und der eisige Wind, den die junge Frau draußen zu spüren bekommen hatte, erschien ihr in der Erinnerung im Vergleich zu Adelheids kalter Herablassung gar nicht mehr so schlimm gewesen zu sein.
Adelheid Isenbrandts Gesicht war von vornehmer Blässe. Auch wenn der unermessliche Reichtum ihrer Familie auf dem Seehandel gründete, so hatte sie selbst in ihrem ganzen Leben nie ein Schiff betreten. Die grau-blauen Augen wirkten stählern und es schauderte Barbara bei diesem Anblick unwillkürlich. Das war ein Blick, von dem man den Eindruck hatte, dass er alles sah, alles durchdrang und dass nichts vor ihm verborgen bleiben konnte - nicht einmal der geheimste Gedanke oder die kleinste seelische Regung.
So unvergesslich dieser Blick auch für jeden sein mochte, der zum ersten Mal von ihm getroffen wurde – so unscheinbar wirkten dagegen die Augenbrauen. Sie waren weißblond wie das Haupthaar und daher kaum zu sehen. Da Adelheids Haaransatz der Mode entsprechend fast bis zur Kopfmitte ausrasiert war, entstand so der offenbar auch gewollte Eindruck einer sehr hohen Stirn.
„So also siehst du aus“, sagte sie und hob das Kinn. Ihre Worte klangen wie ein Urteil, gesprochen von einem Gericht, das keinerlei Verteidigung zuließ. Innerhalb eines Augenaufschlags war dieses Urteil mit einer kalten, an den Streich eines Henkerschwertes erinnernden Präzision, gefällt wurden. Gewogen und für zu leicht befunden, so lautete es wohl. Dass Adelheid Isenbrandt ihrer zukünftigen Schwiegertochter dabei sogar die höfliche Anrede verweigerte, war dabei noch das Geringste. Andererseits konnte sich Barbara unmöglich vorstellen, dass die Entscheidung über die bevorstehende Verbindung zwischen den Häusern Isenbrandt und Heusenbrink etwa ohne Zustimmung dieser mächtigen Frau getroffen worden war. Zwar hielt Adelheid sich aus den Geschäften ihres Mannes weitgehend heraus, wenn man den unter der hanseatischen Kaufmannschaft kursierenden Erzählungen glauben schenken konnte – aber dass sie keinerlei Einfluss auf eine für die gesamte Familie so wichtigen Entscheidung genommen hatte, war undenkbar.
Adelheid wandte sich ihrem Mann Jakob zu. Die Kinnhöhe der Hausherrin veränderte sich dabei nicht um ein Jota. „Du musst es ja wissen“, sagte sie. Dann wandte sie sich Heinrich Heusenbrink zu und fuhr fort: „Aber wenigstens kommt sie zweifellos aus einem guten Haus, auch wenn in letzter Zeit Gerüchte über finanzielle Engpässe die Runde machen.“ Sie zuckte nach diesem gezielten Akt der Boshaftigkeit mit den Schultern. „Aber das sind ja sicher nur Gerüchte...“, fügte sie noch hinzu und lächelte kühl.
Drittes Kapitel: Der Ritter und die Giftmischerin
Nichts aber soll von den gar schrecklichen Taten dieses Weibes verschwiegen werden, auch wenn dadurch auf Bürger von höchstem Ansehen ein Schatten fallen sollte. Denn wie könnte der Gerechtigkeit auf Erden noch Geltung verschafft werden, wenn all der Schmutz der Sünde unter einen dieser wunderschönen Teppiche gekehret würde, wie man sie in den Morgenländern fertigt und neuerdings in England nachzuahmen versucht?
Aus dem schriftlichen Entwurf einer Ratsrede von Richard Kührsen, von 1435 bis 1459 Ältermann der Schonenfahrer-Bruderschaft; undatiert
––––––––
„IHR BRINGT EURE WAFFEN selbst mit – das ist gut“, sagte Hagen von Dorpen, der Kommandant der Stadtwache der Stadt Lübeck, nachdem er nicht nur den fremden Ritter mit dem Rosenschwert-Wappen, sondern auch dessen Habe begutachtet hatte, die auf seinem Streitross und einem Packpferd verstaut war. Hagen zog den Beidhänder aus der Sattelscheide und prüfte die Klinge.
„Guter Solinger Stahl“, sagte Erich von Belden. „Hat noch kein bisschen Rost angesetzt.“
„Und Euer Rapier?“
Der Ritter zog die Klinge hervor. Sie war dünn und zweischneidig – aber das wichtigste Merkmal war die Perforation in der Mitte, die Gewicht sparte und die Waffe sehr leicht und wendig machte. Es war noch nicht lange her, dass die Schmiede in der Lage waren, eine solche Klinge zu fertigen, die trotz ihrer Perforation nicht brüchig wurde oder an Elastizität einbüßte.
„Wollt Ihr auch noch sehen, wie ich mit dem Reflexbogen umzugehen weiß? Ich schieße Euch einen Apfel von der Kirchturmspitze. Lasst mich gegen zehn dieser Nichtskönner antreten, die sich in einer Woche angeeignet haben, wie man mit einer Arkebuse oder einer Armbrust umgeht! Ehe diese Ehrlosen es schafften, ihre Waffen zu laden, hätte ich sie schon allesamt niedergestreckt, wenn genügend Pfeile im Köcher wären!“
„Zeigt mir Eure Kunst später, und falls Ihr gelogen haben solltet, kann man Euch ja immer noch eine leichter zu bedienende Waffe aus der städtischen Rüstkammer in die Hand drücken!“ Hagen von Dorpen lachte in sich hinein und Erich von Belden ärgerte sich darüber, erst einmal keine Gelegenheit zu bekommen, um sein Können unter Beweis zu stellen, denn er hatte den Eindruck, dass der Kommandant der lübischen Stadtwache seine Worte eher als Prahlerei einschätzte.
„Wie Ihr meint“, sagte der Ritter von Belden und gab klein bei, denn er brauchte Geld und war auf den zu erwartenden Sold daher dringend angewiesen.
Hagen von Dorpen nickte anerkennend, während seine Finger über das geleimte Holz des nach ungarischer Art gefertigten Reflexbogens glitten, der hinten am Sattel befestigt war. „Ein gute Stück! Glaubt mir, ich kann es beurteilen – auch wenn ich die englischen Langbogen bevorzuge!“
„Für das Fußvolk! Nicht für Reiter!“, gab Erich zu bedenken.
„Da mögt Ihr wohl recht haben! Ihr seid jedenfalls gut ausgerüstet, sodass bei Eurer Anstellung die Stadtkasse nicht auch noch für die Beschaffung Eurer Waffen zu sorgen hätte!“ sagte der Kommandant zu. Er deutete noch einmal auf das Rapier. „Die Wappengravur am Knauf passt nicht zu dem, was man auf Euren Waffenrock gestickt hat!“, stellte er fest.
„Das Rapier habe ich in einem Turnier gewonnen“, erklärte Erich. „Wenn Ihr mich verdächtigen wollt, ein Wegelagerer zu sein, so...“
„Keineswegs! Aber Eure Arbeit hier wird weniger glanzvoll sein.“
„Das weiß ich.“
„Wie war noch mal der Name?“
„Erich von Belden.“
„Es tut mir Leid, aber ich habe nie von Eurem Geschlecht gehört...“
„Unsere Stammlande liegen weit im Süden. Auf jeden Fall sind sie zu klein, um mehr als einen Erben zu ernähren und so blieb mir nichts anderes übrig, als mich anderwärts zu verdingen.“
Der Kommandant nickte. Es gab viele Rittersöhne, denen es ähnlich erging. Wenn sie nicht gerade die Burgerben waren, dann blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich entweder als Söldner zu verdingen oder einem der Ritterorden beizutreten.
Erich von Belden hatte dem Stadtkommandanten einige Dokumente mit Empfehlungen gezeigt, mit denen er nachweisen konnte, in welchen Heeren er bisher gedient und welche Städte ihn mit welchem Rang als Söldner angestellt hatten. Aber Hagen von Dorpen hatte diese Dokumente kaum angesehen und sich Erichs bisherigen Werdegang mündlich erzählen lassen. Erich hatte den Verdacht, dass der Stadtkommandant einfach nicht gut genug lesen konnte, um mit den Empfehlungsschreiben etwas anfangen zu können. So hatte Erich immer wieder darauf hingewiesen, dass er tatsächlich reichlich Kampferfahrung gesammelt und zuletzt in der Stadtwache von Bremen als Hauptmann angestellt gewesen war, bevor es ihn weiter gezogen hatte - denn als Hauptmann wollte er auch in Lübeck wieder angestellt werden.
„Und was war es, das Euch weiter zog?“, fragte der Kommandant.
„Dass es nicht die Unzufriedenheit meines Dienstherrn war, die mich dazu zwang, Bremen zu verlassen, könnt Ihr an den Dokumenten sehen. Es war einfach der Wunsch, andernorts mein Glück zu suchen. Und da schien mir Lübeck ein verheißungsvoller Ort zu sein.“
„Da seid Ihr nicht der Einzige, der so denkt! Ich nehme an, dass Ihr wisst, was ein Hauptmann der Stadtwache zu tun hat und nur einer kurzen Einweisung bedürft!“
„So ist es“, bestätigte Erich.
„Dann stelle ich Euch wunschgemäß als Hauptmann ein“, sagte der Kommandant. „Mit Eurer Kriegserfahrung werdet Ihr Euch dieses Postens würdig erweisen – und schlechter als in Bremen werdet Ihr Euch hier gewiss nicht stehen, wie ich Euch versprechen kann. Ihr bekommt die übliche Bezahlung und außerdem ein neues Wams und ein Paar Hosen pro Jahr.“
„Aber ich tue nur Dienst an Land“, stellte Erich von Belden klar. „Auf keinen Fall werde ich mich auf eines der Schiffe abkommandieren lassen!“
Hagen von Dorpen war über diese klaren Worte sichtlich überrascht. Er schmunzelte. Männer, die gerade heraus sagten was sie dachten, schätzte er. Und trotzdem – seit zehn Jahren bekleidete Hagen von Dorpen schon seinen Posten und noch nie hatte sich jemand mit dieser Bedingung anwerben lassen.
„Was habt Ihr gegen Schiffe, Ritter Erich?“, lachte der Kommandant.
„Ich kann nicht schwimmen“, erklärte Erich von Belden.
„Da wärt Ihr in guter Gesellschaft – denn gerade unter Seeleuten ist die Kunst des Schwimmens kaum verbreitet. Manche lehnen es sogar regelrecht ab, sie zu beherrschen, da dies bei einer Havarie die Qual des Ertrinkens nur verlängert!“
Erich von Belden zuckte die breiten Schultern. „Wie gesagt, ich kämpfe zu Pferde und zu Fuß und mit welchen Waffen auch immer! Aber nicht auf See.“
„Da kann ich Euch beruhigen“, versicherte der Kommandant. „Die Begleitmannschaften der Flotte werden nicht von der Stadtwache rekrutiert.“
„Dann ist es ja gut!“
„So macht Euer Zeichen unter den Kontrakt, Ritter Erich!“
––––––––
ERICH VON BELDEN BEKAM von einem einfachen Wachmann die Unterkunft gezeigt – einen Raum in einem Gebäude, das in der Nähe der Pferdestallungen lag. Diesen Raum teilte er sich mit zwei anderen Söldnern, die ebenfalls im Rang eines Hauptmanns angestellt waren. Jeder von ihnen hatte vor allem die Wachen in einem Teil der Stadt einzuteilen und dafür zu sorgen, dass sie auf ihrem Posten waren und ihre Waffen stets in Schuss hielten.
––––––––
DREI TAGE SPÄTER HATTE er eine Frau in Gewahrsam zu nehmen, die in einer der engen Gassen im Nordwesten zu Hause war. Sie lebte dort von dem Verkauf von allerlei Wundertinkturen, Heilkräutern und dergleichen. Jetzt wurde sie der Giftmischerei bezichtigt, nachdem einer ihrer Kunden gestanden hatte, sich von ihr ein Gift besorgt zu haben. Dieser Kunde war seiner Frau überdrüssig geworden und hatte ihr deshalb dieses Gift unauffällig unter das Essen gemischt. Sein Geständnis hatte den Stein ins Rollen gebracht. Von insgesamt neun weiteren Fällen wusste man inzwischen.
Die Frau wehrte sich mit Händen und Füßen – wohl wissend, was ihr bevorstand. Aber die beiden Wachleute, die sie packten und fesselten, ließen ihr keine Möglichkeit, ihrem Schicksal zu entkommen.
„Ich bin eine unschuldige Seele!“, rief sie und schrie wie von Sinnen, während die Wachmänner sie davon schleiften.
„Als ob ihr der Teufel selbst im Leib sitzt und hinaus will!“, meinte einer der Männer und versetzte ihr einen groben Faustschlag, damit sie ruhig wurde. Benommen knickten ihre Knie ein, sodass sie schlaff in den Armen ihrer Bewacher hing.
Im ersten Moment wollte Erich von Belden einschreiten, denn es widersprach seinen ritterlichen Idealen, die Gefangene so zu behandeln – mochte sie auch niederen Standes sein. Andererseits ersparte es ihr wahrscheinlich noch eine zusätzliche Anklage wegen Hexerei, wenn sie auf diese Weise zum Schweigen gebracht wurde und ihre irren Schreie nicht durch die Gassen schallten. Man brachte sie hinaus und ihre Füße schleiften dabei über den Boden. In der Gasse wartete ein Pferdegespann für den Transport der halb bewusstlosen Gefangenen und des zu konfiszierenden Beweismaterials.
Mina Lodarsen lautete der Name der Frau. Erich schätzte ihr Alter auf Anfang dreißig.
Der Ritter wies einige weitere im Dienst der Stadt stehende Büttel an, sämtliche Flaschen, Tiegel und andere Gefäße mitzunehmen, damit die Schuld der Giftmischerin bewiesen werden konnte und sich nicht etwa Verwandte oder als Komplizen beschuldigte Mitwisser daranmachten, alles davon zu schaffen.
In einem Nebenraum fand Erich drei verängstigte Kinder.
Ein Mädchen von elf oder zwölf Jahren und zwei Jungen, die Erich auf fünf und neun schätzte. Sie waren mager und ihre Sachen starrten vor Dreck und sie zitterten.
Später sollte Erich erfahren, dass der Vater dieser Kinder Matrose auf der Kogge eines Bergenfahrers gewesen war, die regelmäßig große Mengen von Stockfisch nach Lübeck gebracht hatte, der von dort aus bis nach Baiern und Italien verkauft wurde. Während eines Sturmes war der Matrose im Skagerrak über Bord gegangen und seitdem hatte Mina ihre Kinder allein durchbringen müssen.
Jetzt waren sie sich selbst überlassen. Ganz gleich, welche Schuld ihre Mutter auch immer auf sich geladen haben mochte – bevor über Mina überhaupt ein Urteil gesprochen wurde, waren ihre Kinder bereits grausam gestraft worden.
––––––––
UNMENSCHLICHE SCHREIE gellten durch die finsteren Kellergewölbe. Der städtische Henker und Folterknecht setzte Mina Lodarsen mit glühenden Eisen und Zangen zu, denn auf das Zeigen der Folterwerkzeuge hatte sie nicht mit einem umfassenden Geständnis reagiert, sondern sich im Gespinst ihrer Lügen und Ausflüchte verfangen.
Kommandant Hagen von Dorpen führte das Verhör durch und Erich von Belden war als Zeuge dabei. Da Erich schreiben konnte und im Moment kein anderer Schreiber abkömmlich war, wurde er angewiesen, die Aussage zu protokollieren. Der Henker schien sichtlich Freude an seinem Handwerk zu haben und es gar nicht abwarten zu können, der Gefangenen erneut zuzusetzen. Die Gerüche von Blut, Schweiß, Urin und verbranntem Fleisch mischten sich auf eine Weise, die einem fast den Atem rauben konnte.
Erich hasste es, in diesem Folterkeller seine Pflicht erfüllen zu müssen. Die Schreie der Mina Lodarsen vermischten sich in seiner Vorstellung mit den Schreien der Verwundeten und Sterbenden jener Schlachtfelder, auf denen Erich von Belden gekämpft hatte. Ein Chor der verdammten Seelen, der Erich manchmal in den Schlaf verfolgte und nun wohl um eine weitere Stimme ergänzt wurde.
Der Folterer nahm noch einmal das Eisen und hinterließ damit ein dunkles Brandmal am Oberschenkel. Mina Lodarsen wand sich in ihren Fesseln. Ihre Schreie waren schwach und leise geworden.
„Glaubst du wirklich, dass dieses Vorgehen die Wahrheit befördert?“, fragte Erich von Belden schließlich.
Der Henker grinste. „Es wird ihr jedenfalls auch nicht hinderlich sein“, meinte er und lachte breit.
„Auch nicht, wenn diese Frau nur noch irres Zeug redet und gar nicht mehr weiß, was sie sagt?“
„Ihr scheint ein mildtätiges Herz zu haben, Herr“, sagte der Henker und grinste schief dabei. „Aber Ihr solltet nicht vergessen, bei wie vielen Morden diese Sünderin behilflich war!“ Er spuckte aus und brachte damit seine ganze Verachtung zum Ausdruck. „Nur eine Viertelstunde sollte man sie dem Pöbel da draußen überlassen! Die Leute aus ihrer eigenen Gasse würden sie bei lebendigem Leib zerreißen, sodass sie sich in meine Obhut zurückwünschte!“ Er kicherte.
„Lasst es gut sein!“, schritt jetzt sogar Hagen van Dorpen ein. Der Wille der Gefangenen war schließlich gebrochen und sie gestand nun leise die ersten Namen.
Der Henker schien sich darüber zu freuen, dass er in Zukunft wohl genug zu tun haben würde. Erich hingegen ahnte, dass in den nächsten Tagen wahrscheinlich Dutzende von Verhaftungen durchzuführen waren. Die meisten Mittel und Tinkturen, die Mina Lodarsen hergestellt hatte, waren ihren Angaben nach auch gar nicht zu dem Zweck zusammengemischt worden, eine möglichst wirksame Gift-Mixtur zu erzeugen, sondern aus anderen Gründen. Tränke zur Beeinflussung von Mitmenschen in Liebesdingen hatte Mina Lodarsen angeblich am häufigsten verkauft.





























