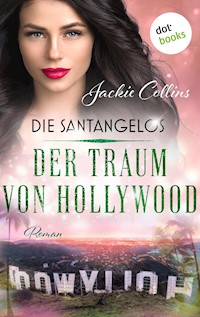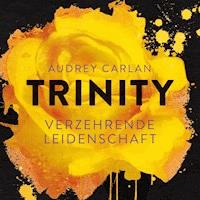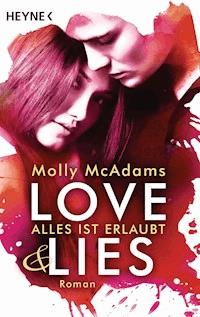4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Die Santangelos
- Sprache: Deutsch
Wer alles will, darf niemals zögern: Die große Familiensaga »Die Santangelos: Der Weg nach oben« von Jackie Collins jetzt als eBook bei dotbooks. So schillernd wie die Lichter von Las Vegas … Seit er als kleiner Junge ohne einen Cent in der Tasche nach Amerika kam, hat Gino Santangelo gekämpft: um sein Überleben, um Anerkennung – und um Macht. Obwohl ihn sein heißblütiges Temperament und die Liebe zu schönen Frauen immer wieder in Schwierigkeiten bringen, hat er ein Imperium aufgebaut, in dem er allein die Fäden in den Händen hält. Niemand würde wagen, ihm die Stirn zu bieten oder ihn gar herauszufordern – niemand außer seiner schönen Tochter Lucky: intelligent, ambitioniert, skrupellos wie ihr Vater … und doch verletzlich, wenn es um die Menschen geht, die sie liebt. Der Auftakt zu einer fesselnden Saga über Leidenschaft, Intrigen und gefährliche Gefühle: »Unverschämt unterhaltsam«, urteilt der ›Sunday Express‹ – und ›The Sun‹ warnt: »Dieses Buch ist so heiß, dass Sie danach vielleicht eine kalte Dusche brauchen.« Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Der Weg nach oben« ist der erste Band der Familiensaga »Die Santangelos« von New-York-Times-Bestsellerautorin Jackie Collins – ein Lesevergnügen für alle Fans von Louise Bay, der »Bourbon Kings«-Reihe von J.R. Ward und der Kult-TV-Serie »Der Denver Clan«. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 909
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
So schillernd wie die Lichter von Las Vegas … Seit er als kleiner Junge ohne einen Cent in der Tasche nach Amerika kam, hat Gino Santangelo gekämpft: um sein Überleben, um Anerkennung – und um Macht. Obwohl ihn sein heißblütiges Temperament und die Liebe zu schönen Frauen immer wieder in Schwierigkeiten bringen, hat er ein Imperium aufgebaut, in dem er allein die Fäden in den Händen hält. Niemand würde wagen, ihm die Stirn zu bieten oder ihn gar herauszufordern – niemand außer seiner schönen Tochter Lucky: intelligent, ambitioniert, skrupellos wie ihr Vater … und doch verletzlich, wenn es um die Menschen geht, die sie liebt.
Der Auftakt zu einer fesselnden Saga über Leidenschaft, Intrigen und gefährliche Gefühle: »Unverschämt unterhaltsam«, urteilt der ›Sunday Express‹ – und ›The Sun‹ warnt: »Dieses Buch ist so heiß, dass Sie danach vielleicht eine kalte Dusche brauchen.«
Über die Autorin:
Jackie Collins (1937–2015) wurde in London als Tochter eines bekannten Theateragenten geboren; ihre Schwester ist die Schauspielerin Joan Collins. Jackie flog als Teenager von der Schule, gerüchteweise, weil sie eine kurze Affäre mit dem doppelt so alten – und weltberühmten – Marlon Brando hatte. Nach einem kurzen Ausflug in die Filmindustrie, bei dem sie in England und Amerika für Kinofilme und Fernsehserien vor der Kamera stand, fand sie ihre wahre Passion – und begann zu schreiben. Jackie Collins‘ Debüt wurde 1968 sowohl ein internationaler Bestseller als auch ein Skandal, weil sie ohne falsche Scham über starke Frauen und deren Liebesleben schrieb. Zahlreiche ihrer mehr als 30 Romane, die sich weltweit über 500 Millionen Mal verkauften, wurden verfilmt. Jackie Collins war zweimal verheiratet und die Mutter von drei Töchtern.
Mehr Informationen über die Autorin auf ihrer Website: www.jackiecollins.com
Bei dotbooks erschien Jackie Collins große Familiensaga rund um die ebenso leidenschaftliche wie skrupellose Lucky Santangelo: »Die Santangelos: Der Weg nach oben«, »Die Santangelos: Freundinnen und Feinde«, »Die Santangelos: Der Traum von Hollywood«, »Die Santangelos: Eiskalte Rache« und »Die Santangelos: Träume und Intrigen«.
***
eBook-Neuausgabe August 2022
Die Originalausgabe erschien 1981 unter dem Titel »Chances« bei Pan Macmillan, London. In Deutschland wurde dieser Roman 1998 zunächst unter dem Titel »Lady Boss« und 2001 unter dem Titel »Lucky Star« bei Knaur veröffentlicht.
Copyright © 1981 by Jackie Collins
Copyright © 1998 der deutschsprachigen Erstausgabe bei Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von shutterstock.com
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-98690-015-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
In diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Santangelos 1« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Jackie Collins
DIE SANTANGELOS:Der Weg nach oben
Roman
Aus dem Englischen von Helga Künzel
dotbooks.
Jeder hat den Hang zum Diebstahl in sich. Die meisten haben nur nicht den Mumm, ihm nachzugeben.
»Lucky« Luciano
Es ist eine Männerwelt, und so soll es auch sein.
Vincent Teresa
Einmal drin, gibt es kein Heraus mehr.
Al Capone
ERSTES BUCH
Kapitel 1New York, Mittwoch, 13. Juli 1977
Costa Zennocotti starrte die junge Frau an, die auf der anderen Seite seines reich geschnitzten Schreibtisches aus edlem Holz saß. Sie sprach rasch, gestikulierte lebhaft und verzog immer wieder das Gesicht, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen. Himmel! Er hasste sich, weil er solche Gedanken hatte, aber sie war die sinnlichste Frau, die ihm je unter die Augen gekommen war ...
»Costa?«, fragte sie scharf. »Hörst du mir überhaupt zu?«
»Natürlich, Lucky«, antwortete er rasch und ein wenig verlegen. Sie war zwar nur ein schlankes junges Ding – wie alt mochte sie jetzt sein, sieben- oder achtundzwanzig? –, dabei aber überaus gescheit und wissend. Vermutlich wusste sie, was er dachte.
Lucky Santangelo. Die Tochter Ginos, seines besten Freundes von Kindheit an.
Edelnutte. Kind. Emanzipierte Frau. Versucherin. Als dies alles kannte Costa sie.
»Du siehst also«, sie wühlte in einer übergroßen Gucci-Tasche und brachte eine Packung Zigaretten zum Vorschein, »dass jetzt auf keinen Fall der richtige Zeitpunkt für Vater ist, ins Land zurückzukommen. Auf gar keinen Fall. Du musst ihn davon abhalten.«
Costa zuckte die Achseln. Manchmal konnte sie so verbohrt sein. Was brachte sie auf den Gedanken, dass irgendjemand Gino von etwas abhalten konnte, das er tun wollte? Als seine Tochter hätte sie wissen müssen, besser als jeder andere, dass niemand ihn von etwas abzuhalten vermochte. Schließlich waren Gino und Lucky zwei von der gleichen Sorte, einander so ähnlich, wie zwei Menschen einander nur ähnlich sein konnten. Auch im Aussehen glich Lucky ihrem Vater wie ein Ei dem anderen. Das gleiche sexuell aufreizende Gesicht mit der olivfarbenen Haut, den tief liegenden, glühenden schwarzen Augen und den breiten, sinnlichen Lippen. Der einzige Unterschied lag in der Nase: Ginos war ausgeprägt männlich, ihre kleiner, passender für eine Frau. Beide hatten rabenschwarzes, lockiges Haar. Lucky trug ihres schulterlang in einer wirren Mähne, und Gino hatte trotz seiner mehr als siebzig Jahre noch immer einen dichten Schopf.
Wehmütig griff Costa nach oben und berührte die kahle Stelle auf seinem Schädel – es war mehr als eine Stelle, es war eine Wüste, ein dürres Stück Haut, das auch die kunstvollste Frisur nicht verdeckte. Na ja, er war achtundsechzig. Was konnte man bei diesem Alter anderes erwarten?
»Wirst du ihm Bescheid sagen?«, fragte sie. »Hm? Wirst du es tun?«
Costa verriet ihr lieber nicht, dass Gino in einer Düsenmaschine saß, die bereits über der Stadt kreiste. Bald würde er landen. Bald würde er zurück sein. Lucky würde der Tatsache ins Auge sehen müssen, dass ihr Vater das Steuer wieder übernahm.
Himmel, das würde einen Riesenkrach geben! Und er, Costa, befand sich genau in der Schusslinie.
Drei Stockwerke höher arbeitete Steven Berkely konzentriert in der Stille des Büros seines Freundes Jerry Meyerson. Die beiden hatten vereinbart, dass Steven, wenn er völlige Abgeschiedenheit brauchte, das Büro nach der normalen Arbeitszeit benutzen konnte. Er fand das großartig. Keine Telefone klingelten. Niemand fand ihn hier. Sein eigenes Büro war das reinste Irrenhaus, zu jeder Tages- und auch Nachtzeit. Sogar in seiner Wohnung schwieg das Telefon selten.
Steven streckte sich und schaute auf die Uhr. Fast halb zehn. Er fluchte leise. Die Zeit war wie im Flug vergangen. Er dachte kurz an Aileen und überlegte, ob er sie anrufen sollte. Die Theaterverabredung mit ihr hatte er abblasen müssen. Das gefiel ihm an Aileen, nichts brachte sie aus der Fassung, sie nahm alles gelassen, ob es nun ein versäumter Theaterbesuch war oder ein Heiratsantrag. Er hatte sie vor drei Wochen gebeten, seine Frau zu werden, und sie hatte ja gesagt. Steven war nicht überrascht gewesen, bei Aileen gab es keine Überraschungen, doch nach Zizi, seiner Exfrau, hatte er wahrlich kein Verlangen danach.
Er war achtunddreißig und sehnte sich nach einem geregelten Leben. Aileen war dreiundzwanzig und würde es ihm geben.
Steven Berkely zählte zu den erfolgreichsten Staatsanwälten der Stadt. Als die Bewegung »Black is beautiful« entstanden war, hatte er in den Startlöchern gekauert, mit abgeschlossenem Jurastudium und viel Begeisterung. Dank seines umfassenden Wissens, seiner geistigen Wendigkeit und seines scharfen Verstandes hatte es ihn relativ wenig Mühe gekostet, dorthin zu gelangen, wohin er wollte. Sein außergewöhnlich gutes Aussehen war dabei keineswegs ein Hindernis gewesen. Er maß über einsachtzig, hatte den Körper eines durchtrainierten Sportlers, sehr offen blickende grüne Augen, lockiges schwarzes Haar und eine Haut in der Farbe von Milchschokolade. Entwaffnend wirkte an ihm, dass er sich seines guten Aussehens eigentlich gar nicht bewusst war. Das brachte die Leute aus dem Gleichgewicht. Sie erwarteten Selbstgefälligkeit und fanden Höflichkeit. Sie erwarteten Arroganz und fanden einen Mann, den die Gedanken und Gefühle anderer beschäftigten.
Methodisch sortierte er seine Papiere und legte die geordneten Stapel in seine abgewetzte Aktentasche. Dann schaute er sich im Büro um, schaltete die Schreibtischlampe aus und ging zur Tür. Er hatte an einer Sonderermittlung gearbeitet, und allmählich zeichnete sich ein Ergebnis ab. Er war müde, aber es war eine angenehme Müdigkeit, wie man sie nach harter Arbeit verspürte – seinem liebsten Zeitvertreib. Harte Arbeit schlug den Sex jederzeit, was den reinen Genuss anbelangte. Nicht dass Sex ihm keinen Spaß machte; mit der richtigen Frau war er wunderbar, aber Zizi war regelrecht davon besessen gewesen. Gib, gib, gib. Die geile kleine Zizi hatte zu jeder Tagesstunde Sex haben wollen, und wenn er nicht zu Hause gewesen war – nun, sie hatte Wege gefunden, sich die Zeit zu vertreiben. Er hätte auf seine Mutter hören und sie gar nicht erst heiraten sollen. Aber wer hört schon auf die Mutter, wenn er Ameisen in der Hose hatte?
Mit Aileen war alles anders. Sie war ein nettes, altmodisches Mädchen und gefiel seiner Mutter sehr. »Heirate sie«, hatte seine Mutter ihm geraten, und genau das gedachte er zu tun.
Er ließ den Blick ein letztes Mal durchs Büro schweifen und ging zum Lift.
Dario Santangelo grub die Zähne in die Lippen, um nicht zu schreien. Über ihm bewegte sich der magere dunkelhaarige Junge stetig auf und ab. Schmerz. Wonne. Köstlicher Schmerz. Schier unerträgliche Wonne. Nicht ganz ... Noch nicht ... Dann konnte er nicht mehr an sich halten. Er schrie, und sein Körper zuckte, unbeherrschbar im Höhepunkt.
Der dunkle Junge zog seinen noch immer steifen Penis sofort zurück. Dario rollte sich herum und seufzte. Der Junge stand auf und schaute auf ihn hinunter.
Dario fiel ein, dass er nicht einmal den Namen des Burschen wusste. Ein weiterer namenloser dunkelhaariger Jugendlicher. Na und? Er versuchte nie, sich mehr als einmal mit ihnen zu treffen. Ficken, und dann ab mit ihnen. Er musste kichern. So lief das Spiel, nicht wahr?
Als er vom Bett aufstand und zur Badtür ging, musterte ihn der Junge reglos und stumm. Lass ihn schauen, lass ihn starren, mit ihm würde er es nicht mehr machen.
Im Bad schloss er die Tür ab und ließ warmes Wasser ins Bidet laufen. Er hatte hinterher immer das Bedürfnis, sich zu waschen. Es war wunderbar, während es geschah, aber danach ... Nun, am liebsten vergaß er alles, verdrängte es, bis der nächste dunkelhaarige Junge auf der Bildfläche erschien. Dario hockte sich rittlings aufs Bidet, seifte sich ein, drehte den Duschhahn auf kalt und ließ den eisigen Strahl auf seine Hoden spritzen, die sich in belebender Weise zusammenzogen. Den ganzen Tag war es so heiß gewesen, so schwül und stickig. Er hoffte, dass der dunkelhaarige Junge nicht bleiben wollte. Vielleicht sollte er ihm etwas Geld geben und versuchen, ihn loszuwerden. Mit zwanzig Dollar war das normalerweise zu bewerkstelligen.
Er zog einen Veloursbademantel an und betrachtete sich im Spiegel. Man sah ihm seine sechsundzwanzig Jahre nicht an. Er sah aus wie neunzehn, schön, schlank, groß, blaue Teutonenaugen und glattes blondes Haar. Er glich seiner Mutter; mit seinem Vater Gino und seiner Schwester Lucky, diesem Luder, verband ihn eine rein unkörperliche Verwandtschaft.
Er schloss die Badezimmertür auf und ging ins Schlafzimmer zurück. Der Junge hatte seine schmutzigen Sachen, die Jeans und das T-Shirt, wieder angezogen, stand am Fenster und schaute hinaus.
Dario trat an die Kommode und zog aus einem kleinen Bündel Banknoten zwei Zehndollarscheine heraus. Er hatte nie viel Geld in der Wohnung – es wäre nicht gut gewesen, seine Zufallsbekanntschaften in Versuchung zu führen.
Er räusperte sich, um den Jungen wissen zu lassen, dass er wieder da war. Dreh dich um, nimm das Geld und geh, befahl er stumm.
Der Junge drehte sich langsam um. Die Wölbung vorn in seinen Jeans sah aus, als habe er immer noch eine Erektion.
Dario hielt die beiden Zehndollarscheine hoch. »Fahrgeld«, sagte er freundlich.
»Hol dich der Teufel«, erwiderte der Junge unfreundlich, hielt einen Schlüsselbund hoch und klimperte drohend damit.
Dario bekam es mit der Angst. Er hasste Schwierigkeiten und Gewalt jeder Art. Das Bürschchen hier würde Schwierigkeiten machen; dies hatte er irgendwie von dem Moment an gewusst, wo der Junge sich auf der Straße unaufgefordert an ihn herangemacht hatte. Normalerweise war es Dario, der den ersten Schritt tat, denn trotz seiner blonden Haare und blauen Augen sah er nicht aus wie ein Homosexueller. Er wirkte ganz normal und achtete auch immer sorgfältig darauf, sich unverdächtig zu kleiden und betont männlich zu geben. Er war sogar übervorsichtig. Bei einem Vater wie dem seinen konnte er sich ein anderes Verhalten gar nicht leisten.
Langsam wich er zur Tür zurück. In seinem Schreibtisch im Wohnzimmer lag seine Lebensversicherung, eine stumpfnasige kleine Pistole vom Kaliber 0,25. Dazu bestimmt, seinen Zufallsbekanntschaften notfalls gehörigen Schiss einzujagen.
Der dunkelhaarige Junge lachte. »Wo willst du hin?« Seine Stimme hatte einen eigenartigen nasalen, quengeligen Ton.
Dario war fast an der Tür.
»Vergiss das Ding«, sagte der Junge. »Hab mich schon drum gekümmert, und die Schlüssel da, Mann, das sind deine Schlüssel. Kapiert? Deine Schlüssel. Weißt doch, was das heißt, oder? Heißt, dass wir in der Wohnung da eingeschlossen sind. Die ist zu wie Präsident Carters Arsch. Und ich wette, der ist fest zu – sehr fest, Mann.«
Langsam griff der Junge in den Bund seiner Jeans und brachte ein tödlich aussehendes Messer zum Vorschein. Gut zwanzig Zentimeter glänzenden Stahls.
»Du hast ’ne großartige Fickerei wollen«, sagte er spöttisch, »und ich werd dir ’ne großartige verpassen – ’ne wirklich ausgiebige, die du nicht so schnell vergisst.«
Dario stand reglos an der Tür. Seine Gedanken rasten. Wer war der Kerl? Was wollte er von ihm? Womit konnte er ihn bestechen?
Und vor allem, hatte ihn Lucky auf ihn losgeschickt? Hatte das Luder beschlossen, ihn endgültig auszuschalten?
Für eine Frau von mehr als sechzig Jahren sah Carrie Berkely sensationell aus. Zwei Sätze Tennis am Tag hielten sie schlank und fit. Das straff nach hinten gekämmte, von zwei Brillantspangen gehaltene schwarze Haar betonte ihren Gesichtsschnitt: hohe Wangenknochen, schräge Augen, voller Mund. Als junges Mädchen war Carrie nicht hübsch gewesen – sie hatte wild erotisch ausgesehen. Doch jetzt, mit der strengen Frisur, dem sparsamen Make-up und den eleganten Kleidern war sie eine schöne Frau. Achtunggebietend. Reich. Beherrscht. Eine schwarze Dame, die in der Welt der Weißen bis an die Spitze gelangt war.
Carrie fuhr einen dunkelgrünen Cadillac Seville, lenkte ihn langsam am Straßenrand entlang und schaute nach einem Parkplatz aus. Sie hatte die Lippen verärgert zusammengepresst, und dies entsprach genau ihrer Stimmung – sie war verärgert. So viele Jahre waren vergangen, und während der ganzen Zeit hatte ihr Geheimnis im Dunkel der Vergangenheit geruht. Jetzt aber – eine unbekannte Stimme am Telefon, und schon fuhr sie nachts durch die Straßen New Yorks auf Harlem zu, auf eine Vergangenheit zu, die sie ein für alle Mal hinter sich gewähnt hatte.
Erpressung nennt man so etwas. Simple, reine Erpressung.
Sie hielt an einem Rotlicht und schloss die Augen, dachte an ihren Sohn Steven – so erfolgreich, so angesehen. Großer Gott, wenn er je die Wahrheit erführe ... Nicht auszudenken.
Von hinten hupte sie jemand an. Sie fuhr mit einem Ruck von der Ampel los. Langsam streckte sie die Hand aus und tätschelte ihre Tasche, ein Weihnachtsgeschenk von Steven. Er hatte einen absolut sicheren Geschmack. Der einzige Schnitzer, den er je begangen hatte, war die Heirat mit diesem Flittchen gewesen – Zizi. Doch das Weibsstück war aus seinem Leben verschwunden und würde nicht wieder auftauchen. Geld ... Welch süße Macht es doch besaß.
Carrie seufzte und schob die Hand in die Tasche. Der kleine Revolver fühlte sich kalt an. Ebenfalls Macht. Schimmerndes Metall, letztes Abschreckungsmittel.
Sie hoffte, dass es nicht notwendig sein würde, dieses Abschreckungsmittel anzuwenden. Aber sie wusste, dass es notwendig sein würde. Und wieder seufzte sie ...
Gino Santangelo war müde. Es war ein langer Flug gewesen, und die letzten zehn Minuten zogen sich endlos hin. Er hatte den Sicherheitsgurt angelegt und seine Zigarre ausgemacht. Ihn verlangte jetzt einzig danach, die Füße fest auf den Boden des guten alten Amerika zu setzen. Nach so langer Abwesenheit kehrte er nun endlich heim – ein schönes Gefühl.
Eine der Stewardessen kam den Gang entlang. »Geht es Ihnen gut, Mr. Santangelo?«, fragte sie mit strahlendem Lächeln. Alle zehn Minuten war es das Gleiche gewesen: »Haben Sie irgendeinen Wunsch?« – »Kann ich Ihnen etwas zu trinken bringen, Mr. Santangelo?« – »Ein Kissen?« – »Eine Decke, Mr. Santangelo?« – »Eine Zeitschrift?« – »Möchten Sie etwas essen, Mr. Santangelo?« Der Präsident hätte nicht aufmerksamer behandelt werden können.
»Mir geht es glänzend«, sagte Gino zu dem Mädchen. Sie war hübsch, aber ein Flittchen; er hatte einen Blick für so etwas.
»Oh, schön.« Sie kicherte. »Wir sind bald da.«
Ja, bald würden sie da sein. New York. Seine Stadt. Sein Territorium. Seine Heimat. Israel war sehr angenehm gewesen. Ein erholsames Zwischenspiel. Aber er hätte die sieben Jahre seiner Abwesenheit lieber in Italien verbracht.
Gino schaute auf seine Armbanduhr, ein mit Edelsteinen besetztes goldenes Schmuckstück, das ihm vor zehn Jahren ein berühmter blonder Filmstar geschenkt hatte. Er seufzte. Bald würde er zu Hause sein ... Bald würde er sich mit Lucky und Dario befassen müssen. Ein bisschen väterlicher Rat, das war es, was die beiden brauchten.
»Kann ich Ihnen irgendetwas bringen, Mr. Santangelo?«, fragte eine andere Stewardess im Vorbeigehen. Er schüttelte den Kopf.
Bald ... Bald ...
Lucky verließ Costas Büro und trat in die Damentoilette. Sie prüfte ihr Gesicht im Spiegel und war nicht sehr zufrieden mit dem, was sie sah. Sie wirkte müde und erschöpft, hatte dunkle Ringe unter den Augen. Was ihr fehlte, waren ein Urlaub und Sonnenbräune, doch sie konnte sich weder das eine noch das andere genehmigen, bevor die Dinge nicht geregelt waren.
Sorgfältig trug sie frisches Make-up auf: Rouge, Lippengloss, Lidschatten. Dann schüttelte sie ihre schwarze Lockenmähne und schob sie mit den Fingern zurecht.
Sie trug Jeans, die sie in die Stiefel gesteckt hatte, dazu eine hellblaue Hemdbluse, deren obere Knöpfe leger geöffnet waren. Durch die dünne Seide zeichneten sich ihre Brüste deutlich ab. Sie entnahm ihrer Schultertasche mehrere Goldketten und schlang sie um den Hals; dann streifte sie zwei breite goldene Armreifen über und vervollständigte ihre Aufmachung mit großen Kreolenringen.
Nun war sie bereit, in die Stadt zu gehen. Das Letzte, wonach sie sich jetzt sehnte, war ihre leere Wohnung.
Sie verließ die Damentoilette und drückte ungeduldig den Liftknopf. Auf ihr bewegliches Gesicht trat ein Ausdruck der Missbilligung, und sie fing an, mit dem Absatz ihrer zweihundert Dollar teuren Leinwandstiefel in nervösem Rhythmus zu klopfen. Costa wurde alt. Und, Teufel noch mal, wem gehörte eigentlich seine Loyalität? Sicher nicht ihr – wenn er es auch noch so nachdrücklich behauptete. Idiotisch, dass sie das nicht längst gemerkt hatte.
Sie schaute auf ihre Cartier-Uhr. Halb zehn. Zwei Stunden mit einem senilen alten Mann vergeudet. »Scheiße!« Das Wort entschlüpfte ihr, und sie blickte schnell den Gang entlang. Hatte jemand sie gehört? Natürlich nicht. Zu dieser späten Stunde war das riesige Bürogebäude verlassen.
Der Lift kam, und sie trat hinein. Ihre Gedanken begannen zu rasen. Wenn sich der liebe Herr Papa tatsächlich auf dem Heimweg befand, was würde passieren? Konnte sie mit ihm klarkommen? Würde er bereit sein, sie anzuhören? Vielleicht ... Schließlich war sie eine Santangelo und das einzige von Ginos beiden Kindern, das Mumm in den Knochen und etwas auf dem Kasten hatte, nicht wahr? In den vergangenen sieben Jahren hatte sie viel erreicht. Es war nicht leicht gewesen. Costa hatte ihr sehr geholfen. Aber würde er weiter auf ihrer Seite sein, wenn Gino zurückkehrte?
Lucky zog die Stirn in tiefe Falten. Verflucht noch mal. Gino. Ihr Vater. Der einzige lebende Mann, der ihr je Verhaltensvorschriften gemacht hatte und damit durchgekommen war. Aber sie war kein kleines Kind mehr, und Gino würde der Tatsache ins Auge sehen müssen, dass er nicht mehr der Boss war. Nein, mein Herr. Sie würde nicht alles aufgeben. Macht – das beste Aphrodisiakum. Sie war am Ruder. Und sie gedachte am Ruder zu bleiben. Er würde sich mit dieser Tatsache abfinden müssen.
Steven Berkely schaute nicht von seiner Zeitung auf, als Lucky in den Lift trat. Blickkontakt war immer ein Fehler, er führte zu belanglosen Unterhaltungen wie: »Ist es nicht heiß heute?«, oder: »Herrliches Wetter haben wir.« Gespräche im Lift waren reine Zeitverschwendung. Lucky beachtete ihn genauso wenig wie er sie. Sie dachte an die vor ihr liegenden Probleme.
Steven las weiter seine Zeitung, und Lucky gab sich weiter ihren Gedanken hin, als der Lift plötzlich mit einem magenhebenden Ruck zwischen zwei Stockwerken stehen blieb und das Licht ausging. Undurchdringliches Dunkel umgab die beiden.
Dario und der dunkelhaarige Junge bewegten sich gleichzeitig, doch Dario war schneller. Er schlüpfte aus dem Schlafzimmer, schlug seinem Gegner die Tür vor der Nase zu und drehte den Schlüssel, der zum Glück im Schloss steckte, rasch herum. Nun hatte er den Jungen im Schlafzimmer eingesperrt, und der Junge hatte ihn in der Wohnung eingesperrt. Dario verfluchte sein extrasicheres Sicherheitssystem. Er hatte es ausschließlich darauf abgestellt, ungebetene Gäste draußen zu halten. Der Gedanke, dass es jemandem gelingen könne, ihn in seiner eigenen Wohnung einzuschließen, war ihm gar nicht gekommen. Nun saßen sie beide fest, verdammt noch mal. Was konnte er tun? Die Polizei rufen? Das hätte ein schönes Gelächter gegeben! Die Bullen hätten die Wohnungstür aufgebrochen, und was dann? Die Erniedrigung, bekennen zu müssen, dass in seinem Schlafzimmer eine übergeschnappte Strichbekanntschaft mit einem Messer lauerte – und noch dazu eine männliche. Die Bullen hätten sofort gewusst, dass er Homosexueller war – und Gnade Gott, wenn das seinem Vater zu Ohren käme ...
Nein, Dario dachte nicht im Traum daran, die Polizei zu rufen.
Lucky hätte natürlich genau gewusst, was man in einer solchen Situation tat. Sie wusste in jeder Situation, was man tat. Aber wie konnte er sich an sie wenden, wenn sie ihm den Jungen vielleicht selbst auf den Hals gehetzt hatte? Das raffinierte Luder Lucky. Kalt. Ruhig. Sicher. Mehr auf dem Kasten, als gut war. Dieses Luder Lucky.
Ein bösartiger Schlag an die Schlafzimmertür trieb Dario zur Aktion. Er öffnete die Schreibtischschublade und stellte entsetzt fest, dass seine Pistole tatsächlich nicht mehr da war. Der Junge hatte also nicht nur ein Messer, sondern auch die Pistole. Jede Sekunde konnte er das Schloss der Schlafzimmertür aufschießen und herauskommen.
Ein Angstschauder überlief Darios Körper. Genau in diesem Augenblick gingen in der Wohnung alle Lichter aus, und Dunkelheit umgab ihn. Dario war mit einem wahnsinnigen Fremdling in tödlicher Finsternis eingeschlossen.
Carrie Berkely wusste, dass sie sich verfahren hatte. Die Straßen Harlems, einst so vertraut, wirkten hässlich und fremd. Aus ihrem bequemen, vollklimatisierten Cadillac schaute sie verzweifelt auf die Straße hinaus. Geöffnete Hydranten verströmten Wasser auf schmuddelige Gehsteige, Menschen lehnten lethargisch an den Wänden oder hockten auf den Stufen der halb verfallenen Häuser.
Der Cadillac war ein Fehler. Sie hätte ein Taxi nehmen sollen. Aber jedermann wusste, dass Taxis sich nicht mehr in die Straßen Harlems wagten – besonders nicht während einer Hitzewelle, wenn die Eingeborenen gereizt, unruhig und aufgebracht waren.
Sie gewahrte einen Supermarkt und fuhr auf den Parkplatz daneben. Den Wagen stehen lassen. Zu Fuß gehen. Schließlich waren zu viele Menschen auf der Straße, als dass irgendeine Gefahr bestanden hätte. Außerdem besaß sie noch immer die beste Lebensversicherung – ein schwarzes Gesicht. Und am Informationsstand konnte sie nach dem Weg fragen. Ohnehin klüger, sie ließ den Wagen stehen, auch wenn sie so vorsichtig gewesen war, die Nummernschilder unkenntlich zu machen.
Carrie stellte den Wagen ab und ging in den Supermarkt. Trotz ihres schwarzen Gesichts starrte man sie an. Zu spät erkannte sie, dass sie hier nicht mehr herpasste. Sie sah teuer aus, roch teuer. Und sie hatte vergessen, ihren Brillantschmuck abzunehmen, die Haarspangen, die Ohrringe und den großen Solitär.
Zwei Jugendliche hefteten sich an ihre Fersen. Sie beschleunigte den Schritt. Am Informationsstand saß ein Mädchen, das sich damit beschäftigte, in den Zähnen zu stochern.
»Können Sie mir sagen ...«, begann Carrie. Sie vollendete die Frage nicht, denn mit einem Mal erloschen in dem Supermarkt sämtliche Lichter.
Turbulenzen hatten Gino nie gestört. Tatsächlich genoss er es, so durchgeschüttelt zu werden. Wenn er die Augen schloss, konnte er sich einbilden, mit einem Motorboot auf rauer See zu sein oder einen Kleinlaster über steiniges Gelände zu fahren. Er hatte nie begriffen, wie jemand vor dem Fliegen Angst haben konnte.
Er schaute zu der allein reisenden schlanken Blondine auf der anderen Gangseite hinüber. Sie umklammerte verzweifelt einen kleinen Flachmann und trank immer wieder in großen Schlucken daraus.
Gino lächelte beruhigend: »Das ist nur ein Wärmegewitter. Kein Grund zur Sorge. Wir werden unten sein, bevor Sie es recht merken.«
Er schaute auf das Lichtermeer hinunter, das sich unter ihnen ausbreitete. New York City. Was für ein herrlicher Anblick. »He!«, rief er plötzlich verwundert.
»Was ist?«, fragte die Frau ängstlich.
»Nichts.« Gino schlug einen lässigen Ton an. Er wollte sie nicht noch nervöser machen. Und, bei Gott, hätte sie gesehen, was er eben gesehen hatte, wäre sie furchtbar nervös geworden!
New York war vor seinen Augen verschwunden. Eben noch eine phantastische Märchenstadt aus Lichtern, und im nächsten Augenblick – nichts. Ein Meer der Schwärze.
Kapitel 2Gino, 1921
»Hör auf!«
»Warum?«
»Du weißt, warum.«
»Sag’s mir noch mal.«
»Gino, nein, ich mein es ernst – nein.«
»Aber du findest es doch schön ...«
»Tu ich nicht, nein. O Gino! Ooooh!«
Immer die gleiche Geschichte. Nein, Gino. Nicht, Gino. Fass mich dort nicht an, Gino. Und die Geschichte hatte immer ein Happy End. Sobald er den magischen Knopf fand, protestierten sie nicht mehr, ihre Beine öffneten sich, und sie merkten es kaum, wenn er den Finger zurückzog und ihn durch sein steifes italienisches Glied ersetzte.
Gino der Rammler, so lautete sein Spitzname. Und es stimmte, er hatte mehr Weiber vernascht als jeder andere Junge in seinem Block. Nicht schlecht für einen Fünfzehnjährigen.
Gino Santangelo. Ein liebenswerter Junge. Ein zungenfertiger Junge, der zurzeit bei seiner zwölften Pflegefamilie lebte und nach einer Fluchtmöglichkeit suchte. Er war 1909 aus Italien nach New York gekommen, im Alter von drei Jahren. Seine Eltern hatten gehört, dass man in Amerika leicht ein Vermögen machen könne, und daraufhin beschlossen, ihr Glück in der Neuen Welt zu versuchen. Seine Mutter Mira, eine hübsche Achtzehnjährige. Sein Vater Paolo, kaum zwanzig, aber voll unschuldiger Begeisterung für alles bereit, was Amerika zu bieten hatte.
Arbeit war damals schwer zu finden. Mira bekam einen Posten in einer Kleiderfabrik. Paolo nahm alles an, was des Wegs kam – und das war nicht immer legal.
Gino machte den Frauen, die sich während der Arbeitszeit seiner Eltern um ihn kümmerten, keine Mühe. Jeden Abend um halb sechs holte ihn seine Mutter ab. Auf diesen Augenblick wartete er den ganzen Tag über.
Als er fünf war, blieb sie eines Abends aus. Die Frau, die ihn versorgte, wurde böse, als niemand erschien. »Wo bleibt deine Mama? He? He?«, schrie sie ihn immer wieder an.
Als ob er das gewusst hätte. Er drängte die Tränen zurück und wartete geduldig.
Um sieben Uhr kam sein Vater. Ein bedrückter, verhärmt wirkender Mann mit einem blassen, für seine Jahre zu alten Gesicht.
»Wo ist Mama?«, fragte Gino.
»Ich weiß es nicht«, murmelte Paolo, nahm seinen Sohn auf die Schultern und eilte in das Zimmer, das sie ihr Zuhause nannten. Dort gab er ihm zu essen und brachte ihn ins Bett.
Die Dunkelheit war keineswegs tröstlich. Gino sehnte sich verzweifelt nach seiner Mutter, aber er wusste, dass er nicht weinen durfte. Wenn er nicht weinte, würde sie am Morgen wieder da sein. Wenn er weinte ...
Mira kam nicht zurück. In der Fabrik, wo sie gearbeitet hatte, verschwand zur selben Zeit ein Geschäftsführer, ein älterer Mann mit drei Kindern – lauter Mädchen. Später, als Gino das nötige Alter erreicht hatte, machte er sich nacheinander an diese drei Mädchen heran und verführte sie systematisch. Das war die einzige Rache, die ihm einfiel. Aber sie befriedigte ihn nicht.
Nach Miras Treuebruch änderte sich das Leben. Paolo wurde bitter und heftig, und Gino war das Ziel seiner Gewalttätigkeiten. Mit sieben Jahren hatte er bereits fünf Krankenhausaufenthalte hinter sich, doch er war ein zäher kleiner Kerl, der sich im Leben zurechtfand. Er wurde ein Meister darin, sich vor Paolo zu verstecken, wenn ihm Prügel zu drohen schienen. Und weil dann kein Kind da war, an dem Paolo seine Wut auslassen konnte, begann er seine Freundinnen zu prügeln, von denen es sehr viele gab. Diese Angewohnheit brachte ihn ins Gefängnis – und Gino sah das erste Fürsorgeheim von innen. Im Vergleich zu dem Leben dort war das Leben mit seinem Vater paradiesisch.
Paolo gelangte zu dem Schluss, dass sich Verbrechen lohnten. Es kostete keine Mühe, ihn zu krummen Touren zu überreden. Das Gefängnis wurde für ihn zur zweiten Heimat, und Gino verbrachte immer längere Zeiträume in Heimen.
War Paolo nicht im Gefängnis, galt sein Interesse hauptsächlich den Frauen. Er nannte sie »Schicksen« und vertraute seinem Sohn an: »Alles, was sie wollen, ist ficken, und das ist alles, wozu sie taugen.«
Paolo ging wie ein Stier auf sie los. Gino – manchmal im selben Zimmer festgehalten – sah zu. Es widerte ihn an, und gleichzeitig erregte es ihn. Mit elf Jahren probierte er es selbst bei einer aufgetakelten alten Hure, die sich seine zwanzig Cents schnappte und während der ganzen Zeit Flüche murmelte.
Gino, von einer Schar bewundernder Freunde umringt, zuckte die Achseln, als er herunterstieg. »Es ist nicht schlecht«, räumte er ein. »Besser als selber reiben!«
»Komm wieder, Söhnchen«, sagte die Hure glucksend. Schon der Elfjährige beeindruckte durch seine Männlichkeit.
Mit fünfzehn besaß er die Gewieftheit der Straße. Er war ein aufgeweckter, gescheiter Junge, der auch den Mund zu halten verstand. Die Kinder der Gegend bewunderten ihn und schauten zu ihm auf. Ältere Jungen wählten ihn aus, wenn sie jemand brauchten, der kleinere Geschäfte für sie erledigte. Und die Mädchen vergötterten ihn.
Erwachsene begegneten ihm voll Misstrauen: ein Fünfzehnjähriger mit den kalten, harten Augen eines Mannes. Irgendwie hatte er, obwohl er gerne lächelte, fast etwas Bedrohliches.
Er war nicht sehr groß, einssechsundsechzig, was ihm Kummer bereitete. Darum arbeitete er eifrig an seinem Körper, lief, spielte Baseball, machte Kniebeugen, Liegestütze und Streckübungen.
Er hatte lockiges schwarzes Haar, ein weiteres physisches Merkmal, das ihn störte, darum glättete er es mit reichlich Fett. Seine dunkle Haut war makellos, er litt nicht an der verunstaltenden Akne, die seinen Freunden so zu schaffen machte – ein entschiedenes Plus. Er sah nicht im üblichen Sinn gut aus, seine Nase war zu ausgeprägt und sein Mund zu fleischig, aber er hatte ein bezauberndes Lächeln und prächtige Zähne.
Eine wirksame Kombination. Gino Santangelo hatte Klasse.
»Gino – nein!«
»Ach, komm schon, Susie. Lass es mich bloß da hintun, bloß zu dir legen. Ich steck’s nicht rein, das schwör ich dir!«
»Aber, Gino ...«
»Da. Ich hab’s dir gesagt. Fühlt es sich nicht gut an?«
»Mhm, ich denk schon ... Aber beweg dich nicht, versprich, dass du dich nicht bewegst.«
»Natürlich nicht. Ich will bloß bei dir sein, das ist alles.« Behutsam führte er sein Glied ein.
»Was tust du da?«, quiekste sie.
»Bloß zurechtrücken«, antwortete er, schob die Hand zwischen ihre Beine und tastete nach dem magischen Knopf.
Susie seufzte auf. Er hatte ihn gefunden.
»Ist’s schön?«, erkundigte er sich.
»O ja, Gino. O ja.«
Alles geritzt. Kein Problem. Er ließ die Finger auf dem Knopf und begann sie richtig zu ficken.
Sie erhob keinen Einspruch. Er verstand zu gefallen. Im zarten Alter von zwölf Jahren hatte ihm seine vierte Pflegemutter beigebracht, den magischen Knopf zu suchen. Eine Lektion, für die er ihr ewig dankbar war. Dadurch war er den anderen Jungen überlegen, die meinten, zum Liebemachen gehöre nur schnelles Stoßen. Gino wusste, man musste es so machen, dass es den Mädchen gefiel, dass sie es wollten – dass sie sogar darum bettelten. Er dachte nicht daran, den Freunden, die ihn glühend um seine Erfolge beneideten, dieses Geheimnis zu verraten.
Susie geriet in Erregung, sie wand sich und ächzte beunruhigend. Er steigerte das Tempo.
Himmel, wie gern er Fötzchen spürte.
Himmel, wie sehr er sich wünschte, ein Mädchen zu finden, das nein sagte.
»Ooooh, Gino!«
Er kam zum Höhepunkt. Stand dann auf. Zog seine Hose an.
»Wir hätten das nicht tun sollen«, erklärte Susie ernst. Doch ihre Wangen glühten vor Wonne, und ihre kleinen Brustwarzen waren keck aufgerichtet.
»Warum nicht? Es war doch schön, oder?«
Sie kicherte zustimmend.
Gino, fertig angekleidet, wollte möglichst schnell aus der leer stehenden Garage weg, wo es dunkel war und kalt. »Muss zu den andern«, erklärte er.
»Seh ich dich bald wieder?«
»Klar, bin immer in der Gegend.«
Susie eilte davon, Gino – die Hände tief in den Hosentaschen – stolzierte lässig in die entgegengesetzte Richtung.
Die anderen warteten auf ihn, eine Schar verwahrloster Jungen, die vor einem heruntergekommenen Drugstore lungerten. Sein bester Freund war ein drahtiger Junge namens Catto, der mit seinem Vater bei der Müllabfuhr arbeitete, weshalb ihm stets ein unbestimmter Gestank anhaftete. »Kann nichts dafür«, sagte Catto mit einem fröhlichen Achselzucken. In dem Haus, wo er wohnte, gab es kein Bad, und wer das öffentliche Bad an der 109. Straße benutzen wollte, musste gewöhnlich zwei Stunden anstehen. Catto hatte den Ehrgeiz, ein Mädchen mit Bad aufzugabeln.
Ein anderer enger Freund Ginos war Pinky Banana Kassari, ein aufgeschossener Junge mit dem Hang, seinen großen Penis zu zeigen, der tatsächlich einer rosaroten Banane ähnelte – daher der Spitzname.
»Hast du eine vernascht?«, fragte Pinky.
»Nee, ich hab gefastet«, antwortete Gino grinsend.
»Verlogener Erzvögler ...«, brummelte Catto.
Die ganze Schar wusste, dass der Tag, an dem Gino Santangelo mal keinen Treffer landete, ein höchst ungewöhnlicher Tag sein würde.
»Was tun wir also heute Abend?«, erkundigte sich Gino.
Die Jungen berieten leise, machten einige Vorschläge, wandten sich dann wie üblich an ihren Anführer und sagten: »Was du willst.«
»Ich will, dass wir ein bisschen Spaß haben«, erklärte Gino. Es war Samstagabend, er hatte gerade ein Mädchen gehabt und fühlte sich großartig. Unwichtig, dass er ganze zehn Cents besaß, dass seine Schuhe Löcher hatten, dass den Pflegeeltern, bei denen er derzeit wohnte, sein Anblick zuwider war. Er wollte Spaß haben. Er hatte ein Recht darauf, oder?
Sie strebten dem Stadtzentrum zu wie ein Rudel Ratten, Gino voran. Er ging übertrieben großspurig, federte auf den Ballen und wiegte sich hin und her. Sie waren zu acht, pfiffen den vorbeigehenden Mädchen nach oder pöbelten sie an: »He, Schätzchen! Willst du’s mit mir machen, Schätzchen?« – »Jej, Baby, ich könnte ins Kitchen kommen für das, was ich denke!«
Gino entdeckte den Wagen am Straßenrand als Erster: einen langen, glänzenden weiß-braunen Schlitten, in dem – er konnte sein Glück kaum fassen – der Schlüssel steckte! In Sekundenschnelle quetschten sich die acht Jungen hinein, und Gino, der sich selbstredend ans Steuer gesetzt hatte, fuhr wie der Blitz los. Seit seinem Schulabgang im vorigen Monat arbeitete er als Automechaniker, er kannte sich inzwischen mit Autos ganz gut aus. Das Fahren lag ihm, wie er sofort merkte. Die ersten paar Mal krachte es, wenn er schaltete, doch bald schaukelten sie lässig dahin. Sie fuhren bis Coney Island.
Die Strandpromenade war verlassen, und vom Meer her wehte eisiger Wind. Doch das störte sie nicht. Sie tobten am Strand herum, schrien und lachten, ballten den feuchten Sand zu Klumpen und bewarfen einander.
Sie waren leichte Beute für den Streifenpolizisten, der geduldig bei dem gestohlenen Wagen wartete, seine Pistole in der Hand.
Gino geriet zum ersten Mal mit der Polizei in Konflikt. Als Fahrer des Wagens – er gestand bereitwillig, dass er chauffiert hatte – bekam er die härteste Strafe aufgebrummt. Man verurteilte ihn zu einem Jahr im New Yorker Heim für verwahrloste Knaben, einer strengen Besserungsanstalt in der Bronx, wohin man Waisen und erstmals straffällig gewordene Jugendliche steckte.
Gino war noch nie eingesperrt gewesen. Er fühlte sich sofort bedroht. Die Ordensbrüder, denen die Anstalt unterstand, waren hart gesottene Männer. Tags hielten sie auf strengste Disziplin, nachts hielten sie es oft mit den jüngeren Knaben. Gino war empört. Die kleinen Burschen hatten keinerlei Chance.
Gino wurde der Schneiderei zugeteilt, einer Arbeit, die ihm verhasst war. Bruder Philippe leitete die Schneiderwerkstatt mit eiserner Faust. Wen er beim Bummeln erwischte, den verprügelte er mit seinem Meterstab. Als Gino an der Reihe war, bot ihm Bruder Philippe statt der Prügel eine andere Lösung an. Gino spuckte ihm ins Gesicht. Ab diesem Tag kam er im besten Fall drei Tage durch, ohne Prügel zu beziehen.
Als Gino sechs Monate hinter sich hatte, traf ein magerer kleiner Waisenknabe von noch nicht ganz dreizehn Jahren ein. Der Junge – Costa mit Namen – war ein gefundenes Fressen für Bruder Philippe, der nicht lange fackelte. Der Kleine versuchte sich zu wehren, doch das half ihm nichts. Die anderen Jungen beobachteten stumm, wie Bruder Philippe den bleichen Costa ins Hinterzimmer schleppte, wo er solche Dinge mit ihm anstellte, dass der kleine Kerl lauthals schrie vor Schmerzen und Pein.
Gino tat nichts, wie alle anderen. Sechs Wochen vergingen, in denen Costa immer mehr zusammenschrumpfte. Er war schon bei seiner Ankunft dürr und unterernährt gewesen, doch jetzt war er nur noch Haut und Knochen. Gino versuchte sich rauszuhalten. Wer hier überleben wollte, durfte sich nirgends einmischen.
Eines Tages, als Bruder Philippe sich Costa erneut herausangelte, spürte Gino Spannung in sich aufsteigen. Der kleine Junge wimmerte und protestierte, aber Bruder Philippe zog ihn am Arm ins Hinterzimmer und warf die Tür zu. Die Schmerzensschreie setzten fast sofort ein.
Gino konnte nicht mehr an sich halten. Er packte eine Schere, die auf einem Arbeitstisch lag, und lief hinterher.
Als er die Tür öffnete, sah er Costa, über einen Tisch gebeugt, Hose und Unterhose um die Knöchel, und Bruder Philippe, der sich anschickte, sein Glied einmal mehr in den After des mageren Kindes zu stoßen. Der Unmensch hob bei Ginos Eintritt nicht einmal den Kopf, so versessen war er auf sein Vergnügen. Er drang in den Jungen ein und pumpte ohne Rücksicht darauf, dass dessen Inneres riss. Costa brüllte vor Schmerz.
Gino handelte, ohne zu denken. Er sprang Bruder Philippe an und stieß zu. Die Schere drang durch die Jacke des bulligen Mannes und bohrte sich in seinen Arm. »Gehen Sie weg von ihm, Sie stinkiges Dreckschwein, lassen Sie ihn in Ruhe!«, schrie er.
Bruder Philippe, dem Höhepunkt nahe, versuchte ihn abzuschütteln. Das war ein Fehler, denn nun verlor Gino die Beherrschung. Plötzlich war der Mann, den er angriff, sein Vater. Eine Art schwarzer Nebel senkte sich auf ihn, und er gab seinem Vater die Schuld an allem: am Verschwinden seiner Mutter. An den Prügelstrafen. An den miesen Pflegeeltern. An den lausigen Einzimmerwohnungen, die das einzige Zuhause waren, das er je kennen gelernt hatte.
Er schrie und die Schere stieß zu. Er hörte erst auf, als der dreckige Hurenbock zu Boden sank. Dann verzog sich der Nebel, und er sah wieder klar. Doch was er sah, das schaute nicht gut aus.
Kapitel 3Carrie, 1913–1926
In Philadelphia war der Sommer sehr heiß. Lureen Jones saß auf dem Bett, das sie mit ihrem sechsjährigen Bruder Leroy teilte. Tränen rannen über ihr hübsches schwarzes Gesicht. Sie war dreizehn und seit siebeneinhalb Monaten schwanger. Niemand wusste es, und sie konnte mit niemandem darüber reden. Sie hatte keinen Vater. Auch kein Geld. Und ihre Mutter Ella, eine magere, ruinierte Frau, verkaufte ihren Körper für Drogen.
Leroy wimmerte. Lureen streckte sich neben ihm aus. Sie konnte nicht einschlafen. Unten trafen »Freunde« ihrer Mutter ein, laute Musik drang die Treppe herauf. Nach einer Weile erklangen andere Geräusche, Stöhnen und Ächzen, unterdrückte Schreie und das Klatschen von Schlägen auf Fleisch.
Sie stopfte sich Watte in die Ohren und kniff die Augen zu. Es dauerte lange, aber schließlich sank sie in Schlaf.
Sie hatte einen Alptraum – glaubte zu ersticken – wollte schreien – hörte sich schreien.
Plötzlich war sie wach. Es schrie wirklich jemand. Sie sprang aus dem Bett und roch den Rauch, noch bevor sie die Schlafzimmertür öffnete und die dichten Qualmwolken hereindrangen.
Sie begann zu würgen, zwang sich aber trotzdem, auf den Gang zu treten. Das ganze Haus brannte. Die Flammen leckten bereits am oberen Treppenabsatz, und von unten kamen jetzt grauenhafte Schreie.
Seltsam, doch sie geriet nicht in Panik. Tränen liefen ihr herunter, aber sie wusste genau, was sie tun musste.
Sie kehrte ins Schlafzimmer zurück, schloss die Tür, öffnete das Fenster, machte sich bei den unten herumrennenden Leuten durch Rufen bemerkbar und bat, Leroy aufzufangen. Dann zerrte sie den Jungen aus dem Bett und warf ihn zum Fenster hinaus.
Die Flammen sprengten die Schlafzimmertür auf und waren hinter ihr, als sie sprang. Mit einem dumpfen Schlag landete sie auf dem Gehsteig. Blut breitete sich um sie aus, doch sie konnte noch leise zu einem Sanitäter sagen: »Rettet mein Baby ... O Gott, bitte rettet mein Baby.«
Bei ihrer Einlieferung ins Krankenhaus war sie tot.
Der Sanitäter sagte einem jungen Notarzt, dass sie schwanger sei, und der Arzt, noch beflügelt von der Begeisterung des Neulings, horchte nach dem Herzschlag des Babys – er war da, wenn auch ganz schwach. Daraufhin alarmierte er einen Chirurgen, und der fand sich bereit, an dem toten Mädchen einen Notkaiserschnitt vorzunehmen. Eine knappe Stunde später erblickte Carrie das Licht der Welt.
Ihre Überlebenschancen waren sehr gering. Sie war winzig, kaum fähig zu atmen. Der Arzt, der sie geholt hatte, gab ihr keine vierundzwanzig Stunden.
Doch Carrie – so tauften sie die Schwestern – war zäh. Sie hatte den Sturz ihrer Mutter überlebt, das Fruchtwasser in der Embrionalhülle hatte als Stoßdämpfer gewirkt, und sie wollte auch den verfrühten Eintritt in die Welt überleben.
Woche um Woche setzte sie alle in Erstaunen, indem sie durchhielt. Als die Wochen zu Monaten wurden, kam sie zu Kräften und entwickelte sich zu einem normalen, robusten Baby. Sie war so gesund, dass bald der Zeitpunkt nahte, wo sie das Krankenhaus mit seiner liebevollen Fürsorge verlassen musste. Doch es gab ein Problem – niemand wollte sie haben.
Sie besaß keine Verwandten außer ihrer Großmutter Ella, die man in einem Zustand betrunkener Stumpfheit aus dem brennenden Haus gerettet hatte, und ihrem sechsjährigen Onkel Leroy.
Ella zeigte sich nicht begeistert von dem Gedanken, ein Maul mehr ernähren zu müssen. Sie schrie im Krankenhaus herum, das Kind habe mit ihr schließlich nichts zu tun. Die Schwestern waren entsetzt bei der Vorstellung, den winzigen Säugling, den sie aufgepäppelt hatten und liebten, einer solchen Frau anzuvertrauen. Eine der Schwestern – eine warmherzige Frau namens Sonny, die drei eigene Kinder hatte – erklärte sich bereit, Carrie zu nehmen.
Ella willigte sofort ein, und so nahm Sonny das Baby mit nach Hause. Von diesem Tag an zog sie Carrie wie ihre eigene Tochter auf. Die Familie war arm, doch was ihr an Geld fehlte, machte sie durch Liebe wett. Carrie gehörte bald ganz dazu. Niemand erzählte der Kleinen je etwas über den tragischen Beginn ihrer Existenz.
An ihrem dreizehnten Geburtstag wurde ihr junges Leben grausam erschüttert, denn Ella erschien auf der Bildfläche.
Wer war diese Fremde, diese verwelkte Frau mit dem narbigen Gesicht, den hohlen Augen und dem fettigen Haar?
Ella war es seit dem Brand nicht gut ergangen. Wer wollte schon eine Hure mit einem narbenbedeckten Körper und einem entstellten Gesicht? Eine Zeitlang schlug sie sich mehr schlecht als recht durch, doch bald begann sie mit kleinen Diebereien, um das Geld für ihre Drogen aufzubringen. Ihre Rettung war Leroy, ein kräftiger junger Kerl. Ella nahm ihn aus der Schule und ließ ihn für sich arbeiten. Mit zwölf Jahren war der Junge bereits der Ernährer der »Familie«. Ella saß trübsinnig und wie versteinert in der gemieteten Einzimmerwohnung, während Leroy sich halb zu Tode arbeitete. Als er achtzehn wurde, verschwand er. Ella stand allein da, eine schwache, kränkelnde, träge Frau ohne Geld.
Da dachte sie zum ersten Mal wieder an ihre Enkelin – wie hieß das Gör? Carey – Carrie – ja, Carrie. Wenn Leroy für sie arbeiten konnte, warum nicht auch Lureens Kind? Schließlich war sie eine Blutsverwandte, oder?
Ella machte sich auf die Suche nach ihr.
Gegen Ende des Sommers 1926 trafen das dreizehnjährige Mädchen und seine Großmutter in New York ein. Ella hatte sich gesagt, in New York sei mehr Geld zu verdienen als in Philadelphia, und sie wollte in dieser großen Stadt sein, wo sich alles Wichtige zutrug.
Was sich zutrug, waren ein verkommenes Zimmer für sie beide und ein Arbeitsplatz für Carrie in einem Restaurant, wo sie den Küchenboden zu putzen hatte. Sie wirkte älter als dreizehn, war hoch aufgeschossen, hatte große Brüste, glattes schwarzes Haar und sehr klare Augen.
Ella, die ein böser Husten plagte, sah für das Mädchen gute Chancen – zu denen Bodenputzen freilich nicht gehörte. Aber man musste noch warten, den rechten Augenblick abwarten. Das Mädchen war schwierig – sogar böse. Man hätte meinen sollen, sie wisse es zu schätzen, dass ihre Großmutter sie gesucht hatte. Doch es war verflucht schwer gewesen, sie von der Familie loszueisen, die sich um sie gekümmert hatte. Diese Leute hatten sogar die Polizei gerufen, aber Ella war es schnell gelungen, ihre Rechte durchzusetzen. Carrie hatte mit ihr gehen müssen. Allmächtiger Gott, sie war die Großmutter des Mädchens, ihre einzige echte Blutsverwandte, und kein Argument auf der Welt konnte diese Tatsache widerlegen.
»Wie alt bist du?«, fragte der schwabbelige kleine Chefkoch.
Carrie, damit beschäftigt, den dreckigen Küchenboden zu schrubben, schaute nervös hoch.
»Ich wette meinen Kopf, dass du keine sechzehn bist«, sagte der dicke Mann höhnisch.
Es war jeden Tag das Gleiche. Zwanzigmal hatte sie ihm erklärt, sie sei sechzehn, aber er glaubte ihr nicht.
»Nun?« Er leckte sich die Lippen, deren Anblick Carrie an Würmer erinnerte. »Was machen wir da?«
»Bitte?«, fragte Carrie matt.
»Was wir da machen? Wenn der Manager dahinterkommt, dass du zu jung bist, setzt er deinen hübschen schwarzen Hintern schneller an die Luft, als eine Hure einen lecken kann.«
Carrie konzentrierte sich auf ihre Putzarbeit. Wenn sie ihn ignorierte, ging er vielleicht.
»Nigger, ich red mit dir!« Er beugte sich zu ihr herunter. »Ich muss ja keinem was sagen – wenn du nett zu mir bist, verrate ich nichts.«
Bevor sie Zeit für eine Bewegung hatte, schob er seine fette Hand unter ihren Rock.
Sie sprang auf, stieß dabei den Eimer mit Seifenwasser um. »Wagen Sie nicht, mich anzurühren!«
Er wich zurück, sein schwammiges Gesicht rötete sich.
Der Manager erschien, ein magerer, jämmerlich anzusehender Mann, der Schwarze hasste. Seine kalten Augen glitten über die Wasserpfütze. »Wisch das auf«, sagte er zu Carrie, den Blick auf die Wand hinter ihr gerichtet, als existiere sie gar nicht. »Dann mach, dass du verschwindest, und lass dich hier nicht mehr blicken.«
Der dicke Chefkoch bohrte sich im linken Ohr. »Dummes Ding«, sagte er. »Ich hätte dir doch nichts getan.«
Langsam wischte sie das verschüttete Wasser auf. Sie konnte noch immer nicht fassen, was aus ihrem Leben geworden war. Ihr war nach Weinen, aber sie hatte keine Tränen mehr. Als die Frau, die sich ihre Großmutter nannte, gekommen war und sie geholt hatte, da hatte sie so viel geweint, dass es für Jahre reichte. Und dann New York – keine Schule mehr – sich die Hände beim Bodenschrubben wund arbeiten. »Du bist verzogen«, hatte Großmama Ella zu ihr gesagt. »Damit ist jetzt Schluss, hörst du, Mädchen? Deine Mama hat immer gearbeitet. Sie hat das Haus sauber gehalten und sich um ihren Bruder gekümmert. Sie hat das geliebt, jede Minute davon.«
Carrie hasste jede Minute ihres jetzigen Lebens. Sie hasste ihre Großmutter und New York und die Arbeit. Sie wollte nichts als heim nach Philadelphia, zu der Familie, die sie als ihre wirkliche betrachtete.
Nun hatte man sie rausgeworfen, und Großmama Ella würde hochgehen. Und es würde ihr nicht mehr möglich sein, ab und zu einen Cent wegzustecken, den sie beim Putzen auf dem Boden fand. Das Ganze war einfach ungerecht.
Nachdem sie zusammengewischt hatte, verließ sie die Küche. Auf dem Gehsteig blieb sie wie betäubt stehen und überlegte, was sie tun sollte. Vielleicht sollte sie sich andere Arbeit suchen, bevor Großmama Ella herausfand, dass man sie entlassen hatte.
Der Winter fasste allmählich Fuß. Es war kalt, und sie hatte keinen Mantel. Frierend setzte sie sich in Bewegung, ging an dem billigen Stehimbiss vorbei, sog hungrig den Geruch von heißen Würstchen ein. Der Geruch war alles, was sie sich leisten konnte; außerdem war Negern der Zutritt zu dem Imbiss nicht erlaubt.
In New York hatte Carrie erfahren, was es bedeutete, schwarz zu sein. Sie hatte das Wort Nigger zum ersten Mal vernommen und sich bald angewöhnt, nicht hinzuhören, wenn man sie wegen ihrer Hautfarbe verhöhnte. In Philadelphia waren die Weißen die Außenseiter gewesen. Carrie hatte dort in einem Farbigenviertel gelebt und eine Schule für Farbige besucht. Weiße! Was ließ sie überhaupt glauben, dass sie etwas Besseres seien?
Die Männer, an denen sie vorbeieilte, musterten sie. In letzter Zeit musterten die Männer sie immer. Ihr Pullover spannte über den Brüsten, sie hüpften beim Gehen, und das mochte Carrie gar nicht. Mama Sonny hatte ihr einen BH versprochen, doch als sie ihrer Großmutter mit der Bitte gekommen war, hatte Ella sie von oben bis unten betrachtet und gesagt: »Führ vor, was du hast, Schätzchen. Zeig denen deine Titten. Mach diesen Weißen ’nen Steifen, dann hast du immer Arbeit.«
Das stimmte doch nicht, oder? Hätte der dicke Chefkoch den Blick auf seine Töpfe gerichtet statt auf sie, wäre sie nicht entlassen worden.
Carrie kam an einem italienischen Restaurant vorbei, das warm und einladend aussah. Frierend blieb sie stehen. Der Wind war jetzt beißend kalt, und sie hatte schon eine Gänsehaut. Sie schlang die Arme um den Oberkörper und überlegte, was sie tun sollte. Ein Landstreicher schlurrte an ihr vorüber, der von ihm ausgehende Gestank nach abgestandenem Alkohol erinnerte sie an Großmama Ella. Carrie wusste, dass sie etwas unternehmen musste. Wenn sie nun einfach durch den Vordereingang hineinging und nach Arbeit fragte? Was konnte ihr schon groß passieren? Auffressen konnten sie sie nicht, nur beleidigen. Und daran gewöhnte man sich in New York sehr schnell.
Ihren ganzen Mut zusammennehmend, schlüpfte sie durch die Tür und wünschte im selben Augenblick, es nicht getan zu haben. Ihr kam es vor, als stehe sie stundenlang da und alle Augen richteten sich auf sie. Doch in Wirklichkeit näherte sich ihr bereits nach wenigen Sekunden ein riesiger Mann. Sie reckte sich, gefasst darauf, hinausgeworfen zu werden.
»Suchen Sie einen Tisch?«, fragte er.
Sie glaubte nicht recht zu hören. Einen Tisch? Sie? Ein farbiges Mädchen in einem Restaurant für Weiße! War der Mann übergeschnappt?
»Ich suche Arbeit«, murmelte sie, »Putzen, Geschirrspülen – irgendwas ...«
»Ah!«, dröhnte er. »Sie wollen eine Stellung. Gehen wir in die Küche. Ich weiß nicht, ob wir was haben, aber wir können ja mal drüber reden. Möchten Sie heiße Pasta?«
Carrie hatte keine Ahnung, was Pasta war, aber jede warme Speise klang verlockend. Sie konnte ihr Glück gar nicht fassen, die Freundlichkeit des Mannes kam ihr unglaublich vor. Sie nickte, worauf er ihr den Arm um die Schulter legte und sie durchs Restaurant führte. In der Küche lernte sie seine Frau Luisa kennen und erfuhr, dass er Vincenzo hieß. Die beiden machten ein Aufhebens um sie, als spiele ihre Hautfarbe überhaupt keine Rolle.
»Sie ist so jung«, sagte Luisa mit singender Stimme, »ein richtiges Baby.«
»Ich bin sechzehn«, log Carrie, doch aus den Blicken, die zwischen den beiden hin und her gingen, erkannte sie, dass das Ehepaar ihr nicht glaubte. Sie wäre gern ehrlich gewesen, aber Großmama Ella hatte ihr schreckliche Angst gemacht. »Verrate jemandem dein wirkliches Alter«, hatte sie gedroht, »und man steckt dich in ein Heim für schlechte Mädchen, die von der Schule abhauen.« Das war gemein. Schließlich hatte Großmama Ella selbst sie aus der Schule herausgerissen und ihr Leben ruiniert.
Vincenzo und Luisa hatten für sie keine Verwendung; ihre Küche war klein, und sie beschäftigten schon drei Helfer. Doch Vincenzo fragte herum und kam mit der guten Nachricht wieder, dass Mr. Bernard Dimes, ein Stammgast von ihnen, für sein Haus jemanden zum Putzen brauche. Wenn sie die Stellung wolle, könne sie sie haben. Und ob sie wollte!
Vincenzo führte sie ins Lokal und stellte sie Mr. Dimes vor, der sie mit seinen ruhigen braunen Augen musterte. »Kannst du am Montag anfangen?«, fragte er.
Sie nickte, denn sie war so eingeschüchtert, dass sie kein Wort hervorbrachte.
Wie benommen verließ sie das Lokal, betäubt von ihrem ungeheuren Glück. Was sollte sie Großmama Ella sagen? Die Wahrheit, dass sie in einem Privathaus arbeiten und mehr verdienen würde? Oder die Lüge, dass sie weiter Küchenböden schrubbe?
Sosehr es gegen ihre Natur ging, es schien ihr vernünftiger zu lügen. Auf diese Weise konnte sie für sich selbst ein bisschen Geld beiseite legen und trotzdem noch den gleichen Betrag abliefern.
Einen Monat lang lief alles glatt. Jeden Morgen verließ Carrie das schäbige Zimmer, das sie mit ihrer Großmutter teilte, und fuhr ins Stadtinnere zu Mr. Dimes’ imponierendem Haus in der Park Avenue. Eine Haushälterin beaufsichtigte sie. Den Hausherrn selbst bekam Carrie nur zweimal zu sehen, beide Male lächelte er und erkundigte sich nach ihrem Befinden.
Sie hatte das Gefühl, ihn gut zu kennen. Sie machte jeden Tag sein Bett, wechselte die seidenen Laken, putzte sein Bad und seine Schuhe, wusch und bügelte seine Wäsche und staubte sein Arbeitszimmer ab. Dort verweilte sie manchmal und betrachtete die silbern gerahmten Fotos von Berühmtheiten.
Mr. Dimes war Theaterproduzent. Eine Mrs. Dimes gab es nicht, nur eine Reihe gepflegter Blondinen, die ihn bei gesellschaftlichen Anlässen begleiteten. Keine blieb je über Nacht – dessen war sich Carrie sicher. Für sie war Mr. Dimes der schönste und beeindruckendste Mann, den sie je gesehen hatte. Er war dreiunddreißig, wie sie herausfand, und sehr reich.
Eines Tages fragte die Haushälterin, ob Carrie nicht in dem Haus an der Park Avenue wohnen wolle. »Im Souterrain ist ein kleines Zimmer«, sagte sie, »und für dich wäre ohne diese Fahrerei bestimmt alles viel einfacher.«
Carrie hielt das für eine großartige Idee. »Ich würde schrecklich gern hier wohnen«, antwortete sie.
»Also abgemacht«, erklärte die Haushälterin. »Bring am Montag deine Sachen mit und richte dich ein.«
Carries Gedanken rasten. Sie würde es tun! Wie wollte Großmama Ella sie dort je finden? Großmama Ella wusste nichts von ihrer neuen Stellung und würde ganz sicher nicht mehr die Energie aufbringen, sie zu suchen.
In dem Haus an der Park Avenue wohnen – ein wahr gewordener Traum! Ein eigenes Zimmer! Fünf Dollar in der Woche! Innerhalb kürzester Zeit würde sie genug beisammen haben, um nach Philadelphia zu ihrer richtigen Familie zurückkehren zu können.
Es war Freitag, also musste sie nur noch das Wochenende durchstehen. Sie eilte heim, plante in Gedanken ihre Flucht. Großmama Ella wartete auf das Geld, das Carrie am Freitagabend brachte, kassierte es und ging weg.
Carrie legte sich auf ihr Bett. Sie war zu müde, um noch zur Eckkneipe zu gehen und sich ein fettiges Stück Hähnchen oder Grütze zu kaufen. Von der Straße unten drang laute Jazzmusik ins Zimmer. Carrie hatte keinen anderen Wunsch, als die Augen zu schließen und möglichst schnell einzuschlafen. Je eher sie einschlief, desto eher würde es Samstag sein und dann Sonntag und dann ...
Eine Hand weckte sie zwei Stunden später. Eine harte Hand, die sie grob an der Schulter rüttelte.
Sie kam langsam zu sich, rieb sich die Augen und fragte: »Was ist, Großmama? Was ist los?«
Doch es war nicht ihre Großmama. Es war ein hoch aufgeschossener schwarzer Bursche mit großen Augen und struppigem Haar.
»Wer sind Sie?«, schrie Carrie entsetzt.
»Nur keine Angst«, sagte der Bursche mit breitem Grinsen. »Ich bin Leroy. Ich such bloß meine Mama.«
»Wie sind Sie herein...«, begann sie, doch dann sah sie, dass er sich gewaltsam Zutritt verschafft hatte. Die dünne, morsche Tür hielt niemandem stand.
»Schätze, du bist Lureens Kleine. Jemand hat mir gesagt, dass Mama so nett war, dich zu sich zu nehmen.«
Carrie setzte sich auf. Sie hatte von Leroy gehört. Großmama Ella erwähnte ihn oft. »Diese miese kleine Ratte, seine eigene Mutter im Stich lassen. Wenn mir der kleine Dreckskerl je wieder unter die Augen kommt, schlag ich ihm den Schädel ein!«
»Sie ist nicht da. Am besten kommen Sie morgen wieder.«
Leroy ließ sich auf dem Fußende ihres Bettes nieder. »Mädchen! Ich geh nicht weg. Ich bin hundemüde. Habt ihr irgendwas zu essen da?«
»Nein.«
»Oh, Scheißdreck. Sieht meiner lieben alten Mama ähnlich.« Er musterte sie mit unverschämtem Blick. »Schätze, du musst dich genauso für sie abschinden wie ich.« Seine Augen verweilten auf ihren Brüsten, die von dem dünnen Unterrock, den sie trug, kaum verhüllt wurden. »Du bist ein hübsches kleines Ding. Ich wette, Mama hat dafür gesorgt, dass du deine Zwetschge verkaufst.«
Carrie zog die Bettdecke um sich. »Ich arbeite als Dienstmädchen«, entgegnete sie steif. Sie wünschte, er wäre gegangen.
»Als Dienstmädchen, so? Für ’nen dicken, fetten Weißen, was?«
»In einem Restaurant.«
»Einem Restaurant? Scheißdreck!« Er kaute an einem Nietnagel herum und studierte sie mit zusammengekniffenen Augen. »Wenn du deine Zwetschge verkaufen willst, bin ich der Richtige, ich kann’s für dich einrichten.«
Plötzlich war sie sehr nervös. Es war, als dröhne in ihrem Kopf ein Warnsystem: Gefahr, Gefahr, Gefahr.
Sie bewegte sich im gleichen Augenblick wie er. Aber er war größer und stärker als sie und hatte ihre Arme im Nu aufs Bett gepresst. »Mach mir doch nicht weis, dass du’s nicht machst«, fauchte er, umklammerte ihre Handgelenke mit einer Hand und fuhr ihr mit der anderen über den Körper.
»Lass mich in Ruh«, keuchte sie.
»Warum sollte ich?« Er lachte. »Ich brauch nicht zahlen. Ich krieg’s umsonst. Ich bin dein Onkel – Mädchen.«
Mit einem groben Ruck riss er ihr die Unterhose herunter. Sie bäumte sich auf, in dem vergeblichen Versuch ihn abzuschütteln. Er presste sie einfach aufs Bett, drückte mit seinen Knien ihre Beine auseinander und drang in sie ein.
Heftiger Schmerz durchfuhr sie. Aber nicht der Schmerz ließ sie aufschreien, sondern die Empörung, die Wut, ihre völlige Hilflosigkeit angesichts dessen, was mit ihr geschah.
»He! He! He!« Er lachte und ergoss sich im selben Augenblick. »Du hast mich nicht verscheißert – du warst ’ne Jungfrau. Heilige Scheiße! Du und ich werden ein Vermögen machen. Deine enge kleine Büchse wird uns reich machen. Schei-ße!« Er war fertig und ließ sie los.
Sie blieb reglos liegen, zu verängstigt, um sich zu bewegen oder etwas zu tun. Zwischen ihren Beinen spürte sie eine brennende, heiße Klebrigkeit. Das war es also, was die Männer wollten. Das war die so genannte Liebe.
Leroy wanderte fröhlich im Zimmer umher; er knöpfte seine Hose zu und redete leise mit sich selbst, während er ihre Besitztümer inspizierte. »Irgendwelches Geld da?«, fragte er.
Sie dachte rasch an die paar Dollar, die sie hatte sparen können. Das Geld steckte in einem zusammengerollten Strumpf unter ihrer Matratze. »Kein Geld«, murmelte sie matt. Sie wünschte, Großmama Ella möge kommen und sehen, was Leroy ihr Entsetzliches angetan hatte.
»Schei-ße!«, rief er. »Kein Geld, kein Schnaps. Schei-ße! Hm, schätze, hier kann man nichts tun, als das schwarze Pferdchen reiten.« Unvermittelt war er wieder über ihr, er spreizte die mageren Beine, hockte sich rittlings auf sie und stieß mit seinem Ding auf sie ein.
Wellen der Schwärze schlugen über Carrie zusammen; sie spürte, wie sie langsam ins Leere fiel ...
»Ah, komm, Mädchen – genieß es«, hörte sie ihn noch sagen. »Ist kein Spaß für mich, wenn’s für dich keiner ist.«