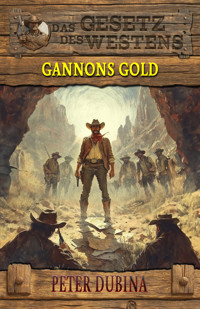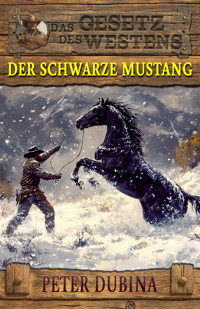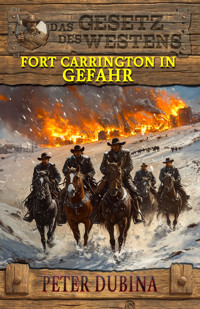Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Peter Dubina
- Sprache: Deutsch
Was unter der Kapuze zum Vorschein gekommen war, glich nicht einem menschlichen Antlitz. Es war eine Fratze, die einer Ausgeburt der Hölle zu gehören schien. Und auf ihrer Stirn war ein Zeichen wie mit glühendem Eisen gebrannt: 6 6 6. New York in den 80er Jahren. Die Stadt ist ein modernes Babylon, laut, dreckig und gefährlich. Hier lebt Matthew Easton, dessen Leben seit zwölf Monaten einem Höllentrip gleicht: Seine Ehe ist zerbrochen, er hat all sein Geld verloren und nun scheinbar auch seinen Verstand. Jede Nacht quälen ihn rätselhafte Träume, in denen er auf einem Scheiterhaufen gezerrt wird. Als Matthew nicht mehr weiter weiß, vertraut er sich dem Psychologen Dr. Antropus an – aber will dieser ihm wirklich helfen? Dunkle Prophezeiungen und ein Wettlauf mit der Zeit: der spannende Horror-Thriller für Leser mit starken Nerven. Jetzt als eBook: "Die Satansklaue" von Peter Dubina. dotbooks – der eBook-Verlag. JETZT BILLIGER KAUFEN – überall, wo es gute eBooks gibt!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
New York in den 80er Jahren. Die Stadt ist ein modernes Babylon, laut, dreckig und gefährlich. Hier lebt Matthew Easton, dessen Leben seit zwölf Monaten einem Höllentrip gleicht: Seine Ehe ist zerbrochen, er hat all sein Geld verloren und nun scheinbar auch seinen Verstand. Jede Nacht quälen ihn rätselhafte Träume, in denen er auf einem Scheiterhaufen gezerrt wird. Als Matthew nicht mehr weiter weiß, vertraut er sich dem Psychologen Dr. Antropus an – aber will dieser ihm wirklich helfen?
eBook-Neuausgabe September 2025
Copyright © der Originalausgabe 1980 BASTEI-VERLAG, Gustav H. Lübbe GmbH.
Copyright © der Neuausgabe 2013 dotbooks GmbH, MünchenAlle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: : Nele Schütz Design, München, unter Verwendung eines Motivs von Fer Gregory/shutterstock.com.
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (ma)
ISBN 978-3-95520-456-3
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Peter Dubina
Die Satansklaue
Horror-Thriller
dotbooks.
Kapitel 1
Ein Traum wie dieser konnte nur aus den tiefsten Abgründen der Hölle emporgestiegen sein; er packte Matthew Easton wie mit eisernem Griff. Es war derselbe Traum, der ihn schon seit Wochen allnächtlich heimsuchte.
Doch obwohl Matthew Easton träumte, schlief er nicht wirklich, denn der zu ihm dringende Verkehrslärm aus den Straßenschluchten des New Yorker Stadtteils Manhattan berührte gerade noch den Rand seines verschwimmenden Bewußtseins. Aber der Traum war stärker.
Die Henkersknechte hatten ihn gepackt und stießen ihn erbarmungslos vorwärts, auf den Scheiterhaufen zu, über dem düster der mit rußgeschwärzten Eisenketten behangene Brandpfahl aufragte. Am Fuß der Leiter, die zum Pfahl hinaufführte, stand der Scharfrichter, die Seilschlinge in der Hand, mit der er den Verurteilten erwürgen würde, bevor er die lodernde Fackel an den aufgeschichteten Scheiterhaufen legte.
Mit nachgebenden Knien taumelte Matthew Easton, angetan mit dem Büßerhemd des von der Inquisition verurteilten und verdammten Ketzers, zwischen den langen Reihen von Mönchen dahin, die vom Gefängnistor bis zur Richtstätte reichten. Die Gesichter der Mönche waren mit Kapuzen verhüllt, jeder trug eine Fackel in der Hand; und ihr dumpfer lateinischer Gesang – »Dies irae«, »Tag des Zorns«, das Lied, das jeden Ketzer auf seinem letzten Weg zum Scheiterhaufen begleitete – drang schrecklich an Matthew Eastons Ohr.
Seinem Körper, welcher von der in den Kerkern des Vatikans erlittenen Folter geschwächt war, bereitete jede Bewegung schreckliche Pein, während er auf den Scheiterhaufen zustolperte und die Leiter hinaufgeschoben wurde.
Ein-, zweimal gaben seine Beine unter ihm nach; doch die Gehilfen des Scharfrichters hielten ihn aufrecht und stießen ihn mit dem Rücken gegen den Brandpfahl. Dann schlangen sich die eisernen Ketten, in denen sich schon so viel Unglückliche in Todesqualen gewunden hatten, straff um seinen Körper, so daß er sich kaum noch bewegen konnte.
Und immer noch sangen die vermummten fackeltragenden Mönche: »Tag des Zorns! Tag des Gerichts!«
Ein einzelner Mönch stand plötzlich am Fuß des Scheiterhaufens und hielt Matthew Easton ein Kruzifix entgegen, das an einer langen Stange befestigt war – der letzte Trost, der einem von der Inquisition Verurteilten vor seinem Tod gewährt wurde.
Matthew Eastons Blick ging über die Reihen der Mönche hinweg. Hinter ihnen – am Rand des »Campo di fiori«, des »Blumenfeldes« (welch höhnischer Name für eine blutgetränkte Hinrichtungsstätte) – sah er die Richter der Inquisition in ihren scharlachroten, weißen und schwarzen Roben an einem langen, mit einem Kreuz und brennenden Kerzen geschmückten Tisch sitzen. Auch ihre Gesichter waren durch tief herabgezogene Kapuzen unkenntlich gemacht.
Und noch etwas sah der Verurteilte – etwas, das ihm schlimmer schien als die Todesqualen, die ihm bevorstanden: Hinter dem Richtertisch erhob sich himmelhoch eine Basilika, vielleicht war es auch ein Dom, eine Kathedrale – eine Kirche jedenfalls. Und auf ihrer Mauer – fürchterlich anzuschauen – ragte ein unmenschlicher Schatten empor, das düstere Abbild eines geflügelten, sich schlangengleich windenden Drachen, der seine Klauen reckte, als wollte er damit die ganze Welt packen und vernichten.
Es war der Schatten des Bösen, des Satans …
In diesem Augenblick durchfuhr eine jähe Erkenntnis Matthew Easton. Plötzlich wußte er wieder, warum er zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt worden war. Ebenso wußte er, wer der Feind war, gegen den er gekämpft und der ihn schließlich doch bezwungen hatte. Sein Erinnerungsvermögen war zurückgekehrt, wie ein Sonnenstrahl durch finstere Gewitterwolken bricht.
Er wollte den Mund öffnen, um die Wahrheit hinauszuschreien; doch nur ein ersticktes Gurgeln kam über seine Lippen. In einem letzten, verzweifelten Aufbäumen riß und zerrte er an den Ketten, konnte sich aber nicht befreien. Er stöhnte auf vor Qual, denn niemand schien den höllischen Schatten an der Kirchenwand zu bemerken, niemand außer ihm! Und dann kam das Ende …
Mit erlöschendem Blick sah er das Schlimmste von allem: Das Kruzifix, das ihm der Mönch am Ende der Stange entgegenhielt, verwandelte sich vor seinen Augen in ein unaussprechlich gotteslästerliches Satanszeichen. Mit letzter Kraft wandte Matthew Easton den Kopf zur Seite und sah, daß der Mönch seine Kapuze zurückgeschlagen hatte. Aber was darunter zum Vorschein gekommen war, glich nicht einem menschlichen Antlitz. Es war eine Fratze, die einer Ausgeburt der Hölle zu gehören schien. Und auf ihrer Stirn war ein Zeichen wie mit glühendem Eisen gebrannt: 6‑6‑6.
Der Rachen der Fratze öffnete sich zu einem verzerrten, zähnefletschenden, höhnischen Gelächter. Und während dieser Auswurf des ewigen Infernos mit einer Hand das Satanszeichen emporhielt, deutete er mit der anderen auf den teuflischen Schatten an der Kirchenwand, der in sprungbereite Lauerstellung gegangen war.
Das schreckliche Gelächter, das nichts Menschliches an sich hatte, war einer der letzten Laute, die Matthew Easton in die Welt jenseits von Licht und Schatten mitnahm – über die Schwelle, die man »Tod« nennt.
***
Matt Easton fuhr aus seinem Traum hoch. Sekundenlang wußte er nicht, wo er sich befand, denn um ihn herrschte Dunkelheit. Dann tastete seine Hand halb unbewußt nach dem Lichtschalter, und mit dem Einbruch blendender Helligkeit in die schreckliche, finstere Welt seines Traumes fand er sich im Schlafzimmer seines Appartements in den »Saturn Towers« in Ost-Manhattan.
Von kaltem Schweiß überströmt, ließ er sich rücklings aufs Bett fallen, bis sein hämmerndes Herz sich so weit beruhigt hatte, daß er aufstehen und nach nebenan in den großen Wohnraum gehen konnte. Mit zitternder Hand goß er sich an der Hausbar einen Whisky ein, leerte das Glas in einem Zug und füllte es abermals. Dann ließ er sich in einen Sessel sinken. Ein Blick auf die Uhr sagte ihm, daß es sechs Uhr dreißig war – Zeit, sich für den kommenden Arbeitstag im »Glaspalast« der UNO am Hudson-River in New York vorzubereiten. Von draußen sickerte widerlich graues Morgenlicht durch die großen Fenster herein. Schemenhaft konnte Matt Easton die Umrisse der Wolkenkratzer von Manhattan im Frühdunst erkennen, den der kalte Wind vom Meer landeinwärts trieb. Er fühlte sich noch immer wie gerädert. Seit Wochen verfolgte ihn dieser furchtbare Traum. Weder Whisky noch Tabletten halfen dagegen. Und Matt Eastons Angst, unter einer Geisteskrankheit zu leiden, nahm immer beängstigendere Formen an.
Viel Glück hatte er nicht gehabt in den vergangenen zwölf Monaten: Seine Ehe mit Elizabeth, die er abgöttisch geliebt hatte, war zerbrochen, und er hatte schwere finanzielle Verluste hinnehmen müssen. Vielleicht lag hier der Grund für seinen sich ständig verschlechternden seelischen Zustand. Um diesem Verfall entgegenzuwirken, hatte er sich Bücher gekauft – medizinische Abhandlungen berühmter Psychiater wie Siegmund Freud, Kinsey, Adler und C.G. Jung –, aber sie hatten ihn einer Lösung seiner Probleme nicht näher gebracht. Und einem Arzt wollte er sich nicht anvertrauen. Er wußte nur zu gut, daß, würde sein Zustand bekannt, dies das Ende seiner Karriere als UNO-Diplomat der Vereinigten Staaten von Amerika bedeuten mußte.
Während er mit dem Whiskyglas in der Hand dasaß, fragte er sich, warum ihn derselbe Traum immer aufs neue mit minutiöser Genauigkeit heimsuchte. Es gab nichts in seinem Leben, was in irgendeiner Weise – und sei sie noch so unbegreiflich – die Wurzel zu diesem entsetzlichen Traum hätte sein können. Es war, als blickte er in seinem Traum in ein vergangenes Leben. Weder Bücher über Parapsychologie noch über Traumdeutung hatten ihm irgendwelche Aufschlüsse geben können. Alle seine Überlegungen schienen sich im Kreis zu drehen; sie deuteten mit einer schier unabwendbaren Gewißheit darauf hin, daß er sich am Beginn einer verhängnisvollen Entwicklung befand, die man nur mit einem Wort umschreiben konnte: Geisteskrankheit.
Wie immer, wenn er mit seinen Überlegungen an diesem Punkt angelangt war, erfaßte ihn lähmende Angst. Hastig stürzte er den zweiten Whisky hinunter, wobei seine Hand zitterte. Wie oft hatte er sich schon gesagt, daß er durch diese unheilvolle Phase seines Lebens einfach hindurch müsse! Er griff abermals nach der Flasche.
Schließlich war alles bloß ein Traum.
War es wirklich nur ein Traum?
Er versuchte, sich an die Erkenntnis zu erinnern, die ihn jede Nacht im Traum kurz vor seinem Tod auf dem Scheiterhaufen so bedrückend überfiel. Vielleicht konnte sie ihm Aufschluß über seine seelische Verwirrung geben. Aber er konnte die Erkenntnis, die ihm in seinen Träumen immer wieder klar vor Augen stand, in wachem Zustand nicht nachvollziehen. Jedesmal, wenn er einen Versuch dazu unternahm, türmte sich eine geistige Barriere wie eine unsichtbare, aber unbezwingbare Mauer vor ihm auf, die allen seinen Anstrengungen widerstand. Doch sein Ahnungsvermögen sagte ihm, daß die dahinter verborgene Wahrheit etwas Schreckliches, Entsetzliches war. Vielleicht verhüllte sein Unterbewußtsein das lauernde Grauen nur deshalb mit einem undurchdringlichen Schleier, weil sein bewußter, wacher Verstand nicht imstande gewesen wäre, dem Schrecken standzuhalten.
Ein eisiger Schauer rann Matt Easton über den Rücken. Es war, als hätte ihn die kalte Hand eines Toten berührt, der sich aus seinem Grab erhoben hatte. Hastig trank er seinen Whisky aus.
Kapitel 2
»Ich finde, du siehst nicht gerade gut aus, Matthew«, sagte Mort Milo. »Fühlst du dich krank?«
Milo hatte die aufreizende Gewohnheit, Easton stets mit seinem vollen Vornamen anzusprechen. Für seine anderen Freunde war er »Matt«, aber Milo beharrte auf »Matthew«. Vielleicht, weil er wußte, daß Easton nicht so angesprochen werden wollte. Es bereitete Mort Milo Vergnügen, andere Menschen zu verletzen, und sei es auch nur durch Belanglosigkeiten.
Die beiden Männer kamen gerade von einer Sitzung der Welternährungskonferenz der Vereinten Nationen und schritten einen der langen Korridore der UNO-Gebäude entlang. Durch die großen Fenster an der Außenseite des »Glaspalastes« konnte man hinter dem bläulichen Dunst des Frühlingstages in der Ferne die Brooklyn-Brücke und dahinter das Häusermeer der New Yorker Stadtteile Brooklyn und Queens sehen.
Mort Milo hatte, während er sprach, Easton mit eindringlichem, sorgfältig prüfendem Blick gemustert. Milo war ebenfalls amerikanischer UNO-Diplomat – ein hochgewachsener Mann, der nur Vierhundert-Dollar-Anzüge trug, schlank, gutaussehend, mit leicht ergrauten Schläfen und sehr reich. Aber trotz aller Vorzüge war er ein Mann, in dessen Nähe es andere Menschen selten lange aushielten. Vielleicht war das seltsam spöttische Lächeln um seine Mundwinkel schuld daran – ein Lächeln, das nur allzu deutlich erkennen ließ, wie geringschätzig Milo über die Menschen im allgemeinen dachte. Er selbst machte sich nichts aus der Abneigung, die ihm von anderen entgegengebracht wurde. Ihm schien nur an einigen wenigen Menschen – darunter Matt Easton – etwas zu liegen.
»Du scheinst deine Scheidung von Elizabeth noch immer nicht überwunden zu haben«, fuhr Milo fort. »Außerdem heißt es, daß du in letzter Zeit bei Börsenspekulationen etliche schwere Verluste hast hinnehmen müssen. Vielleicht kann ich dir mit Börsentips oder, wenn dir das lieber ist, mit Bargeld unter die Arme greifen.«
»Sehr freundlich von dir, Mort«, sagte Matt Easton. »Ich weiß, daß ich wie ein kranker Mann aussehe. Schließlich rasiere ich mich jeden Morgen vor dem Spiegel. Vielleicht bin ich wirklich krank. Aber wenn das so ist, hat es bestimmt nichts mit Geld zu tun. Dann handelt es sich um eine Krankheit, die weder durch einen Scheck über ein paar tausend Dollar noch durch einen chirurgischen Eingriff zu beseitigen ist.«
Er verstummte erschrocken, denn plötzlich wurde ihm klar, daß er bereits mehr gesagt hatte, als er eigentlich sagen wollte und durfte. Milo schien Eastons Gedanken zu erraten.
»Ich bin dein Freund, vergiß das nicht«, entgegnete er. »Was immer du mir anvertraust, wird – wenn du es verlangst – eine Sache zwischen dir und mir bleiben.«
Aus einem jähen Impuls heraus entschloß sich Matt Easton, Milo die Wahrheit zu sagen. Die Last der Angst, die ihn bedrückte, war so groß, daß er sie mit einem anderen Menschen teilen wollte. Und seit Elizabeth sich von ihm getrennt hatte, war Milo der einzige Mensch, in seiner Umgebung, dem er genügend Vertrauen entgegenbrachte, um ihm von seinem schrecklichen Verdacht zu erzählen, daß er an der Schwelle zum Wahnsinn stand.
Sie hatten inzwischen die Tür zu Mort Milos Büro erreicht. Milo öffnete sie, und beide Männer traten ein. Easton ließ sich in einen Sessel sinken. Seine Hände zitterten, als er sich eine Zigarette anzündete. Aber das war ihm nicht neu; seine Hände zitterten schon seit Wochen bei allem, was er tat. Mort Milo ließ die Tür hinter sich ins Schloß fallen.
»Also, erzähle!« forderte er Easton auf. »Ich habe den Eindruck, daß du mir mehr zu sagen hast, als du dir bisher hast entlocken lassen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie hilfreich es sein kann, sich auszusprechen. Vielleicht kann ich dir doch helfen.«
Und Matt Easton erzählte von jenen dunklen Dingen, von denen er geglaubt hatte, sie keinem Menschen anvertrauen zu können. Milo stand hinter ihm an den Türrahmen gelehnt, so daß Easton ihn nicht sehen konnte. Das machte ihm das Sprechen leichter, als wenn er Mort Milo dabei in die Augen hätte schauen müssen. Als er geendet hatte, drückte er den Zigarettenstummel im Aschenbecher auf dem mit schwarzem Mosaik eingelegten Tisch aus. Es herrschte ein kurzes unheilschwangeres Schweigen zwischen den beiden Männern.
»Ich glaube, du hast einen psychischen Schock erlitten. Kein Wunder nach allem, was du im Lauf des letzten Jahres durchgemacht hast!« sagte Milo schließlich. Er ging zu seinem Schreibtisch und blieb mit dem Rücken zu Matt Easton stehen. »Träume sind seelische Spiegelungen unserer unbewußten Ängste. Wenn unsere Träume nicht mehr in Ordnung sind, ist auch unser Gemüt nicht mehr in Ordnung. Du solltest mit einem Psychiater darüber sprechen, Matthew. Ich bin sicher, er könnte dir helfen. Viele Menschen leiden heute unter – werde nicht zornig, wenn ich die Dinge beim Namen nenne! – solchen schizophrenen Wahnvorstellungen.«
Er drehte sich mit einem Ruck um und sah Matt Easton mit einem seltsamen Ausdruck in seinen dunklen Augen an.
»Ich kann verstehen, daß du Wert darauf legst, daß die Geschichte, die du mir erzählt hast, nicht allgemein bekannt wird«, fuhr er fort. »Aber zufällig kenne ich einen Psychiater, auf dessen absolute Verschwiegenheit auch du zählen könntest. Selbst wenn dir das seltsam erscheint: Auch ich lasse mich ab und zu von einem Psychiater analysieren. Der Druck des modernen Lebens lastet auf jedem einzelnen Menschen, Matthew. Wir alle haben Hilfe nötig, weil wir jeden Tag aufs neue unser inneres Gleichgewicht zu verlieren drohen. In den meisten Fällen von psychischen Störungen handelt es sich um Leute, die unter schwerem seelischem Druck stehen. Ein guter Psychiater hätte vielen von ihnen helfen können, wenn sie nur seine Hilfe gesucht hätten, ehe sie den Verstand verloren. Wenn man bei sich selbst Anzeichen entdeckt, die auf eine beginnende Schizophrenie hindeuten, sollte man nicht zögern, sich helfen zu lassen. Ich war schon einmal in einer ähnlichen Lage wie du, Matthew. Ein Freund – ich will seinen Namen nicht nennen, aber er bekleidet ein hohes Regierungsamt in Washington – schickte mich zu seinem eigenen Psychiater, und der half mir. Ich wurde ein ganz neuer Mensch. Ich verfüge heute über eine Macht, die du dir kaum vorstellen kannst. Ich habe alles erreicht, was ich mir im Leben gewünscht habe: Reichtum, Ansehen, Macht. Das Geheimnis des Erfolges beruht nur auf unserer Einstellung zu den Dingen des Lebens. Die ganze Welt liegt dir zu Füßen, wenn du nur …«
Mort Milo brach mitten im Satz ab und schüttelte den Kopf, den Anflug eines eigentümlichen Lächelns um die Lippen.