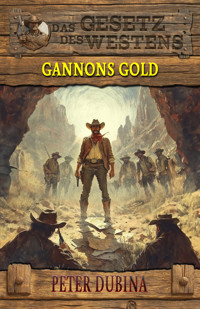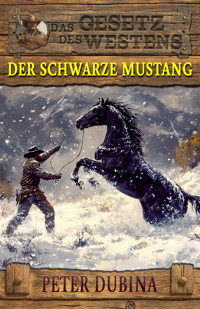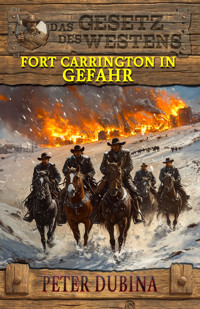2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EK-2 Publishing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Rauchende Colts und echte Männer! Entdecken Sie jetzt die historische Western-Reihe „Das Gesetz des Westens“
Klappentext: Ein vergrabener Silberschatz im Apachenland – der Traum vom schnellen Reichtum vereint Abenteurer, Desperados und eine Frau, die für ihr Volk kämpfen will. Doch für jeden in dieser Gruppe bedeutet der Schatz etwas anderes, und keiner ist bereit, kampflos aufzugeben. Wenn die Gier die Oberhand gewinnt, bleibt nur eine Frage: Wer wird am Ende das Leben – und das Silber – in den Händen halten?
Über die Reihe Das Gesetz des Westens: Freuen Sie sich regelmäßig auf die spannendsten Western-Abenteuer diesseits des Mississippi! EK-2 Publishing hat für „Das Gesetz des Westens“ die ganz großen Koryphäen des Western-Genres versammelt. Alfred Wallon, Peter Dubina und viele weitere Autoren katapultieren sie direkt ins Geschehen und bescheren Ihnen ein unvergessliches Leseerlebnis.
Laden Sie Ihren Revolver und satteln Sie Ihren Hengst, denn es geht auf eine spannende Reise in den rauen Wilden Westen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Peter Dubina
Blutiges Silber
Historische Western-Reihe „Das Gesetz des Westens“
EK-2 Militär
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Liebe Leser, liebe Leserinnen,
zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein kleines Familienunternehmen aus Duisburg und freuen uns riesig über jeden einzelnen Verkauf!
Mit unserem Label EK-2 Militär möchten wir militärische und militärgeschichtliche, sowie historische Themen sichtbarer machen und Leserinnen und Leser begeistern.
Vor allem aber möchten wir, dass jedes unserer Bücher Ihnen ein einzigartiges und erfreuliches Leseerlebnis bietet. Daher liegt uns Ihre Meinung ganz besonders am Herzen!
Wir freuen uns über Ihr Feedback zu unserem Buch. Haben Sie Anmerkungen? Kritik? Bitte lassen Sie es uns wissen. Ihre Rückmeldung ist wertvoll für uns, damit wir in Zukunft noch bessere Bücher für Sie machen können.
Schreiben Sie uns: [email protected]
Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!
Ihr Team von EK-2 Publishing
Blutiges Silber
von Peter Dubina
T
om Kelso kauerte reglos im Schatten eines mannshohen Felsblocks. Der lag am Fuß einer schräg ansteigenden Felsklippe, die aus dem Hügelrücken hervorstand, ihn um mehrere Meter überragend. Von dem Hügel aus konnte Kelso das Tal des Gila River und die Furt, die durch den Fluss führte, durch das Visier seiner Winchester überblicken. Die Wüstenluft flimmerte vor Hitze. Kelsos Hände, die das Gewehr im Anschlag hielten, waren nass von Schweiß. Sogar der Finger am Abzugshahn war so feucht, dass er keinen Halt am Stahl fand und immer wieder nach unten rutschte. Trotzdem wagte Kelso nicht, den Griff zu wechseln. Er wusste, dass er in dem von Licht und Schatten gesprenkelten Felsgewirr auf dem Hügel kaum zu sehen war, solange er sich ruhig verhielt. Aber die geringste Bewegung konnte die Aufmerksamkeit der Apachen auf ihn lenken, und das hätte für ihn den sicheren Tod bedeutet.
Kelso war ein hochgewachsener Mann, breitschultrig, mit schmalen Hüften. Sein unrasiertes, schweißüberströmtes Gesicht mit den scharfblickenden Augen wurde von einem alten Armeehut beschattet. Sonst war Kelso ganz in Leder gekleidet, das über der Brust verschnürte Hemd mit Fransen geschmückt. Zu der abgewetzten Hose trug er statt Stiefel kniehohe Apachenmokassins, deren Schäfte mit Riemen umwunden waren. Tief an seiner rechten Hüfte war ein Armeecolt mit Holzgriff festgeschnallt. Die Patronen in den Schlaufen seines Revolvergurts blinkten stumpf unter einer dünnen Staubschicht. Und Staub lag auch in jeder Falte von Kelsos Kleidung, klebte an den durchgeschwitzten Stellen. Zwischen Kelsos Schultern, wo Schweiß und Staub beinahe unerträglich auf der Haut juckten und brannten, hing in einer Büffellederscheide ein Bowiemesser mit breiter Klinge, das er unter dem Hemd an einem Riemen um den Hals trug.
In seinem Verhalten glich Kelso mehr einem Apachen als einem Weißen. Er war vorsichtig in allem, was er sagte und tat. Kein Draufgänger, denn die starben meistens jung. Er hatte mehr als einen von ihnen begraben helfen. Das wilde Land hatte Kelso zu dem gemacht, was er war: Ein harter Kämpfer, der prüfte und abwog, bevor er sich zum Handeln entschloss.
Deshalb kauerte er schon seit einer Viertelstunde in derselben Haltung, obwohl seine verkrampften Muskeln schmerzten. Vor einer Viertelstunde hatte ihm das Verhalten der Bussarde, die bisher hoch über ihm ruhig ihre Kreise gezogen hatten, verraten, dass Menschen in der Nähe waren, und es musste eine größere Anzahl von Menschen sein. Der einsame Reiter hatte die Raubvögel nicht gestört, doch plötzlich hatten sie die Flucht ergriffen und sich mit schwerfälligen Flügelschlägen nordwärts bewegt.
Kelso hatte ihnen aus zusammengekniffenen Lidern nachgeblickt, wie sie in der Weite des Himmels verschwunden waren, der blau wie ein Türkis war. Dann hatte er sich in den Steigbügeln aufgerichtet und umgeschaut. Die messingfarbene Wüste ringsum schien leer. Aber hier im südlichen Arizona, unweit der Grenze zu Mexiko, durfte ein Mann sich keinen Moment sicher fühlen, wenn er nicht den Finger am Abzugshahn seiner Waffe hatte – und oft nicht einmal dann. Der Tod konnte ihm unversehens und in vielerlei Gestalt begegnen: Eine Klapperschlange, vergiftetes Wasser, ein Fehltritt seines Pferdes in unwegsamem Gelände. Das schlimmste aber waren die Apachen.
Am Biss einer Klapperschlange starb ein Mensch ohne allzu große Qualen. Kelso hatte es mehr als einmal mit ansehen müssen. Manchmal war es in Minuten vorbei. Schaum rann aus den Mundwinkeln des Sterbenden, die Hände griffen blindlings ins Leere, der Herzschlag stockte, die Augen brachen – es war aus. Ein rasches Ende für den Unglücklichen.
Doch Kelso hatte auch schon Männer – besser gesagt, die Überreste von Männern – gesehen, die den Apachen lebend in die Hände gefallen waren. Sie waren nicht so schnell und verhältnismäßig gnädig gestorben. Jedes Mal, wenn er einem dieser Toten in das verzerrte, erstarrte Gesicht geblickt hatte, war er froh gewesen, dass er die Schreie nicht hatte mit anhören müssen, die der Mann ausgestoßen hatte, bevor es mit ihm zu Ende gegangen war.
Als Armeekundschafter in Fort Grant kannte Kelso die Apachen und ihre Grausamkeit besser als die meisten Weißen im Arizona-Territorium und hatte deshalb allen Grund, sie zu fürchten. Er wusste, dass die Apachenbande, deren Spuren er seit drei Tagen bis an die Furt des Gila River gefolgt war, sich irgendwo zwischen den Sierrita-Bergen im Norden und der mexikanischen Grenze im Süden aufgehalten hatte, als er aufgebrochen war, um das Versteck der Horde ausfindig zu machen, damit die Armee die Indianer in die Reservation zurücktreiben oder vernichten konnte. Seine Hoffnung war gewesen, dass die fünfzig Krieger starke Bande, die unter ihrem Anführer Chato aus der weiter nördlich gelegenen San Carlos-Indianerreservation entflohen war und eine Feuer- und Blutspur von fünfzig Meilen Länge durch das Land gezogen hatte, bereits über die Grenze nach Mexiko entkommen wäre, ehe er auf Schussweite an sie hätte herankommen können.
Aufgrund eines Regierungsvertrags zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten durften US-Angehörige und dazu zählte Kelso – die Grenze nicht in südlicher Richtung überschreiten. Eine schnelle Flucht der Apachen hätte Kelso deshalb der Notwendigkeit enthoben, die Verfolgung fortzusetzen. Aber nun hatte er das deutliche Gefühl, dass er sich in unmittelbarer Nähe der Horde befand.
Kelsos Pferd stand zwischen Felsblöcken am Fuß des Abhangs hinter ihm. Er konnte nur hoffen, dass es nicht schnaubte oder mit einem Huf scharrte, denn in der Stille trugen Geräusche weit. Eine andere Gefahr bestand darin, dass der heiße Wüstenwind Kelso von rückwärts traf und seinen Geruch über den Fluss in die Nüstern von Indianerpferden am anderen Ufer tragen und ihn so verraten konnte. Denn die Hitze kochte eine Wolke von Dünsten über dem Mann aus: Beißenden Schweiß und feuchtes Leder, ungewaschene Haare, ungewaschene Haut und selbst den Messinggeruch der Patronen in seinem Waffengurt.
Mitten in seine Gedanken hinein peitschten Schüsse jenseits des Flusses. Dann ertönte fernes, rasendes Hufgetrappel. Aber noch war nichts zu sehen. Kelso versuchte, mit dem schweißglatten Finger einen festen Druckpunkt am Abzugshahn seiner Winchester zu finden.
Plötzlich tauchte zwischen den Hügeln am anderen Ufer des Gila ein Reiter auf. Ein Weißer. Selbst auf die Entfernung von fast dreihundert Yards erkannte Kelso, dass das Pferd des Mannes am Ende seiner Kräfte war. Es galoppierte in kurzen, steifbeinigen Sprüngen, wobei es den Hals fast waagerecht hielt. Sein braunes Fell war an Brust, Hals und Flanken weiß von schaumigem Schweiß. Der Reiter trieb es dennoch erbarmungslos mit den Sporen an, wie nur ein Mann es tut, dem die Todesangst im Nacken sitzt. Er hielt die Zügel in der Linken, den Colt in der Rechten.
Und dann sah Kelso aus der Staubwolke, die das Pferd des Flüchtenden aufwirbelte, die Verfolger auftauchen. Durch das hochgeklappte Winchester Visier unterschied er vier Apachen: Halbnackte erdbraune Gestalten auf scheckigen Pferden, in deren Mähnen und Schweife Federn geflochten waren. Zwei der mit weißer Farbe bemalten Krieger waren mit Spencer-Repetiergewehren bewaffnet, die anderen trugen Bogen.
Kelso krümmte den Finger um den Abzugshahn, aber er zog ihn nicht durch. Die Entfernung war noch zu groß für einen sicheren Schuss. Außerdem wusste er nicht, ob den vier Apachen noch weitere folgen würden. In diesem Fall hätte er nicht in den Kampf eingegriffen. Er kannte den Verfolgten nicht und sah keine Veranlassung, sein Leben für einen Fremden in einem aussichtslosen Kampf aufs Spiel zu setzen.
Der Flüchtende drehte sich im Sattel um und jagte den Apachen heißes Blei aus seinem Colt entgegen. Einer der Indianer warf die Arme hoch und stürzte seitwärts vom Pferd. Doch schon im nächsten Moment hatte der Verfolger genug damit zu tun, sich im Sattel zu halten, denn sein Brauner hatte nun den Fluss erreicht und kämpfte sich in hohen, krampfhaften Sprüngen durch das schäumende lehmgelbe Wasser auf das Ufer zu, an dem Kelso in Deckung lag.
Die Flut reichte dem Tier bis an die Brust. Erhitzt und ausgepumpt, wie es war, ließ das kalte Wasser seine Muskeln erstarren. Trotzdem erreichte es fast – aber doch nur fast – das rettende Ufer. Gerade als es die Vorderhufe auf trockenen Boden setzte, hob jenseits des Flusses einer der Apachen sein Repetiergewehr, zielte kurz und drückte ab. Der Schuss peitschte. Das Pferd des Flüchtenden bäumte sich mit schrillem, durchdringendem Wiehern auf. Seine Vorderhufe schlugen wie Halt suchend durch die Luft, dann stürzte das Her, noch bevor der Reiter seine Füße aus den Steigbügeln ziehen konnte, schwer auf die Seite und blieb, halb auf dem trockenen Ufer, halb im Wasser, liegen.
Der Reiter geriet mit einem Bein unter das Pferd und saß fest. Von den Hüften abwärts lag er im Fluss. Bei dem schweren Sturz war ihm der Colt entglitten. Der Mann streckte sich vergeblich, um die Waffe zu erreichen. Dann stemmte er beide Hände gegen den Sattel und versuchte, sein Bein unter dem toten Pferd hervorzuziehen. Auch das gelang ihm nicht.
Kelso nahm, als er sah, dass den vier Apachen keine weiteren folgten, mit der Gelassenheit des erfahrenen Kämpfers einen der mit Repetiergewehren bewaffneten Indianer am jenseitigen Ufer aufs Korn. Ein Knall – der Krieger reckte sich hoch auf und rutschte dann an der Flanke seines Pferdes zu Boden. Aber keiner der nächsten fünf Schüsse Kelsos traf. Dann war das Magazin der Winchester leer. Als die beiden letzten Apachen hörten, dass Kelso sein Schießen eingestellt hatte, trieb einer von ihnen, der einen Bogen trug, sein Pferd in den Fluss.
Mit zusammengebissenen Zähnen, lautlos vor sich hin fluchend, zerrte Kelso neue Patronen aus den Schlaufen seines Waffengurts und lud die Winchester. Doch so schnell er auch war, der Indianer war schneller. Gerade als Kelso die letzte Patrone ins Magazin schob, war der Krieger bei dem Verfolgten angelangt, der noch immer sein unter dem toten Pferd eingeklemmtes Bein zu befreien versuchte. Der Apache hielt einen Pfeil auf der Sehne und spannte den Bogen. Der Weiße machte eine letzte, verzweifelte Anstrengung, den ihm entfallenen Colt mit der rechten Hand zu erreichen.
In dem Augenblick, als Kelso seine Winchester durchlud und den Apachen ins Visier nahm, hörte er das »Twang« der Bogensehne und das »Sssud«, mit dem das befiederte Geschoss sein Ziel traf. Um einen Sekundenbruchteil zu spät krümmte Tom den Finger am Abzugshahn. Seine Kugel riss den Indianer vom Pferd. Der Krieger trieb im Wasser, das sich rot färbte. Sein Kopf versank, die Beine kamen hoch, wurden von der Strömung erfasst und gegen das Ufer gedrückt.
Der letzte Apache schüttelte wütend sein Spencer-Repetiergewehr gegen Kelso und schrie ihm mit hasserfüllter Stimme ein paar Worte zu. Dann riss er sein Pferd herum und trieb es zu gestrecktem Galopp an, um in den Schutz der Hügel zu gelangen. Kelso wusste, dass er ihn nicht entkommen lassen durfte, wenn er nicht in kurzer Zeit die ganze Apachenhorde auf dem Hals haben wollte.
Der Schuss auf ein sich schnell bewegendes Ziel war auf so große Entfernung schwierig. Kelso lehnte die linke Schulter und den linken Arm gegen den Felsblock, in dessen Schatten er kauerte, um jedes Zittern des Winchesterlaufes zu vermeiden, zielte lange und sorgfältig und krümmte behutsam den Zeigefinger um den Abzugshahn. Der Schuss peitschte. Pferd und Reiter stürzten in einer Staubwolke zu Boden, und nur das Pferd kam wieder auf die Beine.
Kelso lud seine Winchester durch und wartete angespannt. Doch keiner der vier Apachen bewegte sich mehr. Da erhob er sich aus seiner Deckung und ging, die Waffe im Hüftanschlag, zum Flussufer hinunter. Wo der Weiße, sein Pferd und der Indianer lagen, war das Wasser blutig. Die Wellen führten einen breiten roten Streifen flussabwärts.
Als Kelso sich über den Weißen beugte, sah er auf den ersten Blick, dass jede Hilfe für den Mann zu spät kam. Der Pfeil des Apachen hatte ihn unter dem rechten Schulterblatt in den Rücken getroffen, als er sich nach dem Colt gereckt hatte, der außerhalb seiner Reichweite lag. Das befiederte Geschoss stak in der Lunge. Der Mann krümmte sich, rang um Atem, und hellrotes schaumiges Blut rann aus seinen Mundwinkeln. Kelso schob einen Arm unter den Nacken des Verwundeten und hob dessen Kopf etwas höher, um ihm das Atmen – und das Sterben – zu erleichtern.
Den Pfeil herauszuziehen, hätte keinen Sinn gehabt. Die Eisenspitze hätte die Lunge nur noch mehr zerrissen, und der Mann wäre an seinem eigenen Blut erstickt.
»Ich kann Ihnen nicht helfen«, sagte Kelso zu dem Sterbenden. »Nennen Sie mir Ihren Namen, und ich werde dafür sorgen, dass er auf Ihrem Grabkreuz steht. Soll ich jemand von Ihrem Tod verständigen?«
Der Mann sah aus glanzlosen Augen zu ihm auf, in denen kaum noch Leben war. Mit einer Hand tastete er nach seinem Revolvergurt, zog eine Patrone aus der Schlaufe und hielt sie dicht vor Kelsos Gesicht. Seine Lippen bewegten sich, aber seine Stimme klang so leise, dass Kelso sich tief über ihn beugen musste, um die Worte zu verstehen:
»Russell … Gail Russel… Hog-Town … Fort Grant … Sie wird Ihnen – eine Belohnung zahlen … hohe Belohnung … Russell … Gail Russell … Nehmen Sie!« Dann: »Alle meine Männer – von den Apachen getötet. Sie liegen den Weg entlang, den wir nahmen. Sagen Sie Gail, ich liebe sie … Ich vergebe ihr alles. Ich wollte sie, immer nur sie. Es ist schwer, eine schöne Frau festzuhalten …«
Kelso nahm die Patrone aus der Hand des Sterbenden. Der Mann sprach weiter, aber seine Stimme wurde immer schwächer, ertrank zeitweise in einem Gurgeln. Immer mehr Blut rann aus seinem Mund.
»Geben Sie mir … Revolver. Ich will nicht – qualvoll ersticken, so wie einer in der – in der Henkerschlinge am Galgen. Die Waffe – die Waffe … «
Kelso sah keinen Grund, dem Mann seine letzte Bitte nicht zu erfüllen. Wenn ein Sterbender den schnellen, gnädigen Tod von eigener Hand einem qualvollen Ende vorzog, musste man ihm helfen. Kelso ließ den Mann zu Boden gleiten, stand auf und holte den Colt, der dem Fremden entfallen war. Er drehte die Revolvertrommel. In fünf Kammern waren leere Hülsen, nur in der sechsten war eine vollständige Patrone. Kelso drehte die Trommel weiter, bis die letzte Patrone links vom Revolverhahn saß. Dann legte er die Waffe in die rechte Hand des Fremden.
»Es bleibt Ihnen nicht viel Zeit zu tun, was Sie tun wollen«, sagte er. »Ich gehe jetzt, um eines der Indianerpferde einzufangen.«
Er wusste, dass er dieses Gebiet so schnell wie möglich verlassen musste. Wahrscheinlich tauchte Chatos Apachenbande an der Furt durch den Gila River auf, wenn sie lange genug auf die Rückkehr der vier Krieger gewartet hatte, die tot auf dieser und der anderen Seite des Flusses lagen. Das Pferd des Indianers, der als einziger das diesseitige Ufer des Gila erreicht hatte, stand fünfzig Yards flussabwärts! Kelso ging langsam, im Apachendialekt redend, auf das Tier zu. Er würde es brauchen, um den Toten nach Fort Grant zu schaffen. Ihn auf seinem eigenen Pferd hinter dem Sattel festzubinden, hatte er wenig Lust.
In der Wüstenhitze begann ein Toter schnell zu riechen. Auch die Apachen warteten nicht länger als ein paar Stunden, bestenfalls eine Nacht, die in der Wüste sehr kalt war, bevor sie ihre Toten begruben.
Das Indianerpferd schnaubte und wich vor Kelso zurück. Aber mit raschem Griff packte er es am Zügel. In derselben Sekunde fiel hinter ihm ein Revolverschuss.
Langsamen Schrittes kehrte Kelso zu dem Weißen zurück. Der Mann hatte sich in die rechte Schläfe geschossen. Die eine Gesichtshälfte war von Pulverrauch geschwärzt. Die Hand, die den Revolver hielt, war ausgestreckt. Ein letztes Zittern ging durch den Arm, dann war der Mann tot.
Kelso blickte auf ihn nieder, dann zog er die Patrone, die der andere ihm gegeben hatte, aus der Tasche und drehte sie zwischen den Fingern. Es war eine 45-70er Patrone, wie sie in den Infanteriegewehren der US-Armee Verwendung fand. Im Sattelschuh des Toten stak aber eine Winchester. Das war seltsam. Eine Infanteriepatrone passte weder nach dem Kaliber noch nach der Länge der Hülse in die Kammer einer Winchester.
Kelso wog die Patrone in der Hand. Sie schien ihm eine Kleinigkeit zu leicht zu sein. Er nahm das Bleigeschoss zwischen die Zähne und zog daran. Es löste sich aus der Messinghülse. Er drehte sie um, aber es rieselte kein Schwarzpulver heraus. Er warf einen Blick hinein. In der Patronenhülse stak ein fest zusammengerolltes Stück Papier. Mit der Messerspitze zog Kelso es heraus. Eine leere Patrone ist ein gutes Versteck für eine schriftliche Mitteilung, dachte er, denn meistens saß die Bleikugel so genau in der Hülse, dass weder Wässer, Schweiß noch Blut eindringen und das Geschriebene unleserlich machen konnten.
Er schob das Messer wieder in die Nackenscheide und rollte das Papier auseinander. Eine Zeichnung war offensichtlich hastig darauf gekritzelt: Zwei Dreiecke, von denen das eine an der rechten Seite ein Horn zu tragen schien, vor den Dreiecken ein unten offenes Rechteck, über dem ein Kreuz stand. Darunter war ein Kreis zu sehen, der von einer horizontalen Wellenlinie in zwei Hälften geteilt wurde. Ganz unten, am Rand des Papiers, standen ein paar Worte.
»Zwanzig Maultierladungen«, entzifferte Kelso.
Er schob den Zettel in die Tasche, warf die leere Patronenhülse weg und machte sich daran, den Toten zu durchsuchen. Aber er fand nichts bei ihm außer einem Brief, den das Flusswasser und das Blut völlig unleserlich gemacht hatten. Nur die Anschrift war noch zu entziffern. Das Schreiben war an einen Mann namens John Russell in Flaggstaff, Arizona, gerichtet. Vielleicht war das der Name des Toten.
Kelso steckte auch den Brief ein. Dann öffnete er die Satteltasche des Mannes, die nicht unter dem Pferdekadaver eingeklemmt war. Als er die Hand hineinschob, fühlte er darin etwas Schweres, Hartes. Er zog es heraus. Es war in ein Stück Tuch eingewickelt, und als er dessen Enden auseinanderschlug, kam unwillkürlich ein leiser Pfiff über seine Lippen.
Vor ihm lag ein Silberbarren hundert bis hundertfünfzig Unzen schwer, schätzte Kelso. Er musste sehr alt sein, denn die Oberfläche war stellenweise schwärzlich verfärbt. Aber es war gediegenes Silber, daran konnte kein Zweifel bestehen. Der Barren trug auch eine Prägung: S.d.J. und darunter A.D. 1766.
Die drei ersten Buchstaben sagten Kelso nichts, und es war auch nicht der rechte Moment, sich Gedanken darüber zu machen. Denn als er von dem Silberbarren aufblickte – ab und zu innezuhalten und sich sichernd umzuschauen, war eine Gewohnheit, die er von Apachen und verfolgten Wölfen übernommen hatte – sah er von einem Hügel jenseits des Flusses eine dünne graue Rauchsäule in die heiße Luft steigen. Es waren also doch mehr als vier Apachen am anderen Ufer des Gila gewesen. Mindestens einen davon hatte Kelso nicht zu Gesicht bekommen.
Kelso begriff, dass er nicht länger zögern durfte, wenn er mit dem Leben davonkommen wollte. Er wickelte den Silberbarren wieder in das Tuch und schob ihn unter sein Lederhemd. Darin hob er mit großer Anstrengung den schlaffen Körper des Toten auf den Rücken des unruhigen Indianerpferdes.
Er griff nach seiner Winchester, nahm das Tier beim Zügel und führte es rasch um den Hügel herum zu der Stelle, wo sein brauner Wallach stand. Dort nahm er das Lasso vom Sattelhorn und band den Toten auf dem Pferderücken so fest, dass er auch bei einem Galopp nicht herunterfallen konnte. Dann schob Tom die Winchester in den Scabbard, zog aus der Satteltasche einen einzelnen Sporn hervor und schnallte ihn über seinen rechten Mokassin. Minuten später jagte er, das Indianerpferd hinter sich herziehend, nach Norden.
*
Die Sonne versank fern im Westen, und die Schatten waren lang, als Tom Kelso die Hog-Town erreichte, eine Siedlung, die im Schutz von Fort Grant entstanden und zu einer kleinen Stadt angewachsen war. Hier gab es Läden, eine Poststation, eine Schmiedewerkstatt, Saloons, ein Hotel, Offiziers- und Mannschaftsbordelle.
Als Kelso am Hotel vorbeiritt, standen auf der überdachten Veranda ein Mann und eine Frau und blickten ihm entgegen. Der Mann hatte ein kantiges bleiches Gesicht mit scharfblickenden, dunklen Augen und einem schwarzen, sichelförmigen Schnurrbart. Er trug einen dunklen städtischen Anzug, dazu eine rote Seidenweste und eine schwarze Samtschleife am Kragen seines weißen Leinenhemds. Seine blankgeputzten Stiefel reichten bis unter die Knie. Das Gesicht war von einem tief in die Stirn gezogenen eleganten, breitkrempigen schwarzen Hut beschattet. Die Rockschöße waren hinter die Beingriffe zweier Colts geschoben, die tief an den Hüften des Mannes festgeschnallt waren.
Die Frau, die neben ihm stand, war die größte Schönheit, der Kelso jemals begegnet war. Ein ausgesprochen irischer Typ – helle Haut, flammend rotes Haar und große grüne Augen. Die starken Brauen und langen Wimpern waren dunkel. Ihr Kleid war von dem gleichen Grün wie ihre Augen. Es war tief ausgeschnitten und ließ den Ansatz ihres Busens erkennen.
Unwillkürlich drehte Kelso sich im Sattel nach ihr um, als er schon an ihr vorbei war. Und da sah er, dass ihr Blick nicht ihm, sondern dem Toten galt, der auf dem Rücken des Indianerpferdes festgebunden war. Sie schlug beide Hände vor den Mund, wie um einen Aufschrei zu ersticken. Der Mann an ihrer Seite fasste mit besitzergreifender Geste nach ihrem Arm und sagte in scharfem Ton etwas zu ihr. Doch Kelso war schon zu weit von den beiden entfernt, um die Worte verstehen zu können.
Er rückte sich im Sattel zurecht und ritt auf das Wachhaus von Fort Grant zu. Der Armeeposten war weder von Palisaden noch von Bastionen umgeben. Offiziers- und Mannschaftsquartiere, Pferdeställe und Magazine gruppierten sich in exakter, militärischer Ordnung um den großen Paradeplatz, über dem die US-Flagge wehte. Neben dem Fahnenmast stand eine Batterie Perrot-Vierundzwanzigpfünder-Kanonen. Fort Grant war der größte Militärposten im Territorium Arizonas. Gegenwärtig lag hier eine Garnison von mehr als fünfhundert Mann Kavallerie und Infanterie.
Vor dem Wachhaus stand ein Gefängniswagen mit Vierergespann. Kelso hatte solche Gefährte schon mehrmals gesehen. Boden und Decke dieser Gefängniszelle auf Rädern bestanden aus starkem Holz. Statt der Wände gab es nur Eisengitter, durch die im Sommer die Sonne erbarmungslos brannte und im Winter der schneidend kalte Wind pfiff. Ein paar zusammengesunkene Gestalten hockten in dem Wägen: Gefangene. Sie waren mit Eisenschellen an Händen und Füßen gefesselt und sicher angekettet. Für einige von ihnen würde dieser furchtbare Weg am Galgen enden, für andere in einer Zelle des Territorialgefängnisses, in der ihr Wille gebrochen und aus der sie schließlich in schlimmerem Zustand entlassen werden würden, als sie eingeliefert wurden. Nach Kelsos Meinung würden die Gefangenen, die zum Tod am Galgen verurteilt wurden, von mehr Glück sagen können. Es schien ihm besser, dass ein Mann getötet, als dass er langsam und qualvoll zerbrochen wurde. Auch in dieser Hinsicht dachte Kelso wie ein Apache, der nur in Freiheit leben und im Gefängnis nur sterben konnte.
Auf dem Wagenbock saß ein US-Deputy Marshal, eine Winchester über den Knien. Vor der Tür des Wachhauses standen zwei Männer. Einer war der Provost-Marshal von Fort Grant, ein First-Sergeant namens Cummings. Der andere – bullig, untersetzt, mit kurzem Hals und breiten Schultern – trug den Stern eines US-Marshals an der Lederweste.
Sein Revolvergurt, die Stiefel und seine Hutkrempe waren staubbedeckt. Er hatte ein hartes, breites Gesicht, verschlagene Augen und einen grausamen Zug um die Mundwinkel. Tom war solchen Leuten oft genug begegnet, um einen von ihnen sofort als einen Mann zu erkennen, dem es Freude bereitete, andere Menschen zu quälen. Für seine Aufgabe, Gefangene vor den Richter und an den Galgen zu bringen, war er sicher gut geeignet.
»Wen bringen Sie denn da, Kelso?«, fragte Sergeant Cummings mürrisch.
»Einen Mann, der am Gila River Chatos Apachenbande in die Hände gefallen ist.«
Cummings trat auf das Indianerpferd zu, das Kelso am Zügel führte, und wollte dem darauf festgebundenen Toten den Kopf heben, um ihm ins Gesicht zu sehen. Doch er wich gleich darauf wieder angeekelt zurück.
»Der Mann stinkt ja schon, Kelso«, sagte er. »Warum, zum Teufel, haben Sie nicht Ihre Decke über ihn gebreitet, um ihn vor der Sonne zu schützen?«
»Weil dann meine Schlafdecke jetzt genauso stinken würde wie der Tote«, antwortete Kelso. »Ich könnte sie nur noch wegwerfen, und die Armee würde sie mir bestimmt nicht ersetzen.«
»Wer ist der Mann?«, fragte der First-Sergeant.
Kelso zuckte mit den Schultern, dann reichte er Cummings die Zügel des Indianerpferdes.
»Jetzt gehört er Ihnen, und Sie können mit ihm machen, was Sie wollen«, sagte er. Er zog seinen Braunen herum und wollte weiter reiten, doch der US-Marshal trat auf ihn zu und hielt den Wallach am Zügel fest.
»Mein Name ist Quincannon. Ich bin Marshal der Vereinigten Staaten und mit ein paar Gefangenen unterwegs nach Safford. Besteht die Gefahr, dass wir auf dem Weg nach Norden auf Apachen treffen?«
»Nein. Sie können Ihre Gefangenen wohlbehalten bis unter den Galgen fahren. Chatos Bande hält sich weit unten im Süden auf, nahe der mexikanischen Grenze.«
Kelso setzte seinem Pferd die Sporen an, so dass der Marshal die Zügel loslassen musste, und ritt im Schritt davon.
»Ein ziemlich arroganter Bursche«, hörte er Quincannon hinter seinem Rücken sagen. »Ich wollte, er säße angekettet in meinem Gefängniswagen, dort würde ich ihm seinen Hochmut schon mit dem harten Ende des Peitschenstiels austreiben.«
»Dieser Kelso ist stolz und hochfahrend wie die meisten ehemaligen Südstaatenrebellen. Er und seinesgleichen können bis heute nicht vergessen, dass sie den Bürgerkrieg gegen die Union der Nordstaaten verloren haben. Zwar arbeitet er jetzt für dieselbe Armee, die er damals bekämpfte, aber Freundschaft empfindet er nicht für uns. Einmal ein Rebell, immer ein Rebell«, behauptete der First-Sergeant.
*
»Chatos Apachenbande hielt sich – zumindest bis gestern – in der Nähe des Gila River auf, Sir«, erklärte Tom Kelso und umriss mit einer Handbewegung das angesprochene Gebiet auf der Generalstabskarte, die an der Wand des Quartiers von Lieutenant-Colonel Merrill hing. Eine Petroleumlampe, die daneben auf dem Kaminsims stand, warf ihren gelben Lichtschein auf die Karte.
»Es könnte allerdings sein«, fuhr Kelso fort, »dass Chato, da er sich entdeckt weiß, dieses Gebiet nicht mehr für sicher hält und über die mexikanische Grenze nach Süden flieht, wohin die Armee ihm nicht folgen würde.«
»Was, glauben Sie, wird er tun?«, fragte der grauhaarige Kommandant von Fort Grant.
Kelso zuckte mit den Schultern.
»Es ist schwer vorauszusagen, was ein Apache in der nächsten Minute, Stunde oder am nächsten Tag tun wird. Apachen sind wie Wölfe. Sie wandern ruhelos umher, immer auf der Suche nach Beute, immer begierig nach Blut. Sie kommen und gehen wie der Wind – ein Todeswind. Wenn Sie Chatos Bande am Überschreiten der Grenze hindern wollen, müssen Sie Ihre ganze Kavallerie ausschicken, und das möglichst schnell. Sonst entschlüpfen Ihnen die aufständischen Apachen wie Wasser durch die Finger einer zugreifenden Hand rinnt.«
»Ich kann zwei Schwadronen unter Captain Benteen nach Süden schicken«, entgegnete Merrill. »Die müssten ausreichen, Chatos Bande zu zerschlagen, wenn ein erfahrener Armeekundschafter sie unbemerkt in die Nähe der Apachen führt. Ich möchte, dass Sie diese Aufgabe übernehmen, Kelso.«
»Tut mir leid, Sir. Aber diesen Auftrag kann ich nicht übernehmen. Ab sofort arbeite ich nicht mehr für die Armee. Ich habe die aufständischen Apachen für Sie ausfindig gemacht, aber das war die letzte Aufgabe, die ich für Sie erledigt habe.«
»Wollen Sie den Befehl verweigern?«, fragte Merrill mit einem scharfen Unterton in der Stimme.
»Sir, ich unterstehe ab sofort nicht mehr Ihrem Befehl noch dem Befehl irgendeines anderen Offiziers dieser Armee. Ich bin Zivilkundschafter. Sie haben mir von Zeit zu Zeit Aufträge erteilt und mich für deren Ausführung bezahlt. Nur wenn ich Ihre Aufträge annahm, gehörte ich zur Armee und musste Ihre Befehle ausführen. Sie wissen, dass es mir freisteht, Aufträge abzulehnen. Und von nun an nehme ich keine Anweisungen von der US-Armee mehr entgegen.«
Lieutenant-Colonel Merrill trat aus dem Halbdunkel des Raumes in den Lichtkegel der Petroleumlampe. Dicht vor Kelso blieb er stehen und musterte ihn eingehend. Merrill war ein erfahrener Offizier und wusste die Männer unter seinem Kommando richtig einzuschätzen. Obwohl er wusste, dass Kelso wegen seiner unglücklichen Vergangenheit seit dem Ende des Bürgerkriegs kein Freund der US-Armee war, hatte er große Achtung und Vertrauen zu diesem Mann. Noch nie war ihm ein härterer Kämpfer begegnet, ein Mann, der, wenn er eine Sache erwogen und für richtig befunden hatte -sein Leben so aufs Spiel setzte. Kelso suchte den Tod nicht, aber er fürchtete sich auch nicht davor.
Doch die Erinnerung an die Vergangenheit Kelsos, von der nur Gerüchte umliefen, zehrte an diesem Mann wie ein niemals erlöschendes Fieber. Und deshalb schloss er sich alle paar Monate ein und betrank sich bis zur Besinnungslosigkeit. Wenn man ihn dann brauchte, war es oft sehr schwer, ihn wach zu bekommen. Wenn er aber die Augen öffnete, war er sofort vollkommen wach und angespannt. Kampfbereit war das richtige Wort. Kampfbereit wie ein Wolf oder ein Apache – wie jedes gejagte Lebewesen. Manche Menschen wurden von ihren Feinden getrieben, andere von den düsteren Schatten ihrer Erinnerungen. Einer von diesen Ruhelosen war Tom Kelso. Merrill wusste und verstand das.
»Der Bürgerkrieg ist schon lange vorbei, Kelso«, sagte er. »Können Sie noch immer nicht die Vergangenheit vergessen? Was ist damals geschehen, das Ihr Leben so tragisch verändert hat?«
Kelsos Augen funkelten.
»Ich habe alles gesagt, was zu sagen war«, entgegnete er feindselig. »Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, Sir?«
»Natürlich, Kelso. Es steht Ihnen frei, zu gehen und sich wieder einmal bewusstlos zu trinken. Aber glauben Sie mir, es gibt auf der ganzen Welt nicht genug Whisky, dass Sie Ihre Probleme darin ertränken könnten. Sie müssen endlich mit Ihrer eigenen Vergangenheit Frieden schließen, oder Sie enden als Säufer, der sich nicht mehr aufrecht halten kann und auf allen Vieren seiner im Straßenstaub davonrollenden Flasche nach kriecht.
Sie wissen, dass Sie wahrscheinlich das Leben vieler meiner Soldaten retten können, wenn Sie meinen Auftrag annehmen und die Kavallerieschwadronen an die Apachen heranführen. Niemand kennt die Indianer so wie Sie. Schon deshalb, wenn nicht um Ihrer Selbstachtung willen, sollten Sie den letzten Befehl ausführen.«
In Kelsos Gesicht arbeitete es.
»Sir«, erwiderte er mit erzwungener Ruhe, »ich habe bisher Ihre Anordnungen befolgt, obwohl ich Ihre Uniform hasse. Ich habe dafür Ihr Geld genommen, obwohl ich lieber darauf gespuckt hätte. Denn von irgendetwas muss der Mensch leben. Und Whisky ist teuer. Aber von heute an nehme ich nie wieder Befehle von einem Unionsoffizier entgegen. Zum Teufel mit der Unionsarmee.«
Merrill begriff, dass etwas Einschneidendes in Kelsos Leben geschehen war. Dieser Mann würde ihm nie mehr gehorchen. Er machte eine bedauernde Handbewegung.
»Sie waren mein bester Kundschafter, Kelso. Aber wenn ich gewusst hätte, dass Ihr Hass auf die Union so groß ist, dass Sie in Ihrem Herzen noch immer ein Rebell sind, dann hätte ich Ihnen in den Feldzügen der vergangenen Jahre das Leben meiner Soldaten nicht anvertraut.«
»Durch meine Schuld hat keiner Ihrer Männer den Tod gefunden«, entgegnete Kelso. »Ich gehöre nicht zu denen, die sich an Unschuldigen rächen, die sogar Frauen und Kinder morden.«
»Ich habe mir oft Gedanken über Sie gemacht, mich gefragt, was für ein Mensch Sie wohl sein mögen«, entgegnete der Lieutenant-Colonel. »Ich wollte wissen, von welchen Gefühlen Sie bewegt werden. Ich fand keine Antwort darauf. Jetzt haben Sie mich zum ersten Mal, seit wir uns kennen, einen Blick in Ihre Vergangenheit tun lassen.«
Sofort verschloss sich Kelsos Miene. Der alte, schreckliche Schmerz war mit einem Mal wieder da. Durch all die vergangenen Jahre hatte die Erinnerung an das Geschehene nichts von ihren Schrecken verloren. Er konnte Merrill nicht dafür hassen, dass er mit seinen Worten die alte Wunde wieder aufgerissen hatte. Der Lieutenant-Colonel war ein guter Offizier, es gab nicht viele wie ihn in der US-Armee oder irgendeiner anderen Armee auf der Welt. Aber dieses Wissen betäubte den Schmerz nicht. Der verlangte nach einer Flasche Whisky. Und er wollte nicht mehr zu quälen aufhören, bevor nicht der Boden der Flasche trocken war. Aber wenigstens, dachte Kelso, brauche ich nicht länger den Anblick blauer Uniformen ertragen. Am Morgen konnte er das Fort verlassen. Er wollte seinem Schicksalsstern und der Karte aus der leeren Patronenhülse des Toten vom Gila River folgen, wohin dieser Weg ihn auch führen mochte. Doch von der Armee hatte er genug.
»Brauchen Sie mich noch, oder kann ich gehen, Sir?«, fragte er mit rauer Stimme.
»Sie können gehen«, antwortete Merrill. »Aber es wäre besser für Sie, wenn Sie von dieser Stunde an Fort Grant nicht mehr betreten würden.«
»Ich habe nicht die Absicht, das zu tun.«
Tom drehte sich auf dem Absatz um und verließ das Quartier des Lieutenant-Colonels. Toms Mund war trocken, und er hatte einen hässlichen Geschmack auf der Zunge. Draußen band er sein Pferd los, schwang sich in den Sattel und ritt zur Hog-Town zurück. Seit Jahren hatte er eine Flasche Whiskey nicht so dringend gebraucht wie an diesem Abend. Vor dem Saloon »Last Chance«, der rechts und links von seinem Namensschild zwei rote Laternen trug, saß er ab. Der Saloon war gleichzeitig das Offiziersbordell. Einfachen Soldaten und Mannschaftsdienstgraden war der Zutritt verboten. Hier gab es die hübschesten Mädchen in der Hog-Town und den besten, aber auch den teuersten Whisky.
Als Tom durch die Schwingtür trat, sah er, dass nur wenige Gäste anwesend waren. Die Bankhalter an den Poker-, Faro- und Black-Jack-Tischen hatten nichts zu tun, und die mit Flitter behangenen Mädchen saßen gruppenweise an den Trinktischen oder standen an den Enden der langen Theke.
»Geben Sie mir eine Flasche Whisky!« verlangte Tom von einem Barkeeper.
Während er noch in seinen Taschen nach ein paar Silberdollars suchte, fiel plötzlich ein Schatten über ihn. Er blickte auf. Neben ihm war jener Mann an den Tresen getreten, den er eine Stunde zuvor in Begleitung der rothaarigen Schönheit vor dem Hotel gesehen hatte. Die weißen Beingriffe seiner Colts standen unter den schwarzen Rockschößen hervor. Die dunklen Augen in dem bleichen Gesicht mit dem sichelförmigen Schnurrbart blickten Kelso starr an.
»Mein Name ist Dave Bruebaker. Darf ich Sie zu einem Whiskey einladen?«, fragte der Mann in typischem Yankee-Tonfall.
»Wie Sie sehen, ist meine Flasche noch voll. Außerdem trinke ich nie mit Männern aus dem Norden«, antwortete Kelso abweisend. Er warf fünf Dollarmünzen auf die Theke, griff nach der Flasche »Rosebud-Whiskey«, die der Keeper vor ihn hingestellt hatte, und wandte sich zum Gehen. Doch Bruebaker hielt ihn fest.
»Mister, wenn Sie noch Verwendung für Ihre Hand haben, sollten Sie sie da wegnehmen«, sagte Kelso.
Aus den Augenwinkeln sah er, wie der Blick des Dunkelgekleideten an ihm vorbeiging. Unwillkürlich wandte er den Kopf. Zwei Männer, die bisher zu beiden Seiten der Eingangstür gestanden hatten, waren sporenklirrend einen Schritt vorgetreten. Beide waren Revolvermänner, Tom hatte einen Blick dafür. Ihre Colts waren tief geschnallt, die Hände in der Nähe der Waffen, die Blicke wachsam, die Augen kalt.
»Ich weiß zwar nicht, was Sie von mir wollen, Mr. Bruebaker«, sagte Tom, jedes Wort betonend, »aber wenn einer von den beiden nach der Waffe greift, schieße ich Sie nieder.«
»Das ist sehr unwahrscheinlich, denn ich halte mit meiner Linken Ihren rechten Arm fest. Meine Rechte aber ist frei, und auf diese Entfernung habe ich noch nie danebengeschossen. Ihre Chancen sind also äußerst gering, wenn Sie es auf einen Kampf ankommen lassen. Ich suche aber keine Schießerei, sondern möchte mit Ihnen nur ins Geschäft kommen. Wollen Sie mir eine Minute zuhören?«
»Reden Sie, ich höre zu«, entgegnete Kelso knapp.
Bruebaker schickte den Barkeeper mit einer Handbewegung außer Hörweite, dann lehnte er sich mit dem Rücken an die Theke.
»Ich will die Minute, die Sie mir zugestanden haben, nicht mit leerem Gerede vertun«, sagte er mit einem leichten Unterton von Spott in der Stimme. »Ich komme deshalb gleich zur Sache. Sie haben vorhin einen Toten nach Fort Grant gebracht. Wissen Sie, wer dieser Mann war?«
»Nein, er hat mir seinen Namen nicht genannt, bevor er starb. Er hatte einen Indianerpfeil im Rücken und den Mund voll Blut.