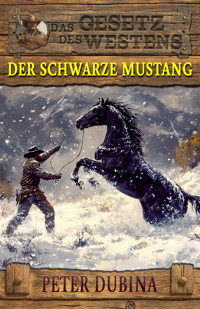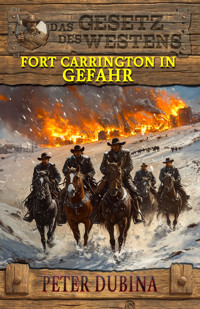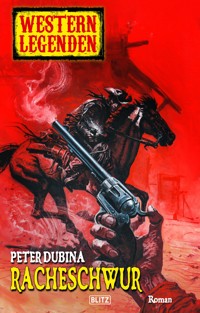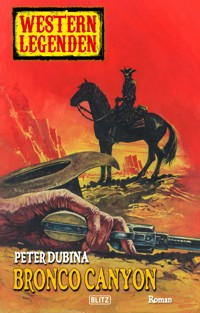Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Western Legenden (Historische Wildwest-Romane)
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Wagenboss Jim DragoAm Black Lance Creek gerät der Fuhrunternehmer Jim Drago mit Fracht und Mannschaft in einen Hinterhalt von Black Horses Comanchenstamm. Von nun an ist der Kiowa Trail für keinen Frachtwagenzug mehr passierbar. Aber wenn die Menschen im weiter nördlich gelegenen Fort keine Waffen bekommen, um sich zu verteidigen, wird niemand überleben. Ausgerechnet der schon besiegte Jim Drago will versuchen, deren Leben zu retten.Whiskey für Paint RockSie haben seine Pferderanch niedergebrannt und damit auch seine Existenz zerstört. Aber Jim Tyree gibt nicht auf, sondern schwört dem Rancher Frank Latimore und dessen Revolvermännern Rache. Da kommt das verlockende Angebot des zwielichtigen Geschäftsmanns Jason Burwick gerade recht: Tyree soll für Burwick eine Ladung Whiskey von Abilene nach Paint Rock bringen. Der Transport wird zum Himmelfahrtskommando.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Western Legenden
In dieser Reihe bisher erschienen
9001 Werner J. Egli Delgado, der Apache
9002 Alfred Wallon Keine Chance für Chato
9003 Mark L. Wood Die Gefangene der Apachen
9004 Werner J. Egli Wie Wölfe aus den Bergen
9005 Dietmar Kuegler Tombstone
9006 Werner J. Egli Der Pfad zum Sonnenaufgang
9007 Werner J. Egli Die Fährte zwischen Leben und Tod
9008 Werner J. Egli La Vengadora, die Rächerin
9009 Dietmar Kuegler Die Vigilanten von Montana
9010 Thomas Ostwald Blutiges Kansas
9011 R. S. Stone Der Marshal von Cow Springs
9012 Dietmar Kuegler Kriegstrommeln am Mohawk
9013 Andreas Zwengel Die spanische Expedition
9014 Andreas Zwengel Pakt der Rivalen
9015 Andreas Zwengel Schlechte Verlierer
9016 R. S. Stone Aufbruch der Verlorenen
9017 Dietmar Kuegler Der letzte Rebell
9018 R. S. Stone Walkers Rückkehr
9019 Leslie West Das Königreich im Michigansee
9020 R. S. Stone Die Hand am Colt
9021 Dietmar Kuegler San Pedro River
9022 Alex Mann Nur der Fluss war zwischen ihnen
9023 Dietmar Kuegler Alamo - Der Kampf um Texas
9024 Alfred Wallon Das Goliad-Massaker
9025 R. S. Stone Blutiger Winter
9026 R. S. Stone Der Damm von Baxter Ridge
9027 Alex Mann Dreitausend Rinder
9028 R. S. Stone Schwarzes Gold
9029 R. S. Stone Schmutziger Job
9030 Peter Dubina Bronco Canyon
9031 Alfred Wallon Butch Cassidy wird gejagt
9032 Alex Mann Die verlorene Patrouille
9033 Anton Serkalow Blaine Williams - Das Gesetz der Rache
9034 Alfred Wallon Kampf am Schienenstrang
9035 Alex Mann Mexico Marshal
9036 Alex Mann Der Rodeochampion
9037 R. S. Stone Vierzig Tage
9038 Alex Mann Die gejagten Zwei
9039 Peter Dubina Teufel der weißen Berge
9040 Peter Dubina Brennende Lager
9041 Peter Dubina Kampf bis zur letzten Patrone
9042 Dietmar Kuegler Der Scout und der General
9043 Alfred Wallon Der El-Paso-Salzkrieg
9044 Dietmar Kuegler Ein freier Mann
9045 Alex Mann Ein aufrechter Mann
9046 Peter Dubina Gefährliche Fracht
9047 Alex Mann Kalte Fährten
Peter Dubina
Gefährliche Fracht
Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-667-5Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Wagenboss Jim Drago
1. Kapitel
Über dem Tal des Black Lance Creek hing die Stille des Todes, nur unterbrochen vom Knistern und Prasseln der Flammen, die den Murphy-Frachtwagen umloderten, der bei der rasenden Flucht mit gebrochener Hinterachse und zersplitterten Rädern auf halber Höhe des Abhangs liegen geblieben war.
Glücklicherweise handelte es sich nicht um den Munitionswagen, sonst hätte längst eine verheerende Explosion alles Leben auf der Hügelkuppe ausgelöscht.
Drei Wagen hatten die Anhöhe erreicht, aber von den Männern, die mit ihnen kamen, waren nur noch zwei am Leben.
Einen Colt in jeder Hand, lag Jim Drago hinter dem Kadaver seines Pferdes, aus dem mindestens fünfundzwanzig mit Eulenfedern befiederte Comanchenpfeile ragten, wie verdorrte Äste aus einem toten Baumstamm.
Jim Drago war ein hochgewachsener Mann. Wenn er aufrecht in seinen Stiefeln stand, maß er sechs Fuß und drei Zoll.
Gewöhnlich blickten seine blaugrauen Augen kühl und abwägend, doch jetzt waren sie von Zorn und Verzweiflung verdunkelt. Das sandfarbene Haar hing ihm in Strähnen in die schweißnasse Stirn. Seine Kleidung war bis hinunter zu den Kavalleriestiefeln und den an ihren Hacken festgeschnallten Sporen mit grauem Texasstaub bedeckt.
Sein mit Fransen geschmücktes, über der Brust mit einem Riemen verschnürtes Lederhemd wies dunkle Schweißflecken auf, denn die Sonne brannte seit einer Stunde erbarmungslos auf seine Schultern und seinen Rücken hinab.
Jim Drago legte einen der beiden Armeecolts neben sich auf die Erde und tastete mit der freien Hand an seinen über Kreuz geschnallten Revolvergurten entlang. Seine Finger fanden noch zwölf Patronen in den Gürtelschlaufen, die letzten zwölf.
Während er die leeren Patronenhülsen aus den Kammern der Colts stieß und neue Patronen hineingleiten ließ, hörte er ein halb ersticktes Stöhnen hinter sich und wandte den Kopf.
Im kargen Schatten eines der Frachtwagen lag Sergeant Royall Angus von der Armee der Konföderierten Südstaaten. Beim letzten Angriff der Comanchen war ihm ein Büffelpfeil quer durch den Körper gefahren, so dass das befiederte Ende des Geschosses unter seinem linken, die Eisenspitze unter seinem rechten Arm herausragte.
Der Mann lag im Sterben, er erstickte langsam an seinem eigenen Blut. Aber Jim Drago konnte ihm nicht helfen. Hätte er den Pfeil herausgezogen, wäre ihm Angus unter den Händen verblutet.
„Nicht aufgeben, Sergeant“, murmelte er. „Halten Sie durch. Wir sind nur noch fünfzehn Meilen von Fort Dexter entfernt. Vielleicht sieht die Garnison die Rauchsäule des brennenden Wagens und schickt eine Abteilung Kavallerie, um uns herauszuhauen.“
„Fünfzehn Meilen, für uns können es ebenso gut fünfzehnhundert Meilen sein“, keuchte der Sterbende. „Jede Hilfe käme zu spät, viel zu spät. Wir stehen schon mit einem Bein in der Hölle, und die Comanchen werden uns vollends hineinstoßen.“
Jim Drago wusste, dass der Sergeant recht hatte. Wenn er den Kopf aus der Deckung hob, konnte er in dem von Hunderten von Pferdehufen aufgewirbelten Staub erkennen, wie sich die Indianer unten am Fuß des Hügels zum entscheidenden Angriff sammelten.
Er schätzte ihre Zahl auf zwei-, dreihundert. Die halbnackten bemalten, federgeschmückten Krieger saßen auf Pferden jeder nur erdenklichen Farbschattierungen.
Viele von ihnen trugen lange Lanzen mit dreieckigen Eisenspitzen, die typische, gefürchtete Comanchenwaffe, die schreckliche Wunden riss und einen Mann glatt durchbohren konnte. Aber die meisten Indianer waren mit Winchester-, Henry- und Spencer-Repetiergewehren bewaffnet. Patronengurte waren um ihre Hüften und die mit weißem Lehm bemalten Oberkörper geschlungen.
Jim Drago hatte die vernichtende Feuerkraft der Kriegshorde während der letzten Stunde erlebt. In dieser Stunde hatte er alles verloren, wofür er Jahre hart gearbeitet hatte: Seine Frachtwagen, die Pferdegespanne und seine Mannschaft.
Nur sein Leben besaß er noch, aber das würde, wie die Dinge lagen, nur noch Minuten währen.
Nun, da es zu spät war, verfluchte Jim Drago seinen eigenen Leichtsinn, der ihn dazu verführt hatte, einen Wagenzug über den Kiowa Trail zu bringen, obwohl er wusste, dass die Indianer den Weg abgeriegelt hatten.
Freilich, der Lohn, der ihm dafür versprochen worden war, zweitausend Dollar in gemünztem Gold, war hoch gewesen. So hatte er alles auf eine Karte gesetzt und verloren.
2. Kapitel
Begonnen hatte es vor zwei Tagen, als Colonel Beauregard, der konföderierte Kommandant von Fort Richardson, ihn zu sich hatte rufen lassen. Beauregard kämpfte in West-Texas einen aussichtslosen Kampf gegen die Prärieindianer. Er hatte zu wenig Soldaten, zu wenig Munition, zu wenige Pferde und zu wenige Wagen, um die wilden Kriegerbanden niederzuhalten, die immer wieder hundert Meilen lange Spuren von Blut und Feuer durch Texas zogen.
Alle verfügbaren Kräfte der Konföderierten Armee standen im Osten, in Virginia, Tennessee und Carolina, wo seit drei Jahren der Bürgerkrieg zwischen den Süd- und Nordstaaten tobte.
Längst waren die Schlachten von Bull Run, Shiloh und Gettysburg geschlagen. Hunderttausende von Soldaten beider Armeen waren gefallen, und es wurde mit steigender Erbitterung gekämpft.
Aber nach Gettysburg hatte sich das Kriegsglück endgültig gegen den Süden gewandt. Zwar kämpfte die Konföderierte Armee noch mit dem Mut eines verwundeten Löwen, aber sie befand sich an allen Fronten auf dem Rückzug, und Verzweiflung hatte die Südstaaten erfasst.
Und nun rebellierten zu allem Überfluss die Präriestämme im Westen, hinter dem Rücken der kämpfenden Konföderierten. Es sah so aus, als ob sie diesmal zu einer ernsten Gefahr für Texas würden, denn sie waren mit neuen Repetiergewehren bewaffnet, brannten Siedlungen und Forts nieder und töteten jeden Weißen, der ihnen in die Hände fiel.
Die Flammen des Indianeraufstandes hatten bereits ganz West-Texas in Brand gesetzt.
„Ich brauche Ihnen wohl nicht zu sagen, in welcher verzweifelten Lage sich Fort Dexter befindet“, begann Beauregard, das von Falten gezeichnete, hagere Gesicht im Lichtkegel der Petroleumlampe, die an einem Eisenhaken von der Decke des Quartiers hing.
„Das Fort ist unser am weitesten nach Westen vorgeschobener Außenposten. Es hat eine Besatzung von nur einhundertfünfzig Mann. Und es ist seit mehr als einem Monat durch die aufständischen Indianer von der Außenwelt abgeschnitten. Wir haben zweimal versucht, den Belagerungsring zu durchbrechen und Nachschub nach Fort Dexter zu bringen, jedes Mal wurden wir blutig zurückgeschlagen. Wir haben dabei alle unsere Armeewagen verloren, die zur Verfügung standen, so dass wir keinen dritten Durchbruchsversuch mehr unternehmen können. Die Lage in Fort Dexter muss inzwischen verzweifelt sein. Munition und Lebensmittel gehen zur Neige, wenn die Vorräte nicht überhaupt schon aufgebraucht sind.“
„Warum erzählen Sie mir das, Colonel?“, fragte Jim Drago, beide Hände auf die Holzgriffe seiner tief geschnallten Armeecolts stützend.
„Weil ich auf der verzweifelten Suche nach einer Möglichkeit bin, Nachschub nach Fort Dexter zu bringen. Der Außenposten darf nicht fallen. Dafür gibt es schwerwiegende Gründe.“ Beauregard deutete auf eine Generalstabskarte an der Wand. „Nordwestlich von Fort Dexter gibt es nur Wüste, Berge und leeres Land. Dahinter aber, in Neumexiko, liegen in den Forts der Nordstaaten wenigstens fünftausend Mann Unionsinfanterie und -kavallerie, dazu etwa hundert Kanonen.
Diese Truppen des Gegners warten nur auf einen günstigen Augenblick, um uns in den Rücken zu fallen und tief nach Texas vorzustoßen, um so dem Süden im Rücken seiner kämpfenden Armeen den Todesstoß zu versetzen.
Ich habe nicht einmal tausend, zum Teil schlecht ausgerüstete Soldaten, um den Gegner abzuwehren. Wenn nun Fort Dexter von den Indianern niedergebrannt wird, liegt das Land weit offen vor den Unions-Regimentern. Wir würden dann nicht mehr rechtzeitig vor dem Heranrücken des Feindes gewarnt, sondern erst auf ihn aufmerksam werden, wenn seine Kanonen Fort Richardson bereits unter Feuer nehmen würden. Deshalb ist Fort Dexter so wichtig für uns.“
Beauregard schwieg einen Augenblick, dann fuhr er mit veränderter Stimme fort: „Aber es gibt noch einen zweiten, schlimmen Grund, weshalb dieser Außenposten nicht fallen darf. Die Garnison besteht nicht nur aus Soldaten, sondern auch aus deren Frauen und Kindern. Und Sie wissen, Drago, welches Schicksal weißen Frauen droht, wenn sie lebend in die Hände der Comanchen fallen. Auch wegen dieser Frauen und Kinder müssen wir Nachschub nach Fort Dexter schaffen, bevor die Indianer es einnehmen.“
„Sie haben meine Frage immer noch nicht beantwortet, Colonel“, entgegnete Jim Drago. „Warum erzählen Sie mir das alles?“
„Weil Sie eine Frachtlinie betreiben und deshalb über Wagen und Gespanne verfügen, die mir nicht mehr zur Verfügung stehen“, sagte Beauregard, jedes Wort betonend. „Ich möchte, dass Sie für die Armee Nachschub nach Fort Dexter bringen.“
Da Jim Drago nicht gleich antwortete, fuhr er fort: „Ich könnte Ihre Frachtlinie auch beschlagnahmen, die Kriegsartikel geben mir das Recht dazu, aber ich brauche nicht nur die Wagen und Pferde, sondern auch einen Mann, der einen Nachschubkonvoi bis nach Fort Dexter bringen kann.“
„Es gibt noch andere Frachtlinien in der Hog-Town vor Fort Richardson“, wandte Jim Drago ein. „Warum machen Sie Ihren Vorschlag nicht Abigail Lamar oder Burwick und Stuart? Der Bürgerkrieg hat die meisten Frachtlinien in Texas an den Rand des Ruins getrieben. Für eine entsprechend hohe Summe wäre jeder Frachtunternehmer in diesem Staat bereit, mit seinen Wagen mitten durch die Hölle zu fahren. Warum kommen Sie mit Ihrem Angebot ausgerechnet zu mir?“
„Ich mache dieses Angebot Ihnen“, sagte Beauregard, „weil niemand den Kiowa Trail so gut kennt wie Sie, Drago. Sie haben einen Weg von hundert Meilen zu bewältigen, und zwischen Fort Richardson und Fort Dexter haben sich schätzungsweise zweitausend Comanchen, Kiowa, Arapaho und Süd-Cheyenne unter einem Anführer namens Black Horse gesammelt, um jeden Durchbruchsversuch zu vereiteln und Fort Dexter so lange zu belagern, bis es in ihre Hände fällt. Sie sind mit Repetiergewehren bewaffnet, deren Feuerkraft die unserer Armeekarabiner weit übertrifft.
Ich nehme an, dass die Nordstaaten diese Waffen an die Indianer geliefert haben, damit diese uns von den Angriffsvorbereitungen ablenken, die die Unionsarmee gegen uns trifft. Abigail Lamar ist eine Frau, sie käme niemals mit ihrem Wagentreck über den Kiowa Trail. Und Burwick und Stuart vertraue ich nicht, denn Stuart ist ein Anhänger der Union, obwohl er es geschickt zu verbergen trachtet. Es bleiben also nur Sie, Drago. Und wenn überhaupt ein Mann einen Nachschubkonvoi nach Fort Dexter bringen kann, dann sind Sie es. Aber ich kann Ihnen nicht mehr als einen Zug Kavallerie unter Leutnant Sturges als Eskorte mitgeben.“
„Bisher haben Sie noch kein Wort darüber verloren, wie viel Sie für dieses Himmelfahrtskommando bezahlen wollen, wenn ich den Auftrag wirklich annehmen sollte“, entgegnete Jim Drago.
„Ich bin bereit, tausend Dollar zu bezahlen“, sagte Beauregard.
„Zweitausend, und nicht in Banknoten, sondern in gemünztem Gold“, sagte Jim Drago rasch, „denn das Papiergeld der Konföderierten ist nichts wert.“
„Ich sehe, Sie sind ein Patriot“, entgegnete der Colonel mit beißendem Spott. „Leute wie Sie machen es mir schwer, an den Sieg der Südstaaten zu glauben.“
„Ich bin in Texas geboren und liebe dieses Land“, antwortete Jim Drago. „Ich würde es genauso gern sehen wie Sie, wenn der Süden den Krieg gewänne. Aber ich bin aus dem Alter raus, in dem man an Wunschträume glaubt, Colonel. Die Konföderierten werden bald die Waffen vor der Übermacht der Nordstaaten strecken müssen. Und wenn das geschieht, wird der Südstaatendollar nicht mehr das Papier wert sein, auf das er gedruckt ist. Deshalb verlange ich meinen Lohn in gemünztem Gold. Ich setze bei unserem Handel schließlich alles aufs Spiel, was ich besitze.“
Er blies das Streichholz aus und warf es weg. Dann schob er die brennende Zigarre in einen Mundwinkel.
„Außerdem möchte ich, dass Sie mir die Hälfte des Geldes im Voraus zahlen“, fuhr er fort, „denn ich habe nicht einmal mehr genug Geld, meiner Mannschaft ihren letzten Lohn zu zahlen. Ein Wagen braucht eine neue Hinterachse, und auf ein halbes Dutzend Räder müssen neue Eisenreifen aufgezogen werden. Wenn dann noch etwas von dem Geld übrig ist, kaufe ich mir eine Flasche Whisky und betrinke mich, um zu vergessen, was ich für ein Narr war, als ich mich zu dem Handel mit Ihnen bereitfand, Colonel Beauregard.“
So waren sie sich einig geworden. Zwei Tage darauf war Jim Drago mit einem Dutzend schwerbeladener Murphy-Frachtwagen, jeder von sechs Pferden gezogen, aus Fort Richardson aufgebrochen.
Zwei Tage lang waren sie über den Kiowa Trail gerollt, ohne auch nur die Spuren von unbeschlagenen Indianerpferden zu finden. Dann aber, am dritten Tag, als sie gerade noch eine Meile von der Furt des Black Lance Creek entfernt waren, hatte der Angriff der Comanchen sie vollkommen unerwartet und mit vernichtender Wucht getroffen.
Wie ein Rammbock waren die Indianer aus einer unsichtbaren Bodensenke hervorgebrochen. Schon die erste Salve aus ihren Winchester-, Henry- und Spencer-Repetiergewehren hatte die Kavallerie-Eskorte bis auf drei Mann aus den Sätteln gerissen.
Von da an hatte es nur noch rasende Flucht gegeben. Als Jim Drago gesehen hatte, wie Leutnant Sturges, der den Comanchen Schuss um Schuss aus seinem Colt entgegen jagte, von einer federgeschmückten Lanze durchbohrt, aus dem Sattel gestürzt war, hatte er als letzter sein Pferd herumgeworfen und war hinter den davon rasselnden Wagen her galoppiert.
Aber nur vier Frachtwagen, einer davon in hellen Flammen stehend, hatten den einsamen Hügel auf der anderen Seite des Black Lance Creek erreicht. Der fünfte war im Flussbett umgestürzt und hatte den nachfolgenden Wagen den Weg versperrt.
Ein brennender Murphy war auf halber Höhe des Abhangs mit gebrochener Achse liegengeblieben, und Jim Dragos Pferd war, von einer Comanchenkugel in den Kopf getroffen, in einer Staubwolke zu Boden gestürzt.
3. Kapitel
Sergeant Angus begann zu keuchen, und Jim Drago sah sich, aus seinen Gedanken gerissen, nach ihm um. Ein breiter Blutstrom rann aus dem Mund des Sterbenden.
„Ich wollte … ich wollte … ich wollte ...“, stöhnte er, aber er konnte nicht zu Ende sprechen. Er fiel zur Seite und lag still.
Im gleichen Augenblick hörte Drago das Getrappel unzähliger Pferdehufe am Fuße des Hügels. Er hob den Kopf aus der Deckung und sah, dass die Comanchen, in drei Kampfreihen gestaffelt, vom Flussufer auf den Hügel zuritten. Da richtete er sich hinter seinem toten Pferd auf den Knien auf und hob in wildem, zornigem Trotz beide Colts hoch über den Kopf.
„Kommt nur, ihr roten Bastarde!“, schrie er. „Hier habe ich noch zwölfmal böse Medizin für euch! Und mit jeder Kugel nehme ich einen von euch mit zur Hölle!“
Die Indianer zügelten sofort ihre Pferde, und einer von ihnen ritt vor die Linie. Er war für einen Comanchen sehr hochgewachsen und trug eine Fellhaube mit Büffelhörnern, baumelnden Hermelinschwänzen und einer Adlerfederschleppe, die bis über den Rücken seines schwarzen Pferdes hinabfiel. Er hatte einen alten spanischen Brustpanzer umgeschnallt. Am linken Arm trug er einen bemalten Büffelhautschild, mit der rechten Hand hob er die Winchester über den Kopf und schüttelte sie in Dragos Richtung.
„Yata-he, Taibo! Yata-he!“, rief er zum Hügel hinauf. Und das hieß: Ich achte deinen Mut, weißer Mann! Du bist ein tapferer Kämpfer! Es war das uralte Ritual der Hochachtung, die jeder Prärieindianer vor einem Gegner empfand, der auch angesichts des Todes noch Mut bewies.
Doch dann, im nächsten Augenblick schon, donnerte die geballte Masse von Pferden und Reitern den Abhang herauf. Jim Drago schoss mit beiden Colts. Er sah einen Comanchen aus dem Sattel stürzen. Ein scheckiges Pferd brach, von einer Kugel getroffen, mit wirbelnden Hufen zusammen und rutschte ein Stück den Abhang hinab. Aber der nächste Reiter setzte im Sprung über das Tier hinweg. Er schleuderte seine Lanze nach Jim Drago. Die Eisenspitze verfehlte ihr Ziel nur um Handbreite und fuhr tief in den Boden.
Rings um Drago war alles in Verwirrung und Bewegung. Reiter jagten schattenhaft durch den Pulverrauch und den von vielen Pferdehufen aufgewirbelten Staub. Die kurzen, gellenden Kriegsschreie der Indianer mischten sich mit dem Krachen der Schüsse.
Jim Drago warf sich auf den Rücken, als die Comanchen zu beiden Seiten an ihm vorbei fegten. Feuerzungen stachen aus den Mündungen seiner Armeecolts, und ein Krieger, der seinen Spencer-Repetierkarabiner auf ihn richten wollte, ließ die Waffe fallen, sank mit zwei Kugeln in der Brust vornüber auf den Hals seines Pferdes und wurde von dem scheuenden Tier in die Rauch- und Staubwolken hineingetragen.
Ein anderer Indianer drängte seinen Schecken nahe an Drago heran und holte mit einem Kavalleriesäbel, wahrscheinlich ein Beutestück aus einem Gefecht gegen die Armee, aus, um dem weißen Mann den Schädel zu spalten.
Jim Drago wehrte den Hieb mit seinem linken Colt ab. Stahl klirrte auf Stahl. Doch die Klinge glitt ab und traf Drago mit der flachen Seite an der Schläfe. Ein dumpfer Schmerz durchzuckte ihn. Augenblicklich verlor sein Körper alle Kraft. Die Colts fielen ihm aus den Händen, und er sackte zu Boden.
Mit einem Triumphschrei warf sich der Indianer aus dem Sattel, zog sein Messer, drückte Jim Drago ein Knie in den Rücken und zog seinen Kopf an den Haaren in den Nacken, um ihm die Kehle durchzuschneiden.
In diesem Moment riss ein Schuss dem Krieger die Klinge aus der Hand. Plötzlich trat eine Stille ein. Eine gutturale Stimme rief Worte im Befehlston.
Jim Drago wurde von harten Händen gepackt und hoch gezerrt. Er war noch immer halb betäubt. Sein Kopf hing herab. Blut rann ihm aus der Stirnwunde in die Augen. Aber ein Winchesterlauf wurde unter sein Kinn geschoben und sein Kopf damit hochgehoben.
Jim Drago sah den hochgewachsenen Indianer in der gehörnten Büffelhaube und dem spanischen Brustpanzer vor sich. Der Comanche hatte ein flaches, kühnes Gesicht mit funkelnden dunklen Augen.
„Alle Weißen außer dir auf dem Hügel sind tot“, sagte er in gebrochener, aber verständlicher Redeweise. „Du allein bist noch am Leben, und ganz allein hast du gegen uns gekämpft. Du bist ein tapferer Mann, Taibo. Mein Volk achtet mutige Kämpfer. Wie wirst du genannt?“
„Drago!“
„Ich bin Black Horse“, entgegnete der Comanche. Jim Drago starrte den gefürchteten Kriegshäuptling durch das Blut hindurch an, das ihm fortwährend in die Augen rann.
„Dann bist du der Mann, der Fort Dexter niederbrennen will?“, brachte er mit schwerer Zunge, die ihm kaum gehorchen wollte, hervor.
„Fort Dexter wird in Flammen aufgehen, und alle Weißen hinter den Palisaden werden sterben“, sagte der Comanche, und es klang wie ein Schwur.
„Aber die grauen Soldaten in Fort Dexter sind nicht dort, um gegen die Indianer zu kämpfen, sondern gegen die fremden Soldaten in den blauen Uniformen. Außerdem sind Frauen und Kinder in dem Militärposten.“
„Du sagst, die weißen Soldaten kämpfen untereinander und nicht gegen mein Volk, Taibo. Aber wenn eine Seite gesiegt hat, wird der Sieger sich als nächstes gegen die Comanchen wenden. Deshalb werden wir euch aus unserem Gebiet vertreiben, ehe der Krieg zwischen den Weißen zu Ende ist. Mit diesen Waffen werden wir euch verjagen oder töten, wenn ihr nicht gehen wollt.“
Bei diesen Worten hielt er Jim Drago seine Winchester mit beiden Händen vors Gesicht.
„Und die Soldatenfestung, die du Fort Dexter nennst, wird als erste fallen. Niemand dort wird mit dem Leben davonkommen. Die Flammen des brennenden Forts werden das Zeichen für alle Indianer sein, sich zu erheben und die Weißen zu vertreiben.
Dir aber schenke ich das Leben, Taibo, damit du nach Fort Richardson zurückkehren und den grauen Soldaten dort erzählen kannst, dass Black Horse die Straße, die ihr Kiowa Trail nennt, gesperrt hat, und jeder Weiße sterben muss, der seinen Fuß daraufsetzt. Dieses Land hat immer den Comanchen gehört, soweit die Erinnerung meines Volkes zurückreicht.
Ihr Weißen seid gekommen und habt es uns gestohlen. Ihr habt hier ohne unsere Erlaubnis Straßen und Forts gebaut. Jetzt werden wir euch vertreiben, eure Forts werden in Flammen aufgehen, und der Wind wird eure Straßen mit Sand zudecken. Kehre nie wieder zum Kiowa Trail zurück, Taibo, sonst gibt es einen Comanchen, der sich deinen Skalp holt.“
4. Kapitel
„Es gibt kein Durchkommen nach Fort Dexter, Colonel“, sagte Jim Drago. Er saß auf dem Stuhl in Beauregards Quartier, ein leeres Whiskyglas in der Hand und starrte auf seine staubbedeckten Stiefel. „Black Horse hat den Kiowa Trail vollkommen abgeriegelt. Er hält sich für stark genug, es mit jedem Gegner aufzunehmen. Und in Wahrheit ist er auch dazu imstande, nachdem die Präriestämme mit Hunderten von Repetiergewehren bewaffnet worden sind.
Jeder erfolgreiche Überfall, jedes siegreiche Gefecht gegen die Armee vergrößerte seine Gefolgschaft unter den Indianern. Jetzt hat er möglicherweise schon zweitausend Krieger aus verschiedenen Stämmen um sich gesammelt. Aber wenn es ihm gelingt, Fort Dexter einzunehmen und niederzubrennen, werden sich ihm weitere fünfhundert oder tausend Comanchen, Kiowas und Cheyenne anschließen.
Und wenn auch sie mit Winchester-, Henry- und Spencer-Repetiergewehren bewaffnet werden, ist Black Horse in der Lage, jedes Armeefort in Texas zu belagern und in Flammen aufgehen zu lassen. Er scheint genau über den für den Süden so verhängnisvollen Verlauf des Bürgerkrieges unterrichtet zu sein und will offenbar alle Anstrengungen unternehmen, um noch vor Kriegsende alle Weißen aus dem Gebiet zu vertreiben, das die Comanchen für sich beanspruchen. Er will sie verjagen oder töten, vor allem letzteres, glaube ich.“
Beauregard hatte sorgenvoll aus dem Fenster auf den Paradeplatz von Fort Richardson geblickt, während Jim Drago sprach.
Nun drehte er sich um und musterte den staubbedeckten, erschöpften Mann, der vor ihm saß und dessen Gesicht noch von Streifen getrockneten Blutes gezeichnet war.
Jim Drago war mitten auf dem Paradeplatz vom Pferd gesunken, nachdem er das Fort endlich erreicht hatte, und zwei Soldaten hatten ihm helfen müssen, sich ins Quartier des Colonels zu schleppen.
„Es tut mir leid, dass Sie gescheitert sind, Drago“, murmelte er. „Aber es war den Versuch wert.“
„Ich glaube nicht, dass Sergeant Angus Verständnis für Ihre Worte hätte, Colonel“, entgegnete Jim Drago. „Es stirbt sich nicht leicht mit einem Büffelpfeil im Leib. Und so wie er würden auch alle übrigen Männer denken, die den Durchbruchsversuch nach Fort Dexter mit ihrem Leben bezahlt haben. Und ich denke auch so, obwohl ich noch am Leben bin. Denn ich habe alles verloren, was ich besaß.“
„Ich kann Ihre Bitterkeit verstehen“, sagte Beauregard. „Aber ich werde trotz aller Fehlschläge auch weiterhin nichts unversucht lassen, Nachschub nach Fort Dexter zu bringen.“
„Das wird solange unmöglich sein, wie die Comanchen über den Zustand und jede Bewegung der Konföderierten Armee genau unterrichtet sind, Colonel. Wer es auch sein mag, der den Indianern Repetiergewehre und Patronen liefert, er berichtet ihnen auch über den Kriegsverlauf auf den Schlachtfeldern im Osten.
Black Horse weiß, dass fast alle Kräfte unserer Armee durch die vorrückenden Yankees gebunden werden, und wir dadurch seinen Kriegshorden zahlenmäßig unterlegen sind. Diesen Umstand macht er sich zunutze. Aber das ist nicht die Art, wie Prärieindianer üblicherweise kämpfen. Sie planen einen Aufstand nicht bis in die Einzelheiten hinein, sie durchschauen und erkennen auch nicht die jeweilige Lage ihres Gegners. Für sie beginnt der Kampf erst, wenn der Feind in Schussweite ist. Dann freilich erweisen sie sich als furchtbare Gegner, denn sie sind die beste leichte Kavallerie der Welt.
Aber Strategie ist nicht ihre Sache. Und darum bin ich sicher, dass hinter diesem Indianeraufstand ein Weißer steckt. Und zwar derselbe, der den Comanchen die Repetiergewehre geliefert hat, mit denen sie meine Mannschaft in Fetzen schossen.“
„Würden Sie noch einen zweiten Versuch wagen, über den Kiowa Trail nach Fort Dexter durchzubrechen?“, wollte Beauregard wissen, während er die Whiskeyflasche vom Tisch nahm und Dragos Glas noch einmal bis zum Rand füllte.
„Womit denn?“, fragte Jim Drago voll bitterem Hohn. „Ich habe am Black Lance Creek alle meine Frachtwagen verloren. Ich habe keine Mannschaft mehr. Ich besitze nicht einmal mehr einen eigenen Sattel.“
„Ich könnte Wagen von einer der beiden anderen Frachtgesellschaften beschlagnahmen. Als Kommandant von Fort Richardson habe ich das Recht dazu, solche Maßnahmen zu ergreifen, wenn die militärische Lage es erfordert. Aber was nützen mir Frachtwagen ohne einen Mann, der imstande ist, sie über den Kiowa Trail nach Fort Dexter zu führen? Sie haben es beim ersten Mal beinahe geschafft, vielleicht haben Sie beim zweiten Mal mehr Glück.“
Jim Drago leerte sein Glas und stellte es hart auf den Tisch.
„Danke für den Whiskey, Colonel“, sagte er und erhob sich von seinem Stuhl. „Zu Ihrem Vorschlag sage ich nein. Ich möchte noch eine Weile leben.“
„Das möchten die Frauen und Kinder in Fort Dexter bestimmt auch“, entgegnete Beauregard. „Aber wenn der Garnison erst die Munition ausgeht und die Indianer über die Palisaden kommen, wird ihrer aller Leben ein schreckliches Ende nehmen.“
„Mir tut es auch leid, aber ...“, begann Jim Drago.
„Aber Sie fürchten sich davor, das Wagnis noch einmal einzugehen“, unterbrach ihn eine Frauenstimme von der Tür her, die geöffnet worden war, ohne dass die beiden Männer es bemerkt hatten.
„Ich habe keine Angst, es zu wagen, Colonel“, sagte sie zu Beauregard. „Wenn Sie mir den Auftrag zu denselben Bedingungen geben wie Drago, dann führe ich meinen Wagenzug nach Fort Dexter.“
„Sie scheinen keine Ahnung zu haben, wovon Sie da reden, Miss Lamar“, erklärte Jim Drago gereizt. „Wenn Sie mit Ihren Frachtwagen auf den Kiowa Trail hinaus rollen, werden Sie bald glauben, Sie wären mitten in die Hölle gesprungen. Ich weiß, im Gegensatz zu Ihnen, wovon ich spreche. Ich habe nämlich meinen ganzen Wagenzug am Black Lance Creek verloren. Die Winchestergewehre der Comanchen würden Sie und Ihre paar armseligen Frachtwagen einfach vom Trail hinunter fegen. Noch vor dem Abend des zweiten Tages würde Ihr schönes rotes Haar im Rauch eines Comanchen-Zeltes trocknen. Colonel, machen Sie dieser Verrückten klar, was sie dort draußen erwartet.“
„Ich wollte, ich könnte so wie Sie das Angebot von Miss Lamar mit ein paar Worten abtun“, entgegnete Beauregard. „Aber ich brauche unbedingt Frachtwagen, um Nachschub nach Fort Dexter zu schaffen.“
„Sie haben mir einmal erklärt, Sie würden diesen Auftrag niemals an Abigail Lamar vergeben, weil sie eine Frau ist und nicht die geringste Chance hätte, über den Kiowa Trail zu gelangen“, sagte Jim Drago.
„Richtig“, sagte Beauregard. „Aber damals befand ich mich in einer anderen Lage, denn da hatten Sie noch Ihre Wagen und Pferdegespanne. Doch jetzt bin ich auf jede Hilfe angewiesen, die ich bekommen kann.“
Er nahm sich eine Zigarre, biss die Spitze ab und spuckte sie aus. „Aber wie wäre es, wenn Sie den Wagentreck von Miss Lamar führen würden? Ich wäre sogar bereit, Ihnen noch einmal eine Kavallerie-Eskorte mitzugeben, obwohl ich eigentlich keinen Mann mehr entbehren kann. Der Lohn wäre der gleiche wie der, den ich Ihnen versprach: zweitausend Dollar in gemünztem Gold. Zwei Drittel für Miss Lamar, ein Drittel für Sie, wenn Sie durchkommen.“
„Ich denke gar nicht daran“, erwiderte Jim Drago zornig. „Ich war einmal verrückt genug, alles, was ich besaß, für zweitausend Dollar aufs Spiel zu setzen. Aber ich bin doch nicht so verrückt, mein Leben wegzuwerfen.“ Und zu Abigail Lamar gewandt, fügte er beißend hinzu: „Sie können die ganzen zweitausend in Gold für sich allein behalten. Doch ich fürchte, Sie werden keine Gelegenheit mehr haben, auch nur einen Cent davon auszugeben.“
5. Kapitel
Wütend verließ er das Offiziersquartier und löste die Zügel seines Indianerpferdes, das draußen angebunden war. Das Tier hinter sich herziehend, schritt er über den Paradeplatz, über dem am Fahnenmast das Sternenbalkenbanner der Südstaaten wehte. Eine Batterie von sechs mächtigen Vierundzwanzigpfünder-Napoleon-Kanonen stand mitten auf dem Platz, schwerfällige Waffen und völlig ungeeignet für den Kampf mit einem so leicht beweglichen, berittenen Gegner, wie die Comanchen es waren. Sie konnte man nur mit überlegenen Kavalleriekräften oder mit Infanterie zum Kampf stellen und schlagen.
Infanterie, sagte ein altes Armeewort, kämpft, wo sie Fuß fasst.
Die Indianer fürchteten die schweren, in Salven feuernden Infanteriegewehre. Als hervorragende Reiter zogen sie den chancengleichen Kampf gegen die Kavallerie vor. Den Kanonen der Armee aber wichen sie einfach aus. Es war unmöglich, mit den Vierundzwanzigpfündern etwa den Kiowa Trail freizukämpfen, weil niemand vorhersagen konnte, wann und wo die Comanchen einen von Kanonen begleiteten Wagenzug angreifen würden, und wenn das geschah, würde es zu viel Zeit beanspruchen, die Geschütze zu laden und zu richten.
Jim Drago verließ das Fort und schritt über die Wagenstraße zur Hog-Town hinüber, einer kleinen Stadt, die sich im Schutz des Armeepostens entwickelt hatte. Sie bestand hauptsächlich aus zwei Reihen von Gebäuden zu beiden Seiten einer von Räderspuren zerfurchten Main Street. Die meisten Häuser waren Frachtkontore, Stores, Schmieden und andere Handwerksbetriebe, Saloons und Bordelle für die Soldaten von Fort Richardson. Jetzt, da die Abenddämmerung hereinbrach, brannten schon die Petroleumlampen vor den Saloons.
Der größte von ihnen, der Bella Union Saloon, gehörte Stuart und Burwick, die auch die größte Frachtlinie in West-Texas besaßen. Er lag dem Fort von allen Gebäuden zunächst, und als Jim Drago an ihm vorbeischritt, wurde die Schwingtür von innen aufgestoßen, und vier Männer und eine Frau traten auf die breite Veranda heraus.
Black Stuart war ein hochgewachsener dunkelhaariger Mann mit scharf geschnittenem Gesicht, das von einem harten, ja brutalen Zug um die Mundwinkel beherrscht wurde. Seine Augen hatten eine beinahe violette Iris, und goldene Einsprengsel schienen in ihren Tiefen zu leuchten. Es waren gefährliche Augen, die zur Vorsicht mahnten.
Black Stuart war ein Mann, der kein Erbarmen mit seinen Gegnern kannte und jeden Menschen zerbrach, der es wagte, sich seinen Plänen in den Weg zu stellen. Auf seine harte, skrupellose Art, und gestützt auf die Colts seiner Revolvermänner, hatte er es zu Macht und Reichtum gebracht, aber seine Pläne zielten noch viel höher.
Seine Frachtgesellschaft, der Saloon und das Geld, das er mit beiden verdiente, sollten ihm, das war ein offenes Geheimnis, nach dem Ende des Bürgerkriegs zu politischem Einfluss in Texas verhelfen.
Nun trat er an den Rand der Veranda, nahm eine Zigarette aus dem Mund und rief Jim Drago zu: „Ich habe schon gehört, dass Sie Ihren Wagenzug auf dem Kiowa Trail verloren haben. Damit scheiden Sie wohl endgültig aus dem Frachtgeschäft aus. Tut mir leid für Sie. Aber Sie waren diesem harten Geschäft eben nicht gewachsen.“
Jim Drago blieb auf der Straße stehen.
„Ich habe nicht die Absicht, aufzugeben, Stuart“, erwiderte er. „Solange ich lebe, werde ich immer wieder neu beginnen.“
Er wusste zwar, dass er wahrscheinlich endgültig geschlagen war, aber er wollte Black Stuart nicht den Triumph gönnen, ihn aufgeben zu sehen.
„Vielleicht leben Sie gar nicht mehr lange genug, um noch einmal von vorn anfangen zu können“, warf der Mann ein, der rechts von Stuart, aber einen halben Schritt hinter ihm stand.
„Nimm dir nur nicht zu viel vor, Caroll“, sagte Jim Drago. „Kein Mann sollte etwas anfangen, was er nicht zu Ende bringen kann.“
Day Caroll war ein noch junger Bursche mit bleichem Gesicht, schwarzem Haar und hellen, fast bernsteingelben Augen, die trotz eines ständigen, fieberigen Glanzes mit derselben Starrheit blickten wie die Augen einer Klapperschlange.
Er trug hohe schwarze Reitstiefel, eine enge Hose aus dunklem Tuch und über einem weißen Hemd eine ärmellose Weste aus schwarzer Chinaseide. Um seine schmalen Hüften waren zwei Revolvergurte über Kreuz geschnallt. In den Halftern steckten silberne Colts, deren weiße Elfenbeingriffe nach vorn gerichtet waren. Day Caroll gehörte zu jener seltenen Sorte von Revolvermännern, die ihre Waffen im Kreuzgriff zogen.
Der Spott in Jim Dragos Worten ließ ihm das Blut in die bleichen Wangen schießen. Unwillkürlich trat er einen halben Schritt vor, und seine schwarz behandschuhten Hände hingen mit gekrümmten Fingern in Hüfthöhe regungslos in der Luft.
„Glaubst du etwa, ich würde nicht mit dir fertig, du erbärmlicher Frachtkutscher?“, fragte er scharf. Die beiden anderen Revolvermänner, Luke Goff, ein hagerer, falkenäugiger blonder Texaner, und der breitschultrige, stiernackige Sid Fessenden, traten neben ihn. Auch ihre Hände befanden sich nahe den Holzgriffen ihrer tief geschnallten Colts.
In diesem Augenblick wurde die Schwingtür des Saloons abermals von innen aufgestoßen, und ein älterer, dicklicher Mann mit wasserhellen Augen unter gelblich weißen Brauen trat auf die Veranda heraus.
Jim Drago erkannte im Lichtkegel einer der Petroleumlampen, die zu beiden Seiten des Eingangs hingen, Jason Burwick, Stuarts Geschäftspartner.
„Was ist hier los?“, wollte Burwick aufgebracht wissen. Er sah erst Stuart an, dann blieb sein Blick an Day Caroll hängen.
„Ihr wisst, ich will keine Schießerei. Black, sag deinen Revolvermännern, sie sollen sich in den Saloon scheren.“
Caroll setzte zu einer zornigen Erwiderung an, doch Stuart brachte ihn mit einer knappen Handbewegung zum Schweigen.
„Burwick hat recht, Day“, sagte er. „Lass Drago in Ruhe. Es hat keinen Sinn, einen Mann mit Füßen zu treten, der schon geschlagen am Boden liegt. Drago ist erledigt, das weiß er selbst ganz genau. Leider kann ich Ihnen nicht einmal eine Stellung als Frachtwagenfahrer anbieten, Drago. Denn meine Mannschaft ist vollzählig. Sie werden wohl anderswo noch einmal von vorn beginnen müssen, denn in der Hog-Town von Fort Richardson gibt es für Sie nichts mehr zu holen. Aber ich möchte Ihnen noch einen letzten Whiskey bezahlen.“
Er zog einen Silberdollar aus der Westentasche und warf ihn Jim Drago vor die Füße. Dann nahm er die schöne blonde Frau, die mit ihm und seinen Revolvermännern aus dem Saloon getreten war, beim Arm und führte sie wieder hinein.
Day Caroll warf Jim Drago noch einen hasserfüllten Blick zu, dann folgte er sporenklirrend den anderen.
Drago hatte einen bitteren Geschmack im Mund, als er weiterschritt. Es war der Geschmack der vielleicht letzten, endgültigen Niederlage.
Stuart hat recht, dachte er voll dumpfer Verzweiflung. Er war ein Mann, der geschlagen am Boden lag. Für Black Stuart war er kein Gegner mehr.
Er band das Indianerpferd vor seinem Fracht-Office an, das in einem niedrigen Lehmziegelbau weiter unten an der Straße untergebracht war, betrat das Haus, riss ein Streichholz an und steckte den Docht einer Petroleumlampe, die auf dem Schreibtisch stand, in Brand.