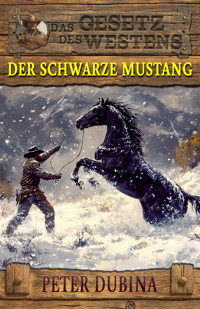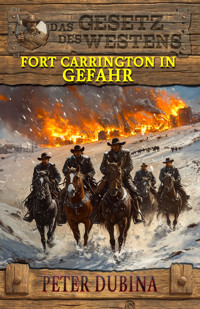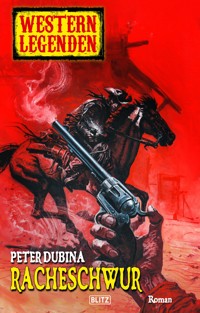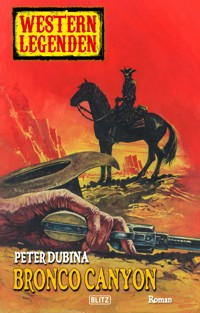Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Western Legenden (Historische Wildwest-Romane)
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Die letzten Apachen haben sich ergeben. Wehrlos sind sie den Soldaten und Indianerpolizisten ausgeliefert. Der Tod erwartet Geronimo und seine Krieger in der Reservation von San Carlos. Doch der Hass der Verlorenen erwacht erneut. Ein gnadenloser Kampf beginnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Western Legenden
In dieser Reihe bisher erschienen
9001 Werner J. Egli Delgado, der Apache
9002 Alfred Wallon Keine Chance für Chato
9003 Mark L. Wood Die Gefangene der Apachen
9004 Werner J. Egli Wie Wölfe aus den Bergen
9005 Dietmar Kuegler Tombstone
9006 Werner J. Egli Der Pfad zum Sonnenaufgang
9007 Werner J. Egli Die Fährte zwischen Leben und Tod
9008 Werner J. Egli La Vengadora, die Rächerin
9009 Dietmar Kuegler Die Vigilanten von Montana
9010 Thomas Ostwald Blutiges Kansas
9011 R. S. Stone Der Marshal von Cow Springs
9012 Dietmar Kuegler Kriegstrommeln am Mohawk
9013 Andreas Zwengel Die spanische Expedition
9014 Andreas Zwengel Pakt der Rivalen
9015 Andreas Zwengel Schlechte Verlierer
9016 R. S. Stone Aufbruch der Verlorenen
9017 Dietmar Kuegler Der letzte Rebell
9018 R. S. Stone Walkers Rückkehr
9019 Leslie West Das Königreich im Michigansee
9020 R. S. Stone Die Hand am Colt
9021 Dietmar Kuegler San Pedro River
9022 Alex Mann Nur der Fluss war zwischen ihnen
9023 Dietmar Kuegler Alamo - Der Kampf um Texas
9024 Alfred Wallon Das Goliad-Massaker
9025 R. S. Stone Blutiger Winter
9026 R. S. Stone Der Damm von Baxter Ridge
9027 Alex Mann Dreitausend Rinder
9028 R. S. Stone Schwarzes Gold
9029 R. S. Stone Schmutziger Job
9030 Peter Dubina Bronco Canyon
9031 Alfred Wallon Butch Cassidy wird gejagt
9032 Alex Mann Die verlorene Patrouille
9033 Anton Serkalow Blaine Williams - Das Gesetz der Rache
9034 Alfred Wallon Kampf am Schienenstrang
9035 Alex Mann Mexico Marshal
9036 Alex Mann Der Rodeochampion
9037 R. S. Stone Vierzig Tage
9038 Alex Mann Die gejagten Zwei
9039 Peter Dubina Teufel der weißen Berge
9040 Peter Dubina Brennende Lager
9041 Peter Dubina Kampf bis zur letzten Patrone
9042 Dietmar Kuegler Der Scout und der General
Peter Dubina
Kampf bis zur letzten Patrone
GeronimoBand 3
Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2021 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-662-0Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Prolog
„Ich habe 300 Mann unter meinem Kommando – mehr als genug, um mit den Apachen fertig zu werden“, entgegnete Terrazas und tat Baylors Einwand mit einem geringschätzigen Achselzucken ab. „Und eines kann ich Ihnen versprechen, Señor: Wir werden keine Gefangenen machen. Ich weiß, dass ich mich auf meine Männer verlassen kann. Sie aber haben fünfundsechzig Apachen als Armeekundschafter unter Ihren Leuten. Wer kann sagen, ob sie sich nicht während des Kampfes plötzlich auf Victorios Seite schlagen? Einem Apachen darf man niemals trauen. Es ist besser, Sie reiten zurück nach Texas, Lieutenant Baylor. Was jetzt noch zu tun ist, wird von der mexikanischen Armee getan werden.“
Baylor fuhr sich, bebend vor Zorn, mit dem Handrücken über den Stoppelbart, der ihm Kinn und Wangen schwärzte. Seit mehr als einem Jahr jagten die Texas Rangers und amerikanische und mexikanische Armee-Einheiten Victorios Bande durch das Berg- und Wüstenland zu beiden Seiten des Rio Grande. Während dieser Zeit hatten die Apachen in blitzschnellen, grausamen Überfällen und wilden Rückzugsgefechten mehr als 200 Weiße – Soldaten, Siedler, Goldgräber und Postkutschenfahrer – und über hundert Mexikaner getötet. Allein in den felsigen Ausläufern der Candelarias hatten die Apachen innerhalb weniger Tage zwei starke mexikanische Milizaufgebote bis zum letzten Mann niedergemacht. Damals war Baylor mit hundert Texas Rangers zum ersten Mal durch den Rio Grande nach Westen geritten, um zusammen mit den mexikanischen Truppen nach den verschollenen Bürgerwehrkommandos zu suchen. Und nun dachte er wieder an den Anblick der nackten, von Bussarden zerhackten Toten, die die Apachen zwischen den Felsen einer engen Schlucht liegen gelassen hatten.
Baylor ließ die Hand wieder sinken, und unbeabsichtigt fiel sie auf den Revolverkolben. Sofort hob Terrazas die Rechte, und die Yaquis, die bisher stumm und mit misstrauischen Augen auf der Erde gehockt hatten, standen auf. Die Hähne ihrer langen Infanteriegewehre knackten, und die Mündungen der Waffen richteten sich auf Baylor und seine vierzehn Texas Rangers, die neben ihm hielten. Baylor starrte in die breiten, ausdruckslosen Indianergesichter; er sah die Zeigefinger in den Abzugsbügeln der Gewehre – und richtete den Blick wieder auf Terrazas, dessen rechte Hand jetzt ganz offen auf dem Colt lag.
Bevor Baylor noch etwas sagen konnte, hörte er hinter sich das metallische Klicken von Gewehrhähnen, als die Apachen-Scouts ihre Karabiner hoben. Terrazas’ Lanzenreiter senkten die Schäfte ihrer Waffen, Pferde stampften unruhig – und für einen Augenblick sah es aus, als sollte es zum Kampf kommen. Baylors Augen ließen Terrazas nicht los, und ein Finger schlüpfte in den stählernen Abzugsbügel seines Colts.
Plötzlich richtete sich Captain Parker in den Steigbügeln auf. „Lieutenant Manney!“, befahl er, und seine Stimme durchbrach die gespannte, unheilvolle Stille. „Das Kommando rückt ab – zum Rio Grande. Wir kehren nach Texas zurück.“
„Ja, Sir!“, hörte Baylor Manney antworten, dann galoppierte ein Pferd schnaubend den mit kleinen Steinbrocken übersäten Hang hinauf.
„Eskadron, in Zweierreihen – vorwärts!“, tönte Manneys Stimme. Hufeisen klirrten, Sattelleder knirschte und Säbelscheiden schlugen gegen Steigbügel.
Baylor zügelte sein unruhig tänzelndes Pferd noch immer auf der Stelle, als die Kavalkade schon über den flachen Hang und den Kamm des Hügels hinwegritt. Wütend starrte er Terrazas in das unbewegte Gesicht, dann zog er seinen Braunen mit einem jähen, harten Zügelruck herum, stieß ihm die Sporen in die Weichen und jagte, von seinen Männern gefolgt, zum Kamm hinauf. Dort hielten Lieutenant Manney und Sergeant J. B. Gillett, ein untersetzter, stiernackiger Soldat, dessen linke Wange vom Auge bis zum Kinn mit einer weißen Säbelnarbe gezeichnet war. Lieutenant Manney hatte sich in den Steigbügeln aufgerichtet, stützte beide Hände auf den Knauf seines hochbordigen McClellan-Sattels und sah hinunter zu Terrazas und den Yaquis, die ihre Gewehre noch immer schussbereit hielten.
Baylor folgte Manneys Blick und sagte finster: „Für die Sturheit dieses Mannes werden viele Menschen diesseits und jenseits des Rio Grande mit dem Leben bezahlen müssen.“
Manney zuckte mit den Schultern. „Es wäre sinnlos gewesen, es auf eine Schießerei ankommen zu lassen“, erwiderte er. „Auf jeden von uns wären zwei Mexikaner gekommen, und bei einer Reiterattacke sind ihre Lanzen mörderische Waffen. Der Captain hat die einzig richtige Entscheidung getroffen, als er Befehl gab, abzuziehen.“
Baylor hörte, wie Sergeant Gillett ausspuckte, und wandte sich im Sattel um. Der narbige Soldat blickte auf Terrazas hinunter.
„Dieser verdammte, ruhmsüchtige Bastard möchte Victorio allein zur Strecke bringen, so viel ist gewiss“, murmelte er. „Ihm ist gleichgültig, wer dafür bezahlt – wenn er nur den Ruhm, den alten Apachenwolf getötet zu haben, mit niemandem zu teilen braucht. Ich weiß nicht, wer behauptet hat, diese Mexikaner hätten heißeres Blut als wir. Terrazas ist kalt wie Eis; im Vergleich zu ihm hat ein Fisch Feuer in den Adern. Eines aber glaube ich ihm: dass er keine Gefangenen machen wird.“
*
Regungslos im Sattel seines schwarzen Hengstes sitzend, sah Terrazas den verhassten Amerikanern nach, bis der letzte Reiter hinter dem Hügelkamm verschwunden war. Plötzlich verlor sein Gesicht den starren Ausdruck, und er wandte sich im Sattel um. Hinter ihm glühten die felsigen Gipfel der Tres-Castillos-Hügel im Licht der untergehenden Sonne. Terrazas blickte nach Westen; dort erhob sich vor dem kupferfarbenen Himmel die gezackte, schwarze Kette der Sierra de los Pinos.
Terrazas gab das Zeichen zum Anreiten, und mit klirrendem Hufschlag zogen die Lanzenreiter auf die Tres Castillos zu, umschwärmt von einem dünnen Schleier von Yaqui-Indianern, die auf dem mit faustgroßen Steinbrocken übersäten Boden leichter und sicherer vorankamen als die Pferde. Jeder von ihnen trug außer dem Gewehr, den Patronengurten und der Machete – dem unterarmlangen, scharf geschliffenen Haumesser – einen Lederbeutel an einem Riemen über der Schulter. Dieser Beutel enthielt Pinole1 und Zucker. Zwei, drei Handvoll davon, gemischt mit Wasser, waren alles, was ein Yaqui an Nahrung für einen Tag brauchte. Dabei nahm es diese irreguläre Infanterie an Ausdauer und Schnelligkeit mit jeder Kavallerieeinheit auf. Sie übertraf in bergigem Gelände Pferde und Maulesel an Zähigkeit, kam mit weniger Wasser aus als die an die Wüste gewöhnten Armeemulis und setzte sich aus tödlich sicheren Scharfschützen zusammen.
Die Reiter folgten dem gewundenen Lauf eines Arroyos, eines ausgetrockneten Flussbetts. Plötzlich tauchten mehrere Yaquis aus dem dürren Gestrüpp an der Uferböschung auf. Terrazas zügelte sein Pferd.
„Que pasa, Mauricio?“, fragte er. „Was gibt es?“
Der Yaqui, zu dem er gesprochen hatte, trat näher an Terrazas’ schwarzen Hengst heran. Er war in zerlumptes Baumwollzeug gekleidet und hatte das strähnige, lange Haar im Nacken mit einem Lederriemen zu einem faustgroßen Knoten zusammengeschnürt. Er hatte eine niedrige, fliehende Stirn, eng zusammenstehende Augen und lange Arme. Mit dem langen Infanteriegewehr deutete er zu den Hügeln hinüber.
„In der Apachenranchería sind jetzt nur Frauen und Kinder und alte Männer“, sagte er auf Spanisch. „Aber von Süden nähert sich eine Staubwolke, mi Colonel.“
„Der alte Wolf kehrt also in seine Höhle zurück“, sagte Terrazas zufrieden.
„Si, mi Colonel!“, nickte der Yaqui eifrig und zog sich dann zu den anderen zurück.
„Bueno. Gut.“ Terrazas gab das Zeichen zum Absitzen und schwang sich aus dem Sattel. Jeweils vier Soldaten übergaben die Zügel ihrer Pferde einem fünften, stießen die Lanzenschäfte in die Erde und zogen die Sharps-Karabiner aus den Sattelschuhen.
Terrazas trat zwischen die Yaquis, die sich abseits niedergekauert hatten. „Hört zu!“, sagte er, zog einen Lederbeutel aus der Tasche, holte eine blinkende Goldmünze daraus hervor und hielt sie mit zwei Fingern hoch. „Das sind zwanzig Pesos in Gold, viel Geld für jeden von euch. Dafür gibt es in euren Dörfern Schnaps und Weiber, soviel ihr wollt. Dieses Goldstück gehört dem, der mir Victorios Kopf bringt.“
Er steckte die Münze wieder in den Beutel, und die Blicke der Yaquis wichen nicht von seinen Händen. Ein gieriges Glitzern stand in ihren dunklen Augen.
„Adelante!“, sagte Terrazas. „Vorwärts! Mauricio, du führst uns.“
Soldaten und Yaquis arbeiteten sich langsam das Flussbett hinauf. Bald verließen sie den Arroyo, tauchten in die kalten, düsteren Schatten der Hügel und stolperten über Felsbrocken und durch dichtes Dornengestrüpp. Mauricio stieg einen lang gestreckten, kahlen Hang hinauf. Der Boden war nun nicht mehr sandig, und die Stiefel der Soldaten schürften über nacktes Gestein. Eine gewaltige Felsklippe erhob sich über ihnen. Ein steiler, schmaler Pfad führte nach oben. Vorsichtig kletterten die Männer hinauf.
Oben auf der Klippe hob Mauricio warnend die Hand. Geduckt schlichen die Soldaten bis zum Rand des Felsens und warfen sich nieder. Von der Klippe führte eine flache Geröllhalde in ein breites, muldenförmiges Hügeltal hinab – und dort unten flackerten Feuer, erhoben sich kuppelförmige Apachenhütten, weideten Pferde und Maultiere und bewegten sich dunkle Gestalten im Feuerschein.
Mauricio berührte Terrazas’ Arm und deutete nach Süden. Dort, jenseits des Talausgangs, wo zwanzig Meilen ebener Wüste in dem seltsam klaren Licht der untergehenden Sonne lagen, war eine helle Staubfahne zu erkennen. Terrazas richtete sein Fernglas darauf – und jetzt sah er Apachen vor der Staubwolke herreiten, die der Wind über die Ebene trieb.
„Mauricio“, sagte Terrazas und ließ das Glas sinken, „verteile deine Männer am Rand des Felsens. Sage ihnen, dass ich jeden aufhängen lasse, der einen Schuss abfeuert, bevor ich das Kommando gebe. Wenn ich es aber gebe, dann verschont niemanden – weder die Männer noch die Weiber oder Kinder.“
„Si, mi Colonel!“ Der Widerschein der roten Sonne blitzte in den Augen des Yaquis. Flach wie eine große Eidechse an den Felsen geschmiegt, schob er sich nach hinten, erhob sich und rannte geduckt am Rand der Klippe entlang. Terrazas gab seinen Männern ein Zeichen, und metallisches Klicken lief die Reihe der Soldaten entlang, als sie die Hämmer ihrer Gewehre spannten.
Mauricio gab Terrazas’ Befehle weiter. Plötzlich brach unten im Tal knatterndes Gewehrfeuer los, die Feuer flackerten höher, und in ihrem Lichtschein ritten die Apachenkrieger in langer Reihe in die Ranchería, beladene Maultiere mit sich führend. Lautes Geschrei drang zu den Yaquis herauf, die wie unförmige Schatten regungslos hinter ihren Gewehren lagen. Mauricio verfolgte über das Klappvisier seines Infanteriegewehres hinweg den vordersten Reiter mit dem Blick. Zusammengesunken kauerte ein weißhaariger Apache auf einem mageren Pferd. Er trug eine Winchester quer über den nackten Schenkeln, und der Schaft seiner langen Lanze wippte über seinem Kopf hin und her.
Der Yaqui kniff die Augenlider zu schmalen Schlitzen zusammen, sein Finger glitt in das stählerne Rund des Abzugsbügels und krümmte sich um den Abzug, als er sah, wie der Apache sich im Sattel aufrichtete – und im gleichen Augenblick gellte Terrazas’ Befehl:
„Fuego! Feuer!“
Mauricio drückte auf den Abzug. Der Schuss peitschte, und unten in der Talmulde brach Victorios Pferd mit schrillem Wiehern zusammen. Dann brach die Hölle los. Der Donner der Gewehre war so laut, dass er jeden anderen Laut verschlang. In Sekunden war der Rand der Felsklippe in davontreibenden Pulverrauch gehüllt.
„Indios diablos!“, fluchte Mauricio, während er das Schloss seines Gewehres aufriss, die rauchende, leere Patronenhülse auswarf, eine neue Patrone in die Kammer schob und den Hammer spannte.
Gellendes Schreien drang aus dem Tal herauf. Im ersten Bleihagel waren fünfzehn Apachen gefallen; die übrigen – Männer, Weiber und Kinder – versuchten, die Feuer zu löschen, oder warfen sich nieder, um den Kugeln zu entgehen, die die Hüttenwände zerfetzten und die Erde zwischen den qualmenden, zertretenen Feuern aufspritzen ließen.
Im schwachen Schein der Glut sah der Yaqui Victorio, die Winchester in der Hand, auf die Felsen am Rand des Lagers zulaufen. Er schoss und verfehlte ihn wieder; dann war der Indianer verschwunden.
Jetzt blitzten die ersten Schüsse zwischen den unförmigen Umrissen der Hütten auf. Mauricio hörte die Kugeln pfeifen. Das mondlose Dunkel des Tales wurde vom orangeroten Feuer der Gewehre gespenstisch erhellt. Die Yaquis beteiligten sich nicht am Salvenfeuer der Soldaten. Sie schossen langsam und zielten sorgfältig, wenn sich zwischen den Hütten die Schatten der von Deckung zu Deckung springenden Apachen bewegten. Die Krieger, die versucht hatten, zu den Pferden zu entkommen, waren die ersten Opfer der Yaqui-Scharfschützen geworden.
Mauricio schob eine neue Patrone in die Gewehrkammer und blickte zu Terrazas hinüber. Dort richtete sich ein Soldat auf den Knien auf, um besser zielen zu können, und fiel in der nächsten Sekunde, von der Kugel eines Apachen zwischen die Augen getroffen, vornüber. Sein Körper wirbelte den Abhang hinunter. Ein anderer Kavallerist stieß den Karabiner weg, griff sich mit beiden Händen an den Hals, rutschte zurück, keuchte und lag still.
Mauricio legte das Infanteriegewehr neben sich, zog seinen Poncho über den Kopf und legte seine Ledersandalen und die beiden Patronengurte ab. Den Riemen der Machete streifte er über den linken Arm und zog ihn bis zur Schulter hinauf. Zwei Patronen nahm er zwischen die Zähne, griff nach seinem Gewehr und kroch in eine schmale Felsrinne, die in die Talmulde hinabführte. In der Rinne war es dunkel. Über ihm zerrissen die Mündungsfeuer der Gewehre die Nacht. Behutsam glitt er zwischen den rauen Felsen dahin, das Gewehr vor sich herschiebend. Ab und zu hielt er inne und starrte zu den mächtigen Steinblöcken hinüber, zwischen denen Victorio verschwunden war.
Ungesehen erreichte er das Ende der Rinne und glitt lautlos in das Gestrüpp, das überall am Fuß des Abhangs wucherte.
Dornen drangen durch sein schmutziges Baumwollhemd und hinterließen blutige Risse in seinem Gesicht, auf seinen Händen und Armen. Aber ohne sich darum zu kümmern, kroch er weiter, das Kinn dicht über der Erde, und warf sich schließlich keuchend hinter einer niedrigen, natürlichen Felsbarriere nieder. Sein Atem rasselte, das Herz hämmerte in seiner Brust, und die Muskeln seiner Arme zuckten krampfhaft von der Anstrengung des Kriechens.
Minutenlang lag er bewegungslos, die Schulter gegen den kalten Stein gepresst, dann richtete er sich auf einem Unterarm auf, hob vorsichtig den Kopf – und sah Victorio, keine zwanzig Schritte entfernt, zwischen den Felsen kauern. Der Apache schob Patronen in seine Winchester, lud die Waffe durch, erhob sich halb und schoss zum Rand der Klippe hinauf, wo ununterbrochen Mündungsfeuer aufblitzten.
Der Yaqui ließ sich zurücksinken, zog das Infanteriegewehr zu sich heran, stellte sorgfältig das Klappvisier ein, spannte den Hammer und hob das Gewehr, bis er Victorios Gesicht genau im Visier sah – dann drückte er ab.
Victorio knickte in die Knie und fiel über seine Winchester, im Sturz den Abzugshahn berührend. Der Schuss peitschte, und die Kugel pflügte fünf Fuß weit durch den Staub.
Mauricio stieß einen gellenden Triumphschrei aus, ließ das Gewehr los und griff nach der Machete. Im gleichen Augenblick gab Terrazas den Befehl zum Angriff. Brüllend stürmten Soldaten und Yaquis die Abhänge hinunter und drangen in die Ranchería ein. Schüsse dröhnten, Feuerbrände wurden in die Hütten geworfen – die letzten Apachen fielen in erbitterten Kämpfen Mann gegen Mann. Sie starben stumm, ohne sich zu ergeben, ohne um Gnade zu flehen. Sie wussten, dass sie von den grausamen Siegern kein Erbarmen zu erwarten hatten. Sogar Frauen und Kinder wurden aus den Felsenlöchern gezerrt und getötet, denn die mexikanische Regierung bezahlte noch immer in Silber für jeden Apachenskalp. Dann war alles vorbei. Das Schreien verstummte, es fielen keine Schüsse mehr, und das Prasseln der brennenden Hütten war das einzige Geräusch, das die Stille erfüllte.
Terrazas stand, in jeder Hand einen Colt, inmitten des brennenden Lagers und gab Befehl, das ganze Tal nach überlebenden Apachen abzusuchen, die sich vielleicht zwischen den Felsen und im Gestrüpp versteckt hatten, um in der Dunkelheit dem Massaker zu entrinnen.
„Sucht nach Victorio!“, rief er. „Zwanzig Goldpesos dem, der ihn findet. Zwanzig Goldpesos dem, der mir seinen Kopf bringt.“
Auf einmal wurde es still; die Soldaten und Yaquis wichen zurück. Im flackernden Schein der wie Scheiterhaufen brennenden Hütten tauchte Mauricio auf. Er hielt das blutige Messer in der einen Hand, in der anderen trug er an dem langen Haar den Kopf eines Apachen, den er Terrazas vor die Füße warf.
„Das war Victorio, mi Colonel“, sagte er und wischte mit Daumen und Zeigefinger das Blut von der Klinge. „Vergiss nicht, was du dem versprochen hast, der ihn tötet.“
Terrazas schob die beiden Colts in die Holster und blickte auf das grausige Siegeszeichen nieder – dann warf er dem Yaqui die Goldmünze zu.
*
Das geschah in der Nacht zum 14. Oktober 1880 in den Tres-Castillos-Hügeln, fünfundzwanzig Meilen südwestlich der Los-Pinos-Berge, in der mexikanischen Provinz Chihuahua. Mehr als 120 Apachen wurden in jener Nacht getötet. Die Verluste der mexikanischen Truppen betrugen drei Gefallene und zwölf Verwundete. Die Legende von Victorio war zu Ende.
Es war nicht so, dass die Apachen nicht schon seit langer Zeit erkannt hätten, dass die Sonne ihres Volkes untergehen würde. Schon im Jahre 1846, während des mexikanisch-amerikanischen Krieges, als sich die mexikanische Armee, auf dem Schlachtfeld besiegt, auf der Flucht befand, sagte Mangas Coloradas, der Anführer der Mimbre-Apachen: „Wir müssen den Pfad des weißen Mannes gehen! Wir müssen! Diese Weißaugen sind Krieger, sie sind tapfer. Wir müssen werden wie sie! Sie bekämpfen die Mexikaner. Für die Mexikaner ist die Sonne untergegangen. Für die Apachen ist es Abend. Wir müssen den Pfad der Weißen gehen! Die Sonne wird für uns untergehen, wenn wir es nicht tun. Wir können nicht gegen sie kämpfen. Wir können sie nicht vernichten. Sie sind Unkraut. Zehn wachsen nach, wo einer ausgerissen wurde. Um zu überleben, müssen wir uns diese Weißaugen zu Freunden machen! Wenn wir nicht in Frieden mit ihnen leben, wird die Sonne für uns untergehen, und dann wird nichts als Finsternis sein.“
Aber die Erinnerung der Apachen an die Weißaugen war alt und blutig. Lange bevor amerikanische Truppen in die Apacheria eindrangen, waren Weiße, einzeln und in kleinen Gruppen, aus dem Norden gekommen. Und im Jahre 1837, als die mexikanische Regierung eine Prämie von einhundert Silberpesos auf jeden Apachenskalp ausgesetzt hatte, waren 400 friedliche Apachen bei den Kupferminen von Santa Rita del Cobre von amerikanischen Skalpjägern und mexikanischen Soldaten niedergemetzelt worden.
Santa Rita wurde niedergebrannt, und von den 400 Einwohnern erreichte kaum ein halbes Dutzend die nächste mexikanische Stadt, Janos. In einer Folge schneller, grausamer Raubzüge drangen die Apachen nach Chihuahua, Sonora und bis nach Durango vor, verbrannten Ranchos, kleine Ansiedlungen und Militärposten, stahlen Pferde, raubten Vieh und hinterließen eine breite Spur von Feuer und Blut.
Dann aber brach im Jahre 1846 der mexikanisch-amerikanische Krieg aus, und General Stephen Watts Kearny zog mit den Reitern des 1. US-Kavallerieregiments durch die Apacheria, um die letzten feindlichen Truppen, die sich in dem wilden, ehemals zu Mexiko gehörenden Land noch hielten, nach Süden zu treiben.
Mangas Coloradas und Geronimo ritten in Kearnys Lager, um die Weißaugen als Bundesgenossen in ihrem Kampf gegen die Mexikaner zu gewinnen. Aber sie mussten rasch erkennen, dass das alte Wort, nach dem ein Apache außerhalb seines eigenen Volkes keine Freunde hatte, auch auf die Weißaugen zutraf. Kearny hatte nur Verachtung für die gefürchteten Wüstenkrieger – und er hatte genug Soldaten, um seine Verachtung offen zeigen zu können.
„Sie sind zu stark. Sie glauben, ein starker Mann braucht keine Freunde“, sagte Geronimo, als die Apachen Kearnys Lager mit dem Versprechen, ihm Pferde und Maultiere zu verkaufen, wieder verlassen hatten. „Und es gibt nur eines, was sie achten: die nackte Gewalt.“
Kearnys Regiment zog durch die Apacheria und kam nicht mehr zurück. Aber andere Weiße kamen – und sie verließen das Apachengebiet nicht wieder.
„Sie durchwühlen die Erde nach weißem und gelbem Eisen, treiben ihr Vieh darüber hinweg oder reißen den Boden mit scharfen Eisen auf, um zu säen, wie die Mexikaner vor ihnen gesät haben. Sie werden unsere Erde nicht gutwillig verlassen, Mangas“, sagte Geronimo. „Jeden Tag kommen mehr Weißaugen in die Apacheria. Lass sie uns töten, wie wir die Mexikaner getötet haben – aber lass es uns bald tun. Jetzt können wir sie noch besiegen; aber eines Tages werden sie zu zahlreich und zu stark sein, und dann werden sie uns vernichten.“
„Wir haben gegen die Mexikaner gekämpft, bis unsere Waffen vom vielen Töten stumpf und unbrauchbar wurden“, erwiderte Mangas Coloradas, am Feuer seiner Hütte hockend, den mächtigen Schädel gesenkt und aus düsteren Augen in die Glut starrend. „Und doch konnten wir sie nicht alle töten, denn für jeden erschlagenen Mexikaner kamen zehn andere, um seinen Platz einzunehmen. Sie gleichen nicht den Mexikanern. Sie sind Krieger wie die Apachen. Um sie zu besiegen, musst du sie töten, alle. Nein, wir müssen versuchen, in Frieden mit ihnen zu leben.“
Aber es gab keinen Frieden. Cochise und seine Chiricahuas waren die Ersten, die Weißaugen töteten, zuvor hatten im Herbst 1860 Soldaten aus Fort Buchanan als Vergeltungsmaßnahme für die Entführung eines weißen Kindes und den Diebstahl mehrerer Pferde Cochises Bruder und fünf andere Apachen aufgehängt.
Die Kämpfe dauerten bis zum Jahre 1861, als der Bürgerkrieg zwischen den Nord- und Südstaaten ausbrach. Immer mehr Truppen wurden aus Arizona und Neu-Mexiko abgezogen – und nun begann die fünfundzwanzigjährige Schreckensherrschaft der Apachen im Südwesten. Bald hieß es, man könne von einem Ende des Apache-Passes zum anderen gehen, ohne den Fuß auf die Erde zu setzen – so dicht lägen dort die Wagentrümmer und Skelette der Opfer.
1862 erkämpfte sich die E-Kompanie des 1. Kalifornischen Infanterieregiments unter dem Kommando von Captain Roberts einen Weg durch den Pass; und nur der Umstand, dass Roberts zwei Feldgeschütze mit sich führte, rettete seine Kompanie bei dem Kampf um die Passhöhe vor der völligen Vernichtung durch die Apachen.
So ging der Krieg zwischen Weißen und Indianern weiter – verbissen und gnadenlos. Keine Seite erwartete, keine Seite zeigte Erbarmen. General Carleton, der während des Bürgerkriegs den hochherzigen General E. R. S. Canby im Kommando des Südwestens ablöste, begann einen gnadenlosen Vernichtungskrieg gegen die Apachen. Sein berüchtigter Befehl an alle Offiziere der ihm unterstellten Truppenteile lautete: „Die Männer der Apachen und Navajos sind zu erschlagen, wo immer sie angetroffen werden. Frauen und Kinder sind gefangen zu nehmen, dürfen aber nicht getötet werden.“
Carletons erstes Ziel war die Niederwerfung der Mimbre-Apachen, die sich bei den Quellen des Gila River, nahe der Goldminen von Pinos Altos in Neu-Mexiko aufhielten. 1863 befahl er Colonel Joseph R. West, als ersten Schritt des geplanten Vernichtungsfeldzugs, Mangas Coloradas gefangen zu nehmen. West seinerseits betraute Captain Shirland mit der Durchführung des Auftrags.
„Gleich, ob tot oder lebendig, nur fangen Sie ihn. Mit List oder Gewalt“, befahl er Shirland.