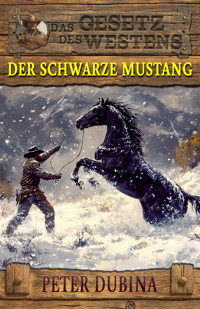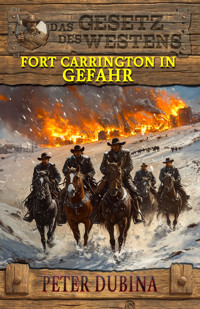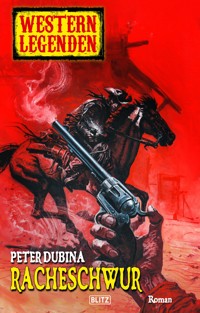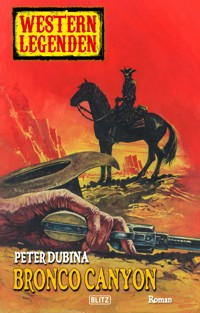Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Western Legenden (Historische Wildwest-Romane)
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Nach Jahren blutiger Kämpfe unterwerfen sich viele Apachenstämme den Amerikanern. Doch Geronimo und seine Krieger wollen nicht wehrlos im Käfig der Reservation dahinsiechen. Wie Geister tauchen sie auf, schlagen zu und verschwinden. Erbarmungslos wie das Land, durch das sie ziehen, ist der Kampf, den sie gegen Amerikaner, mexikanische Soldaten und Indianerpolizisten führen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Western Legenden
In dieser Reihe bisher erschienen
9001 Werner J. Egli Delgado, der Apache
9002 Alfred Wallon Keine Chance für Chato
9003 Mark L. Wood Die Gefangene der Apachen
9004 Werner J. Egli Wie Wölfe aus den Bergen
9005 Dietmar Kuegler Tombstone
9006 Werner J. Egli Der Pfad zum Sonnenaufgang
9007 Werner J. Egli Die Fährte zwischen Leben und Tod
9008 Werner J. Egli La Vengadora, die Rächerin
9009 Dietmar Kuegler Die Vigilanten von Montana
9010 Thomas Ostwald Blutiges Kansas
9011 R. S. Stone Der Marshal von Cow Springs
9012 Dietmar Kuegler Kriegstrommeln am Mohawk
9013 Andreas Zwengel Die spanische Expedition
9014 Andreas Zwengel Pakt der Rivalen
9015 Andreas Zwengel Schlechte Verlierer
9016 R. S. Stone Aufbruch der Verlorenen
9017 Dietmar Kuegler Der letzte Rebell
9018 R. S. Stone Walkers Rückkehr
9019 Leslie West Das Königreich im Michigansee
9020 R. S. Stone Die Hand am Colt
9021 Dietmar Kuegler San Pedro River
9022 Alex Mann Nur der Fluss war zwischen ihnen
9023 Dietmar Kuegler Alamo - Der Kampf um Texas
9024 Alfred Wallon Das Goliad-Massaker
9025 R. S. Stone Blutiger Winter
9026 R. S. Stone Der Damm von Baxter Ridge
9027 Alex Mann Dreitausend Rinder
9028 R. S. Stone Schwarzes Gold
9029 R. S. Stone Schmutziger Job
9030 Peter Dubina Bronco Canyon
9031 Alfred Wallon Butch Cassidy wird gejagt
9032 Alex Mann Die verlorene Patrouille
9033 Anton Serkalow Blaine Williams - Das Gesetz der Rache
9034 Alfred Wallon Kampf am Schienenstrang
9035 Alex Mann Mexico Marshal
9036 Alex Mann Der Rodeochampion
9037 R. S. Stone Vierzig Tage
9038 Alex Mann Die gejagten Zwei
9039 Peter Dubina Teufel der weißen Berge
9040 Peter Dubina Brennende Lager
9041 Peter Dubina Kampf bis zur letzten Patrone
9042 Dietmar Kuegler Der Scout und der General
Peter Dubina
Brennende Lager
GeronimoBand 2
Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2021 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-661-3Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Prolog
In den ersten Frühlingstagen des Jahres 1858 verließ Mangas Coloradas mit mehreren Hundert Mimbre-Apachen die von steilen Felsflanken geschützte Bergfeste seines Volkes. Er wollte nach Mexiko ziehen, denn über den Bergen und Wüsten von Arizona dröhnten die Apachentrommeln, und Kriegsfeuer loderten in den hellen Nächten auf hohen, nackten Felszinnen.
Sechs Chiricahua-Apachen, unter ihnen Cochises eigener Bruder Naretena und die beiden Söhne seines Bruders Juan, waren von weißen Soldaten getötet worden. Cochise selbst hatte ihre Körper von den Ästen des Ahornbaumes geschnitten, an denen sie, nur einen Steinwurf von der Poststation entfernt, auf der Höhe des Apache-Passes gehenkt worden waren.
Einige Zeit zuvor waren der Sohn des weißen Ranchers John Ward aus dem Sonoita-Tal und eine Anzahl Pferde und Maultiere von Apachen geraubt worden. Cochise war deshalb mit einigen seiner Krieger waffenlos und unter einer weißen Fahne zu Buckleys Poststation hinaufgeritten, um mit Lieutenant George N. Bascom vom siebten Infanterieregiment zusammenzutreffen. Der Leutnant erwartete ihn dort mit John Ward und einem Trupp berittener Infanterie.
„Ich weiß nichts von dem Kind, von dem du sprichst, Nantan“, sagte Cochise. „Es lebt nicht bei meinem Volk. Aber ich werde Boten zu den anderen Apachenstämmen schicken, und wenn das Kind und die gestohlenen Tiere dort sind, so werden sie zurückgegeben werden.“
Lieutenant Bascom, der an einem der schießschartenartig schmalen Fenster stand, wandte sich um. Er war ein noch sehr junger Mann mit rötlich-blondem Haar, einem dünnen Schnurrbart und hochmütigen, kalten, blauen Augen.
„Dein Wort steht gegen das von Mister Ward“, versetzte er schroff und deutete auf den Rancher, der, einige Schritte entfernt, finster an dem steinernen Kamin lehnte. „Und Mister Ward behauptet, es seien Chiricahua-Apachen gewesen, die seinen Sohn und die Tiere raubten.“
Cochises Bruder Naretena wollte einen Schritt auf Bascom zugehen, doch eine Handbewegung des Häuptlings hielt ihn zurück. Cochises Gesicht blieb verschlossen und ausdruckslos. Er hatte die Sturheit und den Indianerhass in den Augen des jungen Offiziers gesehen, und er wusste nun, dass es schwer sein würde, ihn von der Wahrheit zu überzeugen.
„Seit mehr als fünf Erntezeiten hat es keinen Krieg mehr zwischen meinem Volk und den Weißaugen gegeben“, erwiderte er langsam und deutlich, sodass der Lieutenant ihn genau verstehen konnte. „Die Amerikaner zogen von Sonnenaufgang nach Sonnenuntergang durch die Apacheria, und wir bekämpften sie nicht. Wenn sie hungrig waren, haben wir ihnen zu essen gegeben; wenn sie durstig waren, haben wir ihnen zu trinken gegeben. Wir haben mit ihnen Handel getrieben, aber wir haben nicht gegen sie gekämpft, Nantan. Sage mir, wie dieses Kind aussieht und wie viele Tiere gestohlen wurden, dann werde ich Krieger zu den Coyoteros, den Mescaleros, Mimbres und White-Mountain-Apachen schicken, und das Kind und alle Pferde und Maultiere werden zurückgegeben.“
Lieutenant Bascom verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich mit einer Schulter gegen die Mauer neben dem Fenster. Er betrachtete Cochise, und seine Mundwinkel zuckten verächtlich.
Der Apache war einfach gekleidet. Er trug ein Baumwollhemd, einen ledernen Lendenschurz und kniehohe Mokassins. Das lang herabfallende, schwarze Haar wurde über der Stirn von einem roten Stoffstreifen gehalten, und eine alte, schwarze Navajodecke mit rotem und weißem Zickzackmuster hing über seinem linken Arm.
Bascom dachte an die Geschichten über die Grausamkeit dieser gefürchteten Wüstenkrieger. Diese Apachen, die da vor ihm standen, sahen eher wie heruntergekommene Landstreicher aus. Wahrscheinlich verstanden sie nur eine Sprache: die der Gewalt.
John Ward, der neben Bascom stand, schüttelte den Kopf. „Dieser verdammte Halsabschneider lügt“, sagte er wütend.
Cochise stand noch immer regungslos da, obwohl er die Worte des Weißen sehr gut verstanden hatte. Sein Gesicht blieb starr und ausdruckslos wie eine hölzerne Tanzmaske. Einen Apachen der Lüge zu bezichtigen, war eine Beschimpfung, die nur mit Blut abgewaschen werden konnte. Doch Cochise wusste, dass es Krieg bedeuten musste, wenn er auch nur einen Tropfen vom Blut eines Weißen vergoss. Seine Augen, flach und leblos wie die Augen einer Eidechse auf einem sonnenheißen Stein, waren auf Bascoms Gesicht gerichtet. Eine Minute verstrich in schwerem, drückendem Schweigen, dann öffnete Bascom endlich die dünnen Lippen.
„Du bist ein Lügner, Cochise!“, sagte er mit harter, herausfordernder Stimme. „Ich glaube, dass deine Männer das Kind und die Tiere gestohlen haben. Ich werde dich in Ketten legen lassen, bis das Kind, das letzte Pferd und das letzte Maultier zurückgegeben worden sind.“
Er gab Sergeant Reuben Bernard, der mit vier Soldaten neben der Tür stand, ein Zeichen.
„Sergeant, nehmen Sie diese Bastarde fest und lassen Sie sie in Eisen schmieden!“, befahl er.
Bernard und die vier Infanteristen mit ihren langen Musketen und den aufgepflanzten Bajonetten traten auf die Indianer zu. Mit einem Wutschrei fuhr Cochise herum.
„Weißer Hund!“, schrie er Bascom ins Gesicht. Die schwarze Navajodecke fiel zu Boden, und Cochise hielt ein Messer in der Hand.
„Fort von hier! Folgt mir!“, rief er den anderen Apachen zu. Er schlug einen Gewehrlauf zur Seite, und die lange Messerklinge zog blitzende Kreise. Die Soldaten wichen zurück, und Cochise stürmte durch die Tür ins Freie und den Hügelhang hinauf, der neben der Poststation steil anstieg.
Die übrigen Indianer versuchten, ihm zu folgen, doch sie fanden die Soldaten vorbereitet. Naretena wurde mit einem Gewehrkolben niedergestreckt, und einer von Juans Söhnen bekam einen Bajonettstich in den Leib. Die anderen ergaben sich, als sie sich von einem Ring schussbereiter Gewehre umgeben sahen.
Cochise rannte geduckt den Hang hinauf. Hinter ihm kamen Soldaten vom Corral gelaufen, wo sie im Schatten der drei Fuß hohen Mauer aus aufeinandergeschichteten Steinbrocken biwakiert hatten. Einige von ihnen blieben stehen und hoben die Gewehre. Schüsse krachten, und Cochise taumelte, als eine Kugel seine Schulter traf. Er stürzte, raffte sich wieder auf und verschwand, eine dünne Blutspur im Staub hinter sich lassend, zwischen Felsen und Gestrüpp.
„Verfolgen Sie ihn, Sergeant!“, befahl Bascom, der hinter Cochise und Bernard aus der Tür gestürzt war. „Finden Sie ihn, und bringen Sie ihn zurück!“
Der Sergeant schob langsam den Reitercolt ins Holster und schloss die lederne Klappe.
„Er ist uns entkommen“, murmelte er. „Den finden wir jetzt nicht mehr. Er hat sich dort oben irgendwo verkrochen.“ Er deutete mit dem Kinn zu den Felsen der Passhöhe in dem harten, flirrenden Sonnenlicht hinauf.
„Wir können uns an die Gefangenen halten“, erwiderte Bascom. „Wenn Cochise den Ward’schen Jungen und die gestohlenen Pferde nicht herausgibt, werden die sechs Apachen aufgehängt.“
Bernard sah ihn unbehaglich an. Im Gegensatz zu Bascom war er ein altgedienter Soldat und hatte Erfahrungen in ungezählten Gefechten gegen Apachenbanden gesammelt.
„Ich halte nicht viel von diesen Indianern, Sir“, sagte er. „Aber wenn Sie die Gefangenen hängen lassen, brocken wir uns mehr ein, als wir schlucken können. Cochise wird das nicht hinnehmen.“
Bascom musterte den Sergeant mit einem langen, kalten Blick seiner hellen Augen. „Es ist allmählich an der Zeit, dass die Apachen begreifen, wer in diesem Land zu befehlen hat“, sagte er in einem Tonfall, der keinen Widerspruch duldete. „Für sie zählt nur eines – die Gewalt. Lassen Sie die Gefangenen in Ketten legen und bewachen.“
Er wandte sich um, blickte zu der weißen Fahne empor, die an einem Pfahl neben der Poststation flatterte, riss sie herunter und trat sie mit dem Stiefelabsatz in den Sand.
*
In der Nacht glühte der Himmel im Westen in unheildrohendem, rotem Feuerschein, und die Soldaten auf Buckleys Station lagen schlaflos hinter ihren schussbereiten Gewehren und starrten in das fahle Zwielicht der mondhellen Nacht. Doch alles blieb ruhig, und nur das Heulen der Coyoten auf der Passhöhe durchbrach ab und zu die unheimliche Stille.
Gegen Mitternacht verließ Lieutenant Bascom, in seinen schweren Armeemantel gehüllt, die schützende Wärme der Station. Die Nacht war kalt, und ein schneidender Wind strich über den Pass.
Sergeant Bernard stand neben dem Brunnen, die stählerne Kolbenplatte des Gewehres auf die steinerne Umfassung gestützt, beide Hände um den Lauf der Muskete gelegt, das Schild der Infanteriekappe tief ins Gesicht gezogen.
„Ich möchte wissen, was dort geschehen ist“, sagte Bascom, und sein Blick ging zu dem Feuerschein im Westen.
„Wenn es das ist, was ich glaube“, murmelte Bernard, „werden wir bei Tagesanbruch mehr Apachen hier haben, als uns lieb sein kann, Sir.“
Bascom schlug fröstelnd seinen Mantelkragen hoch. „Schicken Sie einen Kurier nach Fort Breckenridge, Sergeant. Er soll unbedingt Hilfe holen, und wenn er dabei sein Pferd zuschanden reiten muss.“
Sergeant Reuben Bernard dachte an die sechs Gefangenen, die unter Bewachung und in schweren Ketten in der Schmiede der Poststation lagen, doch er sagte nichts. Er zuckte nur mit den Schultern, wechselte die Muskete in die andere Hand und ging, um einen Meldereiter loszuschicken.
Im Morgengrauen, als der Himmel bleich wurde und die Erde, Felsen, Sand und Berge gleichmäßig grau waren, gab Lieutenant Bascom Befehl, Pferde und Maultiere zur Wasserstelle in der Tiefe des Passes zu treiben. Als die Soldaten das schlammige Wasserloch erreicht hatten, peitschten plötzlich Schüsse durch das Zwielicht des Canyons. Durch die Stirn geschossen, brach einer der Männer zusammen. Zwei andere wurden schwer verwundet von ihren Kameraden 600 Schritte weit in die Deckung der steinernen Corralmauern zurückgeschleppt.
Nun wusste Bascom, dass er mit seinem Kommando eingeschlossen war. Überall in den scheinbar leblosen, kahlen Berghängen hatten sich die Scharfschützen der Apachen eingenistet, denen keine Bewegung auf der Poststation entging. Sie selbst blieben unsichtbar, und das Einzige, was ihre Stellungen in den Felswänden verriet, war Pulverrauch, der im Wind davontrieb. Die Soldaten erwiderten vom Haus und dem Corral her das Feuer, aber sie schossen blindlings, denn nirgendwo bot sich ihnen ein Ziel.
„Sergeant“, schrie Lieutenant Bascom durch das Krachen der schweren Militärgewehre, die das Innere der Poststation mit Pulverdampf erfüllten, „nehmen Sie sich zwei Männer und führen Sie die Gefangenen in Ketten vor den Schuppen! Wenn die Apachen das Feuer nicht einstellen, werden die Gefangenen erschossen.“
Kaum traten die Soldaten mit den sechs gefangenen Indianern, zwischen deren Fußknöcheln bei jedem Schritt die Eisenketten klirrten, vor die Schmiede, als sich eine unheimliche Stille über die Passenge senkte. Die Soldaten ließen die Gewehre sinken.
Plötzlich tauchten mehrere berittene Apachen am Eingang des Passes auf. Bascom sah Cochise durch das Fernrohr. Das Gesicht des Chiricahua-Häuptlings war mit roter und schwarzer Farbe bemalt, und eine einzelne Adlerfeder ragte aus seinem Stirnband. Er trug einen Köcher mit Pfeilen auf dem Rücken, über dem Sattelknauf lag ein Kavalleriekarabiner, und mit der rechten Hand hielt er den langen Schaft einer Lanze aufrecht, von der Federn herabhingen.
Und dann sah Bascom, dass die Apachen einen Gefangenen vor sich hertrieben. Es war ein Weißer mit blondem Haar und blondem Bart. Sein Gesicht und sein nackter Oberkörper waren blutig und zerschunden, seine Hosen zerfetzt. Seine Füße waren bloß, die Arme waren ihm auf dem Rücken zusammengeschnürt, und die Lassoschlinge eines Apachen lag lose um seinen Nacken.
Cochise senkte den langen Speer, hielt ihn dem Gefangenen in den Rücken und trieb ihn so vorwärts. Bis auf fünfzig Schritte ritten die Apachen an die Station heran, bevor sie ihre Pferde zügelten. Cochise richtete sich in den Steigbügeln auf.
„Hör gut zu, weißer Hund!“, rief er zum Haus hinüber. „Wir haben vier weiße Männer in unserer Gewalt. Hast du während der Nacht den Feuerschein am Himmel gesehen? Noch sind keine Amerikaner getötet worden. Lass meinen Bruder und meine anderen Männer frei, und ich will dir meine Gefangenen geben. Wir haben nichts mit dem geraubten Kind zu schaffen, und kein Krieger meines Volkes hat ein Pferd gestohlen. Gib mir meine Männer wieder, Soldatenjunge, sonst müssen die gefangenen Amerikaner sterben.“
„Dieser verdammte, verräterische rote Hundesohn!“, stieß Ward, der neben Bascom stand, hervor. Er hob seinen Wesson-Karabiner, doch der Lieutenant schlug ihm den Lauf der Waffe herunter. Im gleichen Augenblick tauchte auf der anderen Seite des Passes, wo, wie Bascom geglaubt hatte, kein Apache sein konnte, ein berittener Indianer auf und schwang eine rote Decke wie eine Fahne über dem Kopf.
Cochise zügelte sein unruhig stampfendes Pferd.
„Gib mir meine Männer wieder!“, rief er noch einmal zur Poststation hinüber.
„Sie werden erst freigelassen, wenn du das geraubte Kind und die gestohlenen Pferde und Maultiere zurückgibst“, antwortete Bascom. „Und versuche nicht, sie mit Gewalt zu befreien. Ich habe Befehl gegeben, die Gefangenen zu erschießen, wenn ihr die Station angreift.“
„Um Gottes willen, Lieutenant, holt uns heraus!“, schrie der gefangene Amerikaner, und er stolperte einige Schritte auf das Haus zu, bis das sich straffende Seil um seinen Hals ihn zurückriss. „Lieutenant, lasst nicht zu, dass sie uns umbringen. Sie haben uns gesagt, was sie von Ihnen wollen. Gebt die Gefangenen heraus, bevor die Apachen uns umbringen.“
„Du hast meine Entscheidung gehört, Cochise!“, rief Bascom, ohne auf das Flehen des Gefangenen zu achten. „Gib das Kind zurück, und ich werde deine Männer freilassen. Wenn du es nicht tust, werden sie aufgehängt.“
Cochise starrte noch immer zu der Schmiede hinüber, vor der die Gefangenen standen. Einer von ihnen, der bei seiner Gefangennahme vom Bajonett eines Soldaten getroffen worden war, konnte sich kaum auf den Beinen halten. Zwei andere Apachen stützten ihn mit ihren gefesselten Händen.
Auf einmal warf Cochise sein Pferd herum, stieß ihm die stumpfen Fersen seiner Mokassins in die Weichen und preschte zurück zum Ausgang des Passes.
Hinter ihm zerrte der Apachenkrieger, der den Gefangenen am Lasso hielt, mit einem wilden Schrei sein Pintopferd zurück. Das Seil straffte sich und riss den Mann zu Boden. Er versuchte, noch einmal auf die Beine zu kommen, wurde aber von einem scharfen Lassodruck gleich wieder umgerissen. Zusammen mit den übrigen Apachen ritt der Krieger in vollem Galopp hinter Cochise her und schleifte den Gefangenen wie einen Sack voll Mais über die harte, steinige Erde.
Bascoms Wangenmuskeln zuckten über seinen zusammengepressten Lippen. „Dafür werden sie bezahlen!“, sagte er heiser. „Dafür werden sie teuer bezahlen müssen!“
*
Eine Stunde später wusste er, weshalb Cochise und seine Krieger den Canyon verlassen hatten. Eine staubbedeckte, blaue Kolonne von Soldaten ritt von Westen her über die Passhöhe. Es war eine Kavalleriekompanie aus Fort Breckenridge.
Das Kommando war zwei Meilen westlich des Apache-Passes auf die Überreste eines verbrannten Frachtwagenzuges gestoßen.
„Aber unter den Toten, die wir fanden, war kein einziger Amerikaner“, sagte Lieutenant Moore, als er mit einer Zinnkelle Wasser aus einem Holzeimer schöpfte, der im Schatten der Hauswand stand. „Die Apachen haben nur die Mexikaner getötet, die bei den Wagen waren.“
„Cochise hat den Überfall unternommen, um ein Faustpfand zu haben“, erwiderte Bascom. „Er will das Leben von vier Amerikanern gegen das der sechs gefangenen Apachen eintauschen. Ich habe ihm gesagt, die Gefangenen würden aufgehängt, wenn er den geraubten Ward’schen Jungen nicht herausgibt.“
Moore ließ die Kelle sinken, wischte sich mit einem Handrücken das Wasser vom Kinn und sah Bascom seltsam an.
„Ihre Worte, Mister Bascom, werden vielleicht vier weißen Männern das Leben kosten“, sagte er.
Moore war First Lieutenant und damit der ranghöchste Offizier auf der Station. Er schickte mehrere Patrouillen aus, um das Lager der Apachen zu finden.
Nördlich des Passes stieß eine dieser Patrouillen in den Bergen auf eine verlassene Ranchería. Das Dorf war zerstört, die Hütten verbrannt, und nur Bussarde und Krähen kreisten in der Luft.
Fünfzig Schritte von der Grenze des Lagers entfernt fanden die Soldaten vier verbrannte, vielfach von Lanzen durchbohrte Körper. Die Toten wurden zur Station gebracht, und Lieutenant Bascom und Sergeant Bernard erkannten in einem der Männer, der helles Haar hatte, den Gefangenen wieder, den Cochise ihnen gezeigt hatte.
Moore warf nur einen kurzen, angeekelten Blick auf die Toten, dann drehte er sich um, nahm seinen Kavalleriehut ab und wischte sich mit einem Ärmel seiner Uniformjacke den Schweiß aus dem Gesicht.
„Wir werden den Apachen zeigen, dass wir Gleiches mit Gleichem vergelten“, sagte er. „Holt die Gefangenen und hängt sie auf!“
Es war ein kalter Morgen. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, der Himmel leuchtete schwefelgelb, und ein schneidender Wind trieb lange Staubfahnen über die Passhöhe, als die sechs Indianer aus der Schmiede geholt wurden, wo sie die ganze Nacht über bewacht worden waren.
Ihre Ketten schleiften bei jedem Schritt klirrend über die Erde, als sie auf den Gipfel eines Hügels geführt wurden, auf dem ein mächtiger Ahornbaum aufragte. Zwei von ihnen hielten den durch einen Bajonettstich verwundeten Apachen aufrecht zwischen sich. Sie wussten genau, was mit ihnen geschehen würde; sie hatten es in den Gesichtern der weißen Soldaten gelesen, als sich die Türe ihres Gefängnisses geöffnet hatte. Die Gefangenen blieben unter des Sycamore Trees stehen; sechs Schlingen wurden über die stärksten Äste geworfen, und die Indianer wurden gehängt.
*
Auf dem Beratungsplatz der Mimbre-Apachen, einer riesigen Felsenplatte nahe dem Eingang der Bergfeste des Stammes, herrschte dumpfe Stille, als Cochises Bruder Juan schwieg.
Mangas Coloradas ließ seinen Blick über die Männer gleiten, die in weitem Kreis auf dem Felsen saßen. Er wusste, dass Cochise seine Hilfe im Kampf gegen die Amerikaner brauchte; denn sein Volk war zahlenmäßig weitaus stärker als Cochises Chiricahuas.
Mangas Coloradas dachte an den Tag zurück, an dem er von den weißen Goldgräbern in Pinos Altos ausgepeitscht worden war, und die hundert tiefen Narben auf seinem Rücken begannen wieder zu schmerzen. Er hasste die Weißaugen ebenso wie Cochise, aber er wollte nichts mit dem Krieg der Chiricahuas zu tun haben. Er verweigerte Cochise seine Hilfe, und noch in der gleichen Nacht führte er die Mimbre-Apachen auf den langen Weg nach Süden, nach Mexiko, wo das Volk in Sicherheit sein würde.
Stumm befolgten Geronimo und die anderen Krieger Mangas’ Befehle, obwohl sie lieber in ihren Bergnestern geblieben wären, um von hier aus mit Cochise gegen die Weißen zu kämpfen.
Geistgesicht, der Winter, war eben nach Norden gezogen, und der Vorfrühling, den die Apachen Kleiner Adler nannten, näherte sich von Süden. 1.200 Krieger, Squaws und Kinder zogen mit 5.000 Pferden und Maultieren durch wildes, einsames Land zu der mexikanischen Stadt Casas Grandes, um dort friedlich Handel zu treiben.
In mehrere große Stammesgruppen aufgeteilt, schlugen die Apachen ihre Lager in den Bergen auf. Doch die mexikanische Armee ließ ihnen wenig Zeit, um den Handel mit den Bürgern von Casas Grandes in Schwung zu bringen. Zwei Tage später kehrte Geronimo in die Ranchería zurück, und schon von Weitem kündigte ihm eine Wolke von Bussarden und Krähen an, was geschehen war. Überall lagen tote Pferde und Mulis und erschossene Apachen. Verbrannte Hütten schwängerten die Luft mit dem Geruch von Rauch und kalter Asche. Während der Abwesenheit der kampffähigen Männer waren Greise, Kranke und Verwundete, Frauen und Kinder von den Lanzenreitern General Carascos, des Militärgouverneurs der mexikanischen Provinz Sonora, niedergemetzelt worden.
An diesem grauenvollen Tag stand Geronimo über die Leichen seiner ermordeten Familie gebeugt und schwor allen weißen Menschen – Mexikanern und Amerikanern – furchtbare Rache.
Hunderte von Mexikanern zahlten mit ihrem Leben für das, was Geronimo zugefügt worden war. Ganze Städte wurden von den Apachen geplündert und verwüstet und zahllose Frauen in Gefangenschaft geschleppt. Doch Geronimos Rachedurst blieb ungestillt; die Wunde, die ihm geschlagen worden war, wollte sich nicht schließen.
Er wusste, es würde niemals wieder so werden, wie es gewesen war, bevor die Weißaugen in die Apacheria eindrangen. Die Sonne seines Volkes neigte sich dem Abend zu. Auch Mangas Coloradas sah es. Verzweifelt bemühte sich der alte Mimbre-Häuptling, den Frieden zu bewahren. Er hatte hingenommen, dass die Amerikaner sich zu den wahren Herren der Apacheria gemacht hatten, wie er es hingenommen hatte, dass er von ihnen in Pinos Altos halb zu Tode gepeitscht worden war. Er war zu alt geworden und hatte zu viel gesehen, um noch an einen gerechten Frieden zu glauben. Er wollte sein Volk vor der Vernichtung bewahren.
Vergeblich hatte er versucht, mit den Weißaugen Frieden zu schließen. Sie hatten die Freundschaft der Apachen zurückgestoßen, denn sie waren ein zahlreiches und mächtiges Volk, und wer stark ist, der braucht keine Freunde. Sie hatten nur Hass und Verachtung für die Apachen.
Dann kam das Jahr 1861 und mit ihm der Ausbruch des Rebellionskrieges zwischen den Nord- und Südstaaten. Der Krieg, der im Osten tobte, zwang die amerikanische Armee vorübergehend zum Verlassen der Apacheria. Für eine kurze Zeitspanne beherrschten die Apachen das wilde Land noch einmal von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.
„Wer vermag diese Weißaugen zu verstehen“, sagte Mangas Coloradas. „Sie kommen und gehen wie der Wind, der die Wolkenvögel über die Berge treibt. Vielleicht kehren sie jetzt in ihr eigenes Land zurück wie vor vielen Erntezeiten Nantan Bartlett.“