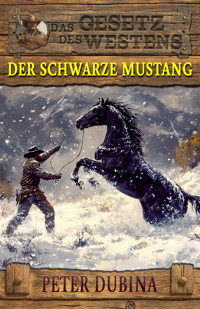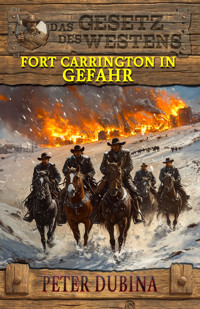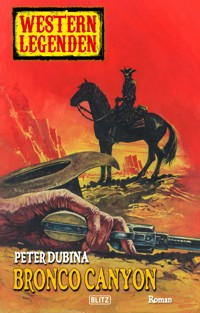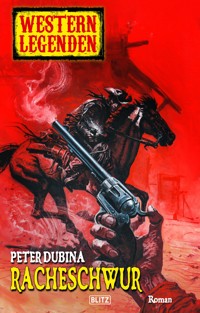
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Western Legenden (Historische Wildwest-Romane)
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Iron Jackets Racheschwur In Texas führt der Indianerhäuptling Iron Jacket einen blutigen Krieg gegen die US-Armee. Comancheros liefern ihm Gewehre und Munition. Der alte Elias arbeitet für diese Waffenhändler. Bei ihm lebt auch der junge Pancho. Elias unterstützt Pancho, damit dieser einmal ein besseres Leben haben kann. Daher verlässt Pancho unbemerkt die Comancheros und schließt sich dem Texas Ranger Matt Crawford an. Iron Jacket führt weiter Krieg. Navajo-Ehre Der fünfzehnjährige Manuelito ist in die Wirren des Navajo-Aufstandes von 1874 verstrickt. Texas Ranger Matt Crawford weiß um die Gefahr und will weitere Eskalationen verhindern, da sich zwei unversöhnliche Feinde gegenüberstehen: Manuelitos geächteter Bruder Hosteen Klah und der Skalpjäger Chingo Hobb. Lautet die letzte Entscheidung Krieg oder Frieden?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Western Legenden
In dieser Reihe bisher erschienen
9001 Werner J. Egli Delgado, der Apache
9002 Alfred Wallon Keine Chance für Chato
9003 Mark L. Wood Die Gefangene der Apachen
9004 Werner J. Egli Wie Wölfe aus den Bergen
9005 Dietmar Kuegler Tombstone
9006 Werner J. Egli Der Pfad zum Sonnenaufgang
9007 Werner J. Egli Die Fährte zwischen Leben und Tod
9008 Werner J. Egli La Vengadora, die Rächerin
9009 Dietmar Kuegler Die Vigilanten von Montana
9010 Thomas Ostwald Blutiges Kansas
9011 R. S. Stone Der Marshal von Cow Springs
9012 Dietmar Kuegler Kriegstrommeln am Mohawk
9013 Andreas Zwengel Die spanische Expedition
9014 Andreas Zwengel Pakt der Rivalen
9015 Andreas Zwengel Schlechte Verlierer
9016 R. S. Stone Aufbruch der Verlorenen
9017 Dietmar Kuegler Der letzte Rebell
9018 R. S. Stone Walkers Rückkehr
9019 Leslie West Das Königreich im Michigansee
9020 R. S. Stone Die Hand am Colt
9021 Dietmar Kuegler San Pedro River
9022 Alex Mann Nur der Fluss war zwischen ihnen
9023 Dietmar Kuegler Alamo - Der Kampf um Texas
9024 Alfred Wallon Das Goliad-Massaker
9025 R. S. Stone Blutiger Winter
9026 R. S. Stone Der Damm von Baxter Ridge
9027 Alex Mann Dreitausend Rinder
9028 R. S. Stone Schwarzes Gold
9029 R. S. Stone Schmutziger Job
9030 Peter Dubina Bronco Canyon
9031 Alfred Wallon Butch Cassidy wird gejagt
9032 Alex Mann Die verlorene Patrouille
9033 Anton Serkalow Blaine Williams - Das Gesetz der Rache
9034 Alfred Wallon Kampf am Schienenstrang
9035 Alex Mann Mexico Marshal
9036 Alex Mann Der Rodeochampion
9037 R. S. Stone Vierzig Tage
9038 Alex Mann Die gejagten Zwei
9039 Peter Dubina Teufel der weißen Berge
9040 Peter Dubina Brennende Lager
9041 Peter Dubina Kampf bis zur letzten Patrone
9042 Dietmar Kuegler Der Scout und der General
9043 Alfred Wallon Der El-Paso-Salzkrieg
9044 Dietmar Kuegler Ein freier Mann
9045 Alex Mann Ein aufrechter Mann
9046 Peter Dubina Gefährliche Fracht
9047 Alex Mann Kalte Fährten
9048 Leslie West Ein Eden für Männer
9049 Alfred Wallon Tod in Montana
9050 Alfred Wallon Das Ende der Fährte
9051 Dietmar Kuegler Der sprechende Draht
9052 U. H. Wilken Blutige Rache
9053 Alex Mann Die fünfte Kugel
9054 Peter Dubina Racheschwur
Peter Dubina
Racheschwur
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-675-0
Iron Jackets Racheschwur
Die Comancheros
„Du brauchst dich nicht zu fürchten, Panchito“, sagte der alte Elias zu dem Jungen, der neben ihm auf dem schmalen Bock des Planwagens saß. Er nahm die langen Zügelleinen, mit denen er die sechs Maultiere seines Gespanns leitete, in die linke Hand und kurbelte die Bremsklötze an den Wagenrädern fest. Der Rauchgeruch, den der Wind über die sonnenverbrannte Ebene trug, hatte die Tiere unruhig gemacht.
Elias ließ seine knochige Rechte einen Augenblick lang auf der Schulter des Jungen ruhen. Nun griff er hinter sich unter die festgezurrte Plane, holte sein Gewehr hervor und lehnte es so neben sich an den Bock, dass es rasch zur Hand war, falls es nötig werden sollte.
Der alte Mann und der Junge trugen schmutziges, ehemals weißes Baumwollzeug. Die Hosen waren mit Seilenden um die Hüften festgebunden, und an den Füßen hatten sie hanfbesohlte Leinenschuhe.
Pancho richtete sich auf und blickte zu den brennenden Wagen hinüber, wo dünner, schmutzig gelber Rauch im Wind trieb. Die letzten Schüsse waren verhallt. Pancho glaubte, in der fast unnatürlichen Stille das Prasseln der Flammen hören zu können, obwohl sie mindestens noch eine halbe Meile von den qualmenden Wagenwracks entfernt waren.
„Ruhig, ruhig!“, sagte der alte Mann zu seinen Maultieren, die an den eisernen Trensen kauten, und zog die Zügel straffer an.
Mehrere Reiter, die den hinter Elias fahrenden Wagen begleitet hatten, kamen nach vorn galoppiert und zügelten ihre Pferde. Sie waren alle auf die gleiche Art wie Elias und der Junge gekleidet. Wagenradgroße Hüte beschatteten ihre scharfgeschnittenen, dunklen Gesichter. Lange Schnurrbartenden hingen ihnen über die Mundwinkel herab. Jeder der Reiter trug zwei Patronengurte kreuzweise über Brust und Rücken und einen Revolver, der hoch an der rechten Hüfte festgeschnallt war. Gewehrkolben ragten aus den Sattelschuhen, und am Steigbügelfutter hing bei jedem Reiter eine schwere Machete in einer Lederscheide.
Das waren Desidero Apodaca und seine Männer, die Letzten der gefürchteten und verhassten Comancheros. Selbst jetzt, im Sommer des Jahres 1874, hatten sie noch eine Lücke in den Postenketten gefunden. Es war ihnen gelungen, die das amerikanische Ufer des Rio Grande bewachenden Texas Ranger und Kavallerieeinheiten zu überlisten und den Grenzfluss zu durchqueren.
Die Comancheros waren Händler. Wenn sie einen sicheren Weg von Mexiko nach Texas entdeckt hatten, zogen sie mit schwer beladenen Wagen oder langen Maultierkarawanen nach Norden. Denn dort, in den Wüsten des texanischen Pfannenstielgebiets, kämpften die letzten Banden der aufständischen Comanchen einen verzweifelten Kampf gegen alle Weißen: Siedler, Büffeljäger, Soldaten und Texas Ranger. Und die Comancheros versorgten sie mit Waffen, Munition, Alkohol und allem, was die Indianer mit geraubtem Vieh, Pferden und Maultieren bezahlen konnten.
Pancho ließ sich wieder auf das harte Sitzbrett des Wagenbocks sinken. Er spürte Elias’ Hand auf seiner Schulter und blickte zu dem sonnenverbrannten, von weißem Haar umrahmten Gesicht des alten Mannes auf, das von einem Gitterwerk winziger, heller Falten zerfurcht war.
Desidero Apodacas Mundwinkel verzogen sich.
„Mierda!“, sagte er auf Spanisch. „Immer müssen sie die Wagen niederbrennen. Hoffentlich haben sie nicht alles in den Flammen umkommen lassen, sondern genügend übrigbehalten, sodass sich der Handel mit ihnen lohnt.“
„Die Antwort darauf werden sie dir selbst geben“, erwiderte ein anderer Comanchero, der neben Apodaca auf seinem Pferd hielt.
Reiter tauchten aus den Rauchschwaden der brennenden Wagen auf und kamen im Schritt und in fächerförmiger Linie heran. Elias riss einen dünnen Span vom Sitzbrett, schob ihn zwischen seine Lippen und kaute darauf herum.
„Das ist Iron Jacket mit seiner Bande“, murmelte er halblaut und kniff die Augen zusammen, um in dem grellen, blendenden Sonnenlicht besser sehen zu können.
Die Indianer hielten kaum zehn Schritte vom Maultiergespann des ersten Wagens entfernt ihre Pferde an. Einer von ihnen hob mit der rechten Hand eine Winchester in Schulterhöhe und stieß einen rauen, kehligen Laut aus. Auf dem Kopf trug er eine Büffelfellhaube, aus der zwei krumme Hörner ragten. Das daran herabhängende Fell war weit geschnitten und fiel wie ein Mantel um seine Schultern. Seine Hosen waren aus rotem Stoff, die Unterschenkel bedeckte wieder Bisonfell. Adlerdaunen wehten von seinen Schultern und dem unteren Rand des zottigen Umhangs. Darunter trug er einen alten, spanischen Brustpanzer, in dem sich die Sonne spiegelte.
Doch es war das Gesicht des Comanchen, von dem Pancho den Blick nicht wenden konnte. Die Augenlider waren weiß bemalt, und ein ockerfarbener Streifen zog sich über den Nasenrücken empor und umschloss die Augen.
„Buenas tardes, ilustre jefe!“, sagte Desidero Apodaca, denn Spanisch war die einzige Sprache, die die Comanchenbanden am Rio Grande außer ihren eigenen Stammesdialekten beherrschten. „Wir haben Gewehre und Patronen in den Wagen, um mit dir Handel zu treiben.“
„Du mein alter Freund“, erwiderte der Indianer, der des Spanischen nur gebrochen mächtig schien. „Wir reden viel, wir trinken viel, wir handeln viel. Mein Lager dort. Komm!“
Er deutete mit dem Lauf seiner Winchester nach Norden, wo eine nackte, weiße Hügelkette durch den zitternden Sonnenglast schimmerte.
„Du viel Whiskey?“, fragte er dann, und seine Stimme klang lauernd.
„Einen ganzen Wagen voll, wenn du das bezahlen kannst.“ Apodaca nickte.
„Ich viel Gold, viel Vieh, viele Pferde“, gab der Comanche zurück. „Wir handeln. Komm!“
Apodaca richtete sich in den Steigbügeln auf, um den Wagen das Zeichen zum Anrollen zu geben. Dreimal stieß er die rechte Faust in die Höhe.
„Adelante, Muchachos!“, erschallte seine Stimme. „Wir fahren weiter.“
„Halte dich nur gut fest, damit du nicht vom Bock fällst und unter die Räder gerätst!“, rief Elias dem Jungen zu. Er löste die eiserne Bremskurbel und griff nach der Peitsche, die so lang war, dass er die Ohrenspitzen der vordersten Maultiere in seinem Gespann damit erreichen konnte. Er ließ sie über dem Sechsergespann knallen, als wollte er die Fliegen von den Rücken der Mulis verscheuchen.
Pancho klammerte sich an die Leinenplane, als sich die Tiere schnaubend ins Geschirr legten, und der schwere Wagen ruckte und schwankte. Die großen Räder mahlten einen Augenblick lang leer im Sand, dann rollte der Wagen langsam nach Norden. Eine Staubfahne erhob sich und hüllte den zweiten Wagen ein. Apodacas Männer und die Comanchen begleiteten die rumpelnden, ächzenden Fahrzeuge zu beiden Seiten.
„Das waren weiße Büffeljäger“, murmelte Elias, als sie an den noch brennenden Wagen vorbeifuhren. Mit dem Kinn deutete er auf die rauchenden, stinkenden Büffelhäute, die überall umherlagen. Tote Maultiere hingen noch in den Geschirren, und als der Qualm einen Moment lang dünner wurde, glaubte Pancho, am Hinterrad eines der Wagen eine zusammengesunkene Gestalt gesehen zu haben, deren ausgestreckte Arme an den hölzernen Radspeichen festgebunden waren. In der nächsten Sekunde drückte der Wind die schweren Rauchschwaden wieder zu Boden, und sie hüllten die Wagenwracks ein.
Elias spuckte den Holzspan aus, warf dem Jungen einen Blick zu und schüttelte den Kopf. „Wir werden die Achsen unseres Wagens mit Fett schmieren müssen“, sagte er. „Hörst du, wie die Räder bei jeder Drehung kreischen?“
„Hast du den Mann an dem brennenden Rad gesehen, Elias?“, fragte Pancho, und ein Schauer rann ihm über den Rücken.
Der alte Mann murmelte etwas vor sich hin. Wieder kniff er die Augen zusammen und blickte in den harten, heißen Himmel hinauf, wo eine ganze Wolke von Bussarden schwebte.
„Ja, ich habe ihn gesehen, Panchito“, antwortete er nach einer Weile. „Und die dort oben haben ihn auch gesehen.“ Er nickte schwer zu seinen eigenen Worten. „Die Comanchen hassen von allen Weißen die Büffeljäger am meisten und töten sie auf grausame Weise. Denn die Büffeljäger schießen riesige Herden wahllos zusammen. Ihnen kommt es nur auf die Häute an; alles andere überlassen sie den Bussarden und Wölfen. Aber mit jedem Büffel, der getötet wird, nimmt der Hunger unter den Comanchen zu. Nun weißt du, warum die Männer bei diesen mit Häuten beladenen Wagen getötet wurden. Aber es ist schon wahr, dass nur wenige Comanchenbanden so grausam sind wie die Iron Jackets. Iron Jacket ist der größte Weißenhasser unter seinem Volk. Seinen Namen hat er von dem eisernen Brustpanzer, den du gesehen hast. Die Indianer glauben, dass dieser alte spanische Harnisch seinen Träger kugelfest macht. Ich weiß nicht, ob das wahr ist oder ob die Soldaten, gegen die Iron Jacket kämpfte, nur schlechte Schützen waren. Aber etwas anderes weiß ich: Ein alter Mann wie ich ist nicht mehr viel wert. Du aber bist noch sehr jung, Panchito, und du hast ein besseres Leben als unser jetziges verdient. Ich weiß, dass die amerikanischen Soldaten und die Texas Ranger die Comancheros eines Tages vernichten werden. Sie kämpfen seit Langem gegen uns, denn wir sind ebenso gut ihre Feinde wie die Indianer. Ohne die Comancheros könnten die Indianerbanden in Texas nicht mehr kämpfen, denn nur wir treiben Handel mit ihnen, und nur von uns bekommen sie Gewehre, Patronen und Whiskey. Wenn aber die Texas Ranger kommen, dann musst du weit, weit fort und in Sicherheit sein, denn es wäre möglich, dass keiner von Desidero Apodacas Männern diesen Kampf überlebt. Und wenn es Überlebende gibt, wird man sie vielleicht aufhängen. Du aber, Panchito, sollst ehrliche Arbeit tun und stolz auf deinen guten Namen sein können. Ein Mann muss seinen Namen mit Stolz tragen. Wenn er das nicht kann, hat er kein Anrecht, von anderen geachtet zu werden.“
„Treibt die Maultiere an!“, rief Apodaca. „Schneller! Schneller!“ Er ritt dicht an Elias’ Wagen heran. „He, Alter! Bring deine Mulis zum Laufen, oder ich nehme dir die Peitsche weg und lasse sie auf deinem eigenen Rücken tanzen.“
Pancho sah zu dem alten Mann auf, doch dieser schien Desidero Apodacas Wort überhaupt nicht gehört zu haben. Er saß vornübergeneigt, die langen Zügelleinen lose in den Händen, die Ellenbogen auf den Knien, die Sohlen seiner verschlissenen Leinenschuhe gegen das Fußbrett des Wagenbocks gestemmt, und sah der fernen Hügelkette entgegen.
Der Texas Ranger
Das Dorf der Comanchen lag jenseits des flachen Wasserlaufes, den Elias den Rio Concho nannte, in der sonnenverbrannten Wüste, zwischen Dorngestrüpp und verdorrten Cottonwoodbäumen, die kaum Schatten gaben.
Jetzt, mitten im Sommer, führte der Fluss nur wenig Wasser. Es reichte kaum an die Naben der großen Wagenräder. Weiße Steine blinkten auf dem Grund. Elias peitschte auf die Maultiere ein, die aus Leibeskräften zogen. Die eisernen Radreifen knirschten auf den Steinen. In eine Wolke von glitzerndem Wasserstaub gehüllt, jagten die schweren Planwagen hintereinander zum anderen Ufer hinüber. Pancho klammerte sich fest, als der Wagen schwankend die jenseitige Böschung hinaufrollte.
Die Büffelhautzelte der Comanchen, mit ihren geöffneten, rußgeschwärzten Rauchklappen, lagen hell im Sonnenschein. Überall weideten riesige Pferdeherden, und Krieger, Squaws, Kinder und ganze Scharen magerer, halb verhungerter Indianerhunde kamen den Wagen der Comancheros entgegen. Der Geruch von Schmutz und dem beißenden Holzrauch vieler Feuer erfüllte die Luft.
Plötzlich sah Pancho unter den dunklen Gesichtern der Comanchen das einer jungen, weißen Frau. Sie stand vor einem der Zelte, eine große Tonschüssel im Arm. Sie war wie eine Comanchen-Squaw gekleidet, doch das lange Haar, das ihr bis auf die Schultern niederfiel, hatte die Farbe reifer Weizenähren.
Panchos Aufmerksamkeit wurde abgelenkt. Während er auf dem holpernden Wagen durch das Comanchenlager rollte, sah er zwischen zwei Büffelhauttipis ein aus geschältem Stangenholz bestehendes, mannshohes Gerüst, an dem ein Mann mit ausgebreiteten Armen festgebunden war. Man hatte ihm das Hemd vom Leib gerissen. Sein Kopf hing vornüber. Es war ein Weißer mit aschblondem Haar. Neben ihm stand ein Comanche, eine Winchester in der linken Armbeuge.
Als die Wagen vorbeifuhren, hob der Gefangene mühsam den Kopf und blickte zu Pancho hinauf, der hoch oben auf dem Bock saß. Für einen Moment trafen sich ihre Blicke, dann sank das Kinn des Mannes wieder auf die Brust.
„Wer ist das?“, fragte Desidero Apodaca, der neben Iron Jacket ritt. Der Indianer deutete auf den Gefangenen.
„Er Texas Ranger“, erwiderte er mit seiner kehligen Stimme in gebrochenem Spanisch, und in seinen dunklen Augen loderte der Hass wie eine Flamme auf. In wildem Lächeln zeigte er seine Zähne wie ein Wolf. „Wir fangen Texas Ranger. Er morgen im Feuer sterben. Heute wir reden, handeln und trinken viel.“
Pancho neigte sich weit über den Rand des Wagenbocks. Wie gebannt hing sein Blick an dem Mann, der an das Gerüst gefesselt war. Elias ergriff ihn schließlich am Arm und zog ihn zurück.
„Pass auf, dass du nicht hinunterfällst!“, sagte er.
„Was werden sie mit dem Gefangenen machen, Elias?“, fragte Pancho, während sie, von kläffenden Hunden umtanzt, weiterrollten.
„Das, was sie mit allen Weißen tun“, murmelte der alte Mann. Dann schwiegen sie beide, bis die Wagen die jenseitige Grenze des Comanchenlagers erreicht hatten. Apodaca gab das Zeichen zum Halt. Elias kurbelte die Bremsklötze an den Rädern fest, schlang die Zügelleinen um den eisernen Kurbelgriff und stieg, müde und steifbeinig von der mühseligen Fahrt, vom Bock, wobei er die Speichen des einen Vorderrades als Trittleiter benutzte. Pancho kletterte auf der anderen Seite hinunter, und sofort waren die Wagen von Indianern umgeben.
Die breitflächigen Gesichter der Comanchen waren stolz und ausdruckslos, aber sie hatten grausame Augen. Ihre Haarzöpfe waren in Otterfell gehüllt, und ihre Adlerfedern wehten im Wind. Pancho drückte sich in Elias’ Nähe, als der alte Mann um den Wagen ging und sich vergewisserte, dass die Plane überall gut festgezurrt war. Er zog an den Seilsträngen, die durch metallgefasste Ösen in der steifen Leinwand liefen, und rüttelte an der hinteren Klappe des Wagenkastens.
„Diese Comanchen stehlen wie hungrige Wölfe“, sagte er dabei.
Desidero Apodaca ritt an ihnen vorbei. „Spannt die Maultiere aus und treibt sie zusammen!“, befahl er. „Vorwärts, beeilt euch! Adelante! Adelante!“
„Komm, Panchito“, murmelte Elias, und sie machten sich daran, den Mulis das Geschirr abzunehmen, während einige der Comancheros aus Seilen und Holzpfählen einen behelfsmäßigen Corral errichteten. Die Pferde und Maultiere wurden hineingetrieben und standen erschöpft, die Flanken dunkel von Schweiß, mit hängenden Köpfen da, zu müde, um mit den Ohren zu zucken und die vielen Fliegen zu verscheuchen.
„He, Alter!“, rief einer der Männer Elias zu. „Hol ein paar Eimer Wasser vom Fluss herauf und gib den Mulis zu trinken!“
Elias nickte und kehrte zu seinem Wagen zurück. Er kletterte auf den Bock, öffnete die Plane und brachte zwei Tragstangen und vier hölzerne Wassereimer zum Vorschein. Er reichte sie Pancho, verschnürte die Plane wieder und stieg herunter.
Die Comanchen beachteten sie nicht, als sie durch das Lager gingen; nur ein paar Hunde begleiteten sie. Sie gingen ein Stück flussaufwärts, wo das Wasser sauber war, denn flussabwärts war in der Nähe eines Indianerlagers alles Wasser verschmutzt. Sie knieten nieder, füllten ihre Eimer und machten sich wieder auf den Rückweg. Diesmal kamen sie an dem Gefangenen vorbei, der unter der erbarmungslos herabbrennenden Sonne regungslos an dem Gerüst hing.
„Holla, was ist mir dir, Panchito?“, fragte Elias, als der Junge stehen blieb.
Pancho antwortete nicht. Er betrachtete den Gefangenen. Dunkle Striemen an seinen Armen und auf seiner Brust zeigten, dass er mit einer Pferdepeitsche geschlagen worden war. Sein Atem ging schwer und keuchend. Aber nach einer Weile hob er den Kopf, als habe er Panchos Blick gespürt, und sah den Jungen an.
„Wasser ...“, flüsterte er heiser. Pancho zögerte einen Augenblick, dann trat er nahe an ihn heran und drehte die über seinen Schultern liegende Tragstange so, dass einer der beiden Eimer die trockenen Lippen des Mannes erreichte. Im gleichen Moment traf ihn ein heftiger Fußtritt von hinten in die Kniekehlen und warf ihn um, und alles Wasser spritzte auf die Erde.
Er wollte sich aufrichten, aber ein Fuß in einem Mokassin trat auf seine Schulter und drückte ihn zu Boden. Der Comanche, der bei dem Gefangenen Wache gehalten hatte, stand über ihm.
„Satkan!“, stieß er hervor. Das war eines der wenigen Worte des Comanchendialekts, die Pancho verstand. Satkan war ein Schimpfwort und bedeutete Pferdemist.
Elias kam rasch auf Pancho und den Indianer zu, doch der Comanche wich blitzschnell zurück, lud die Winchester durch und richtete die Mündung der Waffe im Hüftanschlag auf den alten Mann. Sein Zeigefinger lag hart am Abzug, und der Ausdruck seines Gesichts ließ keinen Zweifel daran, dass er schießen würde, wenn Elias noch einen Schritt näher kam.
Der alte Comanchero blieb stehen. „Nimm deine Eimer und komm!“, sagte er zu Pancho. „Schnell! Diese Indianer sind so unberechenbar wie ein Präriefeuer bei umspringendem Wind.“
Pancho tastete hastig nach seinen Eimern und der schweren Tragstange, ohne den Blick vom Gesicht des Gefangenen zu lösen.
„Ich danke dir, Junge!“, sagte der Mann heiser. „Geh jetzt weg! Der Alte hat recht. Niemand kann sagen, was hinter der Stirn eines Comanchen vorgeht.“
Er sprach Spanisch, und Pancho setzte schon zu einer Erwiderung an. Aber da stieß der Indianer ihm den zweiten Eimer mit dem Fuß hin und sagte etwas, das wie das Knurren eines Hundes klang. Pancho griff nach dem Eimer, stolperte auf Elias zu, und der alte Mann zog ihn rasch mit sich fort. Der Gefangene hatte das Kinn schon wieder auf die Brust sinken lassen, und seine Augen waren geschlossen.
„Komm!“, sagte Elias, und seine Stimme klang ärgerlich und hart. „Wir müssen die Pferde und Maultiere tränken. Die Tiere sind durstig.“
Schweigend gingen sie zum Corral zurück, wo die Mulis sich hinter den Seilen drängten. Desidero Apodaca saß noch immer im Sattel seines großen, schwarzen Hengstes, ein Bein um das Sattelhorn gelegt, und rollte sich eine Maisblattzigarette, während er zusah, wie seine Leute die Wagen entluden. Kiste um Kiste wurde unter den Planen hervorgeholt, bis sich ein hoher Stapel im Sand auftürmte.
Einer der Comancheros wuchtete eine schwere Kiste mit Whiskeyflaschen auf seine Schulter. Da streifte ihn Pancho unabsichtlich mit dem einen Ende seiner Tragstange, an der die leeren Eimer baumelten. Der Mann stolperte und ließ die Kiste los. Sie schlug auf der Erde auf, und mehrere Flaschen zersprangen klirrend. Die Indianer, die zugesehen hatten, schrien wütend auf, als sie sahen, wie der Alkohol in den ausgedörrten Sand rann.
„Loco!“, stieß Apodaca hervor. „Dummkopf!“
Sein Gesicht färbte sich dunkel vor Zorn. Er ließ die Zigarette und das Schwefelhölzchen, das schon brannte, fallen und griff nach der schweren, ledernen Pferdepeitsche, die an seinem Sattelknauf hing. Doch bevor er Pancho damit schlagen konnte, hatte sich Elias vor den Jungen gedrängt und fing den Hieb, der Pancho treffen sollte, mit seinem eigenen Rücken auf. Sein Gesicht zuckte vor Schmerz, als die Peitsche sein verschlissenes Hemd zerriss.
„Geh mir aus dem Weg, alter Narr!“, rief der Comanchero, die Pferdepeitsche noch einmal mit drohender Gebärde hebend.
„Señor, es war ein Versehen“, gab Elias zurück. „Schlagen Sie den Jungen nicht! Er ist ja noch ein Kind. Ich werde die zerbrochenen Flaschen von meinem Anteil an dem Geschäft bezahlen.“
„Dein Anteil an diesem Handel ist der Lohn eines Maultiertreibers“, höhnte Apodaca. „Wenn du mir den verlorenen Whiskey bezahlen willst, wird dir nicht einmal genug Geld für einen Teller Bohnen übrig bleiben. Sieh dich vor, dass der Junge nicht noch mehr zerbricht, sonst spanne ich ihn zu den Mulis vor deinen Wagen und treibe ihn mit der Peitsche an. Und jetzt tränkt endlich die Pferde! Ich will kein Tier verlieren, weil ihr zu faul seid, ihnen Wasser zu geben.“
„Ja, Señor!“, erwiderte Elias und zog den Jungen rasch mit sich zum Corral hinüber. „Geh ihm von jetzt an aus dem Weg!“, murmelte er zu Pancho gewandt. „Er hasst uns, denn eigentlich gehören wir gar nicht zu seinen Männern. Wir sind weder Comancheros noch Bandoleros oder Banditen, und deswegen misstraut und hasst er uns. Aber nun komm! Wir haben noch viel Arbeit vor uns.“
Fünfzig Gewehre
Die Dämmerung kam, und der Fluss schimmerte im roten Licht des Sonnenuntergangs wie ein geschliffener Bronzeschild. Im Dorf der Comanchen dröhnten die hartgespannten Rohhauttrommeln. Das Rasseln von Medizinklappern und das Schrillen von Adlerknochenpfeifen mischte sich in das dumpfe Hämmern. Der flackernde Schein vieler Feuer lag auf den hellen Zeltwänden.
Elias und Pancho hatten die Pferde und Maultiere getränkt und saßen nun abseits vom Lagerfeuer der Comancheros im Schatten eines der Wagen. Jeder hatte vor sich einen Blechteller mit Mais, Rindfleisch und roten Texasbohnen, einen Becher heißen Kaffees und steinharte, alte Maisfladen.
Während er aß, schickte Pancho immer wieder einen Blick zum Feuer hinüber, wo eine Flasche mit Aguardiente, dem wasserhellen, scharfen Agavenschnaps, kreiste. Wachposten standen, in ihre Ponchos gehüllt und die Gewehre in den Armen, an der äußersten Grenze des Feuerscheins. Apodaca hatte sie aufgestellt, um zu verhindern, dass die Comanchen ungesehen an die Gewehr- und Patronenkisten und den Whiskey herankamen. Denn selbst den wilden Comancheros war es zu gefährlich, mit betrunkenen Indianern Handel zu treiben.
„Elias“, sagte Pancho auf einmal, „glaubst du, es ist richtig, wenn man den Indianern Gewehre und Munition verkauft?“
Der alte Mann, der den Rücken gegen die Speichen eines Wagenrades gelehnt hatte, sah von seinem Teller auf.
„Nein“, erwiderte er, nachdem er einen Mund voll Bohnen und Fleisch mit Kaffee hinuntergespült hatte. „Solange die Indianer auch nur eine Patrone haben, werden sie weiter gegen die amerikanische Armee kämpfen, und so lange werden Menschen sterben müssen. Deshalb suchen die Texas Ranger entlang den Ufern des Rio Grande nach Comancheros; und wenn sie sie finden, kommt es zu harten Kämpfen. Viele Comancheros sind auf diese Weise gefallen, nachdem sie kaum den Fuß auf texanische Erde gesetzt hatten. Doch Apodaca sagt, dieser Krieg sei eine Auseinandersetzung zwischen den Amerikanern und den Comanchen und gehe uns nichts an. Wir treiben nur Handel mit den Indianern.“
Pancho sah in das gütige, runzelige, alte Bauerngesicht von Elias. Es war ihm einfach unmöglich zu glauben, Elias könnte etwas tun, was nicht recht war.
„Glaubst du ihm denn?“, fragte er verwirrt und versuchte, die Unsicherheit in seiner Stimme zu verbergen. Der alte Mann starrte in seinen Kaffeebecher. Ohne aufzublicken, schüttelte er den Kopf.
„Ich glaube ihm nicht, Panchito. Apodaca und seine Männer sind Bandoleros, Banditen, das weißt du doch. Es ist ihnen gleichgültig, dass mit den Gewehren, die sie den Comanchen verkaufen, ein grausamer Kampf geführt wird. Für sie zählt nur eines: Geld! Sie wollen ein gutes Geschäft machen; und niemand bezahlt für ihre Handelsgüter mehr als die Comanchen in den Wüsten und Bergen von Texas. Alles Gold, alles Vieh und viele andere Dinge, die die Indianer bei ihren Überfällen erbeuten, fließen auf diese Weise in die Taschen der Comancheros.“
„Aber wenn du das alles weißt, warum arbeitest du dann für sie?“, fragte Pancho. Auch er sah nicht auf, sondern hielt den Blick auf seine zerrissenen Leinenschuhe gerichtet, zwischen denen sein Blechteller und der Zinnbecher standen. Elias lächelte, obwohl ihm nicht danach zumute war. Die Falten in seinem Gesicht vertieften sich.
„Weil wir beide essen müssen, Panchito“, versetzte er leise. „Weil Menschen nicht Gras essen können wie die Tiere. Ich wollte, ich wäre nicht gezwungen, für die Comancheros Wagen zu fahren und Maultiere zu treiben. Viel lieber möchte ich in Mexiko ein Feld umpflügen und Mais anpflanzen. Ich möchte die hölzernen Griffe eines Pfluges führen und nicht das Gespann eines Wagens voller Gewehrkisten. Ich bin ein Campesino, Panchito, ein Bauer. Ich kenne nichts Schöneres, als hinter einem Pflug über ein Feld zu gehen und den Geruch der aufbrechenden Erde zu riechen. Aber in meinem Heimatdorf hat man mich von dem Land, das ich gepachtet hatte, vertrieben, weil ich nach vielen dürren Sommern die Pacht nicht mehr bezahlen konnte. Ich habe den Mann, dem das Land gehört, gebeten, es mir zu lassen. Doch bei uns ist es so, dass die Reichen den Armen wegnehmen dürfen, was sie wollen. Und ich war immer nur ein armer, schmutziger Campesino. Deshalb, Panchito, fahre ich jetzt Wagen für die Comancheros. So haben wir beide, du und ich, wenigstens genug zu essen und bekommen ein paar Pesos. Wäre ich in Mexiko geblieben, würde ich jetzt nicht einmal so viel Land mein Eigen nennen, wie ein Mensch braucht, um darin begraben zu werden. Also arbeite ich für die Comancheros und kämpfe gegen die amerikanische Armee und die mexikanische Armee, gegen die Texas Ranger und die Rurales in Mexiko; und dabei bin ich nur ein alter Mann, der noch einmal in seinem Leben ein Feld bestellen möchte. Aber mehr als alles andere wünschte ich, du wärst irgendwo in Sicherheit.“
„Ich möchte nirgendwo anders sein als dort, wo du bist, Elias“, sagte Pancho. Er schämte sich nun wegen dem, was er vorhin zu dem alten Mann gesagt hatte. Er wusste, wie arm Elias war, und auch, dass er zu alt war, um irgendwo richtige Arbeit zu bekommen. Niemand würde ihn aufnehmen, denn in Mexiko hatten die Reichen, wie Elias gesagt hatte, nur ein Ziel: noch reicher zu werden. Wer würde schon einem alten Mann, der zu schwach für schwere Arbeit war, zu essen geben? Elias hatte keine Wahl gehabt. Er war gezwungen gewesen, zu den Comancheros zu gehen, wenn er nicht verhungern wollte. In Mexiko hatten die Reichen kein Erbarmen mit den Armen. Sie waren sehr stolz und so hart wie der von der Sonne ausgedörrte Erdboden, der viel Arbeit und Schweiß forderte, um schließlich doch nur eine schlechte Ernte herzugeben.
„Du solltest nicht bei mir sein, Panchito“, murmelte der alte Mann. „Du solltest ein Dach über dem Kopf und immer genug zu essen haben. Ich muss zusehen, wie ich dir helfen kann.“
„Ich bin dort zu Hause, wo du bist, Elias“, erwiderte der Junge. Der alte Mann lächelte in der rasch zunehmenden Dunkelheit vor sich hin. Bevor er Pancho auf der Straße eines kleinen, schmutzigen mexikanischen Dorfes aufgelesen hatte, wo er sich halb verhungert herumtrieb, war er lange allein gewesen und hatte, außer seinen Mulis, niemanden gehabt, mit dem er reden konnte. Und die Maultiere waren nicht sehr gesprächig, wenn auch unübertrefflich als Zuhörer. Seit er aber den Jungen bei sich hatte, fühlte er sich nicht mehr so einsam.
„Da, sieh!“, sagte er auf einmal, und als Pancho den Kopf hob, erblickte er viele Comanchen, die zu Fuß und zu Pferd wie aus dem Nichts aus der Dunkelheit auftauchten und in der Nähe der Wagen stehen blieben. Iron Jacket war unter ihnen. Sein Brustpanzer glänzte im Flammenschein.
„Jetzt kommen sie, um zu handeln“, murmelte Elias und deutete mit einer Kopfbewegung auf die langen Reihen von Lastmaultieren, die die Indianer mitgebracht hatten. Unter all den Tieren war keines, das unter der Last der Tauschwaren nicht fast in den Gelenken einknickte. Pancho wollte sich aufrichten, doch Elias zog ihn wieder herunter.
„Es ist besser, wenn du hierbleibst“, mahnte er. „Man weiß nie, wie man bei diesen Indianern dran ist. Das da sind nicht nur Comanchen, Panchito. Unter ihnen gibt es auch Cheyenne und Kiowa. Iron Jacket scheint eine große Bande um sich gesammelt zu haben.“
Pancho sah, wie Desidero Apodaca aufstand und den Indianern entgegenging. „Wir freuen uns, dass unsere Freunde gekommen sind, um mit uns zu trinken und zu handeln“, hörte er ihn sagen. „Wir haben vieles mitgebracht, was euch von Nutzen sein wird.“
Pancho erinnerte sich, was jenseits des Rio Grande alles auf die Wagen geladen worden war. Da gab es Kisten mit Gewehren und Patronen und kleine Fässchen mit Pulver, Blei und Zündhütchen, Whisky und Aguardiente, Decken, Hemden, Messer, Beile und Glasperlen, Messingschmuck, Salz, Zucker, Kaffee und Tabak.
„Noheto! Gut!“, erwiderte Iron Jacket und schwang sich vom Pferd. Mit der Büffelhaube, dem Brustpanzer und seinem bemalten Gesicht wirkte er drohend und unheimlich im flackernden Feuerschein.
„Du zuerst zeigen Gewehre und Patronen!“, forderte er. „Iron Jacket will Gewehre sehen.“
Apodaca ging zu dem vordersten Kistenstapel, ergriff eine Axt, die daneben an einem Wagenrad lehnte, zertrümmerte mit einigen Hieben den Deckel der obersten Kiste, brach die zerspaltenen Bretter ab und zog ein in Ölpapier gewickeltes, langes Bündel heraus. Nachdem er das Papier abgerissen hatte, hielt er ein neues, noch eingefettetes Winchester-Gewehr, Modell 1873, in der Hand.
Er öffnete eine Munitionskiste, nahm eine Handvoll der glänzenden Messinghülsen heraus und schob nacheinander sechs Patronen in die seitliche Ladeöffnung des Gewehrschlosses. Dann drückte er den Ladehebel nach unten und sah sich um, offenbar auf der Suche nach einem Ziel. Sein Blick fiel auf einen Indianer, der etwa zwanzig Schritte entfernt stand und einen brennenden, trockenen Ast wie eine Fackel in Schulterhöhe hielt.
Der Comanchero riss die Winchester an die Wange, und kaum hatte der Kolben die Schulter berührt, zuckte ein Flammenblitz aus der Gewehrmündung. Im Aufpeitschen des Schusses zersprang der lodernde Ast, und das brennende Ende flog hoch. Blitzschnell lud Apodaca durch, und seine zweite Kugel traf das davonwirbelnde, glühende Holzscheit genau in der Mitte und ließ es in einem Funkenregen zerspringen. Dann drehte er das Gewehr um, trat zu Iron Jacket und reichte ihm die Waffe.
„Ich verlange drei Maultiere für eines dieser Gewehre“, sagte er. „Diese Winchester schießt weiter und genauer als alle anderen Waffen. Damit sind deine Krieger sowohl den Soldaten als auch den Texas Rangern und Büffeljägern überlegen. Drei Maultiere sind nicht zu viel für ein solches Gewehr.“
Die dunklen, grausamen Augen des Comanchen blitzten, als er die Winchester in der Hand hielt. Dann aber schüttelte er den Kopf, hob die Rechte und spreizte Zeige- und Mittelfinger.
„Iron Jacket gibt zwei Maultiere für ein Gewehr und zwanzig Patronen“, erwiderte er.
Ein langes Feilschen hob an, und schließlich einigten sie sich darauf, dass die Indianer drei Maultiere oder zwei Pferde für ein Gewehr und fünfundzwanzig Patronen geben sollten.
Die Comanchen hatten alles mitgebracht, was ihnen bei ihren letzten Raubzügen in die Hände gefallen war. Als sie ihre Lasttiere entladen hatten, türmten sich die Stapel der Beutestücke. Da gab es silberbeschlagene spanische Sättel, kostbares Zaumzeug, Schmuck, Beutel mit gemünztem oder rohem Gold, wunderschöne Felldecken und vieles andere. Die Comancheros gingen durch die riesigen Viehherden und suchten sich die besten Tiere, Kühe, Ochsen, Pferde und Mulis aus. Sie bezahlten mit eisernen Pfannen und Kupferkesseln, Messern und Beilen, eisernen Pfeilspitzen und billigem Glasperlenschmuck.
Am meisten aber war den Indianern an Gewehren und Patronen gelegen. Sie gaben einen mexikanischen Silberpeso für eine einzige Patrone und fünf amerikanische Golddollar für eine Handvoll Blei und Zündhütchen, um die abgeschossenen, leeren Hülsen wieder laden zu können. Die fünfzig Winchester-Gewehre, die Apodacas Leute mitgebracht hatten, waren innerhalb einer Stunde gegen Vieh und Pferde eingetauscht. Mit Whiskey und Aguardiente aber hielten die Comancheros zurück, bis der letzte Handel abgeschlossen war. Die Indianer wurden wild, unberechenbar und gefährlich, wenn sie betrunken waren, auch gegenüber den Comancheros, die sie als ihre Freunde und Verbündeten betrachteten.
„Jetzt wird es Zeit, dass wir in den Wagen kriechen, Panchito“, sagte Elias, als Apodaca schließlich die erste Kiste mit Whiskeyflaschen aufbrach. Es war der übliche Handelsschnaps, der mit Petroleum, Holzasche und Pfeffer versetzt war. Die Comanchen liebten Whiskey, der in der Kehle brannte.
Die beiden, der alte Mann und der Junge, kletterten unter die Wagenplane. Nun, da alle Kisten ausgeladen waren, hatten sie Platz genug. Sie breiteten ihre Decken aus, denn sie waren müde.
„Es ist besser, man lässt die Comanchen allein, wenn sie zu trinken anfangen“, murmelte Elias. Pancho hob den Rand der Plane eine Handbreit und blickte durch den Spalt hinaus.
Die Indianer schlugen die Flaschenhälse an den Wagenrädern oder mit den Messerrücken ab und gossen den Whisky in sich hinein.
Es dauerte nicht lange, da fingen die ersten zu torkeln an. Betrunken, wie sie waren, setzten sie Hüte auf, zogen Hemden über oder wanden sich Tücher um die braunen Hälse. Einer von ihnen schwenkte einen bunten Sonnenschirm, ein anderer eine rote Decke über dem Kopf. Einige begannen, um die Feuer zu tanzen; andere schwangen sich auf ihre Pferde und jagten in vollem Galopp hin und her, bis sie schwankten und aus den Sätteln fielen. Niemand kümmerte sich um sie. Ihre Stammesgenossen ließen sie liegen, wohin sie gefallen waren, und ritten einfach über sie hinweg.
Iron Jacket in seiner gehörnten Büffelfellhaube und dem blinkenden Brustpanzer und die übrigen Anführer der Bande, die noch nüchtern waren, verließen zusammen mit den Comancheros das Wagenlager.
„Ich glaube, kein Comanche würde Handel treiben, hätte er nicht die Aussicht, sich nach dem Geschäft bis zur Bewusstlosigkeit betrinken zu können“, sagte Elias, der sich in seine Decke gehüllt und auf die harten Planken des Wagenbodens gelegt hatte. „Du wirst sehen, Panchito, dass sich nach Mitternacht in diesem Lager kein Indianer mehr auf den Beinen halten kann.“
Da Pancho schwieg, richtete sich der alte Mann nach einer Weile auf einem Ellenbogen auf und blickte in die Dunkelheit, die nur matt vom Feuerschein erhellt wurde.
„Kannst du mich hören, oder schläfst du schon?“, fragte er.
Doch bevor Pancho antworten konnte, drängte ein Comanche sein Pferd dicht an den Wagen heran, schwang sich mit einem wilden Schrei auf den Bock und riss die Plane hoch. In seiner linken Hand glitzerte eine Whiskeyflasche, in der anderen hielt er eine Winchester. Er starrte in das dunkle Innere des Wagens, und Pancho blickte geradewegs in sein hässliches, mit weißer Farbe bemaltes Gesicht. Doch entweder war der Indianer schon zu betrunken, oder seine Augen waren noch vom Licht der vielen Feuer draußen geblendet. Er sah nichts, ließ die Plane wieder fallen, sprang vom Wagenbock auf den Rücken seines gescheckten Pferdes und ritt schreiend weiter.