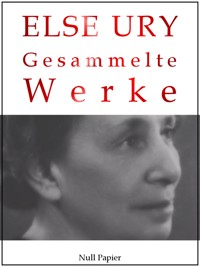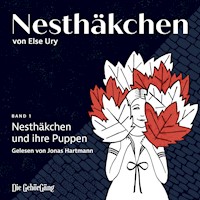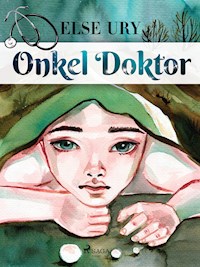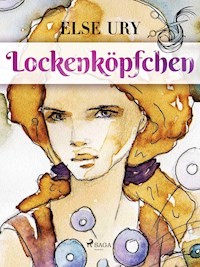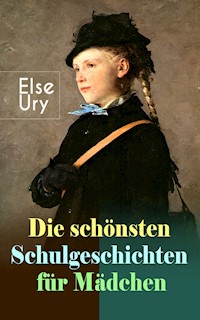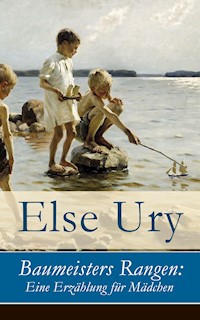1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Dieses eBook: "Die schönsten Gutenacht-Geschichten für die Kleinen (Märchen & Erzählungen)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Else Ury (1877-1943) war eine beliebte deutsche Schriftstellerin und Kinderbuchautorin. Urys Schaffen beschränkt sich auf Prosa: Kinder- und Jugendgeschichten und romane. Die Abenteuer, die Else Ury ihre Helden in ihren Erzählungen erleben lässt, haben häufig eine für den Leser sehr erheiternde Seite. 1905 erschien Else Urys erstes Buch Was das Sonntagskind erlauscht, eine Märchensammlung. Das Buch richtete sich an ein christliches Publikum. 1908 veröffentlichte sie Märchen- und Erzählband mit dem Titel Goldblondchen. Inhalt: Das Sonntagskind Seifenblasen Naschkätzchen Das Regenbogenprinzeßchen Onkel Doktor Der Sandmann kommt Schwälbchen Der schmutzige Straßenjunge Das Wetterhäuschen Fifi Flick und Flock Der erste Schultag Neckpeterle und Schreikäterle Stumpfschwänzchen und Samtfellchen Der kleine Schornsteinfeger Tausendschönchen Der Siebenschläfer Barfüßchen Im Puppenwinkel Traumsuschen Die goldene Eisenbahn Ninja, die kleine Lappländerin "Figuri – kauft Figuri!" Das Himmelstelephon Die Alpenfee Das Pflegeschwesterchen Der kleine Auswanderer Das verzauberte Mäuschen Das Wunderknäuel Das Briefmarkenalbum Lockenköpfchen Am Ostseestrand Das große Kohlblatt Fritz, der kleine Piccolo Heideröslein Das Abendgebet Was der Teekessel summt Zigeunerlisel In Großmutters Flickenkasten Goldblondchens Märchensack Sternschnuppe Lorchen Sommernachtstraum und Wintermärchen In die weite Welt Jungfer Rotnas und Jungfer Naseweis In der Rumpelkammer Buckelhannes Goldregen Aus Stein Der Zauberspiegel Annelieses Weihnachtstraum Aus der Jugendzeit Vom dummen Peter, der durchaus das Fliegen lernen wollte Was Großvater Stumpfzahn erlebte Unter dem Hammer Der Kakaobaum Risi Bisi Das Wasser kommt! Piepmatz, der Gassenjunge
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die schönsten Gutenacht-Geschichten für die Kleinen (Märchen & Erzählungen)
Was das Sonntagskind erlauscht
Was das Sonntagskind erlauscht
Das Sonntagskind
Droben in dem schimmernden Feenreiche, da sitzen in einem lichtfunkelnden Saale all' die guten Feen und schauen mit lächelndem Blick auf die Menschen herab. Und jedesmal, wenn ein Sonntagskind auf die Welt kommt, dann schwebt eine von ihnen zur Erde hinunter und legt dem neugeborenen Kindlein ein Feengeschenk in die Wiege. Das Leben des Kindes aber wird durch die Gabe der guten Fee froh und glücklich, und die anderen Menschen sagen dann: »Es ist eben ein Sonntagskind!«
An einem schönen, klaren Sonntag war's, die Glocken läuteten gar feierlich durch das Land, da schlug wieder einmal ein Kindlein zum ersten Male die strahlenden Augen auf. Und in der Nacht schwebte lautlos aus dem Feenreiche eine lichte Feengestalt, das Märchen genannt, zu der Wiege des neugeborenen Mägdleins herab. Sie neigte sich über das schlummernde Sonntagskind und küßte seine Stirn. Dann nahm die liebliche Fee den Märchenschleier, den sie aus glitzernden, bunten Fäden gesponnen, und warf ihn über das schlafende Mägdlein. Das war die Gabe der Märchenfee; mit goldenen Schwingen flog sie wieder in das Feenreich zurück.
Das Sonntagskind aber wuchs heran, und der Märchenschleier wand sich, unsichtbar den Blicken der Menschen, um sein Blondköpfchen. Mit träumerischen Blauaugen blickte das kleine Mädchen durch das zarte Schleiergewebe in die Welt hinein.
Ach, was sah und hörte das Sonntagskind nicht alles durch seinen Märchenschleier; wenn die anderen Kinder im lauten Spiele durch die Gasse tobten, dann lehnte das Sonntagskind abseits unter der großen Linde, und der durch die Blätter streichende Wind säuselte ihr ins Ohr:
»Was leise flüstert der Abendwind, Das hörst nur du, du Sonntagskind!«
Und er erzählte der lauschenden Kleinen die herrlichsten Märchen; was hatte der Wind, der durch so viele, viele Länder wehte, nicht alles geschaut und erlebt! –
Mittags, wenn die liebe Sonne in das Stübchen flimmerte und Millionen kleiner, goldener Sonnenstäubchen durch die Luft schwirrten, dann griffen wohl auch die anderen Kinder nach den leuchtenden Goldstäubchen; aber nur das Sonntagskind sah durch seinen Märchenschleier, daß das gar keine Stäubchen waren, sondern winzige, goldene Engelchen, die auf den glitzernden Sonnenstrahlen gar lustig auf die Erde herabritten.
Und der Mann im Monde sandte des Abends, wenn das Sonntagskind in seinem Bettchen lag, die silbernen Mond-Elfchen zu ihm herab, die sangen dem kleinen Mädchen die schönsten Märchen ins Ohr.
Von den funkelnden Sternlein tanzten glitzernde Sternschnuppen vom nächtlichen Himmel hernieder, und es tönte leise ins Ohr des Mägdleins:
»Was die Sonne, der Mond und die Sternlein geschaut, Nur dir, dem Sonntagskind, sei es vertraut!« –
Am heißen Sommertage lag das Sonntagskind an der kühlen Waldquelle und lauschte dem Märchen, das der geschwätzige Quell murmelte, von den Wassernixen, die unten auf dem Grunde im kristallnen Palaste hausen. –
Wenn im Frühling die Störche und Schwalben aus heißen Ländern heimkehrten, dann erzählten sie dem Sonntagskinde, was sie auf der weiten Reise geschaut. Und der Storch klapperte, und die Schwalbe zwitscherte:
»Gar viel haben wir in der Ferne geseh'n, Du, Sonntagskind, nur kannst uns versteh'n!« –
Im Winter aber, wenn der Schnee in dichten Flocken zur Erde herabwirbelte, und die Kinder unter Lachen und Jauchzen den grimmigen Schneemann bauten, dann preßte das Sonntagskind sein Blondköpfchen gegen die Fensterscheibe, schaute in das lustige Schneetreiben hinaus, und die herniedertanzenden Flocken erzählten dem kleinen Mädchen von dem bläulich funkelnden Eispalast droben in den Wolken, und durch ihren Märchenschleier erblickte es die schimmernde Eiskönigin in ihrem glitzernden Eiszapfengewande. –
Die allerschönsten Märchen aber wußte das flackernde Kaminfeuer der Kleinen zu berichten, – hei! – wie das knisterte und prasselte, und atemlos lauschte das Sonntagskind den Märchen, die das knatternde Holz aus Wald und Heide erzählte. Aus den Flammen zischte es zu dem Mägdlein empor:
»Was ich schaut' in der Heide auf Waldesmoos, Du Sonntagskind vernimmst es bloß!« –
So wuchs das Sonntagskind heran, und all' die schönen Märchen, die es durch seinen Märchenschleier geschaut und erlauscht, hat es niedergeschrieben, daß sich auch all' die anderen Kinder auf der Welt daran freuen sollen.
»Und für euch Kleinen erzählt jetzt geschwind Die schönsten Märchen das Sonntagskind!«
Seifenblasen
Die Nachmittagssonne glühte vom dunstigen Julihimmel hernieder, da machte es sich Hänschen im Garten unten an dem kleinen Teiche bequem. Dort unter den Jasminbüschen war es kühl und schattig; Hänschen kramte seine mitgebrachten Werkzeuge, das Näpfchen mit Seife und das feine Hollunderrohr heraus und machte sich an die Arbeit. Er füllte das Näpfchen mit Teichwasser, setzte sich in das weiche Gras und da – da flog die erste bunte Seifenblase aus dem kleinen Rohre in die blaue Luft hinein.
Ach – wie sie schimmerte und flimmerte!
Eine bunte Kugel nach der anderen blies Hänschen in die Luft – große – kleine – da diese – ei, wie glitzerte die im Sonnenlicht; mit blinzelnden Augen schaute Hänschen den rot, blau, gelb und grün schillernden Kugeln, die so lustig emporstiegen, nach.
Aber – o weh – eine nach der anderen zerplatzte; keine kam bis an die Wolken, so kräftig auch Hänschen pustete. Ganz rot war der kleine Knirps schon von der Anstrengung, da – flog wieder eine herrliche Seifenblase aus dem Rohre, die war größer und bunter als all' die anderen.
»Ach – wer doch auch so fliegen könnte,« dachte Hänschen. Aber, wie seltsam – die Seifenblase hielt im Fluge inne, ganz still hing sie über Hänschen in der Luft und, o Wunder – jetzt tat sie sogar den Mund auf und sprach:
»Pfui – Hänschen – wie garstig siehst du aus, ganz schwarz und schmutzig bist du; schau mich au, wie rein und klar mein Gesicht und meine Hände sind – hast du dich etwa heute morgen nicht ordentlich waschen lassen?«
Da senkte Hänschen schuldbewußt den Kopf, und ganz leise jagte er:
»Ach, liebe Seifenblase, das Wasser war ja so schrecklich naß und kalt, und die Minna rubbelte immer so mit dem großen Schwamm, und die alte Seife beißt so in die Augen, da habe ich heute beim Waschen wieder geschrien und bin der Minna fortgelaufen!«
»Und die Haare?« sprach die Seifenblase tadelnd, »die hast du dir auch nicht kämmen lassen, ganz struwelig schaust du aus!«
»Ja, – siehst du,« antwortete Hänschen, »die Minna reißt immer so an meinen Locken, das tut so weh, und da –«
»Nun, was war da?« fragte die Seifenblase.
»Da habe ich sie mit den Füßen gestoßen,« kam es ganz beschämt von Hänschens Lippen.
»Du bist ja ein schrecklich ungezogener Junge,« sprach die Seifenblase und schaukelte vor Ärger in der Luft hin und her, »was mache ich denn nun mit dir?«
»Ach,« meinte Hänschen, und seine Augen leuchteten, »wenn du mich ein ganz klein wenig mitfliegen lassen könntest, das wünsche ich mir schon lange!«
»Weil du heute morgen so unartig gewesen bist, nicht wahr?« sagte die Seifenblase, »hast du denn wenigstens schön deine Milch ausgetrunken?«
»Auch nicht ganz,« war die leise Antwort, »es war ja schon so spät geworden; ich mußte in die Schule, und Milch« – er schüttelte sich – »Milch trinke ich überhaupt nicht gern!«
Die Seifenblase dachte ein wenig nach.
»Schön, ich will dich mitnehmen,« sprach sie nach kurzer Überlegung, »aber so, wie du aussiehst, geht es nicht; ich müßte mich ja vor den Vöglein in der Luft, vor der lieben Sonne, vor den Wolken und dem Winde deiner schämen! Geschwind – komm', laß dich waschen!« Und – schwabb – sprang sie Hänschen mit ihrem Seifenschaum über das Gesicht.
Au – war das naß! Schon wollte Hänschen losschreien, aber aus Angst, daß er dann nicht mitgenommen würde, hielt er noch rechtzeitig inne.
»So – nun kannst du dich sehen lassen,« meinte die Seifenblase, »jetzt darfst du aufsitzen.«
»Wirst du auch nicht zerplatzen?« erkundigte sich Hänschen noch vorsichtig.
»Nein, ich bin aus dreifachem Seifenschaum,« sagte die Seifenblase stolz, nahm Hänschen auf den Rücken und stieg wie der schönste Luftballon mit ihm empor.
Ei – das war lustig; Hänschen klatschte vor Vergnügen in die Hände. Wie auf seinem Schaukelpferde ritt er auf der bunten Seifenblase in die Luft hinein; immer höher und höher stiegen sie. Das stattliche, große Haus von Hänschens Vater schrumpfte zu einem winzigen, weißen Punkte zusammen; jetzt waren sie schon höher als die Spitzen der allerhöchsten Berge, und nun ging's geraden Weges in die Wolken hinein.
Hu – war's da kalt und naß – eine tüchtige Dusche kriegte Hänschen über den Kopf, aber er traute sich nicht zu schreien.
»So – mein Junge,« sagte die Seifenblase, »damit du dich an das kalte Wasser gewöhnst!«
Und weiter ging's.
Da begegnete ihnen der Sturmwind.
Mit seinen langen, knochigen Fingern griff er in Hänschens Locken – au – wie er ihn zauste!
»Daß du dich auch an das Kämmen gewöhnst,« sprach die Seifenblase, und die Reise ging weiter.
Jetzt flog die Seifenblase mit Hänschen die Milchstraße entlang – ei – wie hübsch war es hier! Auf funkelnden, silbernen Sternenstühlchen saßen kleine, blondlockige Englein und tranken große Gläser mit Milch.
»Siehst du,« sprach die Seifenblase, »wie artig all' die kleinen Engelchen ihre Milch trinken!«
Nun senkte sich die Seifenblase mit Hänschen herab, tiefer, immer tiefer – und jetzt waren sie in Afrika. Prächtige Palmen und Dattelbäume gab es da, fremdartige, große Blumen, seltsame bunte Vögel, und da – was war das? Ein schwarzes Geschöpf trabte aus den Kokospalmen heraus, pechrabenschwarz war es von Kopf bis zu den Füßen, schwarzes Wollhaar krauste sich um seinen Kopf, mit breitem Grinsen fletschte es die weißen Zähne.
»Ist das ein Affe?« fragte Hänschen ängstlich die Seifenblase, denn er hatte im Zoologischen Garten einmal einen solchen gesehen.
»Nein, Hänschen – das ist ja der Mohr aus dem Struwelpeter, kennst du ihn nicht wieder, der ist hier in Afrika zu Haus. Schau ihn dir nur recht an, gerad' so schwarz und garstig wirst du auch, wenn du dich von der Minna nicht waschen läßt, und deine hübschen, blonden Locken werden solch häßliches, schwarzes Wollhaar, wie der Mohr es hat, wenn du beim Kämmen schreist. So – und nun wollen wir wieder die Heimreise antreten.«
Damit schwang sich die Seifenblase mit Hänschen wieder in die Luft empor.
Aber sie kamen nicht weit, die Seifenblase fuhr plötzlich so ungestüm gegen einen hohen Berg, daß sie in lauter kleine Wasserperlchen zerplatzte; Hänschen fiel – immer tiefer – Sehen und Hören vergingen ihm – und als er die Augen aufschlug – da lag er im weichen Grase unter den Jasminbüschen am Gartenteich; neben ihm stand das Seifnäpfchen, und das Holunderrohr hielt er fest in der Hand. –
Hänschen war bei seinen Seifenblasen eingeschlafen. Vor ihm stand Minna mit der Abendmilch, und schon wollte Hänschen ein Gesicht ziehen, als er die Milch sah, da aber dachte er an die artigen, kleinen Englein droben in der Milchstraße, und – eins, zwei, drei – war das Glas leer.
Als aber auch das Hänschen am anderen Morgen beim Waschen gar nicht schrie und sich auch ganz artig die wirren Locken kämmen ließ, da wunderte sich Minna sehr – freilich, die wußte ja auch nichts von Hänschens lustiger Reise auf der Seifenblase.
Naschkätzchen
»So – Elschen – du sollst auch bei Papas Geburtstagstorte helfen, geschwind, reibe mir die Mandeln auf dem kleinen Reibeisen,« sagte die Mutter lächelnd, der Kleinen eine große Tüte mit süßen Mandeln zuschiebend.
Mit leuchtenden Blicken machte sich Elschen an die Arbeit. Ei, wie schön das ging – lustig sprangen die weißen und braunen Mandelflöckchen in den Napf.
Ob sie wohl schön süß waren? – Elschen machte begehrliche Augen; ach – wenn Muttchen sich doch nur einmal umdrehen wollte! Muttchen aber drehte sich nicht um, ein Ei nach dem anderen schlug sie in die duftende Kuchenmasse und knetete sie mit dem weißen Mehl zusammen.
Elschens eben noch so fröhliches Gesicht wurde mit einem Male ganz brummig; verdrossen rieb sie die Mandelkerne, die lustige Arbeit machte ihr auch kein bißchen Spaß mehr – wenn sie doch nur heimlich eins der hübschen, braunen Kernchen in den Mund spazieren lassen könnte! Aber die liebe Mutter, die ihr doch sicherlich gern eine Mandel geschenkt hätte, darum zu bitten, das fiel dem kleinen Mädchen nicht ein.
»Anna, ist der Backofen auch gut heiß?« fragte die Mutter und wandte sich prüfend dem Herde zu. Schwapp – hatte Elschen eine große Mandel in den Mund geschoben. Doch da – in der Hast kam das Fingerchen zu dicht an das Reibeisen.
»Au« – schrie Elschen und lief bitterlich weinend zur Mutter. Tröstend verband die gute Mutter das blutende Fingerchen; sie sah nicht Elschens verlegenes Gesicht, als sie ihr als Schmerzensgeld zwei wunderschöne, braune Mandeln schenkte. Die Kleine durfte zusehen, wie die großen und die kleinen Rosinen in den Teig gerührt wurden; das sah hübsch aus, fast wie wenn die dunklen Spatzen im Winter auf dem weißen, beschneiten Gärtchen draußen hockten.
Doch als sich die Mutter umwandte, um die Form auszuschmieren, da konnte es sich das naschhafte, kleine Mädchen nicht versagen, ganz geschwind das gesunde Fingerchen in den Teig zu tauchen und eine Rosine herauszufischen.
Die Torte war fix und fertig; eine große »Vierzig«, aus Teig geformt, prangte in der Mitte, denn morgen wurde der liebe Vater ja vierzig Jahre alt. –
Braun und knusprig, über und über mit Zucker bestreut, stand die prächtige Torte neben all den anderen schönen Gaben am nächsten Morgen auf dem Geburtstagstisch; die Mutter war hinausgegangen, um den Vater zur Bescherung hineinzurufen. Mit sehnsüchtigen Augen stand Elschen vor der Torte. Auf dem Boden neben ihr spielte ihr kleines, weißes Kätzchen Mimi, dem sie zu Ehren des Geburtstages ein blaues Seidenschleifchen umgebunden hatte.
Ach, wie herrlich duftete doch die Torte!
Elschens Finger kamen der Vierzig bedenklich nahe – nur ein ganz kleines Stückchen – Vater würde es ja nicht merken! Hei, wie schön das schmeckte! Noch ein ganz klein wenig – wieder näherte sich das Kinderhändchen der Torte – und noch einmal – da war die Vier ganz und gar in Elschens Mund verschwunden; einsam thronte die Null auf der Geburtstagstorte. Entsetzt schaute Elschen auf das zerstörte Backwerk – nein – so ging es nicht, nun mußte die Null auch schon herunter. Da – hörte sie Schritte – o weh, die Eltern kamen – mit zitternden Fingern riß Elschen hastig nun auch noch die Null von dem Kuchen und ließ sie geschwind in die Tasche ihres Kleidchens gleiten.
Sie wagte dem guten Vater, der sein Töchterchen liebevoll in die Arme schloß, kaum in die Augen zu blicken, scheu sah sie zu, wie die Mutter ihn freudestrahlend an den Geburtstagstisch und zu der selbstgebackenen Torte führte.
Aber ach – wie sah dieselbe aus! Die Vierzig fehlte, und ein großes Stück war aus der Mitte herausgerissen. Betrübt schaute die Mutter auf ihr verdorbenes Geschenk. Tränen des Ärgers traten ihr in die Augen, da fiel ihr Blick auf das harmlos auf dem Fußboden herumspielende Kätzchen.
»Das war gewiß wieder Mimi, das naschhafte Kätzchen,« rief sie ärgerlich; denn daß ihr Töchterchen ihr die Freude so gestört haben könnte, das kam der guten Mutter nicht in den Sinn.
Sie griff zu dem Rohrstock – und hui – da sausten die Schläge auf das arme, unschuldige Kätzchen herab. Jämmerlich miaute Mimi – Elschen aber schwieg, sie wagte es nicht, ihre Schuld einzugestehen; doch als das Kätzchen sie gar so vorwurfsvoll anblickte, da begannen Elschens Tränen zu fließen.
»Wie weichherzig das Kind ist,« sagte die Mutter zum Vater, »nun weint sie, daß ich das böse Kätzchen für seine Naschhaftigkeit bestrafe.«
Und Elschen – schwieg weiter, aber die Geburtstagsfreude hatte sie sich gründlich verdorben! – – –
»Komm', mein Kind, du sollst dem kranken Nählieschen ein Gläschen von unseren schönen, eingemachten Kirschen hintragen,« sprach die Mutter eines Tages zu Elschen, »die werden sie ein wenig erquicken. Geschwind, laß dir ein reines, weißes Schürzchen vorbinden und bestelle dem armen Nählieschen einen schönen Gruß.«
Elschen machte sich auf den Weg.
Es war ein prächtiger Sommertag, golden flimmerte die Sonne hernieder; ein linder Wind jagte die weißen Lämmerwölkchen am blauen Himmelszelt lustig vor sich her.
Nählieschen wohnte nicht weit, nur durch den schönen, schattigen Park mußte Elschen gehen, dann kam sie zu den kleinen, armseligen Häusern draußen in der Vorstadt, wo die arme Näherin krank daniederlag.
Elschen ließ sich Zeit, es war herrlich im Park, vorsichtig trug sie ihr Gläschen mit Kirschen vor sich her. Wie die Sonnenstrahlen auf dem Gläschen spielten und glitzerten, wie verlockend die roten Kirschen im Sonnenlicht zu Elschen emporleuchteten!
Das Naschkätzchen konnte nicht widerstehen!
Eine Kirsche nach der anderen wanderte in ihren Mund – wie süß und saftig sie schmeckten – wie erquickend mußte nun erst der schöne Saft von den Kirschen sein!
Kein Mensch ringsherum – nur die Schwäne auf dem Teich machten lange Hälse und schauten dem Naschkätzchen erstaunt zu. Da nahm Elschen das Glas schnell an den Mund – einen großen Schluck – ach – da lief der rote Saft an dem weißen Schürzchen herunter, erschreckt hielt Elschen im Naschen inne.
Was nun?
So durfte sie nicht nach Hause kommen, da merkte die Mutter gleich, daß sie genascht hatte. Elschen wußte sich zu helfen. Flink band sie das Schürzchen ab und warf es in den Teich, lustig schwamm es davon, und argwöhnisch sahen die Schwäne auf das seltsame Ding.
Elschen aber lief weiter zum Nählieschen, und beschämt mußte sie den warmen Dank der armen Kranken für die schönen Kirschen, von denen sie doch die Hälfte fortgenascht hatte, über sich ergehen lassen.
Muttchen merkte nicht, daß Elschen sich heimlich zu Hause ein anderes Schürzchen umband; aber als die alte Waschfrau das nächste Mal die Wäsche brachte, da vermißte die Mutter das weiße Schürzchen.
Hoch und heilig versicherte die Frau, es sei nicht bei der Wäsche gewesen; aber die Mutter, die das Schürzchen nirgends sah, mußte doch glauben, daß die Waschfrau es entwendet habe. Die arme Frau bekam keine Arbeit mehr – und Elschen schwieg wieder dazu. – –
»Ich weiß gar nicht, wo das Schokoladenpulver immer bleibt,« sagte Köchin Anna unwirsch, als sie das Morgengetränk für den Vater kochte.
Elschen wußte es, wo es geblieben war; jeden Morgen, wenn Anna auf den Markt einkaufen ging, stattete Elschen der Schokoladentüte einen längeren Besuch ab.
Auch heute war sie noch vor der Schule heimlich in die Küche hinausgehuscht; vorsichtig, daß die Tür nicht knarrte, öffnete sie den Vorratsschrank.
Heut' lagen gar zwei Schokoladentüten nebeneinander; flink griff Elschen in die eine und stopfte, so viel nur hineingehen wollte, von dem bräunlichen Pulver in den Mund.
Pfui – wie schmeckte das! Elschen würgte und würgte, aber sie hatte den größten Teil schon hinuntergeschluckt. Da fing sie jämmerlich an zu weinen; das war ja gar kein Schokoladenpulver, das war sicherlich Gift!
»Ach – Mutter – liebstes Muttchen – ich muß sterben!« laut schreiend lief sie zu der erschreckten Mutter.
Jammernd und sich vor Angst windend, beichtete sie, daß sie genascht, und die entsetzten Eltern stellten aufatmend fest, daß Elschen an die Tüte mit – Putzpulver geraten war. Trotzdem das Pulver nicht giftig war, sandte man sofort zum Arzt. Wimmernd lag Elschen im Bett.
»Lieber Gott,« betete sie, »laß mich doch nur nicht sterben, ich will ja in meinem ganzen Leben nicht wieder naschen!«
Der Doktor gab Elschen ein Brechpulver, und dann mußte sie im Bett liegen und konnte am nächsten Tage nicht mit auf das schöne Gut zu Großpapa, worauf sie sich doch so gefreut hatte.
Das war ihre gerechte Strafe!
Aber der lieben Mutter beichtete Elschen ganz leise, wer die Vierzig von Vaters Geburtstagstorte fortgenascht hatte, und wohin das weiße Schürzchen verschwunden war.
Da weinte die Mutter bittere Tränen über ihre mißratene, kleine Tochter, und das tat Elschen viel, viel weher als die ärgsten Schläge.
Elschen hat ihr Wort gehalten; in ihrem ganzen Leben hat sie nicht wieder genascht – das Naschkätzchen war gründlich kuriert.
Das Regenbogenprinzeßchen
Wo das Meer in wilden Wogen an den sandigen Strand brandet, weit, weit fort, stand eine einsame Fischerhütte.
Dort wohnte ein armer Fischer mit seinem Weibe und seiner kleinen Pflegetochter Edda. Jede Nacht fuhr er mit seinem Kahne ins brausende Meer hinaus und kehrte gegen Morgen mit vollen Netzen wieder heim, darin krabbelten große und kleine Seefische, die trug dann seine liebe Frau zum Verkauf in die Stadt. So lebten sie schlecht und recht.
Die kleine Edda mußte mit ihren zarten Fingerchen die groben Netze ausbessern, barfuß mußte sie an dem nassen Strand dahinlaufen und große Muscheln und bunte Steinchen suchen, die das Meer herangeschwemmt hatte. In den langen Winterabenden klebte sie dieselben auf rote Kästchen und trug sie dann im Sommer, wenn die Badegäste in das nahgelegene Seebad eingekehrt, zum Verkauf.
Ein jeder schaute wohl dem seltsam schönen Kinde mit dem durchsichtigen, weißen Gesichtchen, in dem die veilchenblauen Augen sternengleich strahlten, und dem wehenden, schimmernden Goldhaar verwundert nach; wie kamen die einfachen Fischersleute zu solch einem Töchterchen?
Vor acht Jahren war's, bei der großen Sturmflut, das Meer raste und toste, schaurig brauste und heulte der Wind in den Lüften.
Da legte sich mit einem Male der Sturm, trotz des noch strömenden Regens brach die Sonne golden durch – ein wunderbarer, farbensatter Regenbogen spannte sich über das Meer.
An dem Ufer aber in dem weißen Sande fand die Fischersfrau ein kleines, rosiges Mägdlein von etwa zwei Jahren, das weinte; ein feines, goldenes Kettchen trug es um den Hals – keiner wußte, woher das Kind gekommen. Das war die kleine Edda!
Die gute Frau nahm das hilflose Mägdlein mit heim, gab ihm warme Milch zu trinken und zog es an Kindesstatt auf. Aber das kleine Mädchen war und blieb anders als all die übrigen seegebräunten, rotbäckigen Kinder des Fischerdorfes. Ihr Gesicht und ihre Händchen blieben trotz der brennenden Sonne weiß und zart, niemals sah man sie an den wilden, lauten Spielen der anderen Fischerkinder teilnehmen, stundenlang lag sie in dem weichen, warmen Sande, horchte dem Rauschen des Meeres zu und starrte träumerisch in die blaue, durchsichtige Luft.
»Das Prinzeßchen« nannten sie die Kinder in der Schule höhnend; darüber weinte die kleine Edda bittere Tränen. Aber wenn sie später allein am Meeresstrande lag, dann dachte sie doch manchesmal: »Bin ich vielleicht wirklich ein kleines Prinzeßchen?« Und sie betrachtete das feine, goldene Kettchen, das sie noch immer um den Hals trug.
Eines Tages ging sie wieder Muscheln suchend am Strande entlang, da flimmerte es in dem weißen Sande. Edda beugte sich herab und hob ein merkwürdig geformtes, dreikantiges Stück Glas auf, das funkelte bunt in Sonnenlicht. Sie hielt das Glas ans Auge und blickte hindurch: »Ein Regenbogen!« jauchzte sie; rot, orange, gelb, grün, blau und violett schimmerte ein leuchtender Regenbogen über dem Meer. Edda war selig über den herrlichen Fund, sorgsam verbarg sie das kostbare Glas in ihrem grauen Leinenkittel.
So oft sie konnte lief sie jetzt an das Meer hinaus und zauberte sich den farbenprächtigen Regenbogen herauf. Viele Stunden schon schaute Edda eines Tages bei strahlendem Sonnenschein wieder durch ihr Zauberglas; immer deutlicher und deutlicher sah sie die herrlichen Farben, sie kamen näher – immer näher – jetzt hüllten sie die kleine Edda mit ihrem bunten Schimmer ganz und gar ein! Der weiße, sonnendurchglühte Strand mit dem Fischerhäuschen, das wogende Meer verschwand plötzlich – Edda war mittendrin in der glänzenden, roten Farbe des Regenbogens! Aber das war keine rote Farbe mehr – ein prächtiger, riesengroßer Garten war's, da blühte und leuchtete der schönste, rote Mohn.
Glückselig lief Edda durch die schimmernden Mohnfelder, die so wunderbar waren, wie sie die kleine Edda nimmer geschaut hatte. Die Mohnblüten waren fast wie ein kleiner Wald so hoch, sie waren größer als Edda selbst, stolz wiegten sie ihr brennend rotes Köpfchen auf dem schlanken, grün behaarten Stengel. Die dichten Mohnbüsche taten sich vor Edda von selbst auseinander, und die Blüten neigten ehrfurchtsvoll ihr Haupt wie vor einem kleinen Prinzeßchen. Ein leises Rauschen ging durch das wogende Mohnfeld, es flüsterte in den Halmen; deutlich vernahm Edda die Worte:
»Rot – rot – wie Blut so rot. Bringen Schlaf und frühen Tod, Pflück' mich doch, ich bitt', Edda nimm mich mit.«
sang die größte Mohnblüte. Schon streckte Edda die Hand nach der leuchtenden Blume aus, um sie zu pflücken, da flog plötzlich ein purpurrotes Marienkäferchen ihr auf die Schulter und summte ihr ins Ohr:
»Prinzeßchen, folg' nicht dem lockenden Ton, Verwandelst sonst selbst dich in roten Mohn.«
Da zog Edda erschreckt die Hand zurück und ging weiter. Die purpurnen Büsche schlossen sich hinter ihr, und sie kam in den zweiten Garten des Regenbogens.
Hier glühte alles im orangefarbenen Schein, rötlich gelb leuchtete es, schattige Orangenhaine wölbten sich über Edda, saftige Orangenfrüchte hingen von den Bäumen herab. Ganz erschöpft war Edda von dem weiten Weg, sie legte sich unter einen Orangenbaum und schloß die müden Augen. Da hörte sie im Traum ein leises Rauschen in den Zweigen:
»Saftig und süß wir Orangen sind. Komm' und pflück' uns, du Königskind.«
Ach, sie war ja so durstig und so verschmachtet! Schon hob sie die Hand nach der lockenden Frucht, da flog ein orangefarbener Falter ihr auf die Schulter und summte:
»Prinzeßchen, folg' nicht dem lockenden Traum, Sonst wirst du selbst zum Orangenbaum!«
Da stand Edda geschwind von dem weichen Lager auf und lief erschreckt aus dem Orangenhain hinaus.
Jetzt kam sie in den dritten Garten, da strahlte alles in funkelndem Gold. Goldgelbe Sonnenblumen standen majestätisch nebeneinander, die waren so groß, daß sie sich mit ihren glänzenden Strahlenblättern wie ein schützendes Dach über Edda schlossen. Hellauf jauchzte Edda beim Anblick der gelben Blumenpracht, das schimmerte und gleißte wie eitel Gold. Die Sonnenblumen streuten goldene Funken auf Eddas wehendes Blondhaar; die schönste aber neigte sich vor ihr und sang:
»Wind' uns zum Krönchen, so funkelnd wie Gold, Setz' uns aufs Köpfchen, du Königskind hold!«
Da faßte Edda die leuchtende Sonnenblume, schon wollte sie die goldenen Blumenblätter zur Krone flechten, da schwirrte eine goldene Fliege ihr auf die Schulter und summte ihr ins Ohr:
»Laß ab – laß ab – in einem Nu Wirst sonst zur Sonnenblume du!«
Sie ließ die glänzenden Blätter entsetzt los und lief hinaus aus dem goldenen Garten.
Weiter ging sie und kam an ein großes, grünschimmerndes Wasser. Daraus wuchs manneshoch grünes Schilf empor; das schwankte und neigte sich im leisen Winde. Am Ufer lag ein kleiner, grüner Nachen zum Einsteigen für Edda bereit, ein grünschillerndes Glühwürmchen saß am Steuer. Edda stieg in den Nachen, und dahin glitt er auf den sanft schaukelnden Wellen. Das Glühwürmchen steuerte mit seinen Fühlhörnern sicher durch das dichte Schilf, das bog sich und rauschte:
»Es wehet das Schilf, es flüstert im Rohr, Zieh' Edda uns aus den Wassern empor!«
Schon berührte das nickende Schilfrohr das weiche Händchen Eddas, da wisperte das Glühwürmchen am Steuer ihr zu:
»Laß steh'n, Prinzeßchen, ohne Hilf' Wirst sonst du selbst zu grünem Schilf!«
Und schnell führte das Glühwürmchen den Nachen ans andere Ufer. Edda stieg aus und wanderte weiter.
Da sprang ein munteres, silberhelles Bächlein durch einen himmelblauen Garten übermütig dahin; leuchtend blaue Vergißmeinnicht umkränzten es und schauten Edda mit frommen Sternenaugen an. Edda lief an dem Bächlein entlang über die blauen Vergißmeinnicht, aber sie zertrat die Blümchen nicht; die zarten Blüten beugten sich unter ihrem Füßchen und richteten sich hinter ihr wieder auf. Leise und fromm klang es zu Edda empor:
»Sind wie der Himmel so blau und licht, Komm' Edda, pflück' das Vergißmeinnicht!«
Und Edda neigte sich herab zu den holden Blümelein und strich ihnen liebkosend über das Köpfchen. Da flog eine kleine Blaumeise ihr auf die Schulter und zwitscherte ihr ins Ohr:
»Prinzeßchen, laß stehn, sonst wirst du – ach – Selbst ein Vergißmeinnicht am Bach!«
Da flossen Edda die Tränlein aus den Augen, gar zu gern hätte sie die Blümlein gepflückt, aber sie hörte auf das warnende Gezwitscher der kleinen Blaumeise, ließ die blauen Blümchen stehen und lief weiter.
Gar süß duftete es jetzt um Edda; sie kam in einen großen Garten, da gab es nichts als Veilchen. Wohin sie auch blickte, schimmerte es violett, herrlich groß standen die samtweichen Veilchen umher, wie ein leuchtend violetter Teppich breiteten sie sich vor Edda. Mit müden Augen blinzelte Edda in das blaue Gewoge um sich herum. Da sah sie plötzlich ein funkelndes, buntschimmerndes Schloß aus dem Garten herüberleuchten; sie wollte hinlaufen, aber der Kopf und die Glieder waren ihr von der betäubenden Veilchenluft so schwer, daß sie sich nicht fortbewegen konnte. Leise klang es ihr ins Ohr:
»Es flimmern wir Veilchen zart violett, Wirf dich ins duftige Veilchenbett, Prinzeßchen pflück' ab uns zur Decke, Die müden Gliederlein strecke!«
Verlockend dufteten die Veilchen zu ihr auf. Da warf sich Edda in die schwellende Veilchenpracht; sie hörte nicht auf das mahnende Zirpen der kleinen Grille:
»Prinzeßchen, schlaf nicht, nur ein Weilchen Und du wirst selbst zum Veilchen!«
Mit vollen Händen riß sie die duftenden Blüten heraus, die hüllten sie weich und warm wie eine Samtdecke ein, Edda fiel in einen tiefen Schlaf.
Als sie daraus erwachte, rieb sie sich die Äuglein und schaute verwundert um sich. Was war mit ihr geschehen? Sie stand nicht viel über dem Erdboden zwischen all den anderen Veilchen; ihre Beine steckten fest in der dunklen Erde, sie waren zu zarten Würzelchen geworden, ihr weißer Körper war zu einem winzigen, grünen Stiel zusammengeschrumpft, statt des blonden Köpfchens trug sie eine leuchtende, violette Blüte; die kleine Edda hatte sich in ein süßduftendes Veilchen verwandelt. Da weinte sie bitterlich, und die Tränen hingen als große Tautropfen an ihren Blumenblättern.
So stand die kleine Edda als Blauveilchen in dem Garten, der das funkelnde, bunte Schloß umkränzte. In dem Schloß aber lebte der König und die Königin vom Regenbogenland. Die schöne, bleiche Königin saß traurig sinnend auf der Terrasse, die in den Veilchengarten hinabführte.
Heute war wieder der Jahrestag, an dem ihr einziges Töchterchen plötzlich verschwunden; acht Jahre war es nun schon her! Lange schon hatte sie die Hoffnung, ihr Kind jemals wiederzusehen, aufgegeben; aber sie konnte ihren verlorenen Liebling noch immer nicht vergessen. Das kleine, zweijährige Mädchen spielte vor ihren Augen auf der Regenbogenbrücke, da kam es dem Rande der Brücke zu nahe, ein Schrei – die kleine Edda versank in der Tiefe!
Ein wirbelnder Windstoß hatte das kleine Prinzeßchen erfaßt, er wehte es durch all' die farbenprächtigen Regenbogengärten – tiefer – immer tiefer herab – bis auf die Erde. Niemals hatten die Eltern ihre kleine Edda wiedergesehen; sie war und blieb verschwunden, alle Nachforschungen des Königs und all' die heißen Tränen, welche die Königin um ihr verlorenes Töchterlein weinte, blieben erfolglos. – – –
Tränenden Auges trat die Königin in den Veilchengarten hinaus und schritt durch die duftigen Blüten. Da sah sie plötzlich im Grase ein Veilchen blühen, das war so zart, samtweich und leuchtend violett und duftete süßer als all' die anderen. Die Königin neigte sich zu dem holden Blümchen herab, grub es vorsichtig aus und strich liebkosend mit ihren weißen, zarten Fingern über sein blaues Blütenköpfchen. Es wurde dem Blauveilchen, der verwandelten, kleinen Edda, so warm ums Herz unter der liebevollen Berührung der weichen Hand der Königin.
»So blau wie das süße Veilchen waren die Augen meines Kindes,« dachte die Königin betrübt, neigte sich auf das Veilchen herab und küßte leise und innig die blauen Blütenblättchen.
Da gab es einen lauten Knall – der Boden rings umher dröhnte – ein Wirbelwind machte sich auf – er riß das Blauveilchen aus der Hand der Königin, statt dessen stand – ein liebliches, zehnjähriges Mägdelein mit leuchtendem Blondhaar vor der Regenbogenkönigin und schaute sie mit schimmernden Veilchenaugen an.
»Mein Kind – meine Edda!« rief die Königin, denn schon hatte sie ihr Töchterchen an dem goldenen Kettchen, das es um den Hals trug, erkannt. Selig schloß sie den wiedergefundenen Liebling in die Arme, und vertrauensvoll schmiegte Edda das Köpfchen an die Brust der Mutter. Im ganzen Regenbogenlande herrschte großer Jubel über die Wiederkehr der kleinen Regenbogenprinzessin, und der König ließ in seiner Herzensfreude seine farbenprächtigen Gärten in den leuchtendsten Farben erglühen; das sahen all' die Kinder unten auf der Erde und jauchzten:
»Ach – der wunderschöne Regenbogen!«
Onkel Doktor
»Onkel Doktor kommt – Onkel Doktor kommt!« riefen die Kinder und stürzten dem lieben Onkel Doktor mit der goldenen Brille und dem gütigen Lächeln jubelnd entgegen.
Klärchen hing sich an seinen linken Arm, Friedchen an den rechten, und der Erich hielt sich an seinen beiden langen Rockschößen fest. So brachten sie ihn im Triumpf herein; alle hatten sie ihn lieb, den guten Onkel Doktor, der mit jedem Kinde sein Späßchen machte.
Nur der Günther, der dumme, kleine Günther, hatte Angst vor ihm; der verkroch sich in die dunkelste Ecke der Kinderstube, wenn er seinen Wagen vorfahren hörte und schrie wie am Spieß, wenn er hervorgeholt wurde, um artig guten Tag zu sagen und seine Zunge zu zeigen. Und dabei tat doch der Onkel Doktor keinem Kinde weh; er zeigte ihnen seine schöne Uhr, die ganz von selbst schlagen konnte und seine feine, goldene Schnupftabaksdose mit den hübschen Bildern. Klärchen, die schon in die Schule ging, bekam für jede gute Zensur eine süße Tüte, Friedchen mußte all' ihre Puppen vorführen, und Onkel Doktor fühlte einer jeden den Puls, und Erich ließ er auf seinen Knien reiten, daß es eine Lust war. Und Märchen konnte er erzählen; kein anderer wußte so herrliche Geschichten wie Onkel Doktor; war ein Kind krank und hatte artig die bittere Medizin eingenommen, dann erzählte er zur Belohnung ein schönes Märchen.
Auch heute drängten sich die Kinder wieder um sein Knie, sie hatten alle drei schon artig ihre Zunge gezeigt und ganz still gehalten, als Onkel Doktor den Puls gefühlt hatte; nur der Günther stand wieder in seiner Angstecke und war nicht herauszukriegen.
»Nun, Günther,« fragte Onkel Doktor, »willst du mir nicht auch guten Tag sagen?«
Günther aber bohrte unartig das Gesicht in seine kleinen Händchen und rührte sich gar nicht. Da kümmerte sich Onkel Doktor nicht mehr um den ungezogenen Jungen.
»Wißt ihr, Kinder,« sagte er zu den anderen drei, »ich habe heute gerade einen freien Nachmittag, ich lade euch ein, mit mir eine Spazierfahrt in meinem Wagen zu machen.«
»Ach, Onkel Doktor – liebes Onkelchen!« jauchzten die Kinder.
»Na, erdrückt mich nur nicht mit euren Zärtlichkeiten, sonst kann aus der Spazierfahrt nichts werden,« sagte der Onkel Doktor lachend, »geschwind, laßt euch fertig machen.«
Die Kinder stürmten davon, und auch Günther kam aus seiner Ecke heraus, aber er sah den Onkel Doktor nicht an.
»Ich möchte auch mit,« klang es nach einem Weilchen von den Lippen des Kleinen.
»Du,« – sagte Onkel Doktor erstaunt, »du hast ja Angst vor mir!«
»Ich könnte mich ja auf den Bock zum Kutscher setzen, dann brauchte ich dich nicht zu sehen,« meinte Günther etwas kleinlaut.
Aber Onkel Doktor schüttelte ernst den Kopf.
»Nein, mein Junge – Kinder, die nicht guten Tag sagen und Angst vor mir haben, die nehme ich nicht mit!«
Und Günther mußte zu Hause bleiben!
Ach, wie drückte er das Näschen sehnsüchtig gegen die Fensterscheibe, als die anderen Kinder lachend in dem prächtigen Wagen davonsausten; ein Tränchen nach dem anderen rollte über seine dicken Bäckchen, denn süße Milch mit Erdbeeren hatte der gute Onkel den Kindern in der Meierei, wohin die Fahrt gehen sollte, ja auch noch versprochen.
Und als abends nun alle fröhlich heimkehrten und nicht genug von dem herrlichen Ausflug erzählen konnten, wie der Onkel Doktor mit ihnen im Walde so schön »Verwechsel' das Bäumchen« und »Dritten abschlagen« gespielt habe, da tat es dem Günther doch sehr leid, daß er so unartig gewesen, aber – er sagte das nächste Mal wieder nicht guten Tag.
Diesmal brachte der Onkel Doktor den Kindern eine Einladung in seinen großen Garten zum Ostereier-Suchen, und wieder stand der Günther in seiner Ecke; er wäre so gern auch eingeladen worden, aber er war zu eigensinnig, um artig »Guten Tag, lieber Onkel Doktor!« zu sagen.
So mußte er also auch diesmal zu Hause bleiben, und der Osterhase legte ihm kein einziges Ei!
Eines Tages hatte sich Günther den Magen gründlich verdorben, es war ein Tag nach seinem Geburtstag; er hatte zu viel von der großen Torte gegessen. Er fieberte stark, und die Mama steckte ihn ins Bett und schickte zum Onkel Doktor.
Der aber war gerade über Land gefahren, und so sandte die Mama zu einem fremden Arzt in der Nähe.
Als der neue Doktor kam, vergrub Günther wieder den Kopf in die Kissen und wollte sich nicht untersuchen lassen. Aber der fremde Doktor machte wenig Umstände mit dem unartigen, kleinen Burschen; so sehr der Kleine auch schrie, der Doktor untersuchte ihn ganz ruhig, und als er sich auch nicht in den Hals sehen lassen wollte, da wurde er ganz gehörig angeschrien.
Nun hättet ihr aber den Günther sehen sollen; muckstill war er plötzlich, ganz ängstlich ließ er sich die bitteren Tropfen eingeben, ja – der neue Onkel Doktor war streng!
Aber als am nächsten Tage der alte Onkel Doktor ins Kinderzimmer trat, um nach dem kleinen Patienten zu sehen, da leuchteten Günthers Augen gerade so wie die der anderen Kinder, ganz artig sagte er »Guten Tag!« ließ sich die schöne Uhr und Dose zeigen und bat, als er die Medizin bekam: »Aber nachher erzählst du mir auch ein Märchen, nicht – lieber Onkel Doktor?«
Ja, der kleine Günther wußte jetzt erst, wie gut und freundlich sein alter Onkel Doktor war, vor dem brauchte er wirklich keine Angst zu haben! –
Hast du auch einen so guten Onkel Doktor, kleiner Leser? Dann artig die Zunge gezeigt und nicht geschrien, denn der Onkel Doktor tut ja nicht weh!
Der Sandmann kommt
Was der Sandmann jeden Abend zu tun hat – das glaubt ihr gar nicht, ihr Kinder!
Schon allein da drüben in dem großen Hause am Markt, wo in jedem Stockwerke Buben und Mädchen wohnen, ja – das dauert da eine ganze Weile, bis der Sandmann die alle ins Bett gebracht hat.
Und der Franz, der böse Junge, der im ersten Stockwerk wohnt, wo die hohen Kristallspiegelscheiben bis zur Decke reichen, und die Sessel und Polster von Samt und Seide sind, erschwert ihm seine Arbeit auch noch so! Keinen Abend geht es ohne Lärm ab. Und wenn Anna, das Kindermädchen, dem Sandmann ein wenig helfen will, den Franz ins Bett zu bringen, ja, dann wehrt sich der unartige Bube und schlägt – es ist ganz schrecklich! – sogar mit Händen und Füßen um sich.
Heute wollte der Franz wieder einmal nicht ins Bett hinein, er hatte seine Festung mit all den schönen Zinnsoldaten und Kanonen auf dem Kindertischchen ausgebreitet und spielte Krieg.
»Fränzchen, du mußt jetzt ins Bett gehen,« sagte die Mutter freundlich, »der Sandmann wird gleich kommen!«
Der aber stand schon längst draußen vor der Tür und schaute durch das Schlüsselloch.
»Ach, der dumme Sandmann,« hörte er den bösen Franz sagen, »der kann warten, erst müssen meine Soldaten noch diesen Turm erobern!«
Und als Anna ihm den Matrosenkragen abzubinden begann, da schrie der große Junge wie am Spieß. Das war dem Sandmann nun aber doch zu viel, leise, ganz leise schlich er sich hinter den Kinderstuhl, öffnete sein Säckchen und – schwapp! – da hatte der Franz die ganzen Augen voll Sand.
Au – drückte das – beide Augen kniff Franz zu, und dann konnte er sie gar nicht mehr aufkriegen. Noch ehe seine Soldaten den Turm erobert hatten, war der Franz auf seinem Kinderstühlchen fest eingeschlafen, und die Anna legte ihn ins Bett. –
Der Sandmann aber stieg geschwind die Treppe hinauf in das zweite Stockwerk.
Da wohnte die kleine, blonde Lisbeth und der krausköpfige Heinz – das waren andere Kinder! Die ließen sich, wenn Mutterchen sagte: »Nun ist's genug – der Sandmann kommt gleich,« artig ins Bettchen bringen, ja – die Kleinen mochte der Sandmann gern, da wartete er dann auch hinter der Tür ein Weilchen, wenn Lisbethchen noch nicht ihre Abendmilch aus hatte, ober wenn Heinz Mütterchen noch immer nicht den allerletzten Gute-Nachtkuß gegeben.
Auf leisen, weichen Söhlchen – ganz unhörbar – schlich der Sandmann heut' wieder hinter Lisbeth und Heinz einher zum Kinderzimmer. Aber soviel Lisbethchen sich auch umsah, sie konnte den Sandmann nirgends erblicken, – denn der ist unsichtbar! Und die Kleine hätte ihn doch so gern, nur ein einziges Mal, gesehen: jeden Abend bat sie: »Mutterchen, laß mich doch noch ein kleines Bißchen aufbleiben, bis der Sandmann kommt; ich möchte ja nur sehen, ob er ein rotes ober ein blaues Kittelchen trägt!«
»Ein graues Röckchen hat er an, so grau wie der Sand in seinem Säckchen,« meinte dann die Mutter lächelnd.
Eins – zwei – drei – lagen die Kinder heut' wieder im Bette, und Rike löschte das Licht. Schnell nahm der Sandmann, der oben auf dem Betthimmel des Kinderbettchens hockte, drei Körnchen Sand aus dem Säckchen – das ist für artige Kinder genug – und streute sie dem Heinz in die Augen. Der begann auch gleich müde zu blinzeln, und der gute Sandmann heftete seinen schönsten Traumbilderbogen an das Bettchen, damit Heinz etwas Schönes träumen sollte.
Nun ging's zum Lisbethchen. – Hier in der Ecke, wo Lisbeths Bettchen stand, schien der Mond nicht so hell – o weh – zwei Körnchen Sand fielen vorbei auf das Kopfkissen, nur eins bekam Lisbethchen in die Blauaugen. Da begann sie sich die Äuglein zu reiben, aber einschlafen konnte sie nicht. Horch – was war das für ein Knistern in der Ecke – war das am Ende der Sandmann?
Lisbeth setzte sich auf.
Es knusperte und raschelte dort unter dem Puppenschrank, nun ging's über Heinz' Baukasten, jetzt sprang es auf die Puppenküche – und jetzt – jetzt sah Lisbethchen deutlich etwas Graues über die Erde huschen – das mußte der Sandmann sein!
Da aber begann das eine Körnchen Sand in Lisbeths Augen zu wirken und – sie schlief ein.
Am anderen Morgen aber stellte die Mama, als ihr Töchterchen ihr erzählte, daß sie in der Nacht den Sandmann gehört und gesehen habe, eine schwarze Falle auf, um, wie sie lächelnd sagte, den Sandmann zu fangen.
Klapp – machte die Falle – aber nicht der Sandmann saß darin, sondern ein niedliches, graues Mäuschen, das hatte Lisbethchen in der Nacht gesehen. –
Ja – der Sandmann, der hatte mehr zu tun, als über Puppenküchen und Baukästen zu springen; der war gleich, nachdem er Lisbeth und Heinz ins Bett gebracht hatte, die Treppe zu dem obersten Stockwerk emporgehuscht. Hier war es lange nicht so fein wie unten. Es lagen keine Teppiche auf den Treppen, und der kleine Raum, den Mariechen mit Base Ernestine bewohnte, war Stube und Küche zugleich.
Müde blinzelnd hockte das kleine Mädchen auf dem niedrigen Schemel und schälte die Kartoffeln für den morgigen Tag. Ach – wenn der gute Sandmann doch erst käme und sie sich auf ihren Strohsack am Herd niederlegen könnte! Schon in aller Herrgottsfrühe mußte Mariechen müde und hungrig in die eisige Winterluft hinaus und noch vor der Schule das Frühstück für den reichen Bäcker nebenan überall in die Häuser tragen. Den ganzen Tag von morgens bis abends hatte das kleine Mädchen hart zu arbeiten, denn Mariechen hatte keine Eltern mehr, und die Base Ernestine behielt sie nur ungern.
Da klinkte der Sandmann ganz leise die niedrige Tür auf.
Mariechen legte das Kartoffelmesser aus der Hand, warf sich auf das harte Lager, und da schlief sie auch schon. Und der gute Sandmann malte ihr im Traum ein so großes Butterbrot in die Luft, daß Mariechen gar nicht mehr fühlte, daß sie heute abend hatte hungrig zu Bett gehen müssen, da kein Geld mehr in der Lade war, um Brot zu kaufen. –
Nun schlich sich der Sandmann hinaus an die letzte Tür. Er ging womöglich noch leiser als zuvor und schaute erst durch die Türspalte.
Ach – da drinnen in dem armseligen Stübchen saß bei der verhangenen Lampe eine Mutter an dem Bettchen ihres todkranken Kindes und betete zum lieben Gott, ihr doch ihr Kind, ihr ein und alles, nicht zu nehmen. Fieberglühend warf sich der kranke Knabe im Bett umher, er erkannte die Mutter gar nicht mehr, mit angstvoll aufgerissenen Augen schaute er in die Luft.
O – welch häßliche Gestalten das böse Fieber vorüberziehen ließ, wie sie ihm drohten und ihn quälten! Da – huschte der Sandmann zur Tür hinein; die betende Mutter sah ihn nicht, aber der Kleine wurde sogleich ruhiger. Der gute Sandmann scheuchte die häßlichen Fiebergebilde von dem Bettchen des kranken Kindes, streute ihm zehn Körnlein Sand in die Augen, da schlossen sich die heißen Augenlider, und als der Sandmann ihm nun das große Traumbilderbuch mit dem grünen Wald, in dem die Sonne so schön schien, und die Vöglein so lustig sangen, und den großen Teich mit den bunten Entlein zeigte, da huschte ein leises Lächeln über das Gesicht des sanftschlummernden Knaben – der liebe Gott hatte ihn durch den guten Sandmann seinem Mütterlein erhalten. –
Und weiter geht's – von Haus zu Haus, treppauf – treppab huscht der Sandmann – bald kommt er auch zu euch, ihr Kleinen – geschwind dann in die Bettchen!
Schwälbchen
Das letzte Haus im Dorfe bewohnte ein armer Bauer mit seinem braven Weibe. Alt und baufällig war die Hütte, das braune Strohdach vielfach geflickt, aber in dem Gärtchen hinter dem Hause, da blühten im Frühling die ersten Primeln und Schneeglöckchen und im Herbst die letzten, bunten Astern, dafür sorgte die junge Bäuerin, die eine gar geschickte Hand in der Blumenpflege hatte. Dem Bauer glückte es weniger, trotzdem er von morgens früh mit dem ersten Hahnenschrei aus dem Bette war und bis zum Feierabendläuten fleißig im Schweiße seines Angesichts sein Stückchen Feld bestellte.
Es wollte ihm nichts gelingen, hatte er Kartoffeln auf seinen Acker gepflanzt, dann gab's gewiß einen Regensommer, und die Kartoffeln faulten; hatte er Weizen oder Gerste gesät, dann kam sicherlich Dürre, und die Halme trugen zum größten Teil taube Ähren. Oder aber ein Hagelschlag kam und vernichtete die gut stehende Saat; bald starb ihm eine Ziege, bald brach eine Seuche unter seinen Kühen aus, was er anfaßte, mißlang.
»Ich bin eben ein Pechvogel,« pflegte er mit bitterem Lächeln zu sagen, »ich habe nun einmal kein Glück!«
Aber eines Tages kam er jubelnd in die kleine, sauber gescheuerte Stube gestürzt, in der seine liebe Frau am Webstuhl saß und fleißig das Schiffchen hin und her warf.
»Frau,« rief er laut, »das Glück ist endlich bei uns eingekehrt, komm' und schau', an unserem Dache nisten Schwalben, die bringen uns sicherlich Glück!«
Die Bäuerin lief schnell mit hinaus, richtig – oben an dem Dachfirst klebte ein kleines Schwalbennest; eifrig flogen die beiden Schwälbchen hin und her, sie trugen Holz, Lappen und Papier in ihrem Schnabel herzu und bauten sich da oben auf dem Strohdach ein lustiges, geräumiges Nest. Wirklich schien mit den beiden Schwälbchen das Glück ins Haus gezogen zu sein; der Bauer schaffte noch einmal so viel als sonst, die Ähren auf dem Felde trugen das Doppelte, und das Korn kam dies Jahr trocken herein.
Die junge Frau aber stand mit sehnsüchtigen Augen zwischen den würzigen Nelken und duftenden Levkojen in ihrem Gärtchen und schaute zu dem Schwalbennest empor. Dort sperrten jetzt sechs hungrige Schwälbchen den kleinen Schnabel auf, und Vater und Mutter flogen ab und zu und steckten den hilflosen Vogelkindern das Futter in die kleinen, weitgeöffneten Schnäbel, schützend breitete die Schwalbenmutter ihre schlanken Flügel über die Kleinen aus, daß ihnen Wind und Wetter nichts anhaben konnten.
»Ach,« sprach da die junge Frau traurig, »hätte ich doch auch ein süßes, kleines Kind, wie wollte ich es lieb haben, es schützen und pflegen, ganz so wie die Schwalbenmutter dort oben!«
Das hörte die Schwalbe oben im Nest, und ihr tat die einsame, junge Frau leid. Als die Kleinen das Fliegen gelernt hatten und groß genug waren, die weite Reise nach den warmen Ländern anzutreten, flogen sie alle mit einem »Behüt di Gott« davon, hinein in die weite, blaue Luft.
Der Winter verging, und als die ersten schwellenden Knospen an dem Fliederbusch im Gärtchen prangten, als die zarten, grünen Grashälmchen neugierig das Naschen aus der braunen Erde steckten, da schaute die Bäuerin wieder nach ihren lieben Schwalben aus.
»Grüß di Gott, grüß di Gott!« klang's da eines Abends aus der Luft, und mit schlanken, schnellen Flügeln kamen sie wieder herzugeschossen, die beiden Schwälbchen, die voriges Jahr auf dem Strohdach gehaust.
Aber – o Wunder – was trug denn die Schwalbenmutter auf dem Rücken? Ein winziges, kleines Mädchen war's, das hatte ihr der Gevatter Storch für die junge Bäuerin mitgegeben. Frau Schwalbe flog in das Gärtchen zu der jungen Frau herab und legte das kleine Mädchen behutsam in die Arme der glücklichen Mutter.
»Quiwitt – quiwitt,« zwitscherte die Schwalbenmutter, sich in die Lüfte schwingend, das sollte heißen: »Siehst du, das habe ich dir von meiner Reise mitgebracht!« –
Nun war das Glück wirklich in das Bauernhäuschen eingezogen; Frohsinn und Freude brachte das kleine Mädchen mit ins Haus. Lisbeth nannten sie die Eltern; aber die Leute im Dorf, die wußten, auf wie seltsame Weise die Kleine ihren Einzug in das Bauernhaus gehalten, nannten das kleine, blondhaarige Mädchen nur »Schwälbchen«. Und bald wurde sie überall, auch von den Eltern, so gerufen.
Das kleine Schwälbchen zwitscherte von morgens bis abends wie ihre Namensschwestern auf dem Dache durch das ganze Haus, schlank und zierlich war sie wie ein Schwälbchen, und sie flog in ihrem kurzen, grauen Röckchen schneller als die anderen Kinder die Dorfstraße entlang.
Und noch ein Geschenk hatte die gute Frau Schwalbe dem kleinen Mädchen mitgegeben, Schwälbchen konnte die Vogelsprache verstehen.
Stundenlang stand sie unten im Gärtchen und schaute dem schnellen, bogenartigen Fluge der Schwalben zu und lauschte ihrem Sange. Jeden Ton verstand Schwälbchen: wie die Mutter die ungeschickten Kleinen im Fliegen unterwies, und wie sie ihnen gute Lehren auf die Lebensreise mitgab. Stets lief Schwälbchen mit ihrem Frühstücks- und Vesperbrot hinaus und teilte es mit ihren lieben Schwalben.
Traurig sah sie zu, wenn ihre guten Freunde zur Winterreise rüsteten und ihr den Abschiedsgruß zuzwitscherten. Und jubelnd lief sie den ersten heimkehrenden Schwalben im Frühling bis zum Weiher am Waldesrand entgegen und rief ihnen ein fröhliches Willkommen zu.
Im Dorfe aber war es laut geworden, daß Schwälbchen die Vogelsprache verstehen konnte; da sprachen die Leute: »Das ist gar kein kleines Mädchen, sondern eine Hexe, eine Zauberin; wir wollen sie aus unserem Dorfe ausweisen, damit sie uns nichts Böses anhaben kann.«
Und sie jagten das arme Schwälbchen trotz des Jammers und der Tränen der Eltern zum Dorfe hinaus.
Traurig zog Schwälbchen die Landstraße entlang und neigte betrübt das zierliche Köpfchen mit den goldenen Haaren. Große Tränen flossen aus ihren blauen Augen; ach, wie einsam und verlassen war sie doch auf der Welt! Doch da – durchschnitten plötzlich schlanke Schwalbenflügel die blaue Luft, und tröstend klang es zu Schwälbchen herab:
»Fürchte dich nicht, Schwälbchen klein, Bist nicht einsam und allein! Denn es zieh'n quiwitt – quiwitt – All' wir Schwalben mit dir mit!«
Da trocknete Schwälbchen die Tränen, und fröhlich zwitscherte sie mit ihren guten Freunden um die Wette.
Sie kam in einen schattigen, grünen Wald, da nisteten viele hunderte kleine Vögel in den Bäumen und Sträuchern; mit klugen Augen schauten sie das kleine Mädchen neugierig an.
»Willkommen im grünen Wald,« sang die Drossel, und alle kleinen Singvögelchen fielen im Chor ein. Da fühlte sich Schwälbchen gleich heimisch unter all' den Vöglein des Waldes. Frau Schwalbe aber rief den Meister Specht herbei, der mußte mit seinem spitzen Schnabel eine große, alte Eiche aushöhlen, und all' die Vöglein, der lustige Fink, die fröhliche Drossel, der bunte Stieglitz, der gelehrige Star, Amsel, Zeisig, Rotkehlchen, Bachstelze, Kiebitz und Zaunkönig, sie alle trugen grünes Samtmoos und wärmende Blätter hinzu, zum weichen Lager für das kleine Schwälbchen.
So wohnte das kleine Mädchen denn in der geräumigen Eichenhöhle, und alle Singvögelchen hielten vor ihrem Baumhäuschen Wache, daß ihr ja nichts Böses geschah. Morgens klopfte Meister Specht an ihren Baum und weckte sie: »Wach' auf, wach' auf, Schwälbchen, es ist Tag!« und die aufsteigende Lerche sang ihr das schönste Morgenlied. Bachstelzchen flog zum Bach hinab und schöpfte einen frischen Morgentrunk für Schwälbchen, der Kiebitz legte ihr frische Eier, Rotkehlchen pflückte ihr die süßesten, roten Erdbeeren, Blaumeise brachte ihr blaue Heidelbeeren, und Zaunkönig trug ihr im Schnabel die dunkelsten und saftigsten Brombeeren von der Hecke am Zaun zu. Die dreisten Spatzen mausten den Bauern des Dorfes die köstlichsten Kirschen für Schwälbchen aus dem Garten, und die diebische Elster wagte sich gar bis in die Vorratskammern der Bauernhäuser, Wurst, Schinken und Brot schleppte sie in ihrem Schnabel für Schwälbchen herzu. Der Dompfaff vertrieb ihr am Tage die Zeit, er pfiff ihr die lustigsten Weisen vor, der Kuckuck rief ihr mit seinem »Kuckuck – kuckuck« die Stundenzahl zu, damit Schwälbchen auch wußte, wieviel die Uhr ist, und Frau Nachtigall flötete abends ihre süßesten Lieder und sang Schwälbchen in den Schlaf.
So lebte das kleine Mädchen fröhlich unter den Vögeln des Waldes, da kehrte eines Tages die geschwätzige Elster von einem Ausflug zurück und berichtete, was es Neues in der Welt gab; all' die Vögelchen hörten neugierig zu, und auch Schwälbchen lauschte der Erzählung der Elster.
»Denkt euch nur,« sprach die Elster, »was die Menschen draußen in der Welt erzählen: Der König des Landes soll einen Sohn haben, einen schönen, jungen Prinzen, dem hat ein böser Zauberer die Lippen mit einem goldenen Schlüssel verschlossen, nun muß der arme, junge Königssohn sein Leben lang stumm bleiben; still und traurig geht er in dem glänzenden Königsschlosse einher. Aber der König hat eine Bekanntmachung im ganzen Lande erlassen, wer ihm den goldenen Schlüssel bringt, den der alte Zauberer in seinem großen Zauberschlosse in Verwahrsam hat, und seinem armen Sohne wieder die Lippen öffnet, der soll König oder Königin vom ganzen Lande werden, und alles sei ihm untertan.«
»Ach – wie traurig,« sprach Schwälbchen mitleidig, »der arme, arme Prinz, wie gern möchte ich ihm helfen!«
Das hörte Frau Schwalbe, schnell flog sie zu dem kleinen Mädchen hinab: »Quiwitt – quiwitt,« sang sie Schwälbchen ins Ohr, »ich habe auf meinen großen Reisen das wüste Schloß, in dem der böse Zauberer haust, gesehen; unheimliche Nachtvögel flattern um den dunklen Bau. Gevatter Uhu haust in dem alten Turm, er wird sicherlich wissen, wo der Zauberer den goldenen Schlüssel versteckt hat.«
Und Frau Schwalbe rief wieder alle Vöglein des Waldes zusammen, die mußten Reiser und Baumäste herbeischaffen, daraus hämmerte Meister Specht einen zierlichen, kleinen Wagen für Schwälbchen, all' die Vöglein spannten sich vor das Wägelchen. Schwälbchen stieg ein, und der Zeisig schwang sich in grüner Kutscherlivree auf den Bock.
Fort ging's durch die Lüfte, im sausenden Fluge zogen die kleinen Vögel den Wagen, und Frau Schwalbe flog voraus und zeigte den Weg.
Grausig schwarz ragte plötzlich ein großes, halbzerfallenes Schloß vor Schwälbchen empor, und ängstlich mit den Flüglein schlagend, flatterten die Vögel zur Erde herab, auch Schwälbchens Herz pochte laut.
Frau Schwalbe aber zwitscherte leise: »Quiwitt – quiwitt« – da steckte der alte Uhu den Kopf aus dem morschen Turme, und die Schwalbe flog zu ihm auf den Söller des Schlosses. Leise berieten die zwei miteinander, der alte Zauberer war gerade ausgegangen, und die Gelegenheit war günstig.
Da rief Frau Schwalbe den schwarzen Raben zu sich herauf, und sie flogen suchend durch das alte Gemäuer.
In alle verstaubten Winkel und Ecken schaute der Rabe, der sich auf das Spitzbubenhandwerk verstand, und der Uhu flatterte mit seinen leuchtenden Augen neben ihm her, damit er in der Dunkelheit sehen konnte.
»Rab – rab« krächzte der Rabe plötzlich laut auf vor Freude; in der Fußbodenritze glitzerte es, mit seinem spitzen Schnabel zog er den goldenen Zauberschlüssel aus dem Versteck und hing ihn Frau Schwalbe um den Hals. Schnell flogen sie, ehe der Zauberer zurückkehrte, zu Schwälbchen herab, die angstvoll ihrer harrte.
Frau Schwalbe warf ihr den goldenen Schlüssel in den Schoß; die Vöglein schwangen sich jubilierend in die Lüfte, fort flog der Wagen, zum Schlosse des Königs.
Vor dem schönen, großen Garten hielt die kleine Vogelequipage; Schwälbchen stieg aus und ging in den herrlichen Garten.
Da begegnete ihr ein schöner, goldlockiger Jüngling.
»Hast du nicht den Königssohn gesehen?« fragte Schwälbchen ihn.
Der schaute sie mit traurigen Augen an und antwortete nicht. Da merkte Schwälbchen, daß er selbst der arme, stumme Prinz war; schnell zog sie den goldenen Zauberschlüssel aus der Tasche und berührte die Lippen des schönen Königssohns.
Und der Jüngling öffnete plötzlich die lang verschlossenen Lippen. »Du hast mich erlöst, holdes Mädchen,« jauchzte er, »nun sollst du auch meine Gemahlin werden und Königin von dem ganzen Reich.«
Glückselig führte er sie zu dem goldenen Thron, auf dem der König saß und das Land regierte. Der schloß seine Kinder freudestrahlend in die Arme, und noch am selben Tage heiratete Schwälbchen den schönen Königssohn und wurde Königin.
Frau Schwalbe aber flog ins kleine Bauernhäuschen zu Schwälbchens traurigen Eltern und holte sie ins glänzende Königsschloß, daß auch sie an dem Glücke der Königin Schwälbchen teilnehmen konnten.
Die Waldvögel aber musizierten und trillierten zur Hochzeit ihre alleischönsten Weisen, und Frau Schwalbe jubilierte laut: »Quiwitt – quiwitt.«
Der schmutzige Straßenjunge
»Karlchen, komm', bring' Vater'n das Essen nach dem Park,« rief die Mutter aus dem kleinen Küchenfenster nach dem engen Hof hinunter, wo der zehnjährige Karl an dem großen Holzklotz stand und das Brennholz in kleine Stücke zerschlug. Laut dröhnte das Beil auf dem Holzklotz, lauter aber noch tönte Karlchens helle Stimme, der mit den Vöglein um die Wette sein Lied in die blaue Luft schmetterte.
Der Schuster, der drunten im Erdgeschoß seine Werkstatt hatte, die Waschfrau droben, ja, selbst der alte, brummige Hauswirt, alle hatten sie das Fenster aufgemacht und lauschten der frischen, fröhlichen Knabenstimme.
Karlchen band das Holz zusammen, wusch sich unter der Pumpe die Hände und sprang vergnügt die enge Treppe hinauf in die ärmliche, aber blitzsaubere Stube. Mutter füllte einen braunen, irdenen Topf mit Brühkartoffeln, legte einen Blechlöffel und ein Stück Brot dazu, und band alles säuberlich in ein reines, weißes Tuch.
»So, Karlchen, bist du fertig, siehst du auch ordentlich aus, lieber Sohn?« sie strich mit der verarbeiteten Hand die blonden, lockigen Haare aus Karlchens Stirn und blickte das kleine Bürschchen prüfend an.
Alles sauber und ganz, die graue Drillichhose war zwar geflickt, die Jacke etwas ausgewachsen, aber ordentlich sah das Karlchen aus, Vater konnte mit seinem Jungen zufrieden sein!
»Hier, Karlchen, hast du zehn Pfennige, da fährst du von der Ecke drüben mit dem Omnibus bis zum Park, wo Vater arbeitet, so, sei vorsichtig und gieße nicht! Ade, mein Junge, grüß' Vater!«
Karlchen setzte die Mütze aufs Ohr, stieg behutsam die Stufen herab und marschierte, fröhlich vor sich hinpfeifend, zur Omnibushaltestelle. Der Wagen war noch ganz leer, Karlchen setzte sich vorn in die Ecke, wo er die beiden Pferdchen sehen konnte und stellte das Töpfchen sorgsam neben sich. »Klinglingling!« machte der Schaffner, und die Pferde zogen an.
Bald füllte sich der Wagen, fast an jeder Ecke stiegen Leute hinzu, nur noch ein Platz war neben Karlchen frei. Da stieg ein kleines, fein gekleidetes Mädchen im weißen Spitzenkleidchen mit ihrem Fräulein ein, die Erzieherin setzte sich, Karlchen nahm das Töpfchen auf den Schoß und drückte sich bescheiden in die Ecke, damit das hübsche, kleine Mädchen auch noch sitzen konnte. Bewundernd blickte er auf ihren weißen Federhut, der auf den schwarzen, langen Locken hin und her wippte.
Das kleine Mädchen sah Karlchen mit ihren dunklen Augen von oben bis unten an, rümpfte das Näschen und – blieb stehen.
»Komm', Lilli,« sagte das Fräulein, »hier ist noch ein Plätzchen für dich,« und sie zog das Kind auf den freien Platz hernieder.
Scheu rückte das kleine Mädchen ganz dicht an das Fräulein heran und zog sein weißes Kleidchen ängstlich an sich, daß es nur ja nicht an Karlchens geflickten Drillichanzug herankäme. Dem Jungen stieg das Blut ins Gesicht, beschämt sah er an sich hernieder.
War er nicht sauber und ordentlich, Mutter hatte ihn doch angesehen, warum rückte das fremde, kleine Mädchen so verächtlich von ihm ab?