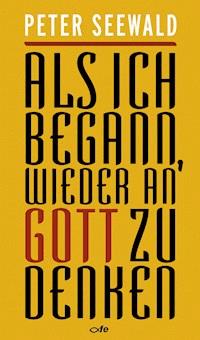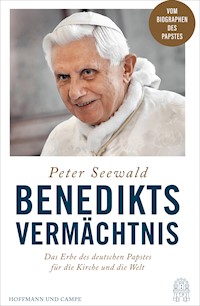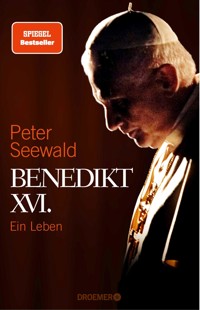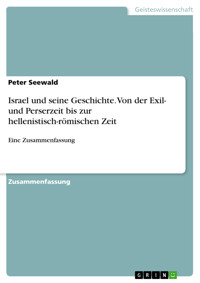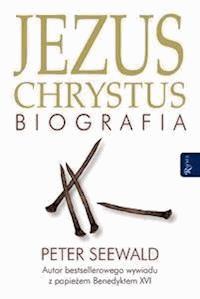18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: bene! eBook
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Der Klassiker christlicher Spiritualität in einer wunderschön ausgestatteten, durchgehend farbigen Neuauflage mit vielen Fotos und Bildern aus der Tradition der Klöster: Immer öfter haben wir das Gefühl, ein Leben im Hamsterrad eines allzu hektischen Alltags zu führen. Wir spüren, dass die innere Grenze des Erträglichen längst erreicht, wenn nicht überschritten ist. Und wir sehnen uns nach Ruhe und Klarheit. Dieses Buch kann eine Antwort auf unsere Fragen sein. Peter Seewald lädt dazu ein, das jahrhundertealte Wissen der Klöster und Orden für heute neu zu entdecken. Von Nonnen und Mönchen können wir lernen, was es heißt, sich auf das Wesentliche zu besinnen, Maß und Mitte zu finden, zu unterscheiden, was wirklich wichtig ist, was bleibt und was trägt. Uraltes Wissen: Quellen des Glücks, tiefer Harmonie, neuer Kraft. Loslassen. Zuhören. Schweigen. Demut. Und über allem: die Liebe. Die Weisheit der Mönche zu entdecken, das heißt zurückzufinden: zu sich selbst, zu seinen Mitmenschen und zu Gott.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Peter Seewald
Die Schule der Mönche
Inspirationen für unseren Alltag
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Immer öfter haben wir das Gefühl, ein Leben im Hamsterrad eines allzu hektischen Alltags zu führen. Wir spüren, dass die innere Grenze des Erträglichen längst erreicht, wenn nicht überschritten ist. Und wir sehnen uns nach Ruhe und Klarheit. Dieses Buch kann eine Antwort auf unsere Fragen sein. Peter Seewald lädt dazu ein, das jahrhundertealte Wissen der Klöster und Orden für heute neu zu entdecken. Von Nonnen und Mönchen können wir lernen, was es heißt, sich auf das Wesentliche zu besinnen, Maß und Mitte zu finden, zu unterscheiden, was wirklich wichtig ist, was bleibt und was trägt. Uraltes Wissen: Quellen des Glücks, tiefer Harmonie, neuer Kraft. Loslassen. Zuhören. Schweigen. Demut. Und über allem: die Liebe. Die Weisheit der Mönche zu entdecken, das heißt zurückzufinden: zu sich selbst, zu seinen Mitmenschen und zu Gott. Der Klassiker christlicher Spiritualität in einer wunderschön ausgestatteten Neuauflage.
Inhaltsübersicht
Widmung
Vorwort
1 Vom Anfangen
2 Vom Loslassen
Pater Johnny Walker
Ganz einfach im Sein
»Lass es nur zu«
Von der Selbstbeherrschung und vom Verzicht
3 Von der Zeit
Die Entdeckung der Langsamkeit
Die Entdeckung der Einsamkeit
Stabilitas
4 Vom Schweigen
Göttliche Ruhe
Vom Reden
Il santo silenzio
5 Vom Hören
Höre – nimm an – erfülle
Vom Gehorsam
6 Vom Guten und vom Bösen
Liebe Sünde
Der Kick des Bösen
Erb- und andere Sünden
Die Antwort der Mönche
Vom Bösen des Guten
Man nannte ihn Francesco
Positiv denken, aber richtig
7 Vom Maß und von der Mitte
Licht auf dem Berg
Mittel-mäßig
»Wenn der Mensch sündigt, leidet der Kosmos«
Ordnung und seelische Harmonie
8 Von der Gesundheit
Um Leib und Seele
Was Mönche empfehlen
Tipps aus der Schule der Mönche
Richtig schlafen
Richtig essen
Richtig spannen und entspannen
Richtig einsam und gemeinsam
Lob des Fastens
Gott heilt mit
9 Vom Zusammenleben
Gemeinsam über die Zeit kommen
Der große Beziehungsberater
Die Werkzeuge der geistlichen Kunst
© Bruder Felix Weckenmann [...]
10 Von der Erziehung
Ratlose Eltern einsam am Küchentisch
Im Namen des Vaters
Schlag nach bei Benedikt
© Bruder Felix Weckenmann [...]
11 Vom Weg
Finde deinen Weg
Der enge und der breite Weg
Vom Weg, der Wahrheit und dem Leben
Gott geht mit
12 Von der Arbeit
Die Entdeckung der Arbeit
Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen
Ora et labora – erst Gott, dann die Arbeit
13 Von der Demut und vom Dienen
Lob der Demut
Die zwölf Stufen der Demut
Vom Dienen
14 Vom Sehen
Zeichen und Symbole
Magical mystery tour
Die Wirklichkeit des Unsichtbaren
15 Vom Leiden
Lob des Leidens
Bruder Tod
Die Schule des Lebens und des Leidens und der Überwindung
16 Vom Lieben
Der Name der Liebe
Liebe – und tu, was du willst
Kleines Abc der Mönche
Für Paul und Jakob
© Bruder Felix Weckenmann OSB
Vorwort
Die kleine Gemeinde, in der ich aufwuchs, wurde groß und größer. Irgendwann gab es auch eine richtige Kirche, aber die kleine Kapelle an der Straßenkreuzung blieb etwas Besonderes.
Im Winter stapfte ich durch den Schnee, um früh am Morgen vor den adventlichen Rorate-Messen die Kerzen anzuzünden. Der Weg war so finster, dass ich Angst vor meinem eigenen Schatten bekam. Einige alte Frauen saßen bereits in den Bänken und beteten den Rosenkranz. Der Herr Kaplan schüttelte den Schnee von seinem Mantel, schlüpfte in das Messgewand, und schon begann ein kleiner Ausflug in die ganz andere Dimension.
Für uns Kinder schufen die Schutzengel am Bett, die Heiligenbildchen, die Gewänder, die Gerüche, die Zeremonien, die Lesungen, die so anders waren als das, was man in der Zeitung lesen konnte, eine sinnliche Welt, in der es nicht schwer war, Gott zu finden. Und in der Wechselwirkung zwischen oben und unten wäre ein Lebensentwurf, der nur das eigene Ego zum Ziel hat, als ziemlich merkwürdig betrachtet und auf keinen Fall zur Nachahmung empfohlen worden.
Die Erde war gewissermaßen nur geliehen. Der Mensch wusste sich eingebettet in einen großen Kreislauf, den er nicht kaputt machen durfte. Wir lernten, dass man mit allem sorgsam umgeht und nichts vergeudet, Tugenden pflegt und Werte verteidigt. Lauter Dinge eigentlich, die im Grunde dem benediktinischen Gesamtkonzept entstammten. Alles hatte seinen Platz, seine Zeit, seine Einbindung in einen bestimmten Ablauf.
Warum kommen einem diese Bilder heute wieder so häufig in den Sinn? Vielleicht der Unrast der Gegenwart wegen? Oder weil man ganz einfach alt geworden ist? Mit Sicherheit auch deshalb, weil wir inzwischen erfahren mussten, dass wir nichts hinzugewinnen, wenn man etwas verliert, das im Grunde unentbehrlich ist.
Auch nur auf zehn Jahre zurückblickend sieht man, dass unser Zeitalter einem enormen Wandel unterworfen ist. Noch nie war dieser Globus so vernetzt – mit revolutionären Erfindungen wie Google, Facebook, YouTube, Wikipedia oder den omnipräsenten Smartphones, die unsere Lebensgewohnheiten verändert haben. Erkennbar wird, dass die ungehemmte Entwicklung der Moderne in ihrem einseitigen Streben nach Profit und Konsum auf eine Katastrophe zusteuert. Da zeigt sich ein entfesseltes Bankensystem, das sich zu einem Raubtier entwickelt und riesige Volksvermögen verschlingt. Kapitaleinsätze müssen sich im Optimierungswahn der Konzerne schneller amortisieren, Ressourcen, etwa Ölvorkommen in der Tiefsee, schneller ausgebeutet werden.
Alles war irgendwann immer schneller geworden. Züge fuhren schneller, Autos kamen schneller von A nach B, Luftschiffe wurden Düsenjets mit Überschallgeschwindigkeit – und die Post kam plötzlich per Express. Man wusch schneller Wäsche, man kochte schneller Fertiggerichte, man warf schneller weg. Nicht nur die Mode, auch Freunde wechselten schneller. Mobilität wurde zum Zauberwort. Mobil sein in jeder Beziehung. Im Job, in der Partnerschaft. Wir machten keine Lichter mehr aus, um auch ja keine Unterbrechung zu haben. Die Geschäfte öffneten sieben Tage in der Woche, und die Politiker fuhren nun auch sonntags in die Regierungszentralen, um zu zeigen, wie vorbildlich sie auch am Tag des Herrn ihre hektischen Sitzungen betrieben – um am Ende mehr Schaden anzurichten, als Schaden zu beheben.
Und natürlich gibt es auch eine andere Seite: Die Moderne bringt uns eine Menge an Dingen, die wir nicht mehr missen möchten. Sie lässt uns freier leben, vielfach besser miteinander umgehen, sie hat Nationalismus und Fremdenhass den Krieg erklärt. Aber die neuen Entwicklungen und Herausforderungen zwingen uns auch zu der Frage, wann Fortschritt wirklich echter Fortschritt ist.
Eine Nonne bewies vor 900 Jahren Weitsicht: »Wenn der Mensch sündigt«, wusste die Ärztin Hildegard von Bingen, »leidet der Kosmos.« Längst ist deutlich geworden, dass diese Gesellschaft unmöglich weitermachen kann wie bisher. Dass grenzenloses Wachstum nicht die Lösung des Problems ist, sondern Teil des Problems. Wir halten ein Hochgeschwindigkeitsleben psychisch und physisch auf Dauer nicht aus. Und was die Schule der Mönche betrifft: Heute ist nicht mehr die Frage, ob diese uralten Regeln mit ihren Empfehlungen von Maß und Mitte, Demut und Selbstzucht nicht doch etwas zu altbacken sind, heute ist die Frage, ob es uns gelingt, diese Lebensregeln möglichst schnell wieder in uns und unsere Alltagskultur aufzunehmen, ähnlich einer wichtigen Arznei, die lebensrettende Wirkung hat. Sie mag manchmal ein wenig bitter schmecken, aber sie wirkt.
Kulturkritiker wie der französische Philosoph René Girard beobachten inzwischen deutliche Vorboten einer bevorstehenden Wende. Es werde als Reaktion einer gefährdeten Menschheit, die sich nach Heilung und Erlösung sehne, zu einer Renaissance traditioneller Werte und Verhaltensmuster kommen, die sogar die Renaissance der Neuzeit übertreffen könnte. Man wird sehen.
Die Schule der Mönche jedenfalls ist ein Beitrag zu dieser notwendigen Kehre, schon deshalb, weil sie nicht beim Allgemeinen ansetzt, sondern beim Konkreten. Weil es nicht um modische Experimente geht, sondern um die Rückeroberung des Erprobten und Bewährten. Es stimmt schon, die Ordensleute des Abendlandes, die Benediktiner, Franziskaner, Augustiner, Dominikaner, Salesianer, Kartäuser, Zisterzienser, Trappisten und all die anderen Klostermenschen können bestimmt nicht so toll durch die Luft wirbeln wie die Mönche der Shaolin. Und sie können auch keine In-fünf-Minuten-bist-du-reich-und-glücklich-Versprechungen machen. Die Ordnung der Schöpfung selbst ist es, was die Mönche gesucht hatten und nach der sie sich alleine orientieren wollten, ein Leben im Einklang, wo Körper, Geist und Seele möglichst harmonisch sich zum Urgrund allen Daseins verhalten.
Es lohnt sich dabei immer, noch einige Minuten länger auch über einen unbequemen Rat nachzudenken, ob er in seinem Kern nicht doch genau das trifft, was richtig ist. Und sei es nur die Empfehlung, sich selbst nicht immer ganz so wichtig zu nehmen.
Peter Seewald
© Bruder Felix Weckenmann OSB
1 Vom Anfangen
»Gestern ist vergangen.
Morgen ist noch nicht gekommen.
Wir haben nur das Heute. Lasst uns beginnen.«
Mutter Teresa
Die Maschine nach Neapel, dem nächsten Flugplatz zu meinem Reiseziel Monte Cassino, war völlig ausgebucht. Einige der Reisenden hatten eine Nummer auf der Warteliste bekommen und hofften verzweifelt auf ein Wunder, aber sie bekamen keinen Platz mehr.
Ich beobachtete Menschen, die an den Schaltern nervös ihre Telefone abhörten und unfreundlich ihr Ticket zeigten. Irgendwann flogen sie ab, und andere kamen nach. Endlich wurde mein Flieger aufgerufen, und schon bald verschwanden unter uns die Landebahnen, Gebäude, Wiesen und Wälder, bis wir durch die Wolken stießen.
Nach der Veröffentlichung meiner ersten Bücher hatte ich einige Einladungen zu Vorträgen bekommen. Da ich schüchtern bin, lehnte ich die meisten ab. In Briefen bekam ich Vorschläge über wichtige Themen, zu denen man dringend ein Buch veröffentlichen sollte. Einige meiner Leser schickten seitenlange, handgeschriebene Aufsätze. »Eine Kirche, für die die Mystik nur noch toter Buchstabe ist, mumifiziert das Evangelium«, hatte mir jemand geschrieben. Ein junger Mann fragte, ob denn Mystik nur etwas aus dem Altertum oder dem Mittelalter gewesen sei, um mir gleichzeitig zu berichten, er habe ein geheimnisvolles Licht gesehen, das sein Leben verändert habe. Bei einem Vortrag in Potsdam wenige Tage vor meiner Abreise hatte mir einer der Zuhörer nach der Veranstaltung davon erzählt, wie sein sozialistischer Lehrer in der ehemaligen DDR ihn gelegentlich vor die Klasse gestellt hatte und dabei aus einer mittelhochdeutschen Bibel vorlas. Immer wenn er damit fertig war, knallte er das Werk höhnisch auf das Pult: »Und so einen Quatsch hat die westliche Welt einmal geglaubt.«
Ich saß eingepfercht auf meinem Fensterplatz und blickte über die Stuhlreihen der Passagiere. Viele von ihnen lasen in Geschäftsunterlagen oder tippten etwas in ihre elektronischen Notizbücher. In einem Punkt hatte der sozialistische Lehrer ja recht. Leben wir nicht alle längst in einer Als-ob-Gesellschaft? Einfache Gläubige, christliche Politiker, selbst Kleriker – wer glaubt wirklich noch daran, dass Gott aktiv auf die Welt einwirkt? Der Begriff »höhere Gewalt« kommt in unserem Sprachgebrauch kaum mehr vor, und wenn, dann im Kleingedruckten von Policen, die gegen Sturm- und Hagelschäden versichern. Ist Gott ein Wunschbild sentimentaler Naturen, die ohne Erklärungen nicht leben können? Wo ist Gott eigentlich? Weitergefahren in eine andere Galaxie, weil ihm die Erde zu langweilig und wir ihm gleichgültig geworden sind?
Als ich damit begann, mich mit dem Thema zu beschäftigen, das zu diesem Buch führte, wusste ich sehr wenig von diesen Dingen. Die Regeln der Mönche, ihre Gewohnheiten, all das war mir völlig fremd. Was war mit dem geheimnisvollen »Nada, nada« der spanischen Mystikerin aus Ávila? Warum zogen sie diese rauen Gewänder an? Warum wollten sie einsam gemeinsam hinter Mauern leben, Gehorsam geloben und sogar auf Sex verzichten?
Meine erste Begegnung mit Mönchen lag lange zurück. Ich war damals Aktivist in einer kommunistischen Splittergruppe. Nachts druckten wir Flugblätter, und wenn wir sie frühmorgens vor den Fabriktoren verteilen wollten, wartete jeweils die Polizei auf uns, um uns zu verhaften. Es war ein seltsames Spiel, aber wir glaubten, darin eine spannende Rolle zu spielen. Anfangs trugen wir schöne schulterlange Haare, die wir im Winter ganz gut unter Wollmützen verbergen konnten; als der Frühling kam, mussten die Haare allerdings weg, um nicht durch einen unproletarischen Look mögliche Sympathien zu verspielen. Im Grunde fanden wir die Welt dieser Erwachsenen, ob proletarisch oder nicht, spießig und verlogen. Wir wollten eine neue, radikale Wirklichkeit finden und suchten nach Menschlichkeit und Nähe. Begriffe wie Gerechtigkeit, Freiheit und Liebe hatte einen guten Klang. Keiner ahnte, dass es sich dabei um die Botschaften der Bergpredigt handelte. Unsere Modelle hießen China und Albanien, und wir freuten uns auf eine Zukunft, in der auch bei uns die Regeln der Revolution den Alltag bestimmen würden.
Zu dieser Zeit hatte ich wenig Schlaf. Es lag an den Druckmaschinen, die mich fesselten, aber nicht nur. Progressive Mädchen fanden es sehr attraktiv, dass wir in unserer Kommune-Wohnung so wenig auf Ordnung hielten, und wir bekamen häufig Besuch. Wir waren nicht direkt auf freie Liebe aus, aber es sah zumindest stark danach aus. Wie gesagt, ich hatte wenig Schlaf damals, aber zunehmend hatte ich auch das Gefühl, mich nur noch um mich selbst zu drehen, eine Bewegung, in der man bekanntlich ganz schwer vorwärtskommt.
Eines Tages packte ich meine Sachen, um jenes Kloster hoch oben auf dem Berg auf der anderen Seite des Flusses aufzusuchen, das so verheißungsvoll in meine Stadt herüberwinkte. Ganz sicher würde es da keine Druckmaschinen geben.
Der Fußweg zum Kloster war steil. Ich erinnere mich an schwere Türen und an einen etwas dichten klerikalen Geruch aus Weihrauch, modrigen Gewändern, altem Holz und alten Büchern. Es gab einen Obstgarten, einen heruntergewirtschafteten Bauernhof und einen »Gottesacker«, den kleinen Friedhof der Mönche, mit einer kleinen Bank unter dem Baum. Man hatte die Gräber vor sich und konnte gleichzeitig über sie hinweg einen weiten Blick ins Tal und auf den Fluss haben. Es war nahezu unmöglich, hier in den Abendstunden nicht über den Weiterfluss des Lebens nachzudenken.
Das Zimmer, das man mir zugewiesen hatte, lag im zweiten Stock mit Blick auf die Stadt. Es gab ein Bett, ein schönes altes Sofa, einen Tisch, einen Schrank, ein Waschbecken. In den Kachelofen legte ich Holzscheite ein, die bald gemütlich knisterten. Schon am ersten Tag saß ich stundenlang in der Bibliothek. Ich konnte im Garten spazieren gehen, in der Zelle die Wand anstarren oder melancholische Gedichte schreiben, die ich für existenzialistisch hielt. Das Kloster hatte etwas Geheimnisvolles, manchmal aber wirkte es auch morbide und gespenstisch. Einer der alten Männer hatte die Angewohnheit, tief in der Nacht in langen Unterhosen auf dem Flur herumzuirren, und wenn man ihn ansprach, war er sehr dankbar, wieder in seine Zelle geführt zu werden.
© Bruder Felix Weckenmann OSB
Wenn man ganz neu im Kloster ist, kann man vieles nicht richtig erkennen. Man sieht es wie durch eine falsche oder zumindest eine sehr verschmutzte Brille. Die Mönche wirken zunächst versunken, grimmig und unnahbar, aber das ändert sich meist schnell. Und wenn Sie mit dem einen oder anderen reden, spüren Sie, dass es klügere und weniger kluge gibt; demütige, aber auch sehr eitle Mönche, die vom täglichen Beten nicht unbedingt geheiligt wurden. Einmal sprachen wir über Stressbewältigung. Es war lange bevor es bei uns Ayurveda-Kurse gab und »Gute-Laune-« oder »Seelen-Tees« auf den Frühstückstischen standen. Ich fragte einen der Mönche, wie er es mache, wenn ihn eine allzu große Belastung irgendwie in die Knie zwinge. Das Wort »Stress« hatte ich vermieden. Ich war auf eine tiefschürfende Antwort gefasst, aber der Mönch sagte nur: »Rausgehen an die frische Luft, ein wenig Bewegung, spazieren gehen, den Kopf frei bekommen.« Ich sagte: »Das ist alles?« Er muss die Enttäuschung in meinem Gesicht bemerkt haben, aber er war nicht aufgelegt, mir deswegen einen Gefallen zu tun. »Natürlich haben wir unser Stundengebet«, meinte er, »das uns den Tag über an den unterschiedlichsten Zeiten schon hilft, damit Stress erst gar nicht aufkommt.« Mehr war zu dem Thema zunächst nicht zu erfahren.
Nach dem Essen saßen wir meist noch kurz zusammen. Es gab nichts zu trinken. Niemand rauchte. Man sitzt einfach in Ruhe da und plaudert, so, wie es früher die Bauern nach dem Feierabend auf ihrer Hausbank taten. Jemand von den Mönchen, es waren Salvatorianer, erzählte davon, wie er mit fünfzig Bäuerinnen eine Flugreise nach Fatima gemacht hatte. Die meisten dieser Frauen waren zuvor noch nie in einem Flugzeug gesessen, und vielen war sehr mulmig zumute. Schließlich habe eine gesagt: »Wenn wir da jetzt abstürzen, dann brauchen wir uns zu Hause aber nicht mehr sehen lassen.« Den meisten der Alten war die Geschichte vielleicht schon hundertmal erzählt worden, aber sie freuten sich darüber, nickten mit dem Kopf und schmunzelten den Gast an, als hätten sie noch nie davon gehört.
Einer der Mönche hatte einen besonders gebückten Gang. Sein Körper war gekrümmt wie die Zeiger auf dem Zifferblatt einer Uhr, wenn sie den bevorstehenden Abend anzeigen. Eines Tages kam er auf mich zu und zupfte mich am Ärmel. »Sehen Sie«, begann er – er zog mich dabei langsam mit sich fort –, »wir sind jetzt nicht mehr so viele. Bald wird es unser Kloster vielleicht gar nicht mehr geben. Aber wenn Sie mit offenen Augen durch die Länder reisen, bemerken Sie etwas, was ohne die Arbeit und das Erbe von uns Mönchen und ohne den Zivilisationsbeitrag des Christentums ganz undenkbar wäre. Die schönen Basiliken, die kleinen Kapellen am Rande, die herrlichen Kulturlandschaften. Und heute? Wir haben in unserer Zeit so unendlich viel an Wissen aus der Tradition, aus den heiligen Überlieferungen unserer Väter einfach aufgegeben. Und keinen scheint das zu beunruhigen. Ich verstehe das nicht. Niemand sieht, dass das auch ein wichtiges Wissen war, das dem Einzelnen hilft, sich besser zurechtzufinden!«
Ich war nicht besonders fromm, aber an der bürgerlichen Welt langweilten mich bald die Spießer, die den Glauben zwar für etwas Angepasstes und Überholtes ansehen, aber gleichzeitig nichts anderes denken und tun als das, was eben alle tun. Und an der Welt der Mönche faszinierte mich in der Tat, dass sie etwas tun, was keiner tut. Was im Gegenteil so absurd, so verkehrt, so ganz weit weg von allem Gewöhnlichen ist, dass man es gemeinhin für verrückt halten müsste. Es war zu vermuten, dass die weltweite Umweltvernichtung nur das kleinere Problem ist im Verhältnis zur Vernichtung geistiger Werte, zu dem gewaltigen Kulturmüll, unter dem wir zu ersticken drohten. Diese Leute setzten etwas gegen die Absenkung des Grundwasserspiegels unserer Kultur – ihr Stopp! Stopp der Selbstzerstörung durch Lebensstile, die immer kaputter machen! Stopp den Verbrechen! Stopp der Gewalt! Stopp den Lügen! Stopp den Vergnügungs- und Drogensüchten! Stopp der Desorientierung!
Der alte gebückte Mönch sah mich ein wenig traurig an und sagte: »Viele Menschen haben kein Rezept. Sie wissen nicht, an was man sich halten, an wen man sich wenden könnte. Und so missachten sie Gesetze des Lebens, die man nicht ungestraft missachten kann. Wissen Sie, unser Glaube ist ja gar keine von Menschen erdachte Verordnung. Manchmal könnte es so aussehen, ich weiß. Aber ich bin heute alt genug, um mir sicher zu sein, dass es nichts anderes ist als das, was Gott selbst in die Welt gebracht hat.«
In den Monaten vor meiner Reise nach Monte Cassino waren seltsame Veränderungen eingetreten. Wenn ich abends ins Bett ging, hatte ich selbst an sonnigen Tagen das Gefühl, als hätte ich den ganzen Tag über stundenlang im Regen gestanden, der meine Kopfhaut durchweichte. Ich fühle mich nervös und ausgebrannt. Mich fror. Mich fror unentwegt und unbarmherzig. Aus Angst, Hunger zu bekommen, kaufte ich kurz nach dem Frühstück ein Sandwich und betrachtete auf dem Weg zu meinem Büro, während ich Stück um Stück davon abbiss, wie sich Schneeflocken darauf niederließen. Die ganze Welt um mich herum und in mir selbst hatte sich auf eine merkwürdige Art verengt und verhärtet. Auch Männer können an den Rand eines Nervenzusammenbruches geraten. Nur werden sie in solchen Fällen nicht bemitleidet oder gar gepflegt, ganz im Gegenteil. Meine Kinder bezweifelten insgeheim, dass ihr Vater überhaupt so etwas wie Nerven oder Gefühle besitzen könnte, und ignorierten mein Befinden. Meine Frau meinte zwischen Tür und Angel, was das denn für ein seltsamer Glaube sei, wenn er einem nicht einmal helfen könnte, ein wenig ruhiger zu bleiben. Irgendwie hatte sie ja auch recht damit, aber eben nur irgendwie.
Unser Geld auf dem Konto schmolz dahin wie Schnee, aber das war es nicht, was mich so irritierte. Schon kleinste Dinge konnten mich verunsichern und überfordern. Ich machte mir Sorgen darüber, dass die Kaffeemaschine entkalkt werden müsste und ob die Putzfrau meine Hemden gebügelt hätte. Ich war gewissermaßen allergisch geworden. Allergisch gegen Medien. Gegen Parteien. Gegen die Großstadt. Und am meisten gegen mich selbst. Gegen die eigene Bequemlichkeit. Das Aufschieben so wichtiger Dinge von Tag zu Tag, die Lebenslügen, die man selber glaubt. Die Unfähigkeit, miteinander offen zu sein, ehrliche Freundschaften zu pflegen. Auf dem Schreibtisch stapelten sich kleine gelbe Zettel mit Notizen, die ich unentwegt produziert hatte. »Regal einräumen«, stand da zum Beispiel, oder: »Was ist der Geist der Zeit? Was umweht uns wirklich?«, und auch: »Notizzettel ordnen!«
Dass man älter wird, lässt sich ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr verbergen. Man sieht in den Spiegel und wundert sich. Man fängt an, sich aus der Distanz heraus zu betrachten, wie einen Patienten mit der Diagnose: unheilbar. Spielt es noch eine Rolle, etwas erreichen zu wollen? Vielleicht war diese Welt für das biologische Leben, für unsere Sinne, unseren Körper ja längst viel zu anstrengend geworden? Wenn ich abends mit der U-Bahn nach Hause fuhr, stellte ich mir die Frage, ob Gott wirklich in jedem dieser Menschen ist, auch in den unangenehmen, auch in den weniger schönen. Auf dem Platz neben mir streichelte eine dicke Mutter ihrer dicken Tochter liebevoll über das Haar. Vielleicht sind es diese banalen, hilflosen Gesten, die die Welt zusammenhalten, überlegte ich.
Jeden Tag wartete ich darauf, dass etwas Wichtiges passieren würde. Nicht gleich eine Botschaft aus dem All, aber vielleicht ein Auftrag, ein Anruf. Aber es passierte nichts. Du bist eingeschneit, dachte ich, und es war ein Gefühl wie draußen im Winter. Die Kälte zieht herauf, und es gibt keinen Weg mehr, der sich noch irgendwie freischaufeln ließe. Ich fühlte mich müde und kaputt, obwohl ich seit Tagen nichts gearbeitet hatte. Eine nicht fassbare Anstrengung hielt mich in Atem. Tausend Gedanken beschossen mich wie Pfeile und betäubten mich, und ich hätte stundenlang einfach nur so dasitzen können, rauchen, trinken, Brot mit Senf essen. Ich wollte etwas tun, das meine komplette Existenz betraf, was ihr einen neuen Grund oder zumindest neue Stützen einziehen könnte. Etwas mit Sofortwirkung, etwas, das hilft wie eine Akontozahlung. Aber ich wusste nicht, was.
Auf meinen Irrungen durch die Stadt hatte ich das Hinweisschild für eine neue ärztliche Praxis entdeckt. Ein Therapeut bot eine Methode an, die er »Inner Clearing« nannte, innere Reinigung. Die Vorstellung hatte mich fasziniert. Wenn einen der Wind durchgepeitscht hatte und man sehr nass geworden war, zerzaust, müde und geschlagen, ist es ein schöner Gedanke, ganz still und bußfertig auf einem Stuhl in der Ecke sitzen zu dürfen. Erschöpft, aber auch erleichtert nach der kathartischen Nacht. Man ist froh, nicht mehr so streng und erfolgreich sein zu müssen. Nicht mehr so zornig. Den Willen einmal ganz aufgeben zu dürfen, einigermaßen geläutert und demütig zu sein. Und man denkt: Ja! Lass mich in aller Ruhe und mit großer Bestimmtheit und Mut und Überzeugung das tun, was man in der größeren Reife eines Lebens tun könnte und vielleicht sogar tun müsste.
Ich war im Flieger eingenickt. Vor mir sah ich einen Engel mit goldenen Locken. Es war kalt. Der Engel saß an einem Tisch und schrieb mit einem goldenen Federkiel an einem Brief. Als ich näher kam, konnte ich seinen Text lesen: »Du glaubst gar nicht, lieber Gabriel, was ich gesehen habe«, stand auf dem Papier. »Die Menschen sind in einen seltsamen Zustand geraten, kein Vergleich zu früher. Irgendetwas ist in Unordnung. Was sage ich, nicht irgendetwas, sondern rundum alles. Sie sitzen auf dem Teufelsrad, werden pausenlos heruntergeschleudert und merken es noch nicht einmal. Gabriel, du glaubst es nicht! Diese Leere in den Köpfen, die Leere in den Gesprächen. Überall haben sie goldene Kälber aufgestellt, die sie mit großen Augen verehren und bejubeln, wie damals bei Aaron am Fuße des Sinai. Sie sind so dumm geworden. Noch nie zuvor gab es eine so große Menge an Wissen. Aber über das, was diese Erde wirklich zusammenhält, wissen immer mehr anscheinend immer weniger. Und jetzt fangen sie auch noch an, an sich selbst herumzuzüchten. Menschen als Biomasse, nach Merkmalen sortiert, und als Ersatzteillager für jene gehalten, die sich das leisten …«
Mehr war nicht zu hören. Ich wachte schweißgebadet auf. Gott sei Dank, es war nur ein Albtraum.
Ich rieb mir die Augen und sah im Flieger auf hundert oder zweihundert gut und schlecht rasierte Hinterköpfe. Ich musste daran denken, wie lange diese einzelnen Wesen, zu denen die Köpfe gehörten, wohl noch reisen könnten. Bald würden ihre Leistungen schwächer werden, sie würden ihr Ticket an andere, kräftigere Wesen abgeben müssen. Wie lange würde ihnen noch bleiben? 30 Jahre? Zehn Jahre? Ja, es stimmt, wir sind Eintagsfliegen. Und das Leben ist, wenn es wirklich keinen Gott gibt, wirklich nur ein Spiel. Ein lächerliches, zynisches und vor allem unheimlich kurzes Spiel.
Ich lehnte mich im Flieger zurück und dachte: Mein Gott, vielleicht bin ich einfach zu anspruchsvoll, um mich damit abzufinden. Aber mir gefiel der Gedanke, unsterblich zu sein. Ich schloss die Augen und genoss es. Ich begann zu träumen und träumte von einer Welt, die ganz anders ist.
2 Vom Loslassen
»Lass es nur zu!«
Jesus von Nazareth
Es war im Frühjahr des Jahres 2000, als ich zum ersten Mal nach Monte Cassino kam. Ich hatte mit Kardinal Ratzinger, heute der emeritierte Papst Benedikt XVI., ein Interview für ein neues Buchprojekt vereinbart, und das Kloster schien mir der beste Ort, in Ruhe darüber zu reden. Alfredo, der Chauffeur des Kardinals, brachte uns in dem nicht mehr ganz so neuen Mercedes der Kongregation auf den Weg. Es ist nicht sehr weit von Rom nach Neapel, aber wir bogen schon bald von der Autostrada ab zur Rast in einem Autogrill. Der Kardinal stellte einen Teller mit Risotto und eine Flasche Wasser auf sein Tablett und ging damit zur Kasse. Als die Kassiererin ihn erkannte, war sie ganz außer sich. »Eminenza, Eminenza«, wiederholte sie ganz aufgeregt, und man merkte ihr an, dass es ein guter Tag für sie war.
Alfredo fuhr sehr vorsichtig die steilen Serpentinen den fünfhundert Meter hohen Berg hinauf. Wir saßen andächtig im Fond des Wagens, beeindruckt von der großartigen Aussicht, die sich uns bot. Der heilige Benedikt war Italien-Experte, er hätte sich keinen besseren Platz für seinen Stammsitz aussuchen können. Die Luft wird kühl und klar, und nach jeder Biegung weitet sich der Blick auf eine neue, silbern-blau schimmernde Bergkuppe. Mit dem Esel muss es beschwerlich gewesen sein, aber ganz oben, von der »Halle des Paradieses« aus, konnten auch schon frühere Pilger mit glänzenden Augen das Panorama eines wunderbaren Landschaftsbildes genießen, von der fruchtbaren »Terra di Lavoro« bis hin zu den ernsten Spitzen der Apenninen. Monte Cassino ist das berühmteste Kloster der lateinischen Kirche. Es gibt keines, das ihm an Alter und Würde gleichkäme. Hier oben, meinte Papst Paul VI., als er 1959 anlässlich der Weihe der wiederaufgebauten Basilika den heiligen Ordensgründer zum Patriarchen und Schutzpatron Europas erhob, sei nicht nur »die geheimnisvolle und bezaubernde Stimme der Geschichte« zu hören, man fühle auch »lebendig den Atem der katholischen Kirche« wie kaum irgendwo sonst.
Wie bei einem Staffellauf hatten die Mönche die Fackel ihrer Berufung weitergegeben und tun es immer noch. Von den Vätern in der ägyptischen Wüste wie Antonius und Pachomius bis zu Mutter Teresa von Kalkutta. Es begann mit der Frage, wie einfache Leute, die Jesus ein wenig mehr als nur auf die gewöhnliche Weise nachfolgen wollten, christlich miteinander leben könnten – und führte zu einem ersten Fall von Globalisierung, nämlich einer beispiellosen, die ganze Welt umspannenden Kette von Niederlassungen in den Tälern und den Zitadellen auf den Bergen, die ihr Licht anzündeten, wenn es dunkel wurde. Es ist nicht übertrieben, zu sagen, dass die christlichen Klöster zum wertvollsten Erbe des Abendlandes geworden sind. Nonnen und Mönche bewahren in den Mauern ihrer Klöster und in ihren Herzen gewissermaßen die Quellcodes für die richtige Lebensweise auf und halten mit ihrem Dienst für Gott und Mensch zuverlässig ein ewiges Licht am Leuchten. Man kann sie mit der Wirkung von Katalysatoren vergleichen. Für die Reinigung unserer geistlichen Luft sind sie mindestens so notwendig, wie es die Alpen sind, um im Smog der Metropolen überhaupt noch Atem zu bekommen.
Napoleon hat sie nicht gemocht. Er empfand die Demut der Mönche als staatsgefährdend und ließ ihre Klöster zu Hunderten schleifen. Und dennoch haben die Ordensleute die Welt mehr verändert als Jakobiner, Bolschewisten, Rote Garden und alle anderen revolutionären Gruppen vor oder nach ihnen. Ihr bloßes Da-Sein, ihr praktisches Beispiel, ihr Vor-Bild, ihr stilles Mahn-Mal und der Anker-Platz, den sie den Gestrandeten aller Zeiten anbieten, wiegen mehr als alle Bücher und Theorien, die es über das Christentum gibt, zusammengenommen. Haben sie nicht in allen Bereichen großartige Meister anzubieten? Meister der Musik. Meister der Zelebration. Meister der Medizin. Meister des Geistes. Meister der Ruhe. Meister des Ackerbaus. Meister des Gartens. Meister der Meditation. Meister der Buße. Meister der Exerzitien. Und sogar Meister der Küche und des Branntweines. Die Kultur der Klöster ist dabei nicht etwas, was neben dem Christlichen steht, sondern ist in gewisser Weise die Essenz davon. Und nur als Essenz – für den gewöhnlichen Konsum eigentlich viel zu stark – konnte sie jede Zeit überdauern und diese Überdosis an Wirkung haben. Der Clou dabei: Weil die Klöster vom Lärm der Welt so weit weg sind, blieb ihre Stimme immer hörbar und lief nicht Gefahr, im Trubel der Zeiten zu versinken.
Pater Johnny Walker
Meine Sehnsucht war mir auf meiner Reise zu den Mönchen lange schon vorausgeeilt. Ich freute mich darauf, und ich hatte mir im Vorfeld unendlich viel vorgenommen. Ich hatte beschlossen, Hilfe zu suchen; auch, um Klarheit in vielen Fragen zu gewinnen, die ich lange Zeit vor mir hergeschoben hatte. Ich hatte beschlossen, mich zu sammeln; meine Buchstaben wieder zusammenzubringen. Ich hatte beschlossen abzunehmen; weniger zu essen, um geistig zuzunehmen. Ich hatte beschlossen zu schweigen (und ich hörte dabei die Stimme meiner inneren Inquisition: »Da deine Sachen so unausgegoren sind und du nicht damit weiterkommst, sondern nur Verwirrung und Unheil anrichtest, wirst du zu zwei Wochen Schweigen verurteilt«). Und ich hatte beschlossen zu vertrauen; den Berg von Fragen und Problemen, der so riesig geworden war, einfach einmal abzuladen. Mein Verlangen nach Kraft und Gesundheit war riesig, und ich wollte mit allem gleich beginnen. Aber meine erste Lektion erhielt ich schon mittags, gleich nachdem ich im Kloster angekommen war.
Der Gastpater nahm mir meine Taschen ab und führte mich auf mein Zimmer. Es war mir unangenehm, mir mein Gepäck tragen zu lassen, aber er ließ sich nicht davon abhalten. Der Mönch stellte sich als »Pater John« vor. Später erfuhr ich, dass ihn einige seiner Mitbrüder liebevoll »Johnny Walker« nannten, nach dem Spitznamen von Papst Johannes XXIII., dem dicken Lieblings-»Papa Giovanni« der Italiener, der so gerne spazieren gegangen war. Vielleicht aber auch nach dem Mann auf der Whiskyflasche, oder einfach nur deshalb, weil er Amerikaner war – ich weiß es nicht. Der Pater stammte ursprünglich aus Boston in Massachusetts. Er war nicht groß und auch nicht klein, hatte einen ovalen, kahlen Kopf mit einem Kranz aus grauem Haar. Seine schwarze Kutte wurde von keinem Bauch gewölbt, aber er war auch nicht unbedingt das, was man einen Asketen nennen würde. John konnte offenbar stundenlang unbeweglich dasitzen, ohne dabei starr zu wirken. Der Eindruck, den er auf mich machte, war konzentriert und offen. Seine kleinen Augen tränten, wenn er lachte, und bekamen einen sehr gütigen Zug, wenn er müde war. Aber das wusste ich damals noch nicht.
»Schön, dass Sie hier sind«, sagte der Pater, dann sah er mich an, überlegte kurz und meinte, ich sollte mich am ersten Tag erst einmal richtig ausschlafen. Nachmittags könnte ich mir übrigens Kaffee und Kuchen holen. Er drückte mir noch einen Zettel mit den Gebetszeiten in die Hand, dann ging er.
Nun, ich wollte mich alles andere als ausschlafen, sondern möglichst schnell möglichst viel lernen. Und ich wollte keinen Kuchen und nicht zunehmen, sondern endlich Kilos abnehmen. Und was das Zimmer betraf: Ich war nicht sonderlich anspruchsvoll. Ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, so was genügt mir. Ich erinnerte mich an einen alten Mönchsspruch: »Bleibe in deiner Zelle, und die Zelle wird dich alles lehren«, und genauso wollte ich es machen. Mein Zimmer hatte alles, Bett, Tisch, Stuhl – nur, es hatte keine Atmosphäre. Der Fußboden war mit Filz ausgelegt. Vom Fenster aus konnte man parkende Autos sehen. Was sollte einen so eine Zelle schon lehren können?
Es gibt immer einen besseren Platz, einen besseren Blick, eine bessere Gelegenheit. Im Restaurant, im Kino, selbst auf einem Berggipfel. Ich bin spezialisiert auf solche Fälle. Ich stand da und überlegte. Die Zelle neben jener, die mir zugewiesen wurde, war nicht belegt. War es Zufall? Möglicherweise war sie angenehmer, konnte ein besseres Gefühl herstellen, und möglicherweise war sie für niemanden sonst bestimmt als für mich! In der Tat, es gab ein Fenster mehr, ein Bett mehr – allerdings konnte es sein, dass der Tisch nicht ganz so vorteilhaft platziert war wie in dem anderen Raum. Da es zwei Betten gab, war es wiederum notwendig, auszuprobieren, in welchem von beiden man letztlich besser schlafen könnte. Ich machte Tests. Ich ging zwischen den beiden Zellen hin und her. Ich wog Vor- und Nachteile gegeneinander ab. Hin und her. Mal fand ich das eine, mal das andere besser. Bald war ich mir sicher – und doch wieder nicht. Mal stellte ich den Koffer hier ab, mal dort. Ein Mann auf Reisen, zwischen zwei Zimmern, hin und her. Die Situation wurde nicht nur immer lächerlicher, sie wurde regelrecht verzweifelt.
Als ich mich in der rastlosen Jagd nach dem Besseren irgendwann erschöpft auf eines der Betten geworfen hatte, sah ich plötzlich jemanden, der belustigt den Kopf schüttelte. Es war Benedikt, der Mann Gottes. Es war mir peinlich, auch wenn es nur ein Bild an der Wand war, das mich ansah. Lass nun endlich einmal los!, so begann der Bärtige zu sprechen. Mach es dir leichter. Wenn dir jemand einen bestimmten Schlüssel in die Hand drückt, dann nimm ihn einfach. Lass es geschehen. Nimm es, wie es kommt. Oder willst du jeweils selbst schon im Vorhinein wissen, was das Beste ist? Deine eigene Wahl wirst du genauso hinterfragen wie die der anderen. Hinterfrage einmal nicht! Nimm die Zelle an, bitte – und gib endlich Ruhe!
Was sollte ich machen? Ich nahm das Zimmer, das man mir gegeben hatte. Ich ließ mich auf das Bett fallen, aber ich schlief nicht. Ich schloss nur die Augen und genoss die selige Freiheit, nicht entscheiden zu müssen. Ich musste über mich selber lachen. Ich hatte eine Lektion bekommen. Und ich hatte tatsächlich beschlossen, einmal zu gehorchen.
Ganz einfach im Sein
Neuankömmlinge fühlen sich im Kloster zunächst fremd und unbehaglich. Das extreme Leben der Mönche entspricht einem Verhalten, das uns fremd geworden ist: in Genügsamkeit, im Beten, in ihrer Kontemplation, im Fasten, in Ordnung und Regel. Aber machen nicht auch wir alles inzwischen genauso extrem wie sie, nur eben in der jeweils entgegengesetzten Disziplin? In Maßlosigkeit, Gottesferne und Esssucht? Der Kontemplation steht unser Aktionismus gegenüber, der Ordnung die Unordnung, der Regel die Regellosigkeit. Im Kontrast zur klösterlichen Umgebung fallen einem diese Dinge, die ansonsten zu den Selbstverständlichkeiten des »zivilisierten« Lebens gehören, nun irgendwie unangenehm auf.
Als Ernest Hemingway versuchte, die Geheimnisse des Stierkampfes darzustellen, meinte er: Der Zuschauer, der zum ersten Mal zum Stierkampf geht, kann nicht erwarten, die Menge an Kombinationen und Hintergründen zu sehen, die es dabei gibt. Es wäre sogar falsch und verwirrend, sofort alle Dinge zu sehen. Im Kloster ist es nicht viel anders. Auch an den Lehren der geistlichen Meister klingt auf den ersten Blick einiges banal, unintelligent und unscharf. Gut, Mönche sind keine Matadore, aber die Tiefe und die Verzweigungen ihrer Tradition und ihrer Möglichkeiten sind mit Sicherheit nicht leichter auszuloten als die Schritte der Toreros. Ich glaube, ihre Lehre ist letztlich so groß, weil sie so simpel scheint. Und sie ist gleichzeitig so kompliziert, weil es schwer ist, das zu tun, was am einfachsten aussieht.
Mit einem der Mönche, einer graubärtigen, asketischen Erscheinung, der mir zufällig über den Weg gelaufen war, wollte ich gerne sofort ins Gespräch kommen. Ich fragte ihn etwas über das Jesus-Gebet, ein uraltes, sehr geheimnisvolles Mantra aus der mystischen Tradition des östlichen Mönchtums. Es besteht aus einem einzigen Satz – »Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner« – und wird, wenn man es gut einüben will, zigtausendmal am Tag gesprochen, so lange, bis es einem gewissermaßen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Mein Herantasten war nun gleich ein Beispiel dafür, wie schwer es ist, auf flotte Art in die Welt der Mönche einzudringen, ohne mehr als dumme Fragen zu stellen: »Wie stellt sich das im Kopf dar«, wollte ich nach einer Weile wissen, »ich meine, wenn man das Jesus-Gebet so lange geübt hat, bis man damit einschläft und auch wieder damit aufwacht?« – »Im Kopf? Sie müssen weg vom Kopf«, sagte mir mein Lehrer wider Willen, »wenn Sie da bleiben, kommen Sie nicht weiter. Es heißt doch: ›Bevor ich euch anrufe, höre ich euch.‹« – »Wie ist es mit der Atemtechnik?« – »Der Atem geht, wie er geht, und fertig.« – »Was stellt sich dann ein?« – »Nichts. Es stellt sich eben überhaupt nichts ein.« Der Alte wurde nun fast schon ärgerlich. »Wenn Sie darauf warten, dass sich etwas einstellt, gehen Sie doch sofort wieder auf die Wirklichkeit zurück. Sie dürfen nichts erwarten, absolut nichts. Nie denken: Was krieg’ ich jetzt dafür, was habe ich davon? Ut in omnibus glorificetur Deus. Ich habe nichts. Ich will nur dienen.« – »Sind wir jetzt im Bauch oder im Herzen?« – »Nein, nein.« Er schüttelte seinen Kopf. »Wir sind im Wesen. Das menschliche Wesen ist weder im Bauch noch im Muskel noch im Herzen. Es ist ganz einfach im Sein.« Allmählich lernt man die Mönche, die man zunächst nur als einförmige schwarze Wolke wahrnehmen kann, die sich mal hierhin, mal dorthin bewegt, besser zu unterscheiden. Man lernt ihre Besonderheiten und Gebrechen kennen. Gott hat sich für seine Spezialeinheit nicht rundweg Models ausgesucht. Es gibt Mönche mit wirklich sehr langen Gesichtern, andere wiederum haben Köpfe wie der Mann im Mond oder wie der Mond selbst. Nicht alle Mönche sind gute Mönche, und Nonnen können ganz schön bissig sein. Selbst Bischöfe verhalten sich so, als habe sie der Heilige Geist längst verlassen. »Wie ich schwerlich bessere Christen kennengelernt habe als jene, die in den Klöstern von Tugend zu Tugend fortschritten«, resümierte der heilige Augustinus, »so habe ich auch keine schlechteren kennengelernt als jene, die in Klöstern zu Fall kamen.« Der Weg dieser Menschen ist der außergewöhnliche, meinte Benedikt über »Mönche, die Gott mit ihrer Tonsur belügen«, und das Unglück bestehe darin, dass er von zu vielen gewöhnlichen Menschen beschritten werde, die ihm nicht gewachsen seien und dann auch folgerichtig an ihm scheiterten.
© Bruder Felix Weckenmann OSB