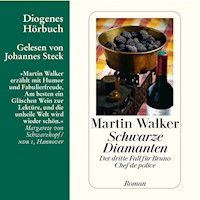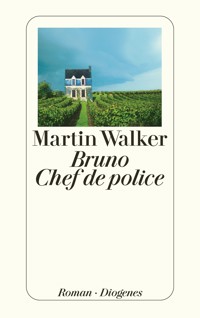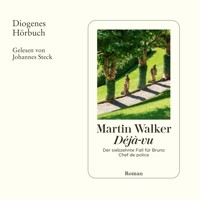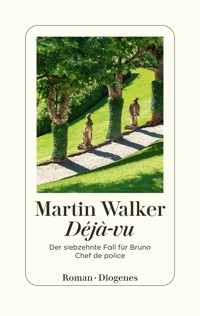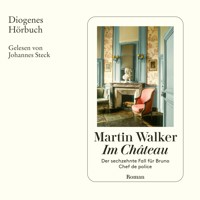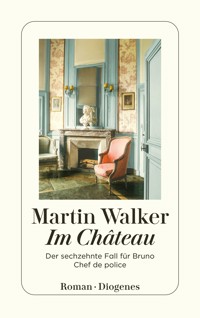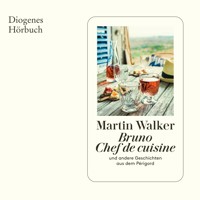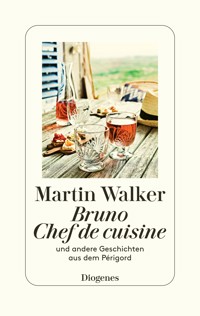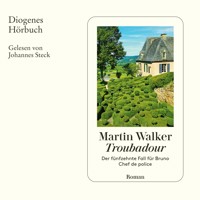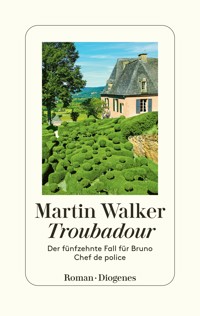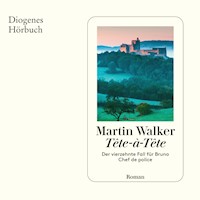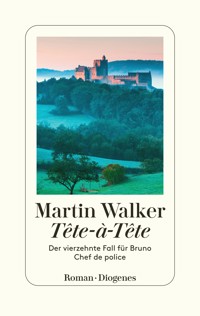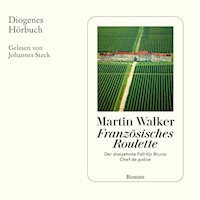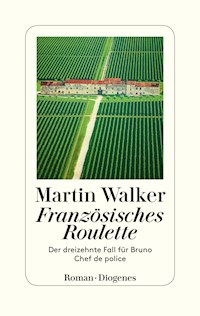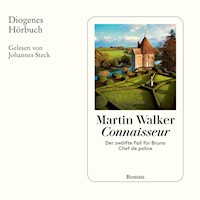9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Das kleinste Buch über die großartige Schweiz! Wie tief ist der Röstigraben und wo liegt er? Was versteckt sich hinter Schwingen, Hornussen und Jassen? Was ist ein Brocki? Warum heißt »Mensch ärgere dich nicht« in der Schweiz »Eile mit Weile«? Haben die Schweizer Humor und wenn ja, welchen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Martin Walker | Anica Jonas
Die Schweiz für die Hosentasche
Was Reiseführer verschweigen
Über dieses Buch
Grüezi!
Fakten und Fundstücke, die Sie schon immer über die Schweizer wissen wollten
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Martin Walker, Journalist, Verleger, Autor und Urner, lebt in Zürich. Auch als Schweizer versteht er sein Land und seine Landsleute nicht immer.
Anica Jonas, vor sechs Jahren aus Deutschland in die Schweiz gezogen, lebt sehr gerne in Zürich, wundert sich aber noch täglich über die Schweiz. Die Germanistin ist in der Verlagsbranche tätig.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER Taschenbuch
Frankfurt am Main, April 2014
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Covergestaltung und -abbildung: bilekjaeger, Stuttgart
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402958-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorwort
Gesellschaft
Eile mit Weile
Die Schweiz in Zitaten
Alle Schweizer sind viersprachig, fließend
Prozentuale Verteilung der von Personen schweizerischer Nationalität gesprochenen Hauptsprachen, 1950–2000
Anteil der 15 häufigsten Nichtlandessprachen in der Wohnbevölkerung (in % und absolut), 2000
Sprachliche Minderheiten
Einführung in das Schweizerdeutsche
Diese 15 Vokabeln müssen Sie verstehen
Bei diesen zehn gängigen Beleidigungen müssen Sie aufpassen, die Heftigkeit nimmt nach unten ab
Die niedlichsten Ausdrücke
15 gängige Helvetismen
Ausländer in der Schweiz
Auslandsschweizer
Schweiz und Deutschland
Zehn Dinge, die Schweizer an den Deutschen nicht mögen
Zwei Dinge, die Schweizer an Deutschen mögen
Zehn Dinge, die Deutsche an der Schweiz mögen
Zehn Dinge, die Deutsche an der Schweiz nicht mögen
Die ordentliche Schweiz
Die Schweiz glaubt. Nur, an was?
Die Schweiz lacht
Schweizer Humoristen
Schweizer Witze
Schweizer Promis
Titelseiten der Schweizer Illustrierten mit ihren Covergirls und -boys (Januar bis Juli 2013, in umgekehrter Reihenfolge)
Royale Schweiz
Schwingerkönige und -königinnen
König Kraska
Thurgauer Apfelkönigin
Kuhkönigin
Braunviehkönigin
Les Reines Prochaines
Virtuelle Schweizer
Heidi
Globi
Knorrli
Betty Bossi
Papa Moll
Chaschperli
Wilhelm Tell
Berühmte Schweizer Auswanderer
Berühmtheiten mit Schweizer Wurzeln
Die häufigsten Babynamen in der Schweiz 2012
Deutschschweiz
Suisse romande
Svizzera italiana
Svizra rumantscha
Wer in der Schweiz begraben ist
Einträge im Guinnessbuch der Weltrekorde
Größtes Taschenmesser
Seillaufen
Längste gefahrene Reise im selben Fahrzeug
Längster Flug mit einem solarbetriebenen Flugzeug
Größtes Alphornorchester
Politik
Zum Gähnen spannend
Politische und kirchliche Spitze der Schweiz
Die wichtigsten Parteien der Schweiz
Die Bundesräte ab dem Jahr 2000
Abgewählte Bundesräte
Die längsten Amtszeiten
2:2:2:1 – Die Zauberformel des Bundesrats
Parteipolitische Zusammensetzung des Nationalrats
Parteipolitische Zusammensetzung des Ständerats
Abstimmungen und Initiativen
Angenommenes und Abgelehntes seit 1900
Die einflussreichsten Politiker
Die Kantone
Heimatort
Landsgemeinde
Die Schweizer Armee
Das Obligatorische
Aus dem Dienstreglement der Schweizerischen Armee (DR 04) vom 22. Juni 1994 (Stand am 1. Juli 2012)
Die zehn wichtigsten politischen Skandale
Der Schweizerpsalm
Der 1. August und das Rütli
Die Schweizer Flagge
Die wichtigsten Schlachten der Schweiz
Die Schweiz und Europa
Liste der Institutionen, mit denen die Schweiz ein Abkommen über Vorrechte, Immunität und Erleichterungen abgeschlossen hat
Wirtschaft
Reiche Schweiz
Die Firmen des Swiss-Market-Indexes
Schweizer Franken
Das Bankgeheimnis
Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz, BankG) vom 8. November 1934 (Stand am 1. Januar 2013)
Prominente Kontoinhaber in der Schweiz (vermutet oder bestätigt)
Das Banker-Rating 2012
Schweizer Banken und Verbrechen in der Literatur
… und dasselbe im Film
Import, Export 2011 in Millionen Franken
Werbung mit der Schweiz
Die wertvollsten Schweizer Marken
Marken, die zu Nestlé gehören – eine Auswahl
Weitere bekannte Schweizer Marken
Wofür der Schweizer sein Geld ausgibt
Die 20 Reichsten in der Schweiz 2012 (und ihr Vermögen in Millionen Franken)
Wer hat’s erfunden?
Tourismus
Einnahmen von ausländischen Gästen in der Schweiz
Die Chinesen kommen
Die beliebtesten Ziele in der Schweiz
Die zehn häufigsten Mitbringsel aus der Schweiz
Vom Zoll sichergestellte Betäubungsmittel 2012
Substanz in kg
In die Schweiz geschmuggelte Lebensmittel 2012 (in Tonnen)
Migros und Coop
Das Brockenhaus
Land der Kühe
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe
Es werde Käse
Die Mietkuh
Was eine Uhr zu Swiss made macht
Die Schokoladenseite der Schweiz
Verkäufe der schweizerischen Schokoladenindustrie (in Tonnen)
Eine Tafel Milchschokolade von 100 g enthält im Durchschnitt
Medienlandschaft Schweiz
Die auflagenstärksten deutschsprachigen Tageszeitungen 2012 (Kaufzeitungen, Anzahl der Exemplare)
Deutschsprachige Wochen- und Monatstitel (Anzahl der Exemplare)
Wer wem gehört
Geographie und Verkehr
Viel Berg um nichts
Die Geographie der Schweiz
660158/183641, Älggialp, Sachseln, OW
Lustige Gemeinde- und Ortsnamen
Exklaven von Kantonen
Die höchsten Berge
Klima
Muotathaler Wetterfrösche
Klimapolitik
Wasserschloss Schweiz
Die längsten Flüsse
Die größten Seen
Grande Dixence
Seeschiffe unter Schweizer Flagge
Namen der Hochseeschiffe
Jahresmobilität 2010
Langsame Berner
Streckennetz 2010
Fahrzeuge
Luftfahrzeuge
Wasserfahrzeuge
Dank Tunnel zum Strand
Hängebrücken
Geologie
Die Schweizerischen Bundesbahnen
Bahnunternehmen im Vergleich 2010
Die Bahnhofsuhr
Verkehrsschilder
Dampfeisenbahnen in der Schweiz
Seilbahnrekorde
Seilbahnen im Kanton Uri
Tüütääto, Postauto!
PostAuto 2012
Das Velo
Fußgänger
Kultur und Sport
Kultur – doch, doch, die gibt es
Kulturell aktiv?
Die Schweiz liest
Diese Bücher von Schweizer Autoren müssen Sie gelesen haben
Sagenhaft – die Basics
Teufelsbrücke
Urnerboden
Pilatus
Sennentuntschi
Filmreife Schweiz
Pro Jahr vorgeführte Filme und Erstaufführungen nach Herkunftsländern
Die wichtigsten Regisseure und ihre Filme
Mit dem Schweizer Filmpreis ausgezeichnete Schauspielerinnen und Schauspieler
Die schönsten Kinonamen der Schweiz
Die wichtigsten zeitgenössischen Schweizer Künstler
Die wichtigsten Kunstmuseen
Fünf originelle Museen der Schweiz
Architektur
Die zehn höchsten Wohn- und Bürohäuser der Schweiz
Hier kann jeder mitsingen
Eurovision Song Contest – Resultate der Schweiz
Publikumsgeschmack – Gold und Platin
Sport
Sportler und Sportlerinnen des Jahres
Schwingen
Porträt des amtierenden Schwingerkönigs
Hornussen
Hornusser Schweizermeisterschaft 2013, Schlussrangliste NLA
Steinstoßen
Schweizerrekorde aller 11 Kategorien im Steinstoßen
Der Unspunnenstein
Fahnenschwingen
Jassen
Fußball
Die Schweizer Fußballnationalmannschaft
Rekordspieler
Rekordschützen
Heimfarben der Nationalliga-A-Clubs
Fortschrittlicher Schweizerischer Fußball Verband: Die alternative Liga
Die Mannschaften heute
Frauen
Brauchtum
Kulinarisches
So isst die Schweiz
Fondue
Raclette
Rööschti
Berühmte Schweizer Gerichte
Kantonale Spezialitäten
Schweizer Käse von extrahart bis weich
Geschützte Ursprungsbezeichnungen
Bier
Schweizer Biermarkt in Zahlen (2012)
Zehn Arten, in der Schweiz ein Bier zu bestellen
Zum Weinen
Die zehn besten Schweizer Weine
Weinverbrauch 2011
Die grüne Fee
Nahrungsmittelverbrauch
Der Schweizer isst pro Kopf und Jahr in Kilogramm
Kultprodukte
Aromat
Vermicelles
Rivella
Bündnerfleisch
Cola-Fröschli
Ricola
Schweizer Sterneköche
Schweizer Fernseh- und Radioköche
Kosten für auswärts essen und trinken
Der nationale Speisezettel
Das sind die meistkonsumierten Speisen 2012
Der nationale Getränkezettel
Die meistkonsumierten Getränke 2012
Angebote von Restaurants, Hotels und Take-aways
Die größten Gastronomiebetriebe
Die beliebtesten Namen für Restaurants
Kulinarischer Sprachführer
Das Wetterschmöcker-Menü im Gasthaus zum Weißen Kreuz in Seewen
Metzgete – Schnörrli, Öhrli, Schwänzli
Macht Schokolade schlau
Kaviar aus der Schweiz
Das fehlt noch
Letzte Fragen
Quellen und Literaturhinweise
Gesellschaft
Politik
Wirtschaft
Geographie
Kultur
Kulinarisches
Literaturhinweise
Vorwort
Man muss sie mögen, die Schweizer. Auch wenn sie es einem nicht auf Anhieb leichtmachen. Im Grunde genommen sind sie aber harmlos und umgänglich – wenn man im Umgang mit ihnen um ein paar Marotten weiß. Die Schweiz für die Hosentasche hilft zu verstehen, wie der Schweizer tickt, gibt zuverlässige Tipps für die richtige Ansprache und enthüllt Wissenswertes über die Schweiz und ihre Bewohner. Dass sich in der Fülle der Statistiken und Listen neben viel Nützlichem auch viel Überraschendes findet, versteht sich von selbst.
Dass die deutschsprachige Schweiz und damit das Verhältnis zu Deutschland ein wenig mehr im Fokus dieses Bändchens steht, möge man verzeihen. Und um gleich mit einem Vorurteil aufzuräumen: Schweizer mögen Deutsche. Wie sonst wäre es zu erklären, dass proportional zur Bevölkerung viel mehr Schweizer in Deutschland leben als Deutsche in der Schweiz?
Wir sagen Ihnen, wie die Begegnung erfolgreich verlaufen kann und wie Sie die größten Fettnäpfchen rechtzeitig erkennen können, wir klären Sie auf über Dos and Don’ts in der Confoederatio Helvetica.
Wenn auf den folgenden Seiten vom »Schweizer« die Rede ist, ist die Schweizerin natürlich immer mitgemeint, auch wenn sie heute selber wählen und abstimmen darf.
Anica Jonas und Martin Walker
Im Oktober 2013
Gesellschaft
Eile mit Weile
Eine kleine Mentalitätsgeschichte der Schweiz
In der Schweiz ist alles ein bisschen gemächlicher, höflicher und rücksichtsvoller. Was nicht bedeutet, dass es langsamer, freundlicher oder nachsichtiger zu- und hergeht. Das Spiel, das in Deutschland »Mensch ärgere dich nicht« heißt, wird in der Schweiz »Eile mit Weile« genannt – und es gibt sogar noch »Bänkli«, Bänke, auf denen man »sicher« ist. Ob die Bänkli im Zuge des Gerangels um das Bankgeheimnis Bestand haben, wird sich zeigen müssen. Aber das Ziel des Spieles ist dasselbe: gewinnen. In der Schweiz lässt man sich dazu einfach ein bisschen mehr Zeit. Ja, man sieht die Schweiz sogar als Bank an sich, die man allerdings auch mal verlassen muss, will man ans Ziel gelangen.
Das hat verschiedene Gründe, einer ist die Tatsache, dass die Schweiz eine Willensnation ist. Sosehr der Appenzeller Appenzeller oder der Urner Urner ist, der Jurassier Jurassier und der Tessiner Tessiner, sosehr ist jeder doch auch Schweizer und glaubt an dieses seltsame Konstrukt, das sich geschickt durch alle politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Fährnisse manövriert, das versucht, keinem auf die Füße zu treten (das nennt sich Neutralität), sich aber trotzdem einen eigenen Weg sichern will (das resultiert in bilateralen Verträgen). Die Politik der Schweiz ist eine Konsenspolitik, innen- wie außenpolitisch. Der Schweizer ist der Meinung, dass er – auch wenn »die da oben« in Bern natürlich machen, was sie wollen – tatsächlich die Macht hat im Staat. Das traut er sich auch zu, indem er etwa über höchst komplexe Vorlagen abstimmt – mit zum Teil erstaunlichen Resultaten, die von verblüffendem politischem Sachverstand zeugen. Es wird auch vermutet, dass die Schweizer wahrscheinlich die einzige Nation sind, die mehr Ferien für alle großmehrheitlich abgelehnt haben. Ebenso gehört auch dazu, dass es sieben Bundesräte gibt, was keine Oppositionspolitik zulässt, und der Föderalismus – eben die Urner, Appenzeller, Jurassier oder Tessiner – hochgehalten wird. Das ist der »Kantönligeist«, der unter anderem auch den Steuerwettbewerb befeuert, der mit dem interkantonalen Finanzausgleich wieder ausbalanciert wird.
Der Umgang mit Schweizern ist einfach. Ein paar Regeln gilt es zu beachten: Nicht zu forsch! Selbst in Restaurants und Geschäften sagt der Schweizer »Ich hätte gerne dies und das«, »Dürfte ich noch dies und das« – und bedankt sich danach sogar dafür, dass er bezahlen darf. Und beim Rausgehen »en Schöne« nicht vergessen, einen schönen Tag dann noch. Der Schweizer hat wenig Verständnis für Kritik an diesen Umgangsformen. »Dann bleib’ doch zu Hause, wenn’s dir hier nicht passt.« Wie gesagt, das Ziel ist dasselbe, nur der Ton dahinter ein anderer.
Apropos Ton: Der Schweizer zählt sich zum deutschen, französischen beziehungsweise italienischen Sprachraum – welchem sich die Rätoromanen zugehörig fühlen, ist unklar. Mit den dialektalen Unterschieden natürlich, die es zwischen Schweizerdeutsch und Hochdeutsch, zwischen dem »Français Fédéral« und dem Französisch der Franzosen gibt. Was das Schweizerdeutsche betrifft: Nicht darüber lustig machen. Ein angehängtes -li macht noch keine Mundart, besonders allergisch sind die Reaktionen auf »Fränkli«, ein Wort, das hier keiner benutzt, auch in der Schweiz geht es um Kohle und »Stutz« – und wenn jemand gerade kein »Münz« hat, so meint er einen Betrag mit mehreren Nullen vor dem Komma.
Die Schweiz war ein klassisches Auswandererland, das Jammern auf hohem Niveau ist eine Folge des wirtschaftlichen Aufschwungs des letzten Jahrhunderts. Heute ist die Schweiz ein Einwanderungsland, was reaktionäre politische Kreise natürlich verhindern wollen. Man darf hoffen, dass sie sich nicht durchsetzen. Gräbt man ein bisschen tiefer in den Familiengeschichten, muss man oft nur wenige Generationen zurückgehen, um ausländische Wurzeln zu finden. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft – »Nati« – erreicht nur deshalb ein gewisses Niveau, weil sie zu großen Teilen aus Spielern mit Migrationshintergrund besteht.
Der Schweizer ist selbstbewusst, manchmal auch aus Trotz und genährt von einem pathologischen Minderwertigkeitsgefühl, selten nachtragend. Er kann auch selbstironisch sein, aber das darf nur er. Fortschrittlich ist er ebenfalls, obwohl »Swissness« in den letzten Jahren einen ungewöhnlichen Boom erlebte, was man auch als Backlash bezeichnen könnte, und in einer Folklore mündete, die etwa bewirkte, dass der Nationalsport Schwingen plötzlich wieder für breite, auch jüngere Massen interessant wurde – sicher als Zuschauer, aber auch als Jödeler und Bödeler. Dass die Schweiz Wilhelm Tell den Dänen verdankt und einem Deutschen, der daraus ein taugliches Stück gemacht hat, gehört zum kollektiven Passivwissen.
Die Schweiz in Zitaten
»Das Land, in dem die Ausnahme die Regel ist.«
Manfred Rommel (1928–2013), deutscher Politiker, 1974–96 Oberbürgermeister Stuttgart
»Wo sich Fuchs und Nerz gute Nacht sagen.«
Friedrich Küppersbusch (*1961), deutscher Journalist und TV-Moderator
»In der Schweiz ist übrigens alles schöner und besser.«
Adolf Muschg (*1934), Schweizer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
»Wenn Sie einen Schweizer Bankier aus dem Fenster springen sehen, springen Sie hinterher. Es gibt bestimmt etwas zu verdienen.«
Voltaire (1694–1778), französischer Philosoph und Schriftsteller
»Als Schweizer geboren zu werden, ist ein großes Glück. Es ist auch schön, als Schweizer zu sterben. Aber was tut man dazwischen?«
Alexander Roda Roda (1872–1945), Schriftsteller und Kabarettist
»Auch mir fällt es schwer, einen möglichen Untergang der Schweiz nicht als Weltuntergang zu sehen. Nur die Vernunft macht mich darauf aufmerksam, dass die Welt größer ist.«
Peter Bichsel (*1935), Schweizer Schriftsteller
»Die Schweizer sind unheimlich schlagfertig, wenn man ihnen genug Zeit dafür lässt.«
Markus M. Ronner (*1938), Schweizer Theologe, Publizist und Journalist
»Jeder Schweizer trägt seine Gletscher in sich.«
André Gide (1869–1951), französischer Schriftsteller und Nobelpreisträger
»La Suisse n’ existe pas!«
Ben Vautier (*1935), Künstler
»La Suisse existe!«
Adolf Ogi (*1942), Schweizer Politiker und Altbundesrat
»Wäre die Schweiz flach wie ein Pfannkuchen, wäre sie größer als Preußen.«
Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), deutscher Dichter
»Wilhelm Tell ist noch immer der einzige Schweizer, den die ganze Welt kennt.«
Friedrich Dürrenmatt (1921–1990), Schweizer Schriftsteller, Dramatiker und Maler
»Sie beschäftigen sich in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit mit Kühemelken, Käsemachen, Keuschheit und Jodeln.«
Friedrich Engels (1820–1895), deutscher Philosoph
»Im Ausland werden Sie gefragt: Haben Sie gut geschlafen? – In der Schweiz: Haben Sie etwas aus der Mini-Bar gehabt?«
Kaspar Villiger (*1941), Schweizer Unternehmer und Politiker
»Es gibt Ausländer, die ein Deutsch ohne jeglichen Akzent sprechen; das sind Glücksfälle. Und dann gibt es Ausländer, die einen Akzent ohne jegliches Deutsch sprechen; das sind Schweizer.«
Raymond Broger (1916–1980), Schweizer Politiker und Landamtmann von Appenzell Innerrhoden
Alle Schweizer sind viersprachig, fließend
Die Schweiz hat vier Landessprachen – Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch (erst seit 1938) – und drei Amtssprachen, zu denen Rätoromanisch nur im Verkehr mit Rätoromanen dazukommt. Dabei bilden die Rätoromanen die mit Abstand kleinste Sprachgruppe, die sich in mehrere Dialekte aufsplittet. Rätoromanisch sprechen Skilehrer, wenn sie von ihren unsicher auf zwei Latten schlotternden, dafür umso teurer eingekleideten Anfängern nicht verstanden werden wollen. (Die Skischüler unter sich sprechen Russisch.) Rätoromanisch lernen Zürcher, die nach Graubünden ziehen – die sogenannten Züzis – und sich damit dauerhaft jede Integration in die dörfliche Bergwelt verbauen. Die Bündner heißen in der Restschweiz nicht umsonst »Steinbock-Tschinggen« (Tschingg = Schimpfwort für Italiener), und das ist noch eine freundliche Bezeichnung.
Die Mehrheit der Schweizer spricht Deutsch, Schweizerdeutsch, wobei sich auch dies in unzählige, mehr oder weniger beliebte Dialekte aufteilt. Beliebt ist Berndeutsch, Bündnerdeutsch (nicht zu verwechseln mit Rätoromanisch). Darüber hinaus gibt es auch noch das schwer verständliche Walliserdeutsch und die Sprachen der Innerschweiz, die man jedoch selten hört. Verhasst sind alle Ostschweizer Dialekte, die Zürcher bekommen Ohrensausen, wenn sie einem Basler zuhören, Basler hören Zürchern prinzipiell nicht zu. Die sogenannte Mundart wird auch geschrieben, durchaus mit literarischem Erfolg, hauptsächlich aber in SMS von Jugendlichen. Auch Mundartlieder haben großen Erfolg. Hier ist Berndeutsch klar die leading language.
Die Schriftsprache ist Hochdeutsch, leicht dialektal eingefärbt. Die meisten Deutschschweizer können kein Hochdeutsch sprechen, obwohl sie reflexartig im Gespräch mit Deutschen in diese Sprache wechseln. (Dieser Reflex ist jedoch als Folge der in Massen einwandernden Deutschen am Abflauen.) Am schlechtesten Hochdeutsch sprechen Parlamentarier und Bundesräte. Deutsche, die Mundart sprechen, mag man nicht. Das offizielle Schweizerdeutsche Wörterbuch heißt Idiotikon.
Im Ausland gibt sich der Schweizer gern polyglott, mit einer Ausnahme: Hören Herr und Frau Schweizer im Urlaub Schweizerdeutsch, werden sie sich nur noch in Zeichensprache unterhalten und schnellstmöglich auf den sicheren Hotelbalkon flüchten. Man will in den Ferien ja nicht ständig unter Seinesgleichen sein.
Im Tessin wird Italienisch gesprochen. Die Situation ist ähnlich der des Rätoromanischen, mit dem Unterschied, dass die Zuzüger nicht mal mehr Italienisch lernen, alle Tessiner sowieso in Zürich studiert haben, es sonst aber kaum mehr zu hören ist. Das Tessin ist so schön, da kann man nicht mal mehr über das Wetter sprechen. Eine Ausnahme gibt es auch hier: Es gibt Fernseh- und Radioprogramme in Italienisch.
Bleibt das Französisch, das als Français Fédéral ein ähnliches Verhältnis zum Französisch der Franzosen pflegt, wie das schweizerische Hochdeutsch zur deutschen Schriftsprache, aber immerhin Teil der Francophonie ist. Deutschschweizer und Westschweizer sprechen miteinander bevorzugt Englisch. In Institutionen gilt die Regel, dass jeder seine Muttersprache spricht und hofft, die anderen mögen das verstehen oder zumindest so tun als ob.
Im Umgang mit den zugewanderten Menschen aus anderen Sprachräumen setzt ein ähnlicher Reflex wie gegenüber Deutschen ein. Der Schweizer spricht spontan ein absolut fehlerfreies Rudimentärdeutsch, bei dem die Verben nicht konjugiert werden, auch wenn das Gegenüber zwar ursprünglich aus Sri Lanka kommt, aber seit zwanzig Jahren in der Schweiz arbeitet – vornehmlich in der Küche beim Röstizubereiten.
Die vier Landessprachen sind unter Druck. Während gerade mal 35000 Personen Rätoromanisch als Hauptsprache angeben, sind es über 100000, die Serbisch bzw. Kroatisch sprechen (darunter bestimmt auch welche, die sich in Zürich erfolgreich eine Existenz aufgebaut haben und nun im Unterengadin Rätoromanischkurse belegen). Englisch ist im Vormarsch.
Kein anständiges Schweizer Unternehmen hat es in den vergangenen Jahren versäumt, sich einen englischen Namen zuzulegen. Dieser Trend ist allerdings teilweise wieder rückläufig. Der Flughafen in Zürich etwa heißt wieder Flughafen Zürich, nachdem die Bezeichnung Unique bis 2009 zu mehreren riskanten Flugmanövern geführt hat, aus Angst, man habe sich versehentlich nach Bayern verflogen. Die Verirrungen gab es auch in der helvetischen Variante: Idée Suisse heißt nun wieder Schweizer Radio und Fernsehen.
Prozentuale Verteilung der von Personen schweizerischer Nationalität gesprochenen Hauptsprachen, 1950–2000
Deutsch
74,2
74,4
74,5
73,5
73,4
72,5
Französisch
20,6
20,2
20,1
20,1
20,5
21,0
Italienisch
4,0
4,1
4,0
4,5
4,1
4,3
Rätoromanisch
1,1
1,0
1,0
0,9
0,7
0,6
Nichtlandessprachen
0,2
0,3
0,4
1,0
1,3
1,6
Anteil der 15 häufigsten Nichtlandessprachen in der Wohnbevölkerung (in % und absolut), 2000
Serbisch/Kroatisch
1,4
103350
Albanisch
1,3
94937
Portugiesisch
1,2
89527
Spanisch
1,1
77506
Englisch
1,0
73425
Türkisch
0,6
44523
Tamil
0,3
21816
Arabisch
0,2
14345
Niederländisch
0,2
11840
Russisch
0,1
9003
Chinesisch
0,1
8279
Thai
0,1
7569
Kurdisch
0,1
7531
Mazedonisch
0,1
6415
Sprachliche Minderheiten
Der Bund erkennt Rätoromanisch und Italienisch als sprachliche Minderheiten an. Dazu kommen als »nicht territoriale Minderheitensprachen« das Jenische und das Jiddische. Wobei es auch zu innerkantonalen Minderheiten kommen kann, wie etwa beim deutschsprachigen Bosco Gurin im Kanton Tessin.
Einführung in das Schweizerdeutsche
Schweizerdeutsch, das es so nicht gibt, denn jeder Kanton hat seine Eigenheiten, ist ein alemannischer Dialekt. Die Betonung liegt häufig auf der ersten Silbe, so heißt der Bankenplatz an der Zürcher Bahnhofstraße im Dialekt »Pàradeplatz« und nicht »Paràdeplatz«, und auch beim Bellevue liegt der Akzent auf dem Schönen und nicht auf der Sicht. Der Infinitiv wird im Schweizerdeutschen mit dem Hilfsverb »go« gebildet – »Ich gang go velofaare« würde in der integralen Übersetzung heißen »Ich gehe Fahrradfahren gehen«. Es gibt auch den nicht netten Begriff »Gango«, das ist der, den man etwas holen schickt. Ein auffälliges Merkmal ist das Fehlen des Futurs, auch wenn sich die Verwendung von »werden« immer mehr einschleicht. Ob das ein Zeichen der Entwicklung ist und in welche Richtung sie geht, muss dahingestellt bleiben. Ob nun etwas »scho guet chunnt« (gut kommt) oder »scho wird« (schon werden wird), ist ein minimaler Unterschied, der passive Charakter ist beiden Formulierungen inne. Der Schweizer bildet die Zukunft mit Hilfswörtern wie »dann« oder »morgen«. »Morn gaani go poschte« soll heißen »Morgen werde ich einkaufen gehen« und nicht etwa, Neuigkeiten auf Facebook posten. Auch bei der Vergangenheit sind die Möglichkeiten eingeschränkt, es gibt nur das Perfekt. »Ich bin z’ Basel gsi« kann bedeuten »Ich bin in Basel gewesen« oder »Ich war in Basel«. Vom Plusquamperfekt wollen wir gar nicht erst reden.
Diese 15 Vokabeln müssen Sie verstehen
Grüezi (»Grüße Sie«, allgemein verbreitete Begrüßung, das E wird ausgesprochen)