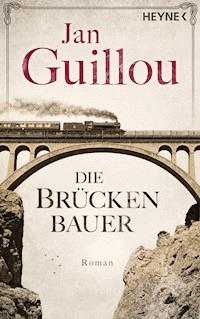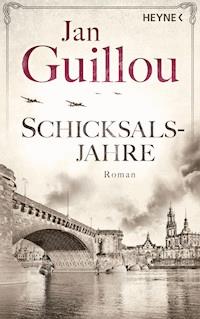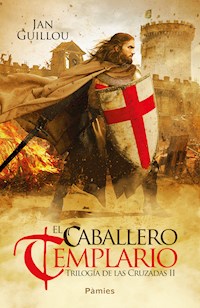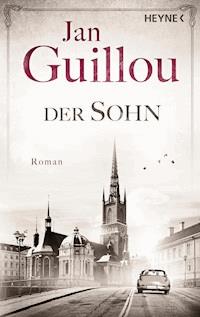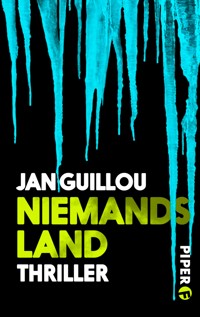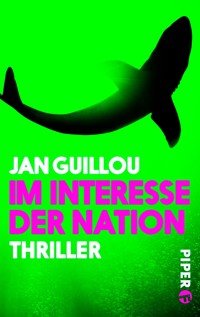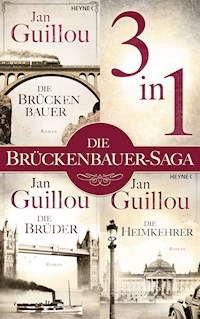9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Brückenbauer-Serie
- Sprache: Deutsch
Das große Jahrhundert-Epos geht weiter
In den politischen Wirren des Zweiten Weltkriegs gerät auch die Familie Lauritzen mehr und mehr in Bedrängnis. Während der Vater sich politisch zurückhält, sind seine beiden Töchter im Widerstand aktiv. Vor allem seine älteste Tochter Johanne, die zunächst als Kurier für den norwegischen Widerstand eingesetzt wird, findet im politischen Kampf ihre Berufung. Als sie bei einer Sabotage-Aktion lebensgefährlich verletzt wird und nur eine Notoperation sie retten kann, wechselt sie ihre Betätigung und schmuggelt fortan norwegische Widerstandskämpfer über die Grenze nach Schweden. Auch hier zeigt sie großes Geschick und wird schließlich von einer Spezialeinheit der britischen Armee rekrutiert. Damit gerät sie in die trügerische Welt der Geheimdienste, in der Angst, Gefahr und Bedrohung bald zum ständigen Begleiter werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Jan Guillou
DIE
SCHWESTERN
Roman
Aus dem Schwedischen von Lotta Rüegger
und Holger Wolandt
Zum Buch
In den politischen Wirren des Zweiten Weltkriegs gerät auch die Familie Lauritzen mehr und mehr in Bedrängnis. Während der Vater sich politisch zurückhält, sind seine beiden Töchter im Widerstand aktiv. Vor allem seine älteste Tochter Johanne, die zunächst als Kurier für den norwegischen Widerstand eingesetzt wird, findet im politischen Kampf ihre Berufung. Als sie bei einer Sabotage-Aktion lebensgefährlich verletzt wird und nur eine Notoperation sie retten kann, wechselt sie ihre Betätigung und schmuggelt fortan norwegische Widerstandskämpfer über die Grenze nach Schweden. Auch hier zeigt sie großes Geschick und wird schließlich von einer Spezialeinheit der britischen Armee rekrutiert. Damit gerät sie in die trügerische Welt der Geheimdienste, in der Angst, Gefahr und Bedrohung bald zum ständigen Begleiter werden.
Zum Autor
Jan Guillou wurde 1944 im schwedischen Södertälje geboren und ist einer der prominentesten Autoren seines Landes. Seine preisgekrönten Kriminalromane um den Helden Coq Rouge erreichten Millionenauflagen. Auch mit seiner historischen Romansaga um den Kreuzritter Arn gelang ihm ein Millionenseller, die Verfilmungen zählen in Schweden zu den erfolgreichsten aller Zeiten. Heute lebt Jan Guillou in Stockholm.
1941
I
GEBRANNTES KIND
Eine der gefalteten Decken wies das für Westnorwegen so typische rot-weiße Muster auf. Verschwommene Bilder vom Operationstisch, der autoritäre Blick der Ärztin über dem weißen Mundschutz.
Es war kein normaler OP-Tisch, sondern der große Esstisch. Die Ärztin: ihre Mutter. Vollkommen ungeordnet vereinten sich die Bilder zu Unbegreiflichem, zu nichts oder manchmal zu Träumen mit einer diffusen Handlung, wie Wochenschauen, aber ruhiger und ohne die schmetternde Musik.
Der warme Sand unten am Steg, die glitzernde Sonne, weiße Segel, die am Startkobben oder Telegrafholmen vorbeiglitten.
Achtung! Ausweise!
Die deutschen Kontrolleure rissen die Abteiltür mit großem Getöse auf. Aber lieber noch die Deutschen als die Schläger der Nasjonal Samling in ihren lächerlichen Uniformen.
Die SS-Männer waren ganz unerwartet in Hønefoss zugestiegen. Wobei diese Leute die geringsten Schwierigkeiten bereiteten. Wer sie in ihrer eigenen Sprache ansprach und sich mit ihren Diensträngen auskannte, konnte sie normalerweise mühelos entwaffnen.
Im Koffer oben im Gepäcknetz lagen etwa 20 000 norwegische Kronen, glatt gebügelte, dicht gebündelte, im Futter des Deckels versteckte Scheine. Die Kurierpost trug sie auf der Haut. An ihren Reisedokumenten war nichts auszusetzen, sie waren nicht einmal gefälscht. Die Angst darum hatte sie sich abgewöhnt, denn ihre Deutschkenntnisse schützten sie wie ein Panzer.
Der SS-Obersturmführer, ein ansehnlicher junger Mann, schien einem deutschen Propagandaplakat entsprungen. Er teilte ihr mit, wie gern er sie bis nach Bergen begleiten würde, aber leider müsse er bereits in Geilo aussteigen. Vermutlich war seine Vertraulichkeit auf ihr gefälliges Deutsch zurückzuführen. Das Gepäck der drei norwegischen Fahrgäste wurde auf seine Anweisung hin gründlich durchsucht, ihres jedoch nicht. Zum Abschied verzichtete er auf den Deutschen Gruß und salutierte stattdessen.
Eine Explosion! Es konnte nur eine Explosion gewesen sein. Das eine Knie schmerzte, nachdem die Hand eines Riesen sie mehrere Meter durch die Luft geschleudert hatte. Brandgeruch in der Nase, eine Wange auf den Schotter des Bahnwalls gepresst. Sie war blind und hörte nichts außer einem schrillen Ton. Nur Gerüche nahm sie wahr.
»Und die Beerdigung ging vorüber wie ein Traum in Schwarz.«
Diese Worte hatten irgendwie mit Karin zu tun. Karin hatte sich das Leben genommen. Fast zur gleichen Zeit wie Virginia. Astarte, ein schlechter Titel. Der Roman müsste, wie ursprünglich geplant, »Die Schaufensterpuppe« heißen. Das war sachlicher. Schließlich sollte damals alles so sachlich sein.
Jemand kümmerte sich um ihre Wunden. Kaltes Wasser, verdünnter Wundalkohol linderte die brennende Hitze. Jemand hob liebevoll ihren Kopf und schob ihr ein paar Tabletten in den Mund, hielt ihr ein Glas Wasser an die Lippen. Dann wurde wieder alles traumlos schwarz. Die Zeit existierte nicht.
Drei Tage kämpfte sie mit dem Fieber. So hieß es zumindest. Es hätte genauso gut eine Woche oder eine Ewigkeit sein können. Ihr Kopf war vollkommen klar, obwohl ihre Erinnerung die eine oder andere Lücke aufwies.
Sie lag alleine im Seglerhäuschen, das in eine private Krankenstube umfunktioniert worden war. Alles mit Ausnahme ihres Bettes war aus dem Raum entfernt worden. Der durchdringende Geruch nach Schmierseife lag in der Luft, die Fenster standen offen, und die weißen Gardinen bewegten sich im Sonnenlicht. Die Möwen kreischten, als wäre es ein ganz normaler Sommertag in den Schären. Neben dem Bett stand ein improvisiertes Infusionsgestell, Brandopfer brauchten viel Flüssigkeit.
Zug Nr. 4352, Waggon NSB 40256, von der Lokomotive aus gerechnet der 38. Die folgenden 21 Waggons waren mit Munition beladen.
Der Plan hatte verführerisch perfekt gewirkt. Die Dokumentation des Nachrichtendienstes ebenfalls, nichts hätte schiefgehen dürfen.
Frachter mit Munition, Pulver und Artilleriegranaten trafen aus Deutschland in Arendal ein. Dort wurde alles für den Weitertransport nach Finnland auf die Bahn umgeladen. Auf den deutschen Frachtzetteln wurde der Inhalt vage als Verbandsmaterial angegeben. Diese Information stammte ursprünglich von der Milorg, dem militärischen Zweig der Heimatfront, aber die Engländer hatten Wind von der Sache bekommen und der SOE die Verantwortung übertragen.
Ein schwedischer Milorg-Informant am Grenzbahnhof Charlottenberg berichtete, das Schmieröl norwegischer Züge sei so lausig, dass die Radlager bis zur Entflammbarkeit heiß liefen. Daher inspizierten die Schweden in Charlottenberg die Radlager aller norwegischen Waggons und erneuerten gemäß Regierungsverfügung das Schmieröl. Schließlich fuhren die Züge durch Schweden, und es oblag den Schweden, dafür zu sorgen, dass die Züge kein Feuer fingen, zumindest nicht auf schwedischem Territorium.
Dieser augenscheinlich so triviale Bericht aus Charlottenberg bildete die Grundlage des gesamten Planes. Über Malcolm ließ sich einiges sagen. In vielerlei Hinsicht entsprach er voll und ganz Vaters als auch Onkel Oscars Vorstellung eines typischen Engländers. Aber trotzdem besaß er Fantasie.
Die Idee, die er vorstellte, wirkte ebenso einfach wie genial. Die Radlager des Zuges Nr. 4352 wurden in Charlottenberg kontrolliert und bei Bedarf geölt, und zwar am helllichten Tag und im Beisein von Eisenbahninspektoren und Wachmannschaften des Militärs.
Von Charlottenberg ging die Fracht nach Hallsberg weiter und wurde dort an einen Zug Richtung Norden mit der Abfahrtszeit 1.45 Uhr angehängt. Der Aufenthalt in Hallsberg betrug knappe zwei Stunden.
Dort, während der einzigen halbwegs dunklen Stunden der Sommernacht, bot sich die Gelegenheit. Der Auftrag vom Team Alpha lautete, sich im Schutz der Dunkelheit an den Waggon NSB 40256 anzuschleichen und das Schmieröl der Radlager durch Sand zu ersetzen. Danach mussten nur noch Zündschnüre, notfalls mithilfe einiger rasch gebohrter Löcher, durch die hölzernen Waggonböden verlegt werden, damit die Plomben an den Waggontüren intakt blieben.
Die Erwärmung der Radlager reichte völlig, um die Zündschnüre zur Pulver- und Munitionsladung in Brand zu setzen. Anschließend gab es nur eine Erklärung für die Katastrophe: Die Radlager hatten sich überhitzt. Irgendwo zwischen Hallsberg und Krylbo musste die Fracht explodieren, mitten auf dem Land, damit keine Menschenleben gefährdet waren.
Der Plan schien perfekt. Die deutschen Truppen in Finnland würden einundzwanzig Munitionswaggons verlieren. Nichts könne schiefgehen, versicherte Malcolm. Alle glaubten ihm.
Der Auftrag des Teams Beta bestand darin, das Gelingen der Aktion unter dem üblichen Deckmantel, nämlich in einem Lastwagen mit einem Blauen Stern, eventuell mit einem Pferd im einsehbaren Teil des Laderaums, zu kontrollieren. Vermutlich beschränkte sich ihr Einsatz darauf festzustellen, dass der Zug 4352 Krylbo aufgrund einer unerklärlichen Explosion nicht erreicht hatte. Dementsprechende Berichte würden umgehend per Telefon in Krylbo eintreffen. Des Weiteren musste sich Team Beta unter irgendeinem Vorwand Zutritt zum Bahnhofsgebäude verschaffen, um in Erfahrung zu bringen, was genau vorgefallen war.
Schlimmstenfalls, falls dennoch etwas schiefging, musste Team Beta die geplante Aktion auf dem Krylboer Bahnhof zu Ende führen, da die Methode der Radlagermanipulation nicht auffliegen durfte, damit weitere Munitionszüge diese Strecke benutzten.
So weit war ihr Gedächtnis kristallklar. Malcolm verabschiedete sich mit einem Scherz von ihr, und die beiden Gruppen gaben sich mit den üblichen Floskeln die Hände, als sie sich an diesem sonnigen und heißen Nachmittag trennten.
Danach wurde ihre Erinnerung verschwommener. Als sich der mit einer Plane abgedeckte Lastwagen Krylbo näherte, war bereits der helle, frühe Morgen angebrochen. Sie parkten jenseits der Gleise gegenüber vom Bahnhof. Es kam keine Nervosität auf, als sich herausstellte, dass der Zug 4352 mit Verspätung eintreffen würde, im Gegenteil. Nach einer Viertelstunde herrschte vollkommene Gelassenheit. Die Anweisung lautete, eine Stunde abzuwarten, ehe sie im Bahnhofsgebäude Nachforschungen anstellten.
Ungefähr von diesem Zeitpunkt an setzte Johannes Erinnerung aus und ging in unzusammenhängende Bilder über. Leere Gleise, eine Rangierlok, die Waggons zusammenschob, um sie mit dem einfahrenden Schnellzug von Jämtland nach Stockholm zusammenzukoppeln. Ein friedlicher, früher Morgen und trotz Hitzewelle noch recht kühl.
Danach nichts mehr. Doch, eine Sache. Das schiere Entsetzen, mit dem sie den Zug 4352 mit 23 Minuten Verspätung langsam in den Bahnhof einfahren sahen. Dort prallte ihre Erinnerung gegen eine Wand. Bis dahin Klarheit, dann nichts mehr.
Sie war offenbar eingeschlafen, als wollte sie auf diese Weise die verlorene Erinnerung im Traum zurückholen.
Schnee auf dem Høyefjell, und das Ende Juni. Zum ersten Mal verspürte sie beim Anlegen der Ole Bull in Tyssebotn Angst. Vier uniformierte Mitglieder der Nasjonal Samling hatten sie während der Überfahrt angestarrt, getuschelt und auf sie gezeigt. Sie war die Tasche mit dem Geld nicht losgeworden. Und NS-Mitglieder besaßen das Recht oder nahmen es sich heraus, jede beliebige Person, jederzeit, mit oder ohne Grund zu durchsuchen oder festzunehmen.
Der Mann, der sie am Hauptbahnhof Bergen ansprach, verwendete nicht die korrekte Losung:
»Ich soll von Ola Nordmann aus Finse grüßen«, hätte er sagen müssen.
Worauf sie geantwortet hätte: »Danke, ich kenne ihn sehr gut.« Daraufhin hätte der Mann seine Tasche neben ihr abgestellt, etwas über das Wetter gesagt, sich eine Zigarette angezündet und wäre anschließend mit ihrer Tasche weggegangen.
Er hatte jedoch nur gesagt: »Ich soll von Ola Nordmann grüßen.«
Sie hatte ihn vermutlich verblüfft angesehen, selbst die kleinste Abweichung in einer vereinbarten Parole stellte eine Todsünde dar.
»Das ist eine seltsame Begrüßung«, erwiderte sie.
»Darf ich Ihnen wenigstens eine Zigarette anbieten?«, versuchte der Mann seinen Fehler auszubügeln.
»Keinesfalls!«, erwiderte Johanne verächtlich und eilte mit klappernden Absätzen davon.
Vor dem westlichen Ausgang der Haupthalle verlangsamte sie ihre Schritte und sah sich rasch um. Der Gestapomann, oder vielleicht war es auch ein Mitarbeiter der Staatspolizei, trat auf eine andere junge Frau zu, die ebenso erstaunt auf seine Botschaft reagierte.
Ihr blieb nur eines übrig: ruhig den Bahnhof zu verlassen, keinesfalls zu rennen, sich nicht umzusehen. Und die Fähre nach Tyssebotn zu nehmen.
Folter. Kaum jemand widerstand der Folter länger als 48 Stunden. Diese 48 Stunden musste man durchhalten, um den Kameraden einen Vorsprung zu ermöglichen. Das hatten sie in der Grundausbildung gelernt. Wie auch Abweichungen in die Losung einzubauen, um die Kameraden zu warnen. Jemand war gefoltert worden, jemand hatte preisgegeben, dass von Ola Nordmann gegrüßt werden sollte, das Detail »aus Finse« jedoch ausgelassen und das Detail mit der Zigarette hinzugefügt.
So musste es sein. Und wenn nicht, hatte sie sich doch nur strikt an die Vorschriften gehalten, an das, was man ihr beigebracht hatte. Ihre Tasche kam ihr auf dem Weg zur Anlegestelle bleischwer vor. Ob sie immer noch Deutscher Steg hieß? Eigentlich bestand für die Besatzer kein Grund, den Namen zu ändern.
Und dann an Bord der Ole Bull dieser unbehagliche Abschaum in NS-Uniform. Vier »Hirdmänner« oder »Hilfspolizisten«. Sie blieben an Bord, eine Landungsbrücke nach der anderen, während sich die Fähre zusehends leerte. In Tyssebotn waren es mit ihr nur noch vier Passagiere. Und die Hirdmänner.
Johanne erwog, an Bord zu bleiben, abzuwarten, bis diese von Bord gingen, und notfalls nach Bergen zurückzufahren. Nein, das wäre dumm. Nach Tyssebotn führte sie immerhin ein triftiger Grund. Als sich die vier Männer nach ihr erhoben und näher kamen, erstarrte sie vor Schreck. Hinter der Gangway zischte einer von ihnen ihr ins Ohr, er wisse, was junge Damen wie sie wirklich bräuchten. Seine Kameraden grinsten. Johanne fiel ein Stein vom Herzen. Sie hatte kein Misstrauen erweckt, sondern war in ihren Augen einfach nur ein Stück Fleisch. Was für Idioten!
Am Fähranleger unterhielten sie überdies eine kleine »Station« mit einer Sonnenkreuzfahne. Offenbar waren sie die einzigen Vertreter der Besatzungsmacht auf der Osterøya und mussten vier ungeduldig wartende Kameraden ablösen.
Großmutter hatte immer noch sehr schönes, aber ergrautes Haar, immerhin war sie bereits über achtzig. Von dem Kupferrot war nichts mehr zu sehen. Straff über die Schläfen gekämmt, fiel es in einem kräftigen Zopf bis auf die Hüfte herab. Im Gegensatz zu den meisten älteren Inselbewohnerinnen trug Großmutter keine Kopfbedeckung, was möglicherweise ihrer ganz eigenen Ästhetik zuzuschreiben war. Sie hatte einen ihrer selbst entworfenen Pullover an, dessen verschiedene Blautöne ihr Haar und ihren klaren eisblauen Blick bewusst untermalten.
Auf Frøynes wurde die Großmutter mit einem Knicks und einer festen, wortlosen Umarmung begrüßt.
Sie wohnte nach wie vor in dem Langhaus, das Vater im Wikingerstil hatte errichten lassen. Der Drachenkopf am westlichen Ende des Dachfirstes wirkte von Wind und Wetter recht mitgenommen.
Johanne musste ihrer Großmutter reinen Wein einschenken. Wie immer hatten sie schweigend gegessen. Dann nahmen sie vor dem großen offenen Kamin Platz. Pflichtschuldig berichtete Johanne von der Familie in Saltsjöbaden. Es gab nicht viel Neues, da ihr letzter Besuch nur vierzehn Tage zurücklag. Johanne richtete von allen Grüße aus und lobte den Klippfisch und die Hammelkeule. Das Kaminfeuer knisterte und knallte ab und zu, da vor allem Tannenholz aus Frøynes verheizt wurde. Großmutter Maren Kristine schwieg wie immer. Nie kam ihr ein unnötiges Wort über die Lippen. Vater hatte manches Mal, unbewusst oder auch bewusst, versucht, ihre Erzählweise im Stile einer Wikingersage nachzuahmen.
»Liebste Großmutter, ich habe eine sehr ernste Bitte«, begann Johanne, verlor dann aber den Faden.
Lange Stille.
»Schwere Zeiten sind angebrochen. Schwer für das Land, schwer für die Norweger. Eine bessere Gelegenheit für ein ernstes Gespräch ist kaum vorstellbar«, sagte die Großmutter schließlich gewohnt lakonisch.
Und wieder langes Schweigen. Der richtige Zeitpunkt, zur Sache zu kommen.
»Ich muss etwas gestehen … nein, ich muss Euch, liebe Großmutter, um einen Gefallen bitten. Und zwar keinen beliebigen Gefallen, sondern um einen lebensgefährlichen.«
Nochmals verlor Johanne den Faden. Sie hatte sich verheddert und wünschte, sie hätte sich etwas behutsamer ausgedrückt. Außerdem wusste man nie so recht, welche Ansichten Großmutters strenger Gott in moralischen Fragen vertrat. Ob Nasjonal Samling oder Heimatfront, wem Seine Sympathien gehörten, erschloss sich Nichtgläubigen nicht so ohne Weiteres.
Stille, das Feuer knisterte. Die Miene der Großmutter war unergründlich. Ein Außenstehender hätte ihr Schweigen für Zögern oder Missbilligung halten können, vermutlich aber sann sie über eine kurze, prägnante Formulierung nach.
»Ich wandere bereits im Tal der Todesschatten. Ich hatte ein gutes Leben. Es würde mich schmerzen, wenn unser Beisammensein nicht einer guten Sache gälte.«
Johanne ließ sich mit ihrer Erklärung Zeit, was durchaus gestattet war. Ihre Großmutter erwartete durchdachte Erläuterungen.
»Dort drüben neben der Tür, liebste Großmutter«, begann Johanne und holte anschließend tief Luft, um ohne Pause weitersprechen zu können, »befindet sich ein loses Bodenbrett. Darunter möchte ich Geld und Dokumente verstecken. Ein Mann oder eine Frau von der Heimatfront wird in einer, spätestens aber zwei Wochen nach Frøynes kommen und folgende Worte sagen: ›Ich soll von jemandem grüßen, der nie auf der Ran, aber auf der Beduin gesegelt ist.‹ Genau diese Worte und keine anderen und genau in dieser Reihenfolge. Darauf sollt Ihr antworten: ›Ich bin auf der Ran gesegelt, aber nie auf der Beduin.‹ Der Kurier sagt daraufhin: ›Es ist gut, mit Freunden Norwegens zu segeln.‹ Das ist alles. Diese Person wird das Geld und die Dokumente unter dem Brett abholen. Ich kann es Euch aufschreiben, Großmutter, denn ein Zettel verschwindet schnell im offenen Kamin, falls die falschen Männer an die Tür klopfen.«
Nach dieser Erläuterung war ihr schwindelig. Jetzt hatte sie ihre eigene Großmutter, eine über Achtzigjährige, in die verbotenen Tätigkeiten der Heimatfront hineingezogen.
Dass die Antwort auf sich warten ließ, brauchte sie nicht zu beunruhigen. Großmutters Miene war wie immer unergründlich, als sie in das verglimmende Feuer starrte.
Als sie schließlich zu sprechen begann, lächelte sie, was nur sehr selten geschah.
»Dein Vertrauen ehrt mich. Ich bin stolz auf dich. Für Worte, die über Leben oder Tod entscheiden, benötigt das Gedächtnis keinen Zettel.«
Noch ungewöhnlicher war, dass sie sich vorbeugte und Johanne wortlos mit ihrer schmalen, knochigen Hand über den Arm strich. Ihren nackten Unterarm rauf und runter, zweifellos eine erotische Annäherung, vollkommen ungewohnt: Das konnte nur ein Albtraum sein.
Tante Christa strich ihr über den Arm, um sie zu wecken, und Johanne erwachte von ihrem eigenen Schrei.
»Ruhig, ruhig, ich bin’s doch bloß, hab keine Angst, du bist in Sandhamn, du bist zu Hause«, tröstete Tante Christa sie. »Ingeborg meinte, es würde dir guttun, ein wenig draußen zu sitzen. Ich könnte dir bei dieser Gelegenheit, wenn es dich nicht zu sehr anstrengt, auch gleich die Haare schneiden.«
»Entschuldige, der Traum war so realistisch.«
»Und wo warst du? Nein … warte! Vergiss meine Frage!«
»Es war weiter nichts dabei, ich war bei Großmutter auf Osterøya. Aber dann hat sie meinen Arm gestreichelt, so vertraulich, dass ich es mit der Angst bekommen habe. Und dabei warst es nur du, Tante Christa. Ich habe auf Norwegisch geträumt, aber nun ist alles in Ordnung!«
Sie lachten erleichtert. Tante Christa hatte bislang weder Schwedisch noch Norwegisch gelernt.
Die Infusionsflasche war verschwunden, und auf dem Nachttisch stand eine Wasserkaraffe. Vorsichtig schwang Johanne die Beine über die Bettkante und stellte sich hin. Erst schwankte sie leicht, dann aber verflog der Schwindel rasch.
Tante Christa platzierte sie resolut auf einem Gartenstuhl hinter dem Langhaus und legte Kämme und zwei Scheren auf den Tisch. Sie erklärte, es sei ihr ein Vergnügen, wieder einmal jemandem einen anständigen Haarschnitt im Stil der fidelen Zwanzigerjahre zu verpassen.
Johanne protestierte halbherzig. Sie hatte Fotos aus dieser Zeit gesehen. Damals hatten die Frauen wie flachbrüstige »Garçonnes« ausgesehen, die ihr zurechtgestutztes Haar kokett wie einen kleinen Helm auf dem Kopf trugen.
Aber sie hatte ohnehin keine Wahl. Auf der linken Seite waren ihre Haare vollkommen versengt, und zwischen dem Schorf schaute nur hier und da etwas roter Flaum hervor. Bis alles verheilt war, würden noch mehrere Wochen vergehen, und bis das Haar nachgewachsen war, mehrere Monate. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als wieder von vorne zu beginnen. Beidseitig gleich lang, das hatte die Frau Doktor verschrieben, und dazu in der nächsten Zeit noch viele Bäder im Salzwasser der Ostsee, und zwar ohne Bademütze.
»Wo ist Mutti? Ich habe sie seit meiner Ankunft nicht mehr gesehen. Wie bin ich denn überhaupt hierhergekommen?«
Tante Christa ließ die Schere sinken und sah aufrichtig erstaunt aus.
»Erinnerst du dich nicht?«
»Nein. Mit meinem Gedächtnis stimmt was nicht. Außerdem höre ich nur noch auf dem rechten Ohr.«
»Dein Trommelfell ist geplatzt, und es wird einige Wochen dauern, bis es verheilt. Erinnerst du dich denn überhaupt nicht daran, was geschehen ist?«
»Nur bruchstückhaft. Ich erinnere mich beispielsweise an den Vortag. Zumindest vermute ich, dass es der Vortag war. Wann bin ich überhaupt hier eingetroffen?«
»Am 20. Juli.«
»All right. Dann war es der Vortag, an den ich mich bis zu einem gewissen Punkt erinnere. Aber wie kam ich hierher?«
Tante Christa schnippelte eine Weile weiter, ehe sie antwortete.
»Fast ohnmächtig bist du am Ufer in Skärkarlshamn herumgewankt. Hans Olaf und Carl Lauritz sind dir entgegengerannt und haben dir nach Hause geholfen.«
»War ich ganz alleine zu Fuß unterwegs?«
»Ja, mit dunkler Sonnenbrille, einer Künstlerbaskenmütze und einem Halstuch.«
»Und dann?«
»Deine Mutti hat sich in Sekundenschnelle in eine Chirurgin mit magischen Fähigkeiten verwandelt und hat dich stundenlang auf dem Esstisch operiert.«
»Ja! An die rot-weiß gemusterten Decken erinnere ich mich.«
»Genau, wir haben dich auf ein paar gefaltete Decken gelegt.«
»Und dann? Ich war bewusstlos, lag im Fieber, hatte seltsame Träume. Aber wo war Mutti? Warum habe ich sie nicht gesehen?«
»Wir haben abwechselnd an deinem Bett gewacht. Du hast in deinen Kursen vermutlich einiges über Brandverletzungen gelernt.«
»Und wo ist Mutti jetzt?«
»Im Augenblick schläft sie. Bei dieser Hitze schläft sie viel.«
Die Unterhaltung kam zum Erliegen. Tante Christa konzentrierte sich auf den Haarschnitt und gab sich zumindest den Anschein, als wüsste sie, was sie tat.
Johanne war sich nicht sicher, ob sie das Gespräch fortsetzen sollte.
»Habe ich im Fieber gesprochen?«, fragte sie schließlich. »Habe ich Unsinn geredet?«
»Durchaus. Allerdings auf Englisch.«
Tante Christas Tonfall war nicht misszuverstehen. Sie betonte Englisch wie ihr Mann, Onkel Oscar, der alles Englische und alle Engländer hasste.
Tante Christa schnippelte und kämmte, und sie schwiegen ein Weilchen. Immer noch hingen viele Fragen in der Luft. Keine einfachen Fragen.
Nur das Klappern der Schere war zu hören. Rote Haarbüschel fielen in den Sand.
»Bericht wie folgt«, sagte Tante Christa schließlich mit dem manchmal recht übertrieben militärischen Tonfall ihres Mannes, den sie des Öfteren nachahmte.
Der sachliche Bericht lieferte auch unausgesprochene Informationen. Die Zeitungen hatten sich während der letzten Tage eingehend mit dem sogenannten Krylboer Knall beschäftigt, gingen aber davon aus, dass es sich um ein Unglück handelte. Von Sabotage war nicht die Rede. Es wurde über heiß gelaufene Räder und übermäßige Radlagerreibung als Brandursache gemutmaßt.
Aber man konnte schließlich nicht wissen, welche Ansichten der Zensur zum Opfer fielen. Oscar analysierte die Situation wie immer ohne den geringsten Zweifel. Eine Person, die sich am Tag nach der Krylboer Explosion halb ohnmächtig und mit schweren Brandverletzungen in Skärkarlshamn dahinschleppte, setzte lieber das eigene Leben aufs Spiel, als ein normales Krankenhaus aufzusuchen. Ergo hatte sich seine geliebte Nichte die Verletzungen bei einem Vorfall zugezogen, den die Behörden mit größter Strenge ahndeten. Am Tag nach der Krylboer Explosion, wie gesagt. Zu diesem Zeitpunkt hatte es keine andere Explosion gegeben. Die liebe Johanne riskierte also die Todesstrafe für sich selbst und lange Gefängnisstrafen wegen Beihilfe für die übrigen Familienmitglieder. Die Familie würde natürlich zusammenhalten. Aus der Denunziantengesellschaft war man 1935 ausgestiegen. So sah die Lage aus.
»Und Papi«, fragte sie, »was meinte der?«
»Das Übliche. Schwamm drüber. Du weißt schon.«
Die unausweichliche Frage hing weiterhin in der Luft.
Sollte sie sie einfach beantworten oder Tante Christa dazu zwingen, sie offen und direkt zu stellen?
Nur das Geräusch der Schere. Der Kopf fühlte sich allmählich kühl an. Eine kreischende Möwe segelte ganz dicht über das Grassodendach des Langhauses.
»Ja«, meinte Johanne schließlich. »Krylbo war beabsichtigt. Ich gehöre einer Abteilung der Heimatfront an, die mit der SOE, der Special Operations Executive, zusammenarbeitet. Nach dem 9. April war ich als Kurierin in Norwegen tätig, wurde aber vor einigen Monaten enttarnt. Daraufhin haben sie mich für andere, neue Aufgaben ausgebildet. Dann kam die Aktion in Krylbo. Eigentlich darf ich nichts erzählen, das verstößt gegen sämtliche Regeln, denn Mitwisser machen sich mitschuldig.«
Die Schere schnippte noch dreimal, dann wurde sie langsam und beherrscht beiseitegelegt, ehe Christa vollkommen die Beherrschung verlor. Laut schluchzend warf sie sich Johanne um den Hals und versicherte, dass nichts sie mit größerem Stolz erfüllen und nichts auf der Welt wichtiger sein könne, als Deutschland zu besiegen, nein, nicht ihr Deutschland, sondern das Deutschland der Nazis. Das könne Johanne sicherlich nachvollziehen, nicht wahr?
Diese Reaktion der sonst so beherrschten und kühl analysierenden Tante Christa, einer laut Mutti »alten unverbesserlichen Bolschewistin«, wirkte übertrieben. Ihr ständiger Streit über Sozialdemokratie versus Bolschewismus dauerte jetzt schon über dreißig Jahre an. Johanne konnte sich nicht daran erinnern, Tante Christa je weinen gesehen zu haben, höchstens einmal vor Rührung. Und jetzt dieser Ausbruch! Wie sollte sie darauf reagieren?
»Ruhig, ruhig, Tante, noch ist Polen nicht verloren«, versuchte sie sie zu trösten und strich der schluchzenden Frau tröstend über den Rücken. Im gleichen Moment erkannte sie, wie unangemessen diese alte deutsche Redensart in diesem Zusammenhang war. Wenn etwas wirklich und wahrhaftig verloren war, dann Polen.
»Ich wollte nur sagen«, lenkte sie ab, »dass wir die Hoffnung nicht aufgeben dürfen und weiterhin Widerstand leisten müssen.«
Tante Christa befreite sich behutsam aus der Umarmung, zog ein Spitzentaschentuch aus der Tasche, trocknete ihre Tränen und lächelte verlegen.
»Offenbar weißt du über einige Dinge nicht Bescheid«, sagte sie und packte Kämme und Scheren weg. »Morgen machen wir beide einen langen Spaziergang, dann erzähle ich dir alles.«
Sie reckte sich, wie um ihre Fassung zurückzugewinnen, und machte sich dann auf den Weg zur Dalstugan. Dort hatte sie sich wie immer mit Onkel Oscar für den Sommer häuslich eingerichtet einschließlich Reisebibliothek. Nach wenigen Schritten hielt sie jedoch inne und kehrte um.
»Marsch ins Wasser, mein Mädel, strenge Anweisung der Frau Doktor. Und zwar ohne Bademütze!«, befahl sie scherzend und entfernte sich wieder.
Nachdenklich blieb Johanne alleine zurück. Was hatte die Tante gemeint? Dinge, die sie nicht wusste? Um Kriegsgeheimnisse konnte es sich wohl kaum handeln, denn über diese wusste sie besser als alle anderen Familienmitglieder Bescheid. Mit Ausnahme ihrer kleinen Schwester Rosa vielleicht, die an unbekannter Adresse in unbekannter Stellung für den schwedischen Nachrichtendienst arbeitete, worüber sie aber nie ein Wort verlor.
Schweiß lief ihr den Rücken hinunter, durchnässte ihr Nachthemd und lenkte ihre Gedanken in eine andere Richtung. Dafür war nicht mehr das Fieber verantwortlich, sondern der heißeste Sommer seit hundert Jahren. Vor einer Woche waren auf der Leeseite des Langhauses 38 Grad im Schatten gemessen worden.
Auf dem Steg legte sie ihren Bademantel ab und sprang, da sie nackt war, schnell ins Wasser, da zwischen ihr und den Badegästen am Sandstrand in Skärkarlshamn nur knappe Hundert Meter lagen.
Mit entspannten Zügen schwamm sie im Schatten der Beduin. Als sie den Bootsrumpf passierte, erblickte sie im Sonnenlicht viele kleine Flundern, die in alle Richtungen davonglitten, um dem bedrohlichen Schatten des weißen Wales über ihnen zu entkommen.
Ihr Kopf fühlte sich ohne das lange Haar ungewohnt kühl an.
Sie tauchte erneut im Schatten der Beduin und schwamm auf die neue Leiter am äußeren Senkkasten des Badestegs zu, die offenbar angebracht worden war, weil die Frauen nicht so gern ins Wasser sprangen.
Sie stützte sich eine Weile mit den Unterarmen auf eine Sprosse der Leiter und keuchte dabei vor Anstrengung. Ganz wiederhergestellt war sie noch nicht. Das kühle Wasser schien aber nicht nur ihren Körper, sondern auch ihre Erinnerung zu erfrischen.
Der Zug 4352 fuhr langsam in den Bahnhof ein. Entsetzt starrten die drei auf den Waggon NSB 40256 hinunter. Heller Rauch drang sowohl aus den Lüftungen im Dach als auch aus den Lattenwänden. Das Feuer war verzögert ausgebrochen. Eine Sprengladung mit Zeitzünder wurde als Maßnahme erwogen. Nein, die würde man finden. Haugli, falls er wirklich so hieß, reichte ihr eine mit Benzin gefüllte Gummipumpe und stieß sie aus dem Lastwagen, schließlich trug sie als Einzige eine Uniform. Sie überquerte zielstrebig und mit ruhigen Schritten die Gleise. Sobald sie vom Bahnhofsgebäude aus nicht mehr zu sehen war, rannte sie. Der Zug befand sich noch in Bewegung, als sie die Pumpenspitze in einen Spalt des Waggons drückte und das Benzin ins Innere spritzte. Dann warf sie die rote Einlaufpumpe weg, entfernte sich eilends einige Meter und kehrte langsam zum Lastwagen zurück, während sie einen Blick auf ihre Kartentasche warf und ihre Uniformmütze zurechtrückte.
Danach beging sie einen gravierenden Fehler, an den sie sich in diesem Moment wieder ganz deutlich erinnerte. Um sich zu überzeugen, dass alles geklappt hatte, drehte sie sich um. Flammen schossen aus dem Waggon. Dann wurde alles schwarz.
Das eine Knie schmerzte, und bis auf einen schrillen hohen Ton hörte sie nichts mehr. Blind. Aber keine Schmerzen im Gesicht. Der Geruch verbrannter Haare.
An alles Weitere erinnerte sie sich nicht mehr, sie konnte nur versuchen, das Geschehene zu rekonstruieren. Auf die erste große Explosion des Waggons NSB 40256 folgte eine Serie kleinerer Explosionen sowie eine weitere sehr kräftige Explosion. Panik brach aus, Menschen rannten hin und her. Offenbar war sie nur eine von vielen gewesen, die von den Druckwellen der ersten oder der zweiten großen Explosion zu Boden geworfen worden waren. Haugli und M. waren in der Menge der Hilfeleistenden kaum aufgefallen.
Sie hatte im Laderaum unter der Pferdebox gelegen, bewusstlos. So musste es gewesen sein.
Weiter wollte sie sich nicht erinnern, zumindest nicht jetzt. Sie tauchte erneut in das kühle, heilende Wasser ab.
Als sie zum Haus zurückkehrte, schimpfte Mutti, weil sie nackt gebadet hatte. Schließlich sei der nahe gelegene öffentliche Badestrand gut besucht.
Natürlich war diese Zurechtweisung nur ein unbeholfener Versuch, ihrer Gefühle Herr zu werden. Dann hielten sie sich lange in den Armen.
»Mein tapferes kleines Mädchen«, flüsterte Mutti auf Norwegisch.
»Meine kluge Mutter, meine erstklassige Chirurgin und Lebensretterin«, erwiderte Johanne flüsternd auf Deutsch. Damit war alles gesagt.
Beim Abendessen war alles wieder wie immer. Es herrschte eine fast schon absurde Normalität, als sei weiter nichts vorgefallen.
Den ersten Toast verwendete Vater allerdings darauf, die »Kranke« an der Tafel willkommen zu heißen und ihr ein Kompliment für ihre neue, praktische Frisur zu machen.
Auf der Veranda wurde ein sommerliches Essen serviert, kalter gedünsteter Dorsch mit neuen Kartoffeln, Mayonnaise und Salat, dazu ein trockener Riesling, anschließend Dosenpfirsiche, Schlagsahne und Eiswein. Mutti ermahnte Johanne, nach drei Tagen mit Brühe nicht zu viel zu essen. Wie immer sprachen sie vom Segeln, da die Regatta bevorstand und Carl Lauritz auf einen Sieg hoffte. Wie immer analysierte Onkel Oscar die strategische Lage. Helene bat prompt darum, wieder ins Seglerhäuschen ziehen zu dürfen. Johanne hatte nichts dagegen, zurück ins Haupthaus in eine der Gästekojen zu ziehen.
Selbst nach der Dämmerung war es noch sehr heiß.
Wenig später saßen Vater und Onkel Oscar mit Zigarren und Whiskysoda allein in der Sommernacht. Alles war wie immer.
In dieser Nacht schwitzte Johanne in ihrer stickigen Koje. Sie schlief schlecht und hatte Albträume von einer nächtlichen Fahrt von Sala nach Stockholm. Sie durfte nicht zu spät, aber auch nicht zu früh eintreffen, musste sich pünktlich zur Abfahrt der Waxholm I um acht Uhr einfinden. Mit diesem Dampfer fuhren am Montagmorgen immer nur ganz wenige Passagiere. Gegen die Schmerzen hatten sie Morphium. Und zum Sterben angeblich Blausäurekapseln, wenn es sich nicht um reines Geprahle der Männer handelte.
Nach dem Morgenbad und Frühstück erschien Tante Christa in altmodischer Spazierkleidung, um Johanne abzuholen. Schließlich seien sie verabredet, wie sie vielsagend mitteilte.
Sie begaben sich auf dem Plankenweg am Strand Richtung Trovill, da es auf den Waldwegen im Innern der Insel unerträglich heiß war. Tante Christa hatte einen Sonnenschirm aus rosa Seide mit weißen und pistazienfarbenen Fransen dabei. Jede andere Person hätte in dieser Aufmachung lächerlich gewirkt.
Anfangs schien sie sich nur über Literatur unterhalten zu wollen. Sie hatte einige Bücher von Johanne geliehen, die die »Selbstmörderinnen dieses Jahres« verfasst hatten.
»Zu meinem Erstaunen muss ich zugeben, dass mir deine englische Freundin imponiert. Sie formuliert ihre Gedanken wirklich sehr treffsicher, insbesondere …«
»Als Freundin würde ich sie nicht unbedingt bezeichnen, aber sie war mit Onkel Sverre während seines englischen Exils gut befreundet.«
»Sie hat dir aber eine sehr freundliche Widmung in das Buch geschrieben und dir viel Erfolg für dein Literaturstudium gewünscht.«
»Was nicht so merkwürdig ist, wie man meinen könnte. Onkel Sverre hat mich und eine Freundin nach dem Abitur auf eine Reise mitgenommen, eine Peregrination, erst nach Paris und dann nach London. Einen besseren Führer hätten wir nicht finden können, ihm standen wirklich alle Türen offen.«
»Ja, daran erinnere ich mich. Unbegreiflich, dass Lauritz zwei junge Studentinnen einfach fahren ließ und noch dazu mit Sverre. Ich weiß ja, wie er in Berlin gelebt hat.«
»Ja, aber der liebe Papi hätte sich so etwas nie vorstellen können.«
»Nein, natürlich nicht, darüber spricht man nicht, man stellt es sich nicht einmal vor. Seid ihr auf dieser Reise übrigens eure Unschuld losgeworden?«
»Findest du diese Frage nicht etwas indiskret, Tante Christa?«
»Doch nicht unter uns progressiven Frauen. Wie auch immer, zurück zu dieser englischen Autorin, also Sverres Freundin. Mein Englisch ist auch nicht mehr das, was es einmal war, aber schließlich haben wir ja ein Wörterbuch in unserem Haus. Folgende Formulierung gefiel mir übrigens am besten. Damit hat sie den Nagel auf den Kopf getroffen. ›A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction.‹ Du hast übrigens beides.«
»Ja, aber ich bin Literaturwissenschaftlerin und nicht Schriftstellerin.«
»Schon möglich. Aber ich glaube durchaus, dass ein eigenes Zimmer und Geld für jede Frau von Vorteil wäre, egal ob sie Hutmacherin oder Saboteurin ist. Mir hat auch dieses Spiel mit männlicher und weiblicher Identität in dem zweiten Buch gefallen. Darin fand sich ebenfalls eine Widmung für dich.«
»Ja, aber da war wirklich nichts dabei. Als wir ihr in einem chaotischen Haus auf dem Land vorgestellt wurden, nahm sie einfach einige der überall herumliegenden unverkauften Exemplare zur Hand. Birgitta von Vegesack hat diese Bücher ebenfalls erhalten.«
»Ach, so war das. Aber sag, war diese Virginia eigentlich Sozialistin?«
»Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Beinahe hätte ich gesagt, das sind doch wohl alle vernünftigen Menschen, aber ich weiß es wirklich nicht. Da musst du schon Onkel Sverre fragen, wenn er nächste Woche kommt.«
»Eigentlich spielt es keine Rolle. Nehmen wir mal an, dass sie intuitive Sozialistin war, denn eine überzeugte Marxistin würde nicht zwischen männlich und weiblich unterscheiden. Nicht einmal ich. Meine fast selbstverständliche Reaktion wäre, dass die Klassenfrage immer an erster Stelle kommt.«
Tante Christa hielt inne, schaute auf das Meer und nach Korsö hinüber, wo die schwedische Kriegsflagge auf dem alten Leuchtturm schlaff nach unten hing. Ihr war deutlich anzusehen, dass sie scharf nachdachte. Johanne befürchtete, dass jetzt eine Vorlesung über marxistische Theorie folgte.
So kam es auch. Sie handelte das Verhältnis von Klassenkampf und Geschlechterkampf ab, ausgehend von Virginia Woolfs Gedankenspiel, dass Shakespeares Vorname nicht William, sondern Judith gewesen ist. In diesem Falle hätten nicht nur fehlende Mittel und Räumlichkeiten die Weltliteratur eines Shakespeares beraubt.
Zehn Minuten lang dauerte Tante Christas Vortrag. Vieles war wie immer scharfsinnig, und es fehlte ihr wahrhaftig nicht an eigenen Erfahrungen. Angefangen mit ihrer Entführung von ihrem Liebhaber 1907 in Kiel bis hin zur Revolution von 1919. Das zwölf Jahre währende revolutionäre Abenteuer endete damit, dass Mutti sie aus dem Gefängnis Moabit befreite, indem sie erklärte, die Gefangene Nummer 2213, die als »Christa Künstler« auf der Liste geführt werde, sei eigentlich die Freiherrin Christa von Moltke.
Das war natürlich alles interessant. Tante Christas abenteuerliches Leben setzte sich aus unzähligen spannenden Anekdoten zusammen, und ihre Fähigkeit zur politischen Analyse imponierte Johanne.
Das war es also nicht, was Johanne störte, sondern dass es sich kaum um wichtige und ihrer Nichte bislang unbekannte Dinge handelte, sondern um ganz gewöhnliche Konversation. Vielleicht bereute Tante Christa ihr Versprechen mittlerweile und mied das eigentliche Thema.
Sie erreichten die Landzunge Kniphalsen und gingen bis zur Spitze hinaus, wo sie sich ein Weilchen hinsetzten und von der Brise abkühlen ließen. Tante Christa schaute aufs Meer. Es hatte den Anschein, als müsste sie sich sammeln. Johanne bemühte sich, ihre Ungeduld zu zügeln.
»Jetzt zu dem, was du offenbar nicht weißt«, begann Tante Christa schließlich. »Oscar und ich lebten in größtem Wohlstand im Garten des Bösen, wie man das nennen könnte. Berlin war im Jahr 1934 nicht mehr, was es einige Jahre zuvor gewesen war. Alle Freunde waren verschwunden, und niemand besuchte noch meinen ›Roten Salon‹. Meine Arbeit bei der Roten Hilfe war verboten worden, aber trotzdem fühlten Oscar und ich uns sicher. Eines Abends schlug jedoch der Blitz ein. Zwei unserer Angestellten hatten uns bei der Gestapo angezeigt, weil die Firma Lauritzen im Unterschied zu allen anderen Firmen in Berlin den Tag nicht mit einem einstimmigen ›Heil Hitler‹ begann! Das hatte Oscar streng untersagt. Er wurde von der Gestapo vorgeladen, noch dazu von ihrem höchsten Chef. Und am späten Abend. Hast du diese Geschichte noch nie gehört?«
»Nein, daran würde ich mich erinnern. Und daraufhin seid ihr also nach Schweden gezogen?«
»Nein. Das hier ereignete sich 1934. Oscar fand sich sicherheitshalber in vollem Ornat bei dem Gestapochef ein, schließlich war er im Großen Krieg der Offizier mit den höchsten Auszeichnungen gewesen. Es wäre aber nicht nötig gewesen, alle Orden anzulegen, wie sich herausstellte. Die Angelegenheit wurde im Adlon beigelegt, wo die beiden Herren zu Abend aßen und sich bestens amüsierten. Ja, und am darauffolgenden Morgen wurden die beiden Denunziantinnen im Beisein der übrigen Belegschaft entlassen. Dieser Vorfall verstärkte die Illusion, dass wir unangreifbar waren und weiterhin unseren Geschäften in Berlin und Dresden nachgehen konnten. Uns würde schon nichts Böses zustoßen.«
Tante Christa verstummte und ließ ihren Blick erneut übers Meer nach Korsö schweifen, wo sich die schwedische Kriegsflagge mit ihren drei Spitzen jetzt in der Brise bewegte.
Johanne betrachtete sie verblüfft. Gewiss war dies eine von tausend »guten Geschichten« aus der frühen Zeit des bösen Reiches. Mit größtem Vergnügen würde sie Onkel Oscar bei Gelegenheit fragen, wie es sich mit dem höchsten Gestapochef zu Abend aß. Eine solche Anekdote eignete sich durchaus als Erzählstoff bei Tisch, zumindest wenn Vater auf seiner Baustelle weilte. In seiner Anwesenheit durfte beim Essen weder von Politik, Geld oder Krankheiten gesprochen werden. Warum ihr diese Geschichte unter vier Augen und im Vertrauen erzählt wurde, war Johanne schleierhaft.
»Aber davon wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sprechen«, fuhr Tante Christa fort, nachdem sie einige Minuten geschwiegen hatten.
Sie schien sich einen Ruck geben zu müssen, um zum »Eigentlichen« zu kommen.
»Ich habe mich Karls Verlobter Louise gegenüber unverzeihlich taktlos verhalten«, sagte sie schließlich, »und schäme mich jetzt meiner Gemeinheiten über die Notwendigkeit von Dachreparaturen.«
Johanne schwieg mit zunehmender Verwunderung, während Tante Christa für ein Geständnis Anlauf zu nehmen schien, das eher den Charakter einer Bagatelle hatte.
»Es war das übliche Arrangement«, fuhr Tante Christa energisch fort. »Die Familie meiner Mutter war vermögend, Familie von Moltke vornehm, um nicht zu sagen, äußerst vornehm. So gehörten die von Moltkes zu den sogenannten Seglerfamilien bei der Kieler Woche und saßen immer an der Tafel des Kaisers. Das war wichtig für sie. Aber das weißt du natürlich alles bereits?«
»Offen gestanden, ja, Genossin Christa. Und worauf willst du hinaus?«
»Als Geschäft im kapitalistischen Überbau war die Transaktion ebenso logisch wie banal«, fuhr Christa fort. »Vulgäres Geld wurde geadelt, und der zahlungsunfähige Adel bereicherte sich. Die Sommerresidenz südlich von Dresden konnte renoviert werden und war anschließend auch im Winter bewohnbar. Dabei spielte übrigens die Dachreparatur eine entscheidende Rolle. Das ist die Pointe. In Zukunft werde ich mich aller Kommentare enthalten, was Louise und ihre Familie betrifft.«
Um zu unterstreichen, dass sie ihr Bekenntnis abgeschlossen hatte, erhob sich Tante Christa, um den Heimweg anzutreten.
Unterwegs versuchten sie, ihre Diskussion über Literatur wieder aufzunehmen, waren aber beide nicht ganz bei der Sache. Johanne hatte den Eindruck, dass Tante Christa immer noch über »das Eigentliche« nachsann, das sie nicht auszusprechen wagte, wovon sie nur notdürftig mithilfe der sinnlosen Geschichte über Dachreparaturen abgelenkt hatte.
*
Vater und Onkel Oscar saßen tagelang mit Bergen vom Kiosk neben dem Dampfschiffanleger erstandenen Zeitungen unten am Ufer und leerten das eine oder andere Glas. Um kein Misstrauen zu erregen, beauftragten sie Carl Lauritz, Hans Olof und die Dienstmädchen, die Zeitungen nacheinander zu kaufen. Zweifellos hatte Onkel Oscar die »Operation« geplant.
Natürlich analysierten sie alles, was über den »Knall in Krylbo« geschrieben wurde. Jede Nuance in den offiziellen Verlautbarungen über die Katastrophe war ihnen wichtig.
Die Erkenntnisse, die sie auf diese Weise möglicherweise gewannen, behielten sie jedoch für sich, als wären nur sie in der Lage, diese Texte zu deuten. Während der gemeinsamen Mahlzeiten wurde nicht darüber gesprochen.
Johanne fühlte sich mit gutem Grund und in zweifacher Hinsicht wie eine Gefangene. Sie konnte sich, ehe ihre Verletzungen nicht verheilt waren und ihr Haar notdürftig nachgewachsen war, nicht unter die Leute begeben und in den nächsten Wochen deswegen nur lesen und baden. Glücklicherweise hielt das schöne Wetter an. Sie erfuhr nicht, was in den Zeitungen stand, als wäre sie immer noch ein Kind, obwohl sie die Berichte über Krylbo mit Sicherheit besser als die übrigen Familienmitglieder verstanden hätte. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als weiter zu baden, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und den männlichen Familienoberhäuptern zuzuwinken, wenn sie auf dem Weg zum Steg an ihnen vorbeiging.
Eines Morgens unternahmen Vater und Mutti einen großen Ausflug mit dem neuen Ruderboot. Segeln war aufgrund der Flaute nicht möglich, und das Benzin im Tank des Motorbootes reichte gerade noch für die Heimfahrt nach Saltsjöbaden am Ende der Sommerferien. Mutti hatte für die Fahrt zum Kurhotel nach Saltsjöbaden fast das ganze Benzin aufgebraucht, um Medikamente zu kaufen. Zu diesem Zeitpunkt hatte die bewusstlose Johanne heftig gefiebert, und Kompromisse waren nicht möglich gewesen.
Deswegen hatte Vater sich anschließend zur Werft am Fläskberget begeben und einen schweren, altmodischen Kahn mit vier Riemen gekauft. Waren die Hästholmarna weder mit Segel- noch Motorboot zu erreichen, müsse eben gerudert werden. Diese Kunst hatten einige Familienmitglieder bereits im Vorschulalter erlernt, erklärte er.
An jenem frühen Morgen, als Vater mit Mutti zu einem ganztägigen Ruderbootausflug mit Picknickkorb aufbrach, verlor Onkel Oscar jegliches Interesse an weiterer Zeitungslektüre und wandte sich wieder seinen Romanen und Biografien zu. Tante Christa und ihm war es gelungen, den größten Teil ihrer Berliner Bibliothek trotz der bereits existierenden Liste verbotener Bücher zu retten.
Jetzt lagen die alten Zeitungen auf dem Stapel mit brennbarem Müll hinter dem Geräteschuppen. Daneben der Abfall, der im Meer versenkt werden sollte: Dosen, Flaschen, zerbrochenes Porzellan und alles andere, was nicht brannte. Um die Abfälle kümmerten sich Carl Lauritz und Hans Olaf, die aber in letzter Zeit offenbar andere Dinge im Kopf hatten. Die Regatta rückte näher und war natürlich unendlich viel wichtiger als die Müllentsorgung, eine Ausrede, für die Vater immerhin vollstes Verständnis hatte.
Johanne fluchte, als sie den rekordverdächtig hohen Müllberg nach Zeitungen durchsuchte. Es gelang ihr, die wichtigsten Tageszeitungen, Svenska Dagbladet und Stockholms-Tidningen, auszugraben. Diese beiden Blätter sympathisierten mit den Deutschen und widmeten sich mutmaßlichen Anschlägen mit besonderem Interesse.
Sie legte die Zeitungen in den Leiterwagen und begab sich dann in den Wald, um in aller Ruhe lesen zu können. Die Hitze musste sie in Kauf nehmen.
Noch ehe sie die Krummholzkiefer erreichte, unter der Rosa und sie sich als Kinder immer versteckt hatten, lief ihr der Schweiß den Rücken herunter. Der niedrigste Ast der Kiefer bildete eine perfekte Rückenlehne. Kein Mensch war in der Nähe.
»Todesbataillon rettet Pulverzug in Krylbo aus dem Granatenhagel«, lautete die erste große Schlagzeile der Stockholms-Tidningen. Der folgende Bericht war sehr anschaulich: »Zwei grauenvolle Stunden lang peitschte ein Hagel aus Granatsplittern unablässig auf das Wasser des Dalälven, während die 2 000 Einwohner Krylbos am Flussufer, in Luftschutzkellern und in den Wäldern Schutz suchten.«
Sie blätterte und überflog die Überschriften. Zweiundzwanzig Verletzte hatte es gegeben, und der Jämtlandsexpress war ausgebrannt. In Nachthemden und Schlafanzügen hatten die Fahrgäste aus den brennenden Schlafwagen fliehen müssen. »Halb nackt mussten sich die Passagiere aus dem Zug retten und durch den Granatsplitterhagel rennen, um sich in Sicherheit zu bringen.« Schaufenster waren zu Bruch gegangen, und das Bahnhofsgebäude war schwer beschädigt worden.
Immer rascher und mit zunehmender Verärgerung blätterte sie weiter, bis sie schließlich fand, was sie suchte. Einem Bauern in Hökmora, einige Kilometer von Krylbo entfernt, sei beim Mähen das glühende, qualmende Radlager eines Zuges Richtung Krylbo aufgefallen. Damit, meinte der Reporter, habe sich die Theorie eines überhitzten Radlagers endgültig bestätigt. Die schlechte Qualität norwegischen Schmieröls wurde ebenfalls als mögliche Ursache erwähnt.
Dagens Nyheter gelangte zu denselben Schlussfolgerungen. Die Behörden und Inspektoren des deutschen Militärs, die an der Ermittlung teilnahmen, ebenfalls.
Nirgends wurde auch nur angedeutet, dass es sich um etwas anderes als einen Unfall handeln könnte. In diesem Punkte waren sich Zeitungen und Behörden vollkommen einig.
Zwei Helden gab es auch: die Bahnhofsarbeiter Folke Lindblom und Gustav Åkerlund, die unter Einsatz ihres Lebens mehrere Waggons von dem brennenden Munitionszug abgekoppelt und mithilfe einer Dampflok, die sie in einem angrenzenden Lokschuppen holten, da die Elektrizität und damit die normale Lok ausgefallen war, in Sicherheit gebracht hatten. Ohne das beherzte Eingreifen der beiden Bahnangestellten, die bald einen Orden erhalten würden, hätte es vielleicht sogar Tote gegeben.
Johanne fand die Orden in diesem Falle durchaus angebracht und blätterte weiter. Sie selbst und ihre Kollegen von der SOE-Sabotagetruppe hingegen hatten sich nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert. Ohne den Einsatz der beiden Bahnhofsangestellten hätte die Operation höchstwahrscheinlich einige Menschenleben gefordert. So viel also zu dem idiotensicheren Plan.
Johanne legte die Zeitungen wieder in den Leiterwagen, kehrte schwitzend zu dem überquellenden Abfallhaufen zurück und warf die Zeitungen darauf.
Die Bretter des Stegs waren glühend heiß. Sie rannte das letzte Stück, sprang in das kühle Nass und tauchte bis zur Ankerboje der Beduin. Dann kam sie wieder an die Oberfläche, um Luft zu holen. Eine Weile ließ sie sich mit geschlossenen Augen auf dem Rücken treiben. Mit zunehmender Abkühlung klärten sich ihre Gedanken.
Egal, was ihre Kameraden davon hielten, Aktionen dieser Art würde es für sie nicht mehr geben. Allein die Vorsehung hatte sie vor einer noch größeren Katastrophe und einer Festnahme durch die Hestapo, die Heimliche Staatspolizei, die eng mit den Deutschen zusammenarbeitete und eine intensive Jagd auf englische Spione und norwegische Widerstandskämpfer betrieb, bewahrt.
Ihr Leben aufs Spiel zu setzen stellte kein Problem für sie dar. Das gehörte zum Widerstand, und jeder Kurier, Saboteur, Grenzlotse, Funker, Waffenschmuggler oder Flüchtlingshelfer tat dies ebenfalls.
Während ihrer Ausbildung in der konspirativen Wohnung der SOE in der Brantingsgatan 29 hatte sie sich keine Gedanken darüber gemacht. Erst nachdem ihre Kuriertätigkeit in Norwegen aufgeflogen war und sie von der Gestapo gesucht wurde, hatte sie sich entscheiden müssen, ganz aufzuhören oder sich für neue Aufgaben ausbilden zu lassen. Der Umgang mit Codes, unsichtbarer Tinte, Sprengstoff, elektrischen Zündern, Pistolen und automatischen Waffen war aufregend gewesen und hatte ihr sogar Spaß gemacht. Pistolenschießen würde sie vielleicht auch nach dem Krieg als Sport weiterbetreiben.
Aber während der Ausbildung hatte sie immer nur Deutsche oder Quislinge vor sich gesehen, aber keinesfalls Zivilisten auf einem schwedischen oder norwegischen Bahnhof. Nie wieder würde sie zu den Sabotagetrupps der SOE zurückkehren.
Vermutlich würden sie ihr Vorhaltungen machen, weil ihre Ausbildung damit für die Katz war und weil es die Schuldigkeit eines jeden sei, den Fähigkeiten entsprechend zum Kampf gegen den Nazismus beizutragen. So etwas war leicht dahergesagt.
Aber sie würde nicht nachgeben. Tote Zivilisten waren ein zu hoher Preis. Vielleicht waren den Engländern skandinavische Verluste auch einfach gleichgültig. Ein fürchterlicher, aber vollkommen logischer Gedanke.
*
»Ich werde dir jetzt etwas Grauenvolles vorlesen, nur dass du’s weißt«, begrüßte Tante Christa sie, als sie sich energischen Schrittes dem Gartentisch am Strand näherte.
»Wirklich? Dieser Roman ist doch in politischer Hinsicht so zurückhaltend, dass sich bei Erscheinen nicht einmal die Männer aufgeregt haben«, erwiderte Johanne.
Während Tante Christa blätterte, um das trotzdem so unerhört schockierende Zitat zu finden, winkte Johanne dem Kahn ein letztes Mal hinterher. In tadellosem Gleichtakt, wie hätte es auch anders sein können, ruderten Vater und Onkel Oscar zügig davon. Mutti in Umschlagtuch, Sonnenbrille und breitkrempigem Hut winkte zurück. Helene schien schlechte Laune zu haben und winkte deswegen nicht.
»Hör dir das an!«, fuhr Tante Christa fort, als sie das Zitat gefunden hatte: »Saxofon: heiße geschmeidige Glieder, nagender Hunger, Urgesang des Begehrens in tropischem Dschungel, wo der Mondschein betört und die Fasane in lauem Nebel schreien.«
»Ja, daran erinnere ich mich. Und?«
»Mal ganz abgesehen davon, was ich als Frau eines Jägers von schreienden Fasanen im Dschungel halte, so ist dieser Text einfach nur ein hochtrabendes Machwerk. Von unserer Selbstmörderin hatte ich mehr erwartet.«
»Man könnte sagen, dass dieses Zitat nur ein prosapoetischer Ausdruck des ›Bewusstseinsstroms‹ ist, ungehemmt aus dem Unterbewusstsein niedergeschrieben. Das war damals sehr beliebt.«
»So lautet also das großzügige Urteil der Literaturwissenschaftlerin? Aber nur ein paar Seiten weiter kommt dieses verdammte Saxofon zurück, dann allerdings ohne Fasane.«
Sie blätterte zum nächsten Zitat weiter, das sie mit einem Zettel zwischen den Seiten markiert hatte.
»Hör dir das an: ›Saxofon: das Blut singt seine dunkle Klage, es fließt und wogt gegen Mauern aus Stein.‹«
»Ja, das ist sehr ähnlich. Aber ich dachte, wir wollten über den Inhalt des Romans und über Politik sprechen und nicht über künstlerische Girlanden. Im Übrigen trage ich eine gewisse Mitschuld, so seltsam das klingen mag.«
»Wie interessant! Erzähl mir erst einmal diese Geschichte, um die politische Analyse kümmern wir uns anschließend.«
Johanne seufzte und blickte dem Kahn hinterher, der ganz weit draußen Richtung Gumman unterwegs war. Sie selbst war nicht mit von der Partie, weil sie immer noch zum Fürchten aussah. Da auch viele andere Sandhamner Sommergäste wegen Benzinmangels mit ihren Ruderbooten unterwegs waren, ließen sich Begegnungen mit Bekannten nicht ausschließen.
Der Schorf war inzwischen getrocknet und fiel ab, aber manchmal verspürte sie einen wahnsinnigen Juckreiz, dem sie, gemäß allerstrengster ärztlicher Anweisung, nicht nachgeben durfte. Tante Christa, die Ruderpartien verabscheute, hatte großzügig angeboten, an Land zu bleiben und ihrer Nichte Gesellschaft zu leisten.
»Du bist plötzlich so nachdenklich?«
»Entschuldige, Tante Christa. Wo waren wir stehen geblieben?«
»Du wolltest mir erzählen, wie du zur Entstehung eines solchen Machwerkes beigetragen hast.«
»Richtig, aber das ist eine lange Geschichte.«
»Du kannst sie ja ein wenig straffen.«
Aber war es auch eine gute Geschichte? Ja, vermutlich. Die junge Studentin, die gerade Mitglied des Clarté-Bundes geworden war und sich auf das erste Semester in Literaturgeschichte freute, war auf ein Fest geraten, das im Kreise hochstehender Literaten stattfand. Dort war sie Karin zum ersten Mal begegnet, die ihren bürgerlichen Hintergrund, ihre Kleidung, Sprache, Körperhaltung, alles, natürlich sofort durchschaute. Ein solcher »Hintergrund« war damals wie jetzt eigentlich auch in literarischen Kreisen nicht immer comme il faut, nicht einmal bei den ganz Etablierten.
Karin arbeitete an einem Roman, ihrem ersten. Sie wollte die Zwänge schildern, die sie in ihrem Konsumverhalten, Kleidungsfragen und Vergnügungen eingrenzten und sie so zu einem männlichen Besitz wie beispielsweise Autos und Geld machten.
Das Problem war nur, dass Karin zu wenig über die Leute wusste, die sie verurteilen wollte. Ob Fräulein Johanne sie nicht, äußerst diskret natürlich, im Hinblick auf exklusive Gewohnheiten beraten und sie vielleicht sogar in Tanzrestaurants begleiten könne?
Dieser Vorschlag war vielleicht nicht ganz so schmeichelhaft wie beabsichtigt, aber natürlich unwiderstehlich. Sie suchten Pelzgeschäfte auf, und während Johanne Preise und Unterschiede in Stil und Geschmack erläuterte, trug Karin alles in ein kleines schwarzes Notizbuch ein. Sie besuchten Modenschauen im NK und im Sidenhuset und sogar ein paar Jazz-Clubs. Und so war das Saxofon vermutlich mit etwas zu feierlichen Worten in das Notizbuch geraten.
Die Rolle der Wegweiserin in die höheren Sphären der Konsumgesellschaft war nicht weiter beschwerlich und nach einigen Wochen erfüllt. In dieser Zeit nahm Karins Bewunderung für ihre zehn Jahre jüngere Begleiterin stetig zu. Zu Beginn schienen die einzigen notwendigen Qualifikationen ein sogenannter bürgerlicher Hintergrund und die Fähigkeit, sich in der verachteten Welt der Konsumwaren zurechtzufinden, zu sein. Zumindest war es Johanne so vorgekommen. Ja, so war es gewesen. Im Jahr darauf hatten sie sich dann auch in Berlin etliche Male gesehen.
Am Ende hatte Karin sie gebeten, ihr ein Geschenk zu beschreiben, mit dem ein Mann aus der Mittelschicht versuchen würde, eine junge Frau aus der Arbeiterklasse zu verführen. Vorzugsweise ein Schmuckstück, das Damen der feineren Gesellschaft erschauern ließ.
Tante Christas Gelächter unterbrach die Erzählung.
»Ach, ich weiß! In dem Buch kommt ganz richtig ein geschmackloses kleines Schmuckstück des unsympathischen Verführers vor. Warte, ich habe es sogar unterstrichen, hier muss es irgendwo stehen.«
Sie blätterte eine Weile, bis sie die Stelle gefunden hatte.
»Aus einem kleinen Etui nahm er eine dünne Silberkette mit einem Anhänger aus kleinen Perlen mit einem Aquamarin zuunterst«, zitierte sie.
»Ja«, gestand Johanne. »Das war mein Vorschlag.«
»In der Verdinglichung der Frau ist der Kapitalismus demnach nicht nur verführerisch, sondern auch verlogen«, schloss Tante Christa. »Mir lief tatsächlich der der Autorin so wichtige Schauer über den Rücken, als ich dieses Schmuckstück vor mir sah. Neusilber, maschinell gefertigte Perlen und ein hellblauer Glassplitter, der einen Aquamarin darstellen soll und in den Läden am Odenplan fünfzehn Kronen kostet. Der Mann erwirbt wissentlich Tand und täuscht die Frau. Dein metaphorischer Beitrag zu diesem Roman hatte also offenbar seine Vorzüge. Das mit dem Skunk habe ich aber nicht ganz begriffen.«
»Skunk?«
»Ja. Warte hier … Seite 110 meiner deutschen Ausgabe. Hier ist von ›weiches und samtenes Rauchwerk, Bisam, Skunk und Silberfuchs‹ die Rede. Stammte dieser kleine Tipp ebenfalls von dir?«
»Da hätte natürlich Schupp und nicht Skunk stehen sollen.«
Sie lachten beide.
»Aber ganz im Ernst, Tante Christa …«
»Es wäre mir lieber, wenn du mich ab jetzt nur noch Christa nennen würdest, nicht nur, weil das freundschaftlicher klingt, sondern auch, weil ich mich sonst unnötig alt fühle.«
»Gerne, aber nicht, wenn Vater dabei ist.«
»Nein, natürlich nicht.«
Sie legten eine Pause ein. Wie im Kino, wenn die Spulen gewechselt und die Räumlichkeiten gelüftet werden und das Publikum im Foyer Erfrischungen zu sich nimmt. Johanne ging ins Haus hinauf und bat um möglichst kalte Limonade mit einem Schuss Weißwein.
Vermutlich wäre es besser gewesen, wenn der Roman seinen ursprünglichen Namen, »Die Schaufensterpuppe«, behalten hätte, darin waren sie sich rasch einig. »Astarte« klang zu geschraubt und weckte falsche Assoziationen. Als wäre die Frau eine Art Göttin, die mehr oder weniger im Scherz verehrt werden musste, wie bei den »Reden an die Frau« der Studentenabende.
Die ironische Auseinandersetzung mit der Traumfabrik der Wochenzeitungen und anderen Dingen, die der weiblichen Leserschaft sehr einleuchtete, entging den männlichen Kritikern vollständig. Johanne konnte sich an einige Rezensionen immer noch sehr gut erinnern. Sie hatte sie eingehend studiert, da sie sich insgeheim beteiligt fühlte, wenn auch nur an der Einführung in die kapitalistische Verführung.
Der Roman glich laut einer Stockholmer Zeitung »einer Ranunkel an der Wange eines schlummernden Kindes« oder, wie der Social-Demokraten behauptete, »einer unterhaltsamen poetischen Plauderei«. Am amüsantesten formulierte es der bekannte Dichter Gunnar Mascoll-Silverstolpe, der in der Stockholms-Tidningen die Betrachtung anstellte, dass sich »die weibliche Verliebtheit zu reiner Vergeistigung sublimieren« ließe. Damit war wohl die Episode mit dem Aquamarin gemeint.
So also äußerten sich die Kritiker über den zornigen Angriff auf den von den Männern konstruierten Unterdrückerkapitalismus!
Das lächerliche Saxofon und ähnliche Ausbrüche lenkten die Gedanken in eine falsche Richtung, meinte Christa. Stilistische Mittel wie das Schreiben im »Bewusstseinsstrom« hätten ja damals, im Sommer 1932, diesen schrecklichen Streit ausgelöst. Johanne hatte die ältere Schriftstellerfreundin einige Male eingeladen. Alles war ausgezeichnet verlaufen, schließlich sprach Karin ein sehr brauchbares Deutsch. Aber dann kam die Auseinandersetzung mit Bert, der sich wahnsinnig über das »unterbewusste Schreiben« aufregte und herumschrie, man solle für wache und nicht für schlafende Köpfe schreiben. Zu diesem Zwecke müsse man selber wach sein und dürfe auf gar keinen Fall schlafen, am allerwenigsten auf der Couch eines Analytikers und Quacksalbers! Welch ein Aufstand. Karin war nach dieser Standpauke nie wieder im Salon erschienen.
»So war das damals nun mal«, meinte Christa nachdenklich. »Der Körper sollte durch Sozialismus und Planwirtschaft befreit werden, die Seele durch Psychoanalyse.«
»Ja, leider. Oder auch nicht. Man sollte neuen Ideen gegenüber offen sein, also fragte ich Karin tatsächlich um Rat.«
»Und wie lief das?«
»Ich kann nicht behaupten, dass es sonderlich gut lief. Erst versuchte ich es bei dem Analytiker, den Karin selbst konsultierte, ein Dr. Schindler. Seine Analyse lief darauf hinaus, dass sich sexuelle Hemmungen junger Frauen durch ausgiebigen Geschlechtsverkehr mit älteren Herren wie ihm selbst beseitigen ließen. Ich hatte ja schon immer eine Schwäche für ältere Männer, das hätte also auf ein Ende mit Schrecken hinauslaufen können. Aber Karin gefiel die Sache gar nicht, darum wechselten wir zu einer Frau, Dr. Lene Lampl, die Verdrängung und sexuelle Hemmungen mittels lesbischer Liebe beheben wollte, was bei Karin besser funktionierte als bei mir. Das war nie so mein Ding.«
»Und jetzt ist sie tot«, stellte Christa fest.
Dieser Stimmungsumschwung wirkte angesichts der jüngsten Ausgelassenheit irgendwie verrückt.
»Ja«, räumte Johanne mit leiser Stimme ein. »Jetzt ist sie tot.«
»Warum hat sie sich eigentlich umgebracht?«
»Was weiß man schon? Weil letzten Frühling alles so betrüblich wirkte und es aussah, als würden wir alle in das Tausendjährige Reich einverleibt? So wie in ihrem dystopischen letzten Roman. Jetzt, wo Hitler auf dem Weg nach Moskau ist, sieht es noch düsterer aus. Da denken doch fast alle an Selbstmord!«
»Aber du doch nicht?«
»Nein. Wenn ich sterbe, dann im Kampf gegen den Nazismus. Das erscheint mir als ein viel sinnvollerer und anständigerer Tod.«
Christa brach in Tränen aus, was Johanne dieses Mal nicht erstaunte. Zum ersten Mal streifte sie der Gedanke, ihre Tante könnte tatsächlich verrückt sein. Und sie angesteckt haben, hatte sie doch selbst gerade etwas ziemlich Verrücktes gesagt. Vielleicht war es aber auch ganz einfach nur der Krieg.
Es dauerte eine Weile, bis sich Tante Christa wieder gefangen hatte, danach verbrachten sie den Rest des Nachmittags gut gelaunt damit, Karin Boye und Virgina Woolf zu vergleichen.
*
Als Rosa endlich auf Stippvisite in Sandhamn erschien, begab sie sich unverzüglich mit Johanne zu ihrem Lieblingsplatz unter der Krummholzkiefer.
Es war wie damals in ihrer Jugend, wenn die Schwestern das Bedürfnis verspürten, unter sich zu sein, und nicht auf ihre kleinen Cousins aufpassen und ihren lärmenden Brüdern entrinnen wollten, um Dinge zu besprechen, die nur sie beide etwas angingen.
Jetzt saßen sie wieder so da, barfuß, in Shorts und weißer Bluse. Rosa hatte sich nach ihrer Ankunft sofort umgezogen und sich von einer berufstätigen jungen Dame wieder in einen Teenager verwandelt.
Es war wie früher und auch wieder nicht. Der unterste Ast der Kiefer reichte nicht mehr als Rückenlehne für beide. Johanne hatte gewöhnlich links neben ihrer kleinen Schwester gesessen und hatte ihr meist tröstend einen Arm um die Schultern gelegt. Jetzt waren die Rollen vertauscht.
Rosa war die hässliche kleine Schwester gewesen. Mit karottenrotem Haar, Zahnspange, Brille und schielbedingter Augenklappe. Johanne wurde bei den Tanztees im Clubhaus umschwärmt, während sich Rosa, das ewige Mauerblümchen, ständig aufs Neue unglücklich verliebte.
Vielleicht war es eine Übertreibung zu behaupten, dass aus dem hässlichen Entlein ein Schwan geworden war, denn hässlich war Rosa ohnehin nur in ihren eigenen Augen gewesen. Nachdem sie die fatalen Jahre mit Zahnspange und Augenklappe hinter sich gelassen hatte, kleidete sie sich nun modisch. Mühelos hätte sie sich als Model für Unterwäsche-Anzeigen geeignet, die die Männer neben dem Sport mit Vorliebe lasen.
Die Rollen waren in vielerlei Hinsicht vertauscht. Johanne mied seit Beginn ihrer Sandhamn-Gefangenschaft alle Spiegel. Sie vermutete, dass sie mit ihrem verfilzten, kurz geschnittenen Haar und ihrer wie von Läusen und Räude verschorften Kopfhaut wie eine russische Strafgefangene aussah. Rosa sah, wenn man bei den gängigen Klischees bleiben wollte, aus wie eine gepflegte, intelligente Literaturwissenschaftlerin, Johanne hingegen wie die Spionin in einem deutschen Film. Sie hatten die Rollen also vertauscht, sowohl die äußeren als auch die inneren.
Auf dem Weg zu ihrem alten Versteck sprachen sie über nichts Spezielles, also über das Wetter, über die gesunde, aber einseitige Kost, nur Fisch, und über die Begeisterung ihres Cousins für das Segeln.
Nun endlich ganz für sich und weit von unerwünschten Zuhörern entfernt, war der richtige Zeitpunkt gekommen. Johanne überließ die Initiative ihrer kleinen Schwester, auch hier also vertauschte Rollen. Sie wusste nicht, wie weit Rosa im Bilde war und ob sie nur als ihre kleine Schwester oder auch in ihrer Rolle als Vertreterin einer Behörde neben ihr saß. Rosa, die mit der Situation keinerlei Probleme zu haben schien, wirkte unbekümmert und gelassen und kam ohne Umschweife zur Sache.
»Wie du vielleicht weißt, haben wir Malcolm Munthe bereits einen Tag nach dem Ereignis in Krylbo ausgewiesen. Alles deutete auf einen Anschlag der SOE hin. Die Deutschen konnten aus nachvollziehbaren Gründen nicht dahinterstecken, und die Kommunisten verfügen nicht über die nötigen Mittel, außerdem werden sie gut überwacht. Also kamen nur die Engländer infrage, und zwar mit oder ohne norwegische Helfer. Später wirkten diese Schlussfolgerungen allerdings etwas übereilt, denn für einen Anschlag fehlten jegliche Beweise. So ist die Lage.«
Johanne wusste nicht recht, wie sie antworten sollte. Wurde sie etwa von ihrer eigenen Schwester verhört?
»Wir?«, erwiderte sie vorsichtig. »Wer sind wir? Wer hat Malcolm ausgewiesen?«
»Wir. Schweden, wenn du so willst.«
Wir, dachte Johanne. Wir Schweden, das schloss die Heimatfront vermutlich nicht mit ein.