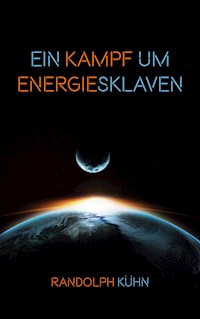Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein spannender Science-Fiction Roman über die Schaffung einer neuen Welt, in der sich die Wirtschaft den Naturgesetzen anpasst. Das internationale Parteienbündnis "Schwingen der Freiheit" kämpft erfolgreich für Reformen der Energie- und Finanzmärkte. Reformgegner verwickeln zwei befreundete Paare aus dem Parteienbündnis in den kolumbianischen Bürgerkrieg. Die von den Schwingen-Parteien vorangetriebene internationale Kooperation zur Bewältigung der Energie-, Umwelt- und Sozialkrisen mündet trotz Bedrohung durch Meer und Terror in den Aufbruch zur Industrialisierung des Weltraums in den Bereichen des Librationspunkts L5 und der geostationären Umlaufbahn.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das internationale Parteienbündnis Schwingen der Freiheit kämpft erfolgreich für Reformen der Energie- und Finanzmärkte. Reformgegner verwickeln zwei befreundete Paare aus dem Parteienbündnis in den kolumbianischen Bürgerkrieg. Die von den Schwingen-Parteien vorangetriebene internationale Kooperation zur Bewältigung der Energie-, Umwelt- und Sozialkrisen mündet trotz Bedrohung durch Meer und Terror in den Aufbruch zur Industrialisierung des Weltraums in den Bereichen des Librationspunkts L5 und der geostationären Umlaufbahn.
Randolph Kühn ist das Pseudonym eines Autors, der auf unterhaltsame Weise seinen Lesern neue Erkenntnisse der Energie-, Umwelt- und Wirtschaftsforschung nahebringen möchte.
Die handelnden Personen dieses Science-Fiction Romans sind fiktiv, der Hintergrund zur „Science“ steht im Literaturverzeichnis.
Eure alten Männer werden träumen, und Eure jungen Männer haben Visionen.
Das Buch Joël, Kap. 3, Vers 1
Inhaltsverzeichnis
Klostersee
Petersberg
2.1 Theorie
2.2 Erfahrung
2.3 Planung
Syracuse
3.1 Der Mann von La Mancha
3.2 Aufwind
Prag
4.1 Verdacht
4.2 Recherche
Cali
5.1 Das Tal
5.2 Gewitter
5.3 Cumbia
5.4 Das Licht
Berlin
6.1 Koalition
6.2 Russischer Frühling
Akademgorodok
7.1 Das Birkenrindenmuseum
7.2 Austausch
7.3 Währungswechsel
7.4 Der Oligarch
Tokay Mura
8.1 Anreise
8.2 Vision
8.3 Orbit Queen
8.4 Tsunami
Pflegeheim
Kapitel 1
Klostersee
„Glänzende Oberfläche – innen Müll“, knurrte Gregor Sanders und feuerte den ‘Spiegel’ ins Gebüsch.
„Hola, Schatz“, lachte Britta und kniff ihn in den mittleren Ring, der sich neuerdings zwischen Rippen und Hüfte vordrängte, „seit wann so zornig auf Dein Leibblatt?“
„Das mein’ ich doch nicht, ’s is nur die dämliche Reklame, schau her.“
Er angelte das Magazin aus dem Ginsterstrauch und hielt ihr die Hochglanz-Anzeige mit dem Party-Mädchen vor die Nase: „Verschaff Dir Respekt. Zeig Deine starke Seite. Das neue Super-Handy M66 wird Dich mit seinem markanten Design und seinen Dynamic Lights durch die Nacht begleiten. Spür die Kraft der Evolution. Be inspired.“
Sie verdrehte die Augen: „Ich versteh’ Dich nicht. Immer wieder ärgerst Du Dich mit Wonne über Werbung. Nimm den Schwachsinn einfach nicht mehr wahr. An mir läuft das schon lange ab. Jetzt machst Du wieder Dein finsteres Gesicht, und dabei ist der Tag so schön.“
Sie stand auf und streckte sich. Er schaute von unten zu ihr hoch, lächelte und entspannte. Der Tag war wirklich schön, besonders mit ihr, wie sie so dastand in der Sonne: straffe Figur, nahtlos braun vor dem blauen See, an dessen fernem Nordende sich die schiefergedeckten Barockkuppeln des Klosters über die hohen, tiefgrünen Weiden hoben. Sie waren jetzt 19 Jahre miteinander verheiratet, und noch immer war sie so schön wie in jenen Tagen, als sie sich am Strand von Viña del Mar kennengelernt und ineinander verliebt hatten.
„Du hast ja recht. Aber das Werbegeschrei hämmert’s mir so ins Gemüt, in welche Sackgasse wir alle rennen. Drum reg’ ich mich immer wieder auf. Doch jetzt Schluss mit Sich-Ärgern.“ Er sprang auf die Füße und nahm ihre Hand: „Komm, wir schwimmen.“
Drei Tritte die Böschung hinunter, und sie warfen sich ins warme Wasser. „Heute ist der See besonders klar. Schau, wie unsere Ringe unter Wasser in der Sonne blitzen.“
„Ja“, lachte er, „und besonders schön ist es, nur die Ringe anzuhaben.“
Sie küssten sich und schwammen in langen, gleichmäßigen Zügen aus der Badebucht mit den Gummibooten der fröhlich lachenden und plantschenden Kinder hinaus auf die weite, schimmernde Seefläche. Sonne, Mensch, Natur, und das herrliche Gefühl der Freiheit beim Gleiten durch das Wasser.
„Ich hab’s“, rief er plötzlich.
„Was hast Du? Wieder ’ne Idee, wie man Werbung sabotieren könnte?“, neckte sie.
„Ach was. Ich habe den Namen für unser Projekt: Die Schwingen der Freiheit.“
„Kannst Du gar nicht abschalten? Und was für ein Projektname: Die Schwingen der Freiheit.“ Sie dehnte die letzten Worte, und dann spöttisch: „Klingt ziemlich nach Rosamunde Pilcher.“
„Du bist gemein. Meinen schönen Namen gleich in den Schmonzetten-Topf zu schmeißen.“ Er schwamm auf sie zu, fasste sie um die Taille, stemmte sie halb aus dem See und warf sie rückwärts ins Wasser. Weitere Angriffe wehrte sie lachend mit Fußfontänen ab. Schließlich tauchte er unter, kam neben ihr wieder hoch, zog sie an sich, und ihre Lippen verschmolzen. Sie sanken unter die Wasseroberfläche, ließen sich los, tauchten prustend wieder auf.
„Da vorn ist’s flacher.“ Ihre Augen blitzten, sie ergriff seine Hand und schwamm in Richtung Ufer bis er stehen konnte. Dann umschlang sie ihn.
Später, auf der Heimfahrt, fragte Britta: „Ist es dir ernst mit dem Projektnamen?“
„Ja, warum nicht?“
„Also, ich will mich ja nicht wiederholen....“
„Ooch“, grinste er, „wir können ja noch mal alles wiederholen.“
„Pass auf die Straße auf“, rief sie und schob seine Hand von ihrem Schenkel, „jetzt wird Auto gefahren.“
„Oder auch nicht“, erwiderte er, zog den Wagen durch die beiden letzten Kurven, die auf die Höhe führten, und bog in den Parkplatz ein.
„He Greg, was soll das?“, protestierte sie.
„Du hast wieder angefangen mit dem Projekt. Jetzt spinnen wir’s weiter.“
„Ach so. Und wo willst Du hin?“
„Auf die Bank am Hang, vor dem Trockenrasengebiet.“
Sie kannte ihren Mann. Wenn er entspannt war und dann eine Idee hatte, war er schwer zu bremsen. Außerdem liebte sie die Bank über dem Fluss. Jetzt, Ende Juni, würde es erst in drei Stunden dunkel werden, da konnten sie nochmal in Ruhe über die Pläne reden, mit denen sie nach ihrer Guatemala-Reise Gregor geimpft hatte, die seitdem in seinem Kopf spukten und inzwischen weit gediehen waren. Die Kinder waren heute nicht mitgekommen. Sie hatten sich mit Freunden verabredet, bei denen sie auch übernachten würden. Also spielte es keine Rolle, wann sie heimkämen.
„Also gut“, entschied sie „gehen wir. Und schließ den Wagen ab.“
Nach 15 flott gegangenen Minuten gab der Kiefernwald den Blick frei auf eine der schönsten unbekannten Landschaften Deutschlands.
Steil fällt der Hang über mehr als 100 Meter zum Fluss hinunter. Oben mit Schlehdorn, Hartriegel und niedrigen Kiefern bewachsen, zwischen denen der Diptam blüht, trägt er Rebstöcke im unteren Drittel, deren Grün heraufleuchtet. Am Fuß des Steilabfalls läuft die Straße parallel zum Fluss, der von Norden kommend sich in weitem Bogen nach Westen schwingt. Jenseits des Flusses steigen Dörfer, Gärten und Felder in langen Wellen zu den Waldbergen am Horizont auf, denen die Sonne entgegensinkt und das Land mit goldenem Licht überschüttet. Rechts schimmert der Klostersee, auf dessen Uferweg noch winzige, braune Gestalten wandeln.
Sie setzen sich auf die Bank. Sie legt ihren Kopf an seine Schulter. „Wir leben hier in unserem Land auf einer Insel der Seligen, und die wenigsten wissen es“, flüstert sie.
„Und wie lange noch?“, fragt er in die Landschaft. Unten auf dem Fluss begegnen sich zwei Frachtkähne.
„Du meinst also, du hättest den richtigen Namen für unser Projekt“, eröffnet sie schließlich das Gespräch, von dem sie weiß, dass es lange dauern wird.
„Ich glaube schon. Und der richtige Name ist wichtig, um die richtigen Verbündeten zu gewinnen. Aber wem sag ich das. Schließlich hast Du ja die Idee von Deiner Frauen-Tour mitgebracht.“
Sie denken beide zurück an den Januar vor zwei Jahren: er, wie er auf ein Fax oder eine E-Mail von ihr gewartet hatte, sie an ihre Begegnung mit den Frauen von „Mujeres del Mundo“ in Guatemala-Stadt und ihre anschließende Reise durch das Land mit Adelgard, Carol und Carmen.
Sie und Adelgard waren vom Weltladenverband gebeten worden, als Beobachterinnen am zweiten Weltfrauenkongress („Congreso Mujeres del Mundo“) in Guatemala teilzunehmen.
Der „Primer Congreso Mujeres del Mundo“ war zwei Jahre zuvor in Buenos Aires von den Müttern und Witwen der während der Militärherrschaft Verschwundenen ausgerichtet worden. Den zweiten Kongress hatte die Witwenorganisation Guatemalas übernommen. In ihr hatten sich die Maya-Witwen der Männer zusammengeschlossen, die während des zwanzigjährigen Bürgerkrieges entführt, gefoltert und ermordet oder auch bei Gefechten in den Bergen umgekommen waren. Hauptthema beider Kongresse war die Stellung der Frau in den Gesellschaften der Entwicklungsländer. Natürlich lag der Schwerpunkt noch auf Lateinamerika, aber in Guatemala waren auch schon einige Frauen von den Philippinen und aus Angola mit dabei. Und eine der drei Nachmittagssitzungen war dem Thema „Frauen in den Industrie- und Entwicklungsländern: Die ökonomischen Grundlagen gleichberechtigter Partnerschaft“ gewidmet.
Das scheinbar trockene Thema hatte die erste Universitätsabsolventin der Mayas, Luz-Elena Flores, zusammen mit Carmen Mendoza aus Medellin durchgesetzt. Mit einem Stipendium der privaten deutschfranzösischen Stiftung „Maiskorn“ hatte sie Tropen-Agrarwirtschaft studiert und vor einem Jahr ihre Ausbildung als Ingeniera abgeschlossen. Jetzt war sie die stellvertretende Leiterin einer Maya-Kooperative, die über die Organisationen des Fairen Handels ihre Produkte vermarktete. Während ihres Agrarpraktikums auf einer Zuckerrohr-Hacienda im kolumbianischen Valle del Cauca hatte sie Carmen, die Tochter des Hacendados, kennengelernt, die in Medellin Ökonomie studierte. Die beiden jungen Frauen hatten bald erkannt, dass sie, obwohl ganz unterschiedlichen sozialen Schichten entstammend, die Ursachen der Probleme ihrer Länder ganz ähnlich sahen: Korrupte politische Eliten, die das Ausland nachäfften und kein Interesse an einer wirtschaftlichen Entwicklung hatten, die auch nur eines ihrer Privilegien angetastet hätte. Sie waren schnell Freundinnen geworden und „Mujeres del Mundo“ bald nach der Gründung beigetreten.
Die Hoffnung, dass Männer in ihren Ländern etwas bessern könnten, hatten sie schon lange aufgegeben. Sie wussten aber auch, dass einheimische Frauen allein an den Machtstrukturen der Macho-Gesellschaften nichts ändern konnten. Sie waren auf Hilfe von außen angewiesen. Darum hatten sie im Organisationskomitee des „Segundo Congreso Mujeres del Mundo“ vorgeschlagen, dass auch Beobachterinnen aus Europa und Nordamerika eingeladen würden und schließlich Erfolg gehabt, nicht zuletzt mit dem Hinweis, dass „Mujeres del Mundo“ durchaus ja auch die Frauen aus dem reichen Drittel der Menschheit einschlösse. Sie hatten sich dann an die ökumenischen Büros der Kirchen beider Kontinente gewandt, die die Aktivitäten für Entwicklung, Gerechtigkeit und Frieden koordinierten. In Verbindung mit den einschlägigen Nichtregierungsorganisationen hatten diese dann fünf Frauen aus Europa und Nordamerika gebeten, an dem Kongress teilzunehmen und darüber zu berichten.
Adelgard und Britta waren von Carmen am Flughafen abgeholt worden, zusammen mit Carol Hull aus Syracuse, N.Y., deren Maschine kurz nach ihrer gelandet war. Im Taxi auf der Fahrt in die Innenstadt verstanden sich die vier Frauen auf Anhieb. Verständigungsschwierigkeiten gab es keine, denn wie Britta sprachen auch Carol und Adelgard von früheren Lateinamerika-Aufenthalten her fließend Spanisch. Nach den Sitzungen saßen sie, meist auch mit Luz-Helena, lange zusammen und diskutierten darüber, wie man das Grundproblem wirtschaftlicher Entwicklung – ausreichende Produktion und gerechte Verteilung – in der Welt, so wie sie nun einmal ist, lösen könnte.
Der Kongress schloss mit einem Gottesdienst, der von einem Pfarrer der lutherischen Gemeinde Guatemalas und vom Nachfolger von Bischof Juan Gerardi gehalten wurde. Bischof Gerardi war kurz nach der Veröffentlichung seines Berichts über Menschenrechtsverletzungen während des Bürgerkriegs vor seiner Haustür erschlagen worden. In den Fürbitten wurde besonders der von der burmesischen Militärdiktatur in Einzelhaft gehaltenen Friedensnobelpreisträgerin An Suu Kyi gedacht.
Am Abend zuvor waren Carol, Carmen, Britta und Adelgard übereingekommen, noch 14 Tage lang gemeinsam durchs Land zu reisen und Selbsthilfe-Initiativen zu besuchen, die von den guatemaltekischen Kongress-Teilnehmerinnen vorgestellt worden waren. Luz-Helena konnte nicht mit von der Partie sein. Sie musste noch die Kongress-Abrechnungen machen und dann sofort zurück auf ihre Kooperative. Aber natürlich hatten sie Luz-Helena dort besucht, und waren, wie auch bei den anderen Projekten, tief beeindruckt von der Gastfreundschaft und Freundlichkeit der Campesinos und der Zähigkeit, mit der diese um ihre wirtschaftliche Selbständigkeit kämpften. Amüsiert-beeindruckt stellten sie fest, dass praktisch überall die Männer eingesehen hatten, dass es besser für die Gemeinschaft war, wenn das Geld von den Frauen verwaltet wurde. Die Gedenktafeln zur Erinnerung an die Rechtsberater, Lehrer, Nonnen, Priester und Katecheten, die sich für die Campesinos und ihre Unabhängigkeit eingesetzt hatten und von Auftragsmördern umgebracht worden waren, hatten sie erschüttert.
Die Sanders redeten nochmals so ausführlich über diese Dinge wie damals nach Brittas Rückkehr. Ausreichende Produktion und gerechte Verteilung. Das traf genau den Kern des Problems, das ihn umtrieb, seit eine missglückte Reform nach der anderen Deutschland immer tiefer in die Krise trieb. Weitere Verschlechtbesserungen drohten, orientiert – je nach ideologischer Präferenz – an einer der sich widersprechenden ökonomischen Theorien, zu denen neue Erkenntnisse scheinbar nicht passten. Ihm ging nicht mehr aus dem Kopf, was sie damals gesagt hatte: „Man müsste ein großes, internationales Projekt aufziehen, das die technischen, wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen, machtpolitischen und psychologischen Aspekte von Wachstum und Gerechtigkeit global untersucht und dann das als richtig Erkannte politisch durchsetzen hilft.“ Das nannten sie kurz „Unser Projekt“. Und weil sie wussten, dass die Leute zu 80 Prozent aus dem Bauch heraus entscheiden und es deshalb so entscheidend auf die Verpackung ankommt, hatten sie während der zweijährigen Vorbereitung auf die Petersberg-Konferenz im September immer wieder nach einem Namen für das Projekt gesucht, das auf der Konferenz angeschoben werden sollte. Alle bisherigen Vorschläge, die sie noch einmal durchsprachen, waren entweder zu allgemein und abgegriffen oder zu speziell und trocken.
Britta blickte hinüber zum Klostersee. Ein Reiher segelte über das dunkel gewordene Wasser. In der Höhe kreiste ein Bussard mit weit ausgebreiteten Schwingen, und über den dämmernden Himmel zogen die Jets die schlanken Pinselstriche ihrer Kondensstreifen, denen eine untergegangene Sonne noch ihr goldenes Leuchten lieh. „Die Schwingen der Freiheit“, sinnierte sie halblaut, „vielleicht doch nicht so schlecht.“ Sie lächelten sich an, standen auf und gingen zum Auto.
„Eine Fahrt durch durch die Waschstraße würde dem Wagen auch nicht schaden“, bemerkte Britta beim Einsteigen auf dem Parkplatz. „Ach, das hat noch Zeit. Außerdem soll es nächste Woche regnen. Das reicht“, meinte Gregor. Doch die Vogelgrüße auf der Frontscheibe verlangten eine Sofortmaßnahme, die er mit dem Rest aus ihrer Mineralwasserflasche und dem Scheuerschwamm fürs Grobe erledigte.
Als er mit einem Papiertuch gerade nachwischte, bog ein Mietwagen in den Parkplatz ein und hielt hinter ihnen. Zwei freundlich lächelnde, schwarzhaarige, junge Männer stiegen aus und baten in gebrochenem Deutsch um Auskunft über den kürzesten Weg in die Kreisstadt mit dem Zementwerk und der Moschee. Sie seien Omar aus Bagdad und Hassan aus Riad und am Nachmittag auf dem Flughafen Frankfurt eingetroffen. Auf dem Weg nach München wollten sie den Onkel von Hassan besuchen. Er sei der Iman der islamischen Gemeinde, aus der viele in dem Zementwerk arbeiteten.
„Gregor, lass uns den beiden den Weg zeigen“, schlug Britta vor. „Die Gemeinde kennen wir doch seit ihrem Tag der Offenen Tür. Das waren alles nette Leute. Und so groß ist der Umweg für uns ja nicht.“
Nach der Ankunft bei der Moschee mitten im Industriegebiet bedankten sich die beiden Araber vielmals für den Lotsendienst. Sie erzählten noch, dass Omar in München eine Stelle als Fertigungsingenieur in der Magnetschwebebahn-Produktion antreten wolle. Auch sein Freund Hassan könne als Elektronik-Techniker dort arbeiten – allerdings habe er auch ein attraktives Angebot aus den USA. Man müsse sehen. Auf jeden Fall würden sie sich jetzt dank der freundlichen Hilfe in Deutschland schon nicht mehr so fremd fühlen.
Während der Heimfahrt dachten Britta und Gregor zurück an ihre Zeit in Chile und wie ihnen gerade damals freundliche Fremde geholfen hatten, schnell heimisch zu werden. Während die Lichtbalken der Autoscheinwerfer durch die Kurven der nächtlichen Straße schwenkten, sinnierte Gregor: „Wie Omar und Hassan wohl zurecht kommen werden?“
Viele Jahre später würden er und die beiden Araber – ohne voneinander zu wissen – eingebunden sein in das Drama, das im großen Umbruch des 21. Jahrhunderts die Entwicklung zum Besseren einleiten sollte.
Kapitel 2
Petersberg
2.1 Theorie
ÖKONOMISCHES FORUM
BETTER ECONOMICS – BETTER WORLD
MEILLEURE ECONOMIE – MEILLEUR MONDE
MEJOR ECONOMIA – MEJOR MUNDO
MIGLIORE ECONOMIA – MIGLIORE MONDO
LUTSCHSCHAJA EKONOMIKA – LUTSCHSCHIJ MIR
BESSERE ÖKONOMIE – BESSERE WELT
stand in den Farben des Regenbogens über dem Eingang zum Kongresszentrum auf dem Petersberg. Die Konferenzteilnehmer waren nach der Eröffnungssitzung ins Freie getreten und kommentierten mit Kaffeebechern in der Hand die Eröffnungsansprachen. Nach der Begrüßung durch Alfred Stahl, Geschäftsführer der Werner-und-Elfriede-Hartmann-Stiftung, die zu der Konferenz eingeladen hatte und sie finanzierte, war Gregor Sanders, der Vorsitzende des Organisationskomitees, erfreulich kurz auf die Vorgeschichte und das Programm der Konferenz eingegangen und hatte sie dann vor dem Beginn der ersten Arbeitssitzung noch einmal für 15 Minuten auf die Aussichtsterrasse entlassen mit ihrem herrlichen Blick auf das Rheintal und die schon leicht herbstlich bunten Wälder auf seinen Hängen. Im Nordwesten, wo das Tal in die Ebene übergeht, ahnte man Bonn.
Die Glocke rief ins Plenum. Den ersten Plenarvortrag hielt Frederick Greenbam von der Manchester School of Social Sciences über das Thema: „Der Zusammenbruch des Sozialismus und die Krise des Kapitalismus“. Seine Großeltern hatten noch 1939 den damals einjährigen Friedrich Grünbaum aus Wien über Ungarn nach England retten können. Die Eltern waren von den Nazis nach Theresienstadt deportiert worden – nie mehr hatte er von ihnen gehört. Im ersten Semester seines Studiums der Geschichte und Politischen Ökonomie war er in die kommunistische Partei Englands eingetreten. Die Niederschlagung des Ungarn-Aufstands hatte er noch als historische Notwendigkeit im Kampf gegen den Faschismus akzeptiert. Doch als die Truppen des Warschauer-Paktes den Prager-Frühling liquidierten, auf den er wie viele seiner Altersgenossen große Hoffnungen gesetzt hatte, verließ er die Partei. Seine Dissertation über die Messung wirtschaftlicher Ungleichheit erregte international großes Aufsehen, seine Methode fand unter dem Stichwort „Greenbam-Koeffizient“ bald Eingang in die Lehrbücher der empirischen Sozialforschung, und mit 32 Jahren wurde er an die Manchester School of Social Sciences berufen. Trotz vieler Angebote von auswärts war er Manchester treu geblieben: In der Stadt, von der die hässliche Spielart des Kapitalismus ihren Namen bezogen hatte, war es reizvoll, dagegen zu arbeiten. Außerdem hatte er in dem seit 25 Jahren laufenden Großforschungsprojekt „Die Entwicklung der wirtschaftlichen Ungleichheit in den OECD-Ländern“ ein großes Team um sich versammelt, dem Verpflanzen nicht gut getan hätte.
„Mit dem Fall der Berliner Mauer begann der Niedergang des Kapitalismus“, waren seine Eröffnungsworte. Bald alarmierte er durch die jüngsten Forschungsergebnisse auch diejenigen im Saal, die vor der Konferenz noch nichts davon gehört hatten: Während in den letzten Jahren vor der Auflösung des Ostblocks und dem Zusammenbruch der Sowjetunion der „Greenbam-Koeffizient“ in den marktwirtschaftlichen Demokratien zwischen 20 und 30 gelegen hatte und das Einkommen der reichsten Zehn-Prozent der Haushalte etwa so groß war wie das der unteren Fünfzig-Prozent, lag der „Greenbam-Koeffizient“ jetzt durchweg bei 40, und die reichsten Fünf-Prozent bezogen so viel wie die Gesamtzahl aller Haushalte der unteren Siebzig-Prozent. Die Zahl der Personen mit einem Finanz-Vermögen von mindestens einer Million Dollar war in 2002, dem letzten statistisch erfassten Jahr, weltweit um 3,6 Prozent gestiegen. Robustes Wachstum fand nur noch in der Luxus-Produktion statt, während seit zehn Jahren das Wirtschaftswachstum insgesamt bei lediglich zwei Prozent lag. Dabei schrumpfte der Mittelstand stetig, und nur der Beschäftigungssektor der niedrigen, schlecht bezahlten kleinen Dienste expandierte. Die Verhältnisse näherten sich immer mehr denen in den alten Oligarchien Lateinamerikas und den neuen Oligarchien Russlands an. Greenbam stellte die These auf, dass nach dem Wegfall des konkurrierenden, theoretisch egalitären Gesellschaftsmodells des Sozialismus der Kapitalismus in seine überwunden geglaubten Frühformen zurückfiele und die Greenbam-Koeffizienten aller Länder im Laufe der Zeit gegen die russischen und brasilianischen Werte konvergieren würden. Dass die Deutschen bei der Lastenverteilung nach der Wiedervereinigung so ziemlich alles falsch gemacht hatten, was man falsch machen konnte und dadurch ihre bis dahin vorbildliche Soziale Marktwirtschaft gerade dann diskreditierten, als andere Länder sich danach auszurichten begannen, vermerkte Greenbam mit besonderem Bedauern. Er schloss mit einem tief-pessimistischen Ausblick auf eine Welt, in der eine kleine Schicht international agierender Oligarchen Marktwirtschaft und Demokratie faktisch außer Kraft setzten und hinter einer Fassade, auf der fügsame Medien die Illusion von „Freiheit und Wettbewerb“ in schreienden Farben immer wieder neu plakatierten, die Weltwirtschaft lenkten. In den Industrieländern könnten die Leute durch Sport- und Spielshows und das Surfen im Internet noch eine Zeitlang ruhig gestellt werden, aber wenn ein sparsamerer Umgang mit Ressourcen unvermeidlich würde, erwarte er das Aufbrechen bewaffneter Verteilungskämpfe unter ideologisch-religiösen Mäntelchen wie auf den Philippinen oder in Kolumbien und Nordirland.
Nach teils höflichem, teils lebhaftem Beifall kam es zu heftigen Diskussionen. Niemand bestritt die Fakten. Dafür war Greenbams Autorität zu groß. Aber stimmten seine Schlussfolgerungen, und was waren die Ursachen für die Entwicklung?
Als nach 20 Minuten Gregor Sanders die Diskussion beenden wollte, gab es Proteste. Viele hatten noch Wortmeldungen und wollten ihren Beitrag unbedingt loswerden.
„Also gut“, schlug Sanders vor „wir können noch zehn Minuten länger diskutieren, wenn wir die Kaffeepause vor dem nächsten Vortrag auf fünf Minuten verkürzen.“
Das wirkte wie immer. Eine deutliche Mehrheit war bei der Abstimmung für Schluss der Debatte, und man ging in die Kaffeepause. Für danach war im Konferenzprogramm der Vortrag „Energie und Ökonomie“ mit dem Referenten Jan van Oisterhuiz vom Physikalisch-Chemischen Laboratorium der Rijksuniversiteit Utrecht angekündigt.
„Ich muss ihnen leider mitteilen, dass Jan van Oisterhuiz vor vier Tagen auf der Rückfahrt von einer Konferenz in Siena einen Herzinfarkt erlitten hat und auf der Intensivstation in Lugano liegt“, eröffnete Gregor Sanders, sichtlich bewegt, die nächste Sitzung. „Auf der Siena-Konferenz vor zwei Jahren hatte ich Jan kennengelernt, und es sind nicht zuletzt die Arbeiten seiner Gruppe, die unsere Konferenz hier angeregt haben. Ich bin seinem Mitarbeiter, Helmut Eschenbach, sehr dankbar, dass er sich kurzfristig bereit erklärt hat, Jans Vortrag zu übernehmen. Kurz zur Person von Helmut Eschenbach: Er hat in Mannheim Betriebswirtschaft und in Rochester Physik studiert. Anschließend ist er nach Utrecht in die Energieforschungsgruppe von Jan van Oisterhuiz gegangen. Mit seinen dort angefertigten Arbeiten über Produktions- und Wachstumstheorie hat er voriges Jahr in der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Karlsruhe bei Wilhelm Eder, der Jan gut kennt, promoviert. Herr Eschenbach forscht z.Zt. im Utrechter Zweig des niederländisch-deutschen Instituts für Interdisziplinäre Studien und wird heute über seine Arbeiten mit Jan van Oisterhuiz und Wilhelm Eder berichten. Helmut, Du hast das Wort.“
Eschenbach präsentierte mit etwas Mathematik und vielen Bildern neueste Forschungsergebnisse des Projekts „Produktivität und Arbeitsmarkt“ der Europäischen Union, die gute Übereinstimmung von empirischem und theoretisch berechnetem Wirtschaftswachstum in einer Reihe von Industrieländern zeigten. Zentrales Ergebnis der computergestützten Optimierungsrechnungen war: In hochindustrialisierten Ländern werde das Wirtschaftswachstum einerseits getrieben von Investitionen in Maschinen und die zu ihrem Schutz und Betrieb benötigten Gebäude und Anlagen; andererseits trügen die jährlichen Veränderungen des Energie-Einsatzes am meisten und die der geleisteten Arbeitsstunden am wenigsten zu den konjunkturellen Schwankungen bei, wie sie beispielsweise im Zusammenhang mit den beiden Ölpreis-schocks zwischen 1973 und 1981 die marktwirtschaftlichen Industrieländer erschüttert hatten. Das quantitative Maß für das wirtschaftliche Gewicht der Produktionsfaktoren, die Produktionsmächtigkeit – ökonometrisch: Produktionselastizität – liege für Energie zwischen 50% und 60%, für die menschliche Arbeit zwischen 20% und 10% und für das Kapital bei 30%. Andererseits entfallen von den Gesamtkosten der Produktion auf die Energie nur rund 5%, auf die Arbeit hingegen der Löwenanteil von ca. 70%, und auf das Kapital, d.h. die Maschinen und Anlagen, etwa 25%. [1] Das bedeute: einer großen Produktionsmächtigkeit billiger Energie stehe eine geringe Produktionsmächtigkeit teurer Arbeit gegenüber. Darum ersetzten im Zuge wachsender Automation in immer stärkerem Maße billige Energie/Kapital-Kombinationen die teueren Arbeit/Kapital-Kombinationen. Das erkläre den Verlust vieler gut bezahlter industrieller Arbeitplätze in Europa und den USA. Im Dienstleistungssektor nähmen Beschäftigungsverhälnisse im Mindestlohnbereich zwar zu, doch unterm Strich würden die mittleren Einkommensklassen schrumpfen, die für die soziale und politische Stabilität so wichtig seien. Greenbams Warnungen habe er nichts hinzufügen. Jan van Oisterhuis habe einmal gesagt, dass ihn die Verhältnisse an das Ende der römischen Republik erinnerten: Dort war im Gefolge der gewonnenen Eroberungskriege des 2. und 1. Jahrhunderts vor Chr. die Zahl der versklavten Kriegsgefangenen in den neuen agrarischen Großbetrieben gewaltig angestiegen. Gegen die konkurrenzlos billig produzierenden Sklaven konnten die freien kleinen und mittleren Bauern, deren Produktions- und Wehrkraft die römische Republik groß gemacht hatte, wirtschaftlich nicht mehr bestehen. Sie verkamen zum Proletariat, das nach den Wirren der Bürgerkriege die Cäsaren als Stabilitätsbringer begrüßte. Heute wirkten sich Energiesklaven ähnlich aus wie damals menschliche Sklaven.
„Und was versteht man unter Energiesklaven?“, wollte ein Zwischerufer wissen.
„Danke für Ihre Frage. Genau die sollte jetzt kommen“, antwortete Eschenbach, und alle lachten.
„Also, die Zahl der Energiesklaven eines Wirtschaftssystems berechnet sich aus dessen mittlerem täglichen Primärenergieverbrauch, dividiert durch den menschlichen Energiebedarf von 2,9 Kilowattstunden (kWh) pro Tag bei schwerer körperlicher Arbeit.“
Viele Zuhörer schauten so irritiert drein, dass Eschenbach nachlegte: „Ich würde gerne ein paar Beispiele vorrechnen. Aber ich habe meine Zeit schon überzogen. Möglicherweise wird Herr Pflügli am Nachmittag noch etwas dazu sagen. Drum hier nur Ergebnisse: Die Zahl der Energiesklaven pro Kopf der Bevölkerung beträgt zur Zeit in den USA 92, in Deutschland 45, im Weltmittel 15, und im Durchschnitt der Entwicklungsländer 6. Das passt zur globalen Wohlstandsverteilung, und das ist kein Zufall. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“
Der erste Diskussionsbeitrag kam von einem Redakteur der Allgemeinen Finanz-Zeitung, AFZ, der gleich in die Vollen ging: „Was Sie uns da erzählt haben, muss falsch sein. Die von Ihnen als Produktionsmächtigkeiten bezeichneten Produktionselastizitäten von Kapital, Arbeit und Energie müssen den Kostenanteilen dieser Produktionsfaktoren gleichen. Das können Sie in jedem Lehrbuch der Ökonomie nachlesen. Wenn dem nicht so wäre, dann läge das Geld ja auf der Straße. Man bräuchte sich nur zu bücken, d.h. Arbeit durch Energie zu ersetzen, und es aufheben, d.h. riesige Gewinne machen. Warum tun wir das nicht?“
„Ja genau das wird doch getan“, war Eschenbachs Antwort, „nur nicht auf einen Schlag. Der Automationsfortschritt, der der Energie immer breitere Einsatzfelder erschließt und immer mehr Energiedienstleistungen ermöglicht, braucht seine Zeit. Denken Sie nur daran: Als die maschinelle Informationsverarbeitung noch per Elektronenröhre betrieben wurde, wäre ein Rechner von der Leistungsfähigkeit Ihres Laptops ein viele Tonnen schweres, energiehungriges Monster von der Größe eines Mehrfamilienhauses gewesen. Doch seit der Einführung des Transistors und seiner Mikro- und Nanostrukturierung ersetzen immer mehr und immer dichter gepackte Informationsprozessoren im Verbund mit Wärmekraftmaschinen, den Arbeitspferden unserer Industriegesellschaft, des Menschen Hirn und Hand, so dass wir inzwischen Automobilfabriken haben, die praktisch vollautomatisch arbeiten. Sie brauchen nur noch ein paar Leute zum Drücken der Schalter, die die Energieströme in die Maschinen leiten. Und im Bankensektor werden ganze Kreditabteilungen durch einen Angestellten am Desktop-Computer mit Evaluations-Software ersetzt. Natürlich schreitet die Automation nicht in allen Wirtschaftsbereichen gleich schnell voran, zu unterschiedlich sind die Aufgaben und Anforderungen, und dann gibt es da auch noch ein paar hemmende Sozialgesetze. Aber im Prinzip sollte es nicht mehr lange dauern, bis die allermeisten Routinearbeiten von energiegetriebenen Generatoren, Motoren und Transistoren erledigt werden können. Jedesmal, wenn ein Unternehmen Fortschritte in dieser Richtung macht und wieder einen Teil seiner Belegschaft entlässt, steigt sein Kurswert an der Börse. So wird das Geld auf der Strasse immer schneller von den großen Energiesklavenhaltern aufgehoben, die die Verfügungsmacht über die Produktionsanlagen haben. Und alle Produktionsanlagen sind letztendlich Energieumwandlungsanlagen, in denen menschlicher Erfindergeist gespeichert ist.“
Zornig erregt schloss sich der zweite Diskussionsredner dem ersten Kritiker an: „Ich bin Professor Helmfurth. Was hier als Wissenschaft verkauft wird, ist ein typischer URUR-Effekt von Computerrechnungen: Unsinn Rein, Unsinn Raus. Ihre Theorie widerspricht den Grundlagen der modernen Wirtschaftstheorie. Sind Sie gescheiter als alle Ökonomie-Nobelpreisträger zusammen? Die vielsprachigen Sprüche unter der Ankündigung ‘Ökonomisches Forum’ auf dem Regenbogentransparent über dem Eingang ließen mich sowieso schon vermuten, dass es sich hier um eine Versammlung von – ich sag’s mal lieber auf Italienisch – Sapientones handelt. Es ist für Wirtschafts-Fachleute schon sehr betrüblich, dass immer mehr Individuen aus anderen Fächern daherkommen, mit selbst gebastelten, völlig inadäquaten Instrumenten auf dem weiten Feld der Ökonomie herumackern, und apodiktische Urteile über eine Wissenschaft fällen, von der sie nichts verstehen. Wer glauben Sie, wer Sie sind, Sie – Herr?!“ Und damit stürmte er aus dem Saal.
Nach betretenem Schweigen gab es dann noch eine Reihe von Fragen zu Methode, statistischen Gütemaßen und der Zuverlässigkeit der empirischen Datenbasis. Als Gregor Sanders gerade die Mittagspause verkünden wollte, meldete sich noch Frederick Greenbam, der bis dahin geschwiegen hatte. „Wenn es richtig ist, was Sie sagen, wenn also Energie wirklich der mächtigste Produktionsfaktor ist, dann würde ich verstehen, warum Karl Marx mit seiner Verelendungstheorie nicht Recht behalten hat und der Kapitalismus den Sozialismus besiegen konnte: In den letzten hundert Jahren hätte der Kapitalismus dann nicht so sehr Menschen sondern Energiequellen ausgebeutet und eine ganze Menge des daraus geschöpften Mehrwerts breiten Bevölkerungsschichten zukommen lassen. Deshalb wurde er für die Menschen im Ostblock immer attraktiver, bei denen die Bürokraten der Nomenklatura alles vermasselt haben. Aber wie wird’s in Zukunft weitergehen? Erklärt nicht Ihre Begründung für die wachsende Automation auch meine Beobachtungen wachsender Ungleichheit? Könnten wir etwas dagegen tun, indem wir an der Energiepreis-Schraube drehen?“
Jetzt konnte Sanders den Diskussionswillen des Auditoriums nur mit dem Hinweis brechen, dass es eine – leider oft begangene – Todsünde von Konferenzen sei, die Küche mit dem Essen warten zu lassen. Angesichts des ausgezeichneten Rufs der Petersberger Küche würden sich die Konferenzteilnehmer aber auch selbst schaden, wenn sie den Rheinischen Sauerbraten kalt werden ließen. Am Abend könne man die Diskussion im Ritterkeller ja noch fortsetzen. Mit „Der nächste Vortrag beginnt um 15 Uhr“, schloss er die Sitzung.
Die Nachmittagssitzung wurde von Frederick Greenbam geleitet. Als erster Redner sprach Rochus Pflügli vom Institut für Umweltgeschichte der Universität Bern über „Energie, Zivilisation und Treibhauseffekt“. Er zeigte, wie der zivilisatorische Aufstieg der Menschheit mit steigendem Energiebedarf pro Kopf und Tag einherging. Bei den Jägern und Sammlern vor einer Million Jahren lag dieser Bedarf bei 2 kWh, nach der Zähmung des Feuers bei 6 kWh. Seit dem Beginn der gegenwärtigen Warmzeit vor zehntausend Jahren, als im Zuge der neolithischen Revolution Ackerbau und Viehzucht den Zugriff des Menschen auf die solaren Energieflüsse erheblich erweiterten und die von Bauern und Handwerkern getragenen agrarischen Hochkulturen entstanden, stieg er auf 14 kWh vor 7000 Jahren und auf 30 kWh im Europa des Mittelalters. Die Erfindung der Dampfmaschine im 18. Jahrhundert durch James Watt löste die industrielle Revolution aus und erschloss der Menschheit die fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas. Diese stellen nunmehr im Verbund mit Otto- und Dieselmotoren, Dampf- und Gasturbinen sowie Öfen und Reaktoren jedem Einwohner der reichen Industrieländer für Ernährung, Güterproduktion und Dienstleistungen 100 bis 300 kWh pro Tag zur Verfügung. Im Weltmittel und in den Entwicklungsländern sind die Beträge deutlich kleiner. [2] Daraus erhalte man die von Herrn Erschenbach am Vormittag genannten Energiesklaven-Zahlen. Kehrseite der Medaille sei, dass die Ausscheidungen aller Energiesklaven die Umwelt belasten; insbesondere führten die Kohlendioxid-Emissionen wegen des Treibhauseffekts zu höheren mittleren Temperaturen der Erdoberfläche. Wegen der physikalisch unvermeidbaren Emissionen bei jedem Energieumwandlungsprozess gebe es auf der Erde unüberwindbare Grenzen für das Wirtschaftswachstum, das für die Stabilität unserer Industriegesellschaften so wichtig geworden sei. Nicht verschweigen wolle er in diesem Zusammenhang allerdings, dass sehr namhafte und politisch einflussreiche Wirtschaftswissenschaftler abgeschätzt hätten, dass von einem Klimawandel im Wesentlichen nur die Landwirtschaft betroffen sei, und wenn deren Produktion um 50 Prozent einbräche, bedeute das lediglich einen Verlust von maximal 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), da die Landwirtschaft zum BIP der Industrieländer ja nicht mehr als 3 Prozent beitrage. Diesen Verlust könne man durch Wachstum im Industrie- und Dienstleistungssektor locker wettmachen (Zwischenruf aus dem Publikum: „Statt Kartoffel-Chips essen wir dann Computer-Chips?!“), so dass man am besten den wirtschaftlichen Fortschritt nicht durch Maßnahmen zur Eindämmung des Treibhauseffekts behindern solle. Es sei ökonomischer, wenn sich die Leute an die Folgen des Treibhauseffekts anpassten. [3]
Nachdem Pflügli die Empörung seiner Zuhörer mit der wiederholten Beteuerung gedämpft hatte, dass er nur die Meinung der sehr namhaften Ökonomen referiert habe, ohne sie zu teilen, schlug Greenbam vor, gleich den Vortrag „Natur und Wirtschaft“ von Francois Vitoux, Centre des Etudes Economiques, Fontainebleau, anzuschließen.
Vitoux legte dar, dass sich die moderne Ökonomie eigentlich nicht für die physische Sphäre der Produktion sondern fast ausschließlich für das Verhalten der ökonomischen Akteure interessiere. Fundamentale Naturgesetze wie die von der Erhaltung der Energie oder der Zunahme der Entropie spielten in der Wirtschaftswissenschaft praktisch keine Rolle. Deshalb könne sie auch so tun, als sei die Wirtschaft ein Perpetuum Mobile, das Wertschöpfung aus dem Nichts dank eines gütigen Phantoms, genannt „Technischer Fortschritt“, schaffe. Man spräche auch von „Manna vom Himmel“. „Ach, jetzt ahne ich, wie es zu den von Pflügli zitierten Ansichten kommt“, meinte danach einer, der sich zuvor besonders aufgeregt hatte.
Das Folgereferat „Theorie der ökonomischen Evolution“ von Erich Wetter, Abteilung Ökonomie des Max-Planck-Instituts für Evolutionsforschung, Dresden, vertiefte Vitoux’ Ausführungen und betonte die Notwendigkeit, die naturgesetzlichen Beschränkungen, denen die Nutzung der Material- und Energieressourcen unterliegt, in alle Theorien ökonomischer Entwicklung miteinzubeziehen. Im übrigen seien die Theoretiker in der Nachfolge Adam Smiths davon überzeugt, dass vollkommene Märkte mit vollkommenem Wettbewerb völlig gleichberechtigter und gleichinformierter Akteure dann am effizientesten funktionierten und zu optimaler Wirtschaftsentwicklung führten, wenn der Staat sich weitestgehend heraushalte. Zugleich wüssten sie aber, zumindest die Klügeren von ihnen, dass es den vollkommenen Markt in unseren Tagen nicht mehr gibt. Darum müsse der Staat selbstverständlich mit gesetzlichen Rahmenbedingungen und Aufsichtsbehörden wie dem Kartellamt dafür sorgen, dass die Wirtschaft dem Allgemeinwohl dient. Er beschrieb dann den Homo Ökonomikus und die sehr unterschiedlichen Modellierungen des menschlichen Verhaltens auf Märkten, die zu den sich häufig widersprechenden wirtschaftspolitischen Empfehlungen der verschiedenen ökonomischen Denkschulen führten. Ein Erliegen des Wirtschaftswachstums durch Erreichen einer Bedarfssättigung würde jedoch von allen aufgrund des Sayschen Theorems ausgeschlossen, demzufolge jedes Angebot seine Nachfrage schaffe. Allerdings, so schloss er nachdenklich, müsse man sich schon fragen, wie weit es ethisch vertretbar sei, in den reichen Industrieländern mittels immer aufwändigerer Werbung immer neue Bedürfnisse zu wecken und mit knapper werdenden Energie- und Umwelt-Ressourcen zu befriedigen, während zwei Drittel der Menschheit kaum ihren Hunger stillen könnten [4].
Nach dem Abendessen lösten einige Konferenzteilnehmer ihre Sitzungsverspannungen durch Laufen im Petersberger Wald. Die meisten jedoch wählten die bequemere Lockerungsmethode: den guten Rheinwein in der gemütlichen Atmosphäre des Ritterkellers. Während die Themen des Tages in Gruppen bis tief in die Nacht diskutiert wurden, zog sich das Organisationskomitee zur Auswertung und Strategiebesprechung ins Turmzimmer zurück. Helmut Eschenbach vertrat Jan van Oisterhuiz. Er und Britta Sanders warfen nochmal die schon früher diskutierte Frage auf, ob man nicht doch auch ein oder zwei traditionelle Wirtschaftswissenschaftler als Referenten hätte einladen sollen.
„Aber was hätte das gebracht?“, hielt Erich Wetter dagegen, „die wollen doch von dem, was wir heute diskutiert haben, überhaupt nichts wissen“, und Gregor Sanders erinnerte an den zornigen Ausbruch des Ökonomieprofessors, der am Vormittag die Konferenz verlassen hatte.
Doch abgesehen davon war man mit dem Engagement der Teilnehmer sehr zufrieden. Carol Hull schlug vor, zur Planungssitzung am nächsten Abend auch Frederick Greenbam hinzuzuziehen. Carmen, die nach ihrer Heirat jetzt Hernandez de Mendoza hieß, unterstützte den Vorschlag, er wurde akzeptiert, und das Komitee löste sich in Richtung Ritterkeller auf.
Dort war die Stimmung inzwischen locker geworden. Es standen ja auch schon genügend leere Wein- und Bierflaschen auf den Tischen. Aus einer Ecke schallte immer wieder Gelächter.
„Die Ökonomie ist die Königin der Wissenschaften, die alles in sich vereinigt“, erklärte gerade Greenbam. „Nur in diesem Fach können zwei Leute gemeinsam den Nobelpreis für Theorien bekommen, die einander widersprechen.“
„Da wir gerade bei der Ökonomie sind“, legte der AFZ-Redakteur nach, „kennt Ihr den Zweiten Hauptsatz der Ökonomie? Nein? So lernet denn: Nur eines ist gefährlicher als ein Ökonom – der Amateurökonom.“
„Soll das eine Anspielung auf einen der heutigen Vorträge sein?“, wollte ein Kollege wissen. Der AFZ-Mann grinste nur.
Da schaltete Wetter sich ein: „Als ich in London studierte, hatte ich einen gebürtigen Inder als Lehrer. In der ersten Stunde seiner Einführung in die Volkswirtschaftslehre motivierte er seine Studenten mit einem Beispiel aus der Reinkarnationslehre: Der gute, tugendhafte Ökonom wird als Physiker wiedergeboren, der böse, schlampige als Soziologe“.1
Britta hielt dagegen: „Neulich hing bei uns am Schwarzen Brett eine Partner-Suchanzeige: Attraktive, einfühlsame Frau sucht nach schwerer Enttäuschung zärtlichen, liebevollen, gebildeten Partner – Physiker ausgeschlossen.“
Ein junger Ökonom aus Eschenbachs Arbeitsgruppe ergänzte: „Vor kurzem war ich auf einer Konferenz, die die Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Ökonomen und Physikern ausloten sollte. Zum Schluss wurden die Konferenzteilnehmer gebeten, auf einer Pin-Wand einen Halbsatz zu ergänzen. Dieser lautete:
‘Wenn Physik auf Volkswirtschaftslehre trifft, ...’. Allgemeine, fröhliche Zustimmung fand die Ergänzung: ‘... trifft Arroganz auf Ignoranz.’ Dabei war allen klar, dass man es genauso gut auch anders herum hätte sagen können.“
So ging es weiter durch die Berufe. Als es dann etwas derber wurde – so fragte ein Energietechniker: „Welchen Beruf hatte der liebe Gott bei der Erschaffung des Menschen?“ und lieferte, da niemand was sagte, die Antwort: „Bauingenieur. Wer sonst legt einen Abwasserkanal durch das Vergnügungsviertel?“ – zupfte Britta ihren Gregor am Arm und zeigte auf die Uhr. Der dachte an das schöne, breite Bett im großzügig eingerichteten Konferenzleiter-Zimmer, murmelte zu den anderen etwas wie „Es ist spät. Wir geh’n schon mal. Morgen gibt’s viel zu tun“, und verließ mit Britta den Raum.
Als sie die Treppe emporstiegen, schmiegte sie sich an ihn. Seine Hand glitt über ihre Hüfte, die sich geschmeidig-fest unter dem dünnen Stoff ihres Kostüms bewegte. Kaum hatten sie die Tür ihres Zimmers hinter sich geschlossen, schlüpften sie schnell aus den Kleidern und traten aneinander geschmiegt ans Fenster. Unten im Tal glänzte der Rhein silbrig im Mondlicht. Dann zog ihn Britta aufs Bett: „Vien, mon amor“.
2.2 Erfahrung
Carmen Hernandez eröffnete die Morgensitzung mit: „Gestern war der Tag der Theorie. Heute wollen wir hören, wie sich wirtschaftstheoretische Vorstellungen ganz massiv auf das tägliche Leben auswirken. Als erster spricht zu uns Arthur Lion vom Energy Research Institute in Berkeley über ‘Wie Kalifornien ins Dunkel stolperte: Ideologie gegen Technologie’ “ [5].
„Kalifornien, die sechststärkste Ökonomie der Welt, stolpert ins Dunkel, weil bei der Deregulierung des Energiemarktes in den 1990er Jahren die Wettbewerbsideologen das Sagen hatten und das Wissen der Energietechniker und Energieökonomen unberücksichtigt blieb.“ Mit diesen Worten begann eine brillant-polemische Abrechnung mit den Missionaren des blinden Glaubens an „die Marktkräfte“, die den politischen Entscheidungsträgern Kaliforniens eingeredet hatten, dass Handel – in diesem Falle an Energiebörsen – der wichtigste Wohlstandsmotor sei und die dabei die technischen und ökonomischen Rahmenbedingungen der Stromerzeugung und -verteilung sträflich vernachlässigt hatten. So wurden Investitionen in den Kraftwerkspark und das Stromnetz unattraktiv, und das ganze technische System wurde immer brüchiger. Hinzu trat wachsender Strombedarf und absurde Energieverschwendung, z.B. durch das Klimatisieren von Garagen, die thermisch noch schlechter isoliert sind als die ohnehin miserabel wärmegedämmten Häuser. Als Folge kam und kommt es immer wieder zu großflächigen Netzzusammenbrüchen und Stromausfällen mit gewaltigen volkswirtschaftlichen Verlusten, für die am Ende der Steuerzahler aufkommen muss. „Leider“, schloss Arthur Lion seinen Vortrag, „macht der Rest der Welt uns Amerikanern ja inzwischen fast alles nach. Wenn sich auch in anderen Ländern Ignoranz und Inkompetenz auf dem Energiesektor breitmachen, bekommen wir allesamt einige Probleme.“
Rochus Pflügli meldete sich als Erster: „Die USA sind doch wohl deshalb der Welt größter Energieverschwender, weil dort die Energiepreise dank niedriger Energiesteuern am niedrigsten sind. Warum aber wird der, wie wir gestern gehört haben, wichtigste Produktionsfaktor nicht höher besteuert, so dass mit ihm effizient umgegangen wird, wie sich das für Produktionsfaktoren gehört?“
„Darauf gibt es zwei Antworten“, erwiderte Lion. „Erstens betrachten viele einflussreiche Ökonomen Energie überhaupt nicht als einen Produktionsfaktor wie Kapital und Arbeit – und neuerdings Wissen – sondern als einen Rohstoff wie Kupfer oder Bauxit. Wenn ein Rohstoff knapp wird, so sagen sie, sorgt der technische Fortschritt und die ‘unsichtbare Hand’ des Marktes schon rechtzeitig für Ersatz. Nun kann man zwar innerhalb naturgegebener Grenzen Energie durch Investitionen in Wirkungsgradverbesserungen einsparen. Dass aber wegen der thermodynamischen Hauptsätze Energie grundsätzlich nicht komplett durch irgendetwas anderes ersetzt werden kann, hat sich in der Wirtschaftswissenschaft noch nicht besonders weit herumgesprochen. Zweitens gehören üppige Energiedienstleistungen zu unserem ‘American Way of Life in the Land of the Free’. Gegen ihre Verteuerung würden wohl die meisten meiner Landsleute heftig rebellieren. Es wäre wohl so, als beschnitte man ihnen etwas wie, sagen wir, ‘The Wings of Freedom’.“
Britta Sanders drückte die Hand ihres Mannes.
Ein Teilnehmer aus Bristol steuerte noch Pannen-Geschichten aus dem britischen Eisenbahnsystem nach dessen Deregulierung bei, dann ging es in die Kaffeepause.
Den zweiten Vortrag einleitend sagte Carmen Hernandez, dass sie gerne erzählen würde, wie die einst blühende kolumbianische Textilindustrie durch billige Textilimporte aus China ruiniert wurde, nachdem die kolumbianische Regierung auf Drängen der USA dem freien Welthandel zuliebe die Zollbarrieren gesenkt hatte, und wie die kleinen kolumbianischen Kaffeebauern nach der Aufkündigung des Weltkaffeeabkommens durch die USA und dem Verfall der Kaffeepreise in den Rauschgiftanbau oder die Guerrilla abgedrängt wurden, doch dürfe sie den folgenden Berichten nichts von ihrer wegen des Konzerts am Abend ohnehin knapper bemessenen Zeit wegnehmen. „Zudem“, schloss sie „kommt Lateinamerikas Leiden unter den Kollateralschäden ökonomischer Theorien jetzt in dem Vortrag ‘Wie die Chicago School of Economics die argentinische Wirtschaft ruinierte’ von Carol Hull zur Sprache. Als Mitarbeiterin des Department of Ecology der Syracuse University hat Carol mehrere Jahre mit Feldstudien in Argentinien verbracht.“