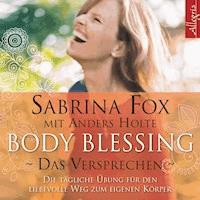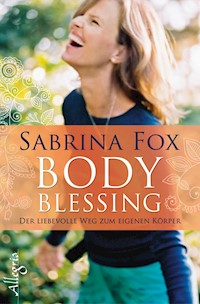12,99 €
Mehr erfahren.
Sabrina Fox, spirituelle Powerfrau und Symbolfigur der weiblichen Sinnfindung hat ihren Bestseller grundlegend überarbeitet und um zentrale Themen der letzten Jahre erweitert. Dabei geht es ihr immer auch um die Frage: Betrachten wir unser Leben mit den Augen der Seele oder mit den Augen der Persönlichkeit? Unter diesem Gesichtspunkt beleuchtet sie alle Bereiche unserer menschlichen Erfahrung – Kindheit, Beziehungen, Selbstliebe, die Sprache des Körpers, Achtsamkeit, Mut und Ängste, Leben und Sterben – und zeigt auf, wie wegweisend es ist, die eigene Intuition als Sprache der Seele zu erkennen. Ihre voll Wärme und Offenheit dargelegten Bekenntnisse inspirieren, auf sich selbst zu hören. Denn wenn wir unser Leben im Außen verändern möchten, müssen wir im Inneren anfangen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Originalausgabe
Copyright © 2016 Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Uno Werbeagentur, München
Umschlagmotiv vorne: Copyright Jorinde Gersina
Lektorat: Ralf Lay, Mönchengladbach
SSt · Herstellung: cb
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-17969-4V002
www.goldmann-verlag.de
»Vor allen Dingen,
konzentriere dich auf das Gute,
das Zweckmäßige und
das Erwachen deiner selbst.«
Zarathustra
Inhalt
Vorwort zur überarbeiteten Neuauflage
Die Sehnsucht meiner Seele
Sehnsucht
Vergangenheit und Vergebung
Vertrauen in das Göttliche
Stille
Unsichtbares
Intuition
Jetzt
Gefühle
Zeit und Geduld
Der Mut zur Veränderung
Ehen und Beziehungen
Kinder
Sterben
Unser Körper
Technik
Natur und Naturgeister
Angst
Seelengruppen
Kommunikation
Heiliger Raum
Dienst
Lehren
Seelenreisen
Zauber, Wunder und Gebete
Meisterschaft
Nachwort
Danke
Veröffentlichungen von Sabrina Fox
Videos von Sabrina Fox
Vorwort zur überarbeiteten Neuauflage
Es ist eine ungewöhnliche Gelegenheit, wenn man das, was man vor fast zwanzig Jahren geschrieben hat, noch einmal lesen und überarbeiten kann. Es ist fast so, als würde man in einem alten Tagebuch stöbern. Manches ist einem vertraut, manches ist überholt, manches fehlt. Mit den Jahren verändert sich viel, besonders wenn man sich dem Wachstum verpflichtet hat. Es war berührend zu sehen, dass Themen, die mich damals beschäftigt hielten, sich aufgelöst haben. Dinge, von denen ich vermutet hatte, dass sie eintreten, auch eingetreten sind. All das lässt sich rückblickend mit großer Dankbarkeit erkennen. Ja, Wachstum erleichtert das Leben enorm.
Als ich das Angebot annahm, das Buch zu bearbeiten, ging ich davon aus, dass ich vielleicht zwanzig Prozent verändern würde. Es war genau umgekehrt. Beim ersten Lesen merkte ich, dass ich eigentlich ein neues Buch schreiben werde. Ja, bestimmte Erinnerungen sind noch drin, aber alles durfte ich auf den neuesten Stand bringen. Einige Kapitel sind völlig neu geschrieben worden, andere gab es früher nicht. Über die Jahre habe ich auch einige Videos zu vielen Themen aufgenommen (am Ende des Buches finden Sie eine Liste zu relevanten Videos passend zu einzelnen Kapiteln).
Gleichzeitig bekam ich außergewöhnlich viele dankende E-Mails zu diesem Buch, das immerhin schon seit 1999 auf dem Markt ist. Bei älteren Büchern passiert das recht selten. Meistens waren es Erinnerungen von Lesern und Leserinnen, denen es einst geholfen hat, für die es rückblickend das erste spirituelle Buch war, die damals dadurch ihren eigenen Weg entdeckt hatten.
Es ist einfacher, sich einer der traditionellen Glaubensgemeinschaften anzuschließen. Feste Regeln. Eine Richtung. Viele, die schon mitmachen. Gesellschaftlich anerkannt. Und doch unterschätzen wir die männliche Autorität, die diesen Religionen vorsteht und die uns seit Jahrtausenden sagt, was wir zu glauben und wie wir zu leben haben. Gerade die weibliche Seite – immerhin die Hälfte der Weltbevölkerung – findet dort keinen gleichwertigen Platz. Viele sind in Kirchen, Synagogen, Moscheen und Tempeln, weil sie die Gemeinsamkeit schätzen, in vielem aber den Regeln und Vorgaben nicht zustimmen. Wir können erahnen, was es wirklich bedeuten würde, wenn alle Religionen ihre Macht und ihren Anspruch auf Unfehlbarkeit ablegen würden.
Sind wir selbstständig genug, erwachsen genug, interessiert genug, um uns selbst zu fragen, was wir glauben? Es fordert mehr persönlichen Einsatz, wenn man sich seinen Glauben basierend auf seinem eigenen Weltbild, seinen eigenen Erfahrungen und seiner eigenen Intuition zusammenstellt. Was glaube ich? Was glaube ich nicht? Was macht für mich Sinn? Was kann ich wie integrieren? Was möchte ich weitergeben?
Wenn wir der Sehnsucht unserer Seele folgen, dann entsteht ein intimeres Verhältnis zu uns selbst und zum göttlichen Ganzen. Jeder Schritt ist ein Schritt in ein neues Land. Eines, das sich unter unseren Füßen, in unserem Herzen und in unseren Gehirnen entwickeln darf.
In diesem Buch beschreibe ich meine Erfahrungen, die mein spirituelles Leben geprägt haben. Es möchte einfach nur Inspiration sein, dem eigenen Seelenweg zu folgen. Wohlgemerkt dem eigenen – und nicht meinem. Ich lasse mich gerne inspirieren – doch die Entscheidung ob und was ich übernehme, überlasse ich niemand anderem. Es ist unpraktisch jemandem zu folgen, denn dadurch verliert man seinen eigenen Weg.
Wir lernen dazu. Lernen hat oft den Beigeschmack von ungeliebter Arbeit. Wir müssen üben, werden hin und wieder versagen, probieren es eben noch einmal. Doch Lernen ist auch Freude. Während wir als Kinder sprechen gelernt haben, waren wir froh, als wir uns Wort für Wort besser mitteilen konnten. Wenn wir in einer Fertigkeit besser werden, dann haben wir auf diesem Gebiet mehr Spaß. Das ist mit dem Leben genauso: Jeder hat die Möglichkeit, sich auf ein Niveau von mehr Leichtigkeit hinzuentwickeln. Ich liebe es zu lernen. Als Lehrer erzähle ich von Dingen, die ich schon weiß. Als Schüler darf ich Neues erfahren – und das ist für mich enorm spannend und macht das Leben erst lebenswert.
Schon die Erstauflage dieses Buches, für die ich zusammengefasst hatte, was ich bis dahin lernen und erfahren durfte, empfand ich als eine Art gesammelte Hinterlassenschaft. Ich weiß, es klingt ein wenig pathetisch – bitte sehen Sie es mir nach. In diesem Sinne habe ich es weitergeschrieben.
Ich wünsche mir von Herzen, dass dieses Buch Ihnen nützlich ist.
Alles Liebe,
Sabrina Fox
im Sommer 2016
Die Sehnsucht meiner Seele
Da war sie, die Seele, die an flüssiges Blau erinnerte. Sie machte sich bereit, noch einmal auf der Erde zu leben.
Der erste Schritt war die Trennung. Das flüssige Blau, das sich nur als »Wir« kannte, musste sich loslösen von den anderen. Das war, wie wenn man einen Tropfen aus dem Meer nimmt und ihn allein in ein großes Glas fließen lässt.
In dieses Glas ließ das Göttliche Geschenke fließen: Seelenschwestern und Seelenbrüder, ein Kind, das ihr später geboren würde. Tiere und Pflanzen, die sie an die Liebe eines unveränderten Gottes erinnern würden. Talente und Charisma. Fantasie, Humor, den Wunsch, vom Meer zu erzählen, und die genetischen Gaben und Herausforderungen ihrer Eltern.
Ihre Mutter, die ihr die Gabe des Überlebens schenken wird. Die Geduld, wieder von vorn anzufangen. Eine klare Stimme. Die Reiselust. Einen Sinn für Schönheit. Ihre Neugierde. Das Gefühl der Verantwortung. Die Möglichkeit, mit wenig auszukommen, und das Talent, sich anzupassen.
Aber mit ihr wird auch die Herausforderung kommen, sich durchzusetzen. Mutig zu sein. Grenzen zu setzen. Nicht jedem Streit ausweichen zu wollen. Nicht in einer Opferrolle zu versinken.
Ihr Vater wird ihr sein Lachen schenken, sein Aussehen, seine Lust am Leben, sein Geschick, mit den Händen zu arbeiten, die Ergebenheit für seine Freunde. Die Gabe der Passion und das Aufgehen in einer Tätigkeit. Er schenkt ihr seine Großzügigkeit und seine Ausdauer.
Aber auch die Gefahr der Oberflächlichkeit wird mit ihm kommen. Sich zu verlieren in dem, was ihm nicht guttut. Realitäten nicht ins Auge zu sehen und Unannehmlichkeiten zu ignorieren. Mit ihm kommt die Herausforderung, nicht die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Die Gewohnheit, sich in Sprachlosigkeit zurückzuziehen.
Dann kamen die Meister und Engel, die dem flüssigen Blau beizustehen versprachen.
Am Schluss, das Glas war fast voll, kam der Atem. Der Atem des Göttlichen mit der Sehnsucht nach Wachheit. Dieser Sehnsucht wird sie folgen. Manchmal nicht klar erkennend, wohin sie führen wird. Zuweilen wird die Sehnsucht wie eine Flamme leuchten und ein andermal wie ein kümmerlicher Stumpen gerade noch flackern. Aber die Liebe und die Sehnsucht danach werden sie bis zur Erfüllung begleiten.
Und erst dann, wenn alle Aspekte ihres Lebens erfüllt sind, wird die Sehnsucht vergehen und dieser Wachheit weichen. Dann wird sich der Tropfen, der an flüssiges Blau erinnert, obwohl losgelöst in einem Glas auf Erden lebend, wieder eins fühlen mit dem Meer. Und das Glas – ihr Körper – wird keine Trennung mehr fühlen. Und ihr Wunsch wird es sein, von der Erfahrung zu erzählen. Andere daran zu erinnern, dass auch sie Wassertropfen aus dem unendlichen Meer des Göttlichen sind.
Mit diesem Wissen wurde sie geboren – um alles sofort wieder zu vergessen …
Sehnsucht
Der Seelenplan
Solange ich zurückdenken kann, fühlte ich diese Sehnsucht. Eine Art Einsamkeit kam dazu, die ich als sehr schmerzlich empfand. Ich fühlte mich als Außenseiterin. Als nicht dazugehörig. Ich schaute hinein zu denen, die offensichtlich wussten, wie man hineinkam, und fühlte mich fremd. Das Glas, in dem ich saß, war dick.
Meine Geburt war schwer, so erzählte mir meine Mutter. Mein Vater hatte kurz vor meiner Geburt kalte Füße bekommen und sich nach Paris abgesetzt. Meine Mutter wurde krank, und sie boten ihr das Contergan-Mittel an, das sie ablehnte. Ich kam zwei Wochen zu spät zur Welt. Fast so, als ob ich mir noch ein bisschen Ruhe gönnen wollte. Die Nabelschnur hatte sich dreimal um den Hals gewickelt, und auf meiner Haut lag das abgesetzte Fruchtwasser, was meine Mutter eher an ein Rührei als an ein Baby erinnerte. Mein Vater war wieder zurück, und als meine Mutter einen verschreckten Blick auf ihr Kind geworfen hatte, forderte sie die Krankenschwester auf, es um Himmels willen nicht ihrem Mann zu zeigen.
Ich war ein braves Kind. Still. Gehorsam. Schüchtern. Fast so, als ob ich dem Drama, in dem unsere Familie lebte, nichts hinzufügen wollte. Ich bin mit Verboten, strengen Pfarrern und was man macht und nicht macht, groß geworden. Mein Vater, der mit seinem Dasein von Jahr zu Jahr unzufriedener wurde, fing zu trinken an. Da er mit Geld nicht umgehen konnte, gab es enorme finanzielle Probleme und den gelegentlichen Besuch des Gerichtsvollziehers. Meine Mutter bekam noch zwei Mädchen, meine Schwestern Susanne und Renate, und schaffte es vorbildlich, uns Kinder mit dem wenigen, was mein Vater ihr gab, zu ernähren.
Wir lebten in einer winzigen Sozialwohnung. Wir Kinder schliefen in der Küche, und da es wenig Platz für mich gab, flüchtete ich in die Fantasiewelt der Bücher. Gleichzeitig fing ich an zu lügen.
Zuerst eher harmlose Geschichten von einem Pferd, das wir im Keller hatten. Sprachen, die keiner kennt. Reisen, die wir angeblich machten. Ich gab niemals zu, geschwindelt zu haben. Ich dachte nicht, dass ich gut genug, nett genug, schön genug, klug genug und talentiert genug war, um ganz einfach so, wie ich war, gemocht zu werden.
Wenn ich meine kleine Welt beobachtete, dann sah ich zwei Arten von Menschen: diejenigen, die zu einer Gruppe gehörten, und die, die außen herum waren. Die in der Gruppe schienen mehr Freude zu haben. Selbstbewusster zu sein. Sich sicherer zu fühlen. Zwei Lehren zog ich aus diesen Beobachtungen. Eine war, dass ich eine Gruppe brauchte, und die andere, dass ich mich dazu anpassen musste. Ich war fünfzehn, bebrillt, flach und ungeküsst. Ein Zustand, für den es einfach keine Gruppe gab.
Meine Augen wurden immer schlechter: Es gab vieles, was ich nicht sehen wollte. Besonders die Ungerechtigkeit, mit der mein Vater meine Mutter behandelte, war mir unbegreiflich. Oft mischte ich mich ein, wenn ich den lauten Streit aus dem Wohnzimmer nicht mehr ertragen konnte. Meine Mutter bat mich, ihn sein zu lassen. »Du weißt doch, wie er ist.« Immer wieder dieses »Jetzt nicht, Kind, warte, bis ein besserer Zeitpunkt kommt«. Dieses Vorsichtig-sein-Müssen, weil man nicht weiß, wie der andere reagieren wird, prägte mich sehr. Obwohl ich selbst sehr viel log, sehnte ich mich nach Wahrheit und Offenheit. Ich weiß noch gut, wie meine Mutter nach einer besonders lauten Nacht am nächsten Morgen weinend am Bett saß.
»Lass dich doch scheiden«, schlug ich als Siebenjährige vor, und meine Mutter schaute mich mit traurigen Augen an und meinte: »Aber ich liebe ihn doch.« Mit solch einer Liebe wollte ich nichts zu tun haben. Ich erkannte in diesem Moment: Mit meinen Eltern stimmte was nicht. Ihr Benehmen ist nicht ideal. Es ist nicht meine Schuld (Kinder glauben das öfter), sondern ihre Wahl. Ich erkannte auch die Bereitschaft meiner Mutter, ein Opfer zu sein. Und dennoch wählte auch ich später häufiger die Opferrolle. Mein Vater verschwand oft für Tage. Und das waren die schönsten Zeiten meiner Kindheit. Zu Hause war Ruhe. Keine Stimmungsschwankungen. Keine überraschenden Dramen. Endlich der Frieden, nach dem ich mich so lange gesehnt hatte.
Als ich siebzehn war, warf mich mein Vater aus dem Haus. Er kam betrunken mit einem Freund von einer Reise zurück und schimpfte über meine Mutter. Ich wies ihn vor dem anderen zurecht, und als der sich verabschiedete, flog ich nach.
Ich musste die Schule aufgeben und fand einen Job als Sekretärin und ein kleines Ein-Zimmer-Apartment. Beim Auszug wog ich noch über achtzig Kilo, und da ich weder Geld für den Kauf eines Bestecks noch für ausreichend Lebensmittel hatte, fand ich mich nach Monaten plötzlich schlank wieder.
Ich heiratete mit neunzehn Jahren, ließ mich scheiden, hatte Beziehungen, wenig Affären, neue Berufe, neue Freunde, Kontaktlinsen, sogar Geld und irgendwann einmal Erfolg. Ich fand mich im Fernsehen und auf Titelseiten wieder, und trotzdem gehörte ich noch nicht dazu. Die Sehnsucht meiner Seele, mittlerweile verkümmert auf ein klitzekleines Flämmchen, fühlte ich kaum.
Meine Tage waren ausgefüllt. Ich war mit den täglichen Dramen in meinem Leben beschäftigt und fühlte mich wie eine Fahne im Wind. Durchgeschüttelt von einer Kraft, die für mich keinen Sinn ergab. Momentane Freuden, wenn mir eine Sendung angeboten wurde. Tränen, wenn sie jemand nicht mochte. Interviews, in denen ich gemocht werden wollte. Veranstaltungen, in denen ich Menschen überzeugen musste. Privat war es nicht anders. In meinen Liebesbeziehungen passte ich mich an nach dem Motto: »Was für eine Art Frau hättest du denn gern?«
Ich heiratete noch einmal. Zog nach Los Angeles zu einem Mann, dessen Sprache ich kaum verstand und dessen Kultur mir fremd war. Ich war beeindruckt von der Gewissheit, mit der er mir den Hof machte. Und ich dachte, vielleicht sei es dieser Mann, der mir meine Sehnsüchte erfüllen würde. Ein Jahr später glaubte ich, vielleicht sei es das Kind, das mir geboren wurde. Wieder später meinte ich, vielleicht die neue Sendung, die so wichtig ist …
Die Dramen wurden nicht weniger. Nun kam das Zusammenwachsen in einer Ehe hinzu. Nach dem ersten Verliebtsein begann das Aneinandergewöhnen. Ich hatte immer noch nicht gelernt, die Wahrheit zu sagen und Grenzen zu setzen. Hatte die Gene, die mir meine Eltern mitgegeben hatten, noch nicht »erweitert«. Ich ging immer noch Unannehmlichkeiten aus dem Weg.
Mein Selbstbewusstsein hing ausschließlich mit meinem Beruf zusammen. Dass mein Mann gut Geld verdiente, war mir eher unangenehm. Ich hatte zu lange an mir gearbeitet, um nicht von der Wichtigkeit meiner eigenen finanziellen Unabhängigkeit überzeugt zu sein. Wusste ich doch durch das Leben meiner Mutter, was passieren kann, wenn man als Frau kein eigenes Geld verdient. Die Angst davor saß mir im Nacken. Ich war gewöhnt, eigenes Geld großzügig zu verteilen. Sein Geld gehört nicht mir. Deshalb traf es mich umso härter, als ich mich durch eine berufliche Krise endlich der Frage stellen musste, die ich all die Jahre so erfolgreich ignoriert hatte: Wer bin ich? Ohne Karriere, ohne eigenes Geld, ohne den Erfolg, an den ich mich so gewöhnt hatte? Und endlich, endlich begann das Licht meiner Sehnsucht größer zu werden.
Jeder von uns kennt diesen Moment, in dem die Sehnsucht unserer Seele nicht mehr ignoriert werden kann. Wir spüren, wir müssen uns ändern. Wir spüren, so wollen wir nicht mehr weitermachen. Wir wissen nur nicht genau, wie es weitergeht. Aber wir ahnen, dass unsere Persönlichkeit nicht die Basis unseres Seins ist. Wir ahnen, dass es da mehr gibt.
Wir als Seele haben uns eine Persönlichkeit (Ego) erschaffen. Und damit beginnt eine unbewusste Entscheidung: Mit welchen Augen betrachten wir unser Leben? Mit den Augen der Persönlichkeit oder mit den Augen der Seele?
Betrachten wir unser Leben durch die Augen unserer Persönlichkeit, dann sehen wir Dramen, die keinen Sinn ergeben. Wir erleben uns im Mangel, denn andere haben mehr: mehr Erfolg, mehr Geld, mehr Schönheit, mehr Zufriedenheit, mehr Gesundheit, mehr Sex, mehr Glück. Wir machen uns Sorgen, dass uns oder unseren Liebsten etwas zustoßen könnte. Die Welt ist kein sicherer Platz. Da wir recht haben wollen, müssen die anderen unrecht haben. Da wir uns unsicher fühlen, erleben wir uns oft wie von äußeren Mächten durchgeschleudert.
Sehen wir hingegen die Welt durch die Augen unserer Seele, wissen wir, dass wir als Seele für immer sind. Wir wissen, dass jede Herausforderung unserem Wachstum dient, und sind dankbar für jede Schwierigkeit und jede Angst, denn dadurch entwickeln wir uns weiter. Wir erspüren, dass es uns tief im Innern an nichts mangelt. Wir machen die anderen nicht kleiner, damit wir besser dastehen. Wir machen uns aber auch selbst nicht kleiner. Denn wir wissen, dass wir alle aus der gleichen Quelle kommen und zurück zur gleichen Quelle gehen: Wir sind ein Tropfen im göttlichen Meer. Wir sind Seele. Nie getrennt und niemals allein. Nie geboren, nie sterbend, immer nur im Sein. Unser Leben, unsere Zeitabläufe haben wir uns erschaffen, damit wir uns gemeinsam im Wachstum unterstützen können. Wir leben im Meer der Schöpfung.
Wir haben uns für dieses Leben entschlossen, weil wir Erfahrungen sammeln wollten. Je mehr Erfahrungen wir sammeln, desto mehr Mitgefühl sammeln wir. Und eines wissen wir alle: Wenn wir etwas selbst erlebt haben – und die damit verbundenen Schwierigkeiten –, haben wir mehr Verständnis für diejenigen, die Ähnliches auch erleben. In der Summe entsteht daraus ein mitfühlender Mensch. Und so ein Mensch ist großzügig. So ein Mensch ist verständnisvoll. So ein Mensch kann Verhaltensweisen nachvollziehen, weil er sie selbst erlebt hat – in der Summe all seiner Leben.
Jedes Leben hat seine eigenen Herausforderungen. Um herauszufinden, was wir in diesem Leben lernen wollen, hilft es zu betrachten, was uns Probleme bereitet: Fällt es uns schwer zu verzeihen? Nicht über andere zu sprechen? Kein Opfer zu sein? Sind wir neidisch? Flüchten wir in Selbstmitleid, suchen wir im Alkohol oder in Drogen Vergessen? Wollen wir Problemen aus dem Weg gehen? Setzen wir Zynismus ein, um unsere Sensibilität zu verbergen? Können wir nicht nein sagen? Oder haben wir uns angewöhnt zu lügen?
Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen, und ähnlich ist es mit der Liste von dem, was wir lehren wollen: Ist es Verständnis? Ist es Großzügigkeit? Ist es zu lernen, der Intuition zu folgen? Ist es Körperbewusstsein? Ist es Schönheit? Ist es die Fähigkeit zu verzeihen? Ist es Lachen? Ist es Kunst? Ist es Kreieren? Ist es Vertrauen? Ist es Mut?
Vor circa zwanzig Jahren bat ich meine Freundinnen, mir meine guten Eigenschaften und die, die ich noch verbessern kann, mitzuteilen. Die Liste habe ich leider nicht mehr, aber ich erinnere mich noch an einiges sehr genau. Meine guten Eigenschaften waren Mut, Enthusiasmus, Großzügigkeit. Was ich noch verbessern konnte, war, dass ich rechthaberisch war und Ratschläge gab, ohne gefragt worden zu sein. Sie sagten mir, ihnen fiele auf, dass ich selten den Moment genieße, sondern immer vorausplane oder mich in der Zukunft aufhalte. Dass ich mir nicht genug Ruhe gönne und gleichzeitig zu streng mit mir bin. Und manchmal vorwärtsstürze und vergesse nachzuschauen, ob die anderen auch mitwollen.
Das half mir damals sehr, mich besser zu verstehen. Was ziemlich lange brauchte, war meine Schwierigkeit, den Moment zu genießen. Ich fühlte mich lange getrieben. Kaum hatte ich ein neues Projekt begonnen, konnte ich es kaum erwarten, bis es fertig war. In einer meiner Meditationen hieß es mal: »Warum hast du damit angefangen, wenn alles, was du willst, ist, damit fertig zu werden?« Das machte mir klar, dass ich das, was ich tat, genießen und nicht nur hintendran einen »Erledigt«-Haken machen will. Ich lernte, das Tempo runterzufahren. Mir Zeit zu lassen. Das waren Herausforderungen, deren Gelingen noch viele Jahre dauern sollte.
Unser Seelenplan ist ein einfacher: wach zu werden. Was ist wach? Wach ist zu wissen, dass wir eine Seele sind, die hier eine menschliche Erfahrung macht. Wach bedeutet, dass man Emotionen zwar hat, aber nicht in ihnen versinkt. Wir sind zwar traurig, aber wir drohen uns nicht gleich aus dem Fenster zu stürzen. Wir wissen, dass diese Traurigkeit einen Grund hat, und wir wissen auch, dass sie vergeht. Wir haben eine Emotion, aber die Emotion hat nicht uns.
Nichts in unserem Leben ist ein Versehen und nichts ohne Sinn. Wir können unseren Lebensweg nicht verpassen, so wie wir es nicht verpassen können einzuatmen. Solange wir leben, atmen wir, und wenn wir nicht mehr atmen, dann verlassen wir damit diesen Körper. Das heißt: Solange wir leben, leben wir unseren Seelenplan.
Zarathustra, einer meiner spirituellen Lehrer, öffnete mir eines Tages die Augen für die Zusammenhänge. Zarathustra ist ein Meister, der lange vor Christi Geburt in Persien lebte. Er verfügt über keinen menschlichen Körper mehr, sprach aber bis Ende der neunziger Jahre durch den Körper meiner mittlerweile verstorbenen Freundin Jacqueline Snyder. Diesen Vorgang nennt man »Channeln« – nach dem englischen Wort channel, was »Kanal« bedeutet. Ich war damals noch damit beschäftigt, Dinge in meinem Leben in Richtig und Falsch einzuteilen. Und so zögerte ich auch, Entscheidungen zu treffen; denn ich befürchtete, einen Fehler zu machen.
Mitte der neunziger Jahre befand ich mich mit einer Gruppe von Freunden auf einem Berg in Montana. Wir waren eine Woche dort, um tagsüber viel Zeit in der Stille zu verbringen und am Abend den Lehren Zarathustras zu lauschen. Und einer von uns, ein junger Mann aus Mittelamerika, hatte eine ihm wichtige Frage: »Ich will als Schauspieler arbeiten. Soll ich nun nach Los Angeles ziehen oder lieber nach New York?« Seit Monaten schon konnte er sich nicht entscheiden.
Zarathustra, der durch Jacquelines Körper mit ihm sprach, schaute ihn lange an und sagte dann: »New York.«
Der junge Mann atmete erleichtert auf. Und wir mit ihm.
Zarathustra wartete, bis wir uns alle vor Freude ob dieser Entscheidung, die endlich gefallen war, wieder beruhigt hatten, und dann fuhr er fort: »Und wenn es dir dort nicht gefällt, dann geh nach Los Angeles.« Wir mussten lachen – wir verstanden sofort, was er uns damit sagen wollte. »Und wenn es dir dort nicht gefallen sollte, dann geh wieder zurück nach New York.«
Jetzt war es uns allen klar: Unser Schicksal ist kein Bus, den wir verpassen können. Unser Schicksal ist ein Busbahnhof. Wann immer wir bereit sind, wird ein Bus für uns dastehen.
Wir sind auf diesem Planeten vergleichbar mit Kindern auf einem Kinderspielplatz. Ob wir jetzt aus Sand eine Burg oder einen Kuchen bauen, ist völlig egal. Wir lernen, mit Sand umzugehen. Ich hingegen hing noch an meiner Form: Soll ich die Burg- oder die Kuchenform auswählen, um den feuchten Sand einzupressen? Soll ich den Sand am Rand oder den in der Mitte nehmen? Soll ich mit anderen zusammen bauen oder allein? Soll ich meine Mama oder meine Spielkameradin um Hilfe bitten?
Das alles sind Wahlmöglichkeiten. Je nachdem, wozu ich Lust habe. Die Hauptsache ist eine andere: Ich beginne zu verstehen, wie Sand funktioniert. Mit unserem Leben haben wir die Freiheit der Wahl geschenkt bekommen. Manchmal schauen wir zurück und sind ärgerlich oder enttäuscht über eine gefällte Entscheidung. Sie scheint uns falsch. Oder zumindest dumm. Aber in Wirklichkeit war nichts umsonst. Nichts war falsch. Nichts war zufällig. Alles, was in unserem Leben passierte, war ein Geschenk. Manchmal gefiel uns die Verpackung nicht. Oft weigerten wir uns, es als Geschenk zu betrachten. Aber nichtsdestotrotz haben wir etwas daraus gelernt.
Es ist ein faszinierendes Wirken unseres Seelenplans: Das Tal in meiner Karriere gab mir die Zeit, mich nach mir selbst umzusehen. Die Auseinandersetzungen in meiner Ehe halfen mir, Grenzen zu setzen. Dass ich wenig Geld verdiente, brachte mich dazu, Vertrauen zu lernen. Durch den Alkoholismus meines Vaters lernte ich Vergebung.
Allerdings muss noch eine kleine Hürde genommen werden, bevor wir erkennen können, dass alles, was im Leben passiert, ein Geschenk ist. Die Hürde? Bei mir war sie so hoch wie eine Mauer. Ihr Name? »Die anderen sind an allem schuld.«
Vergangenheit und Vergebung
Bleib nur in der Vergangenheit, wenn du dort leben willst
Der erste Stein zur Mauer namens »Die anderen sind an allem schuld« ist bei mir schon früh gelegt worden. Immer wenn ich als kleines Kind irgendwo anstieß, war der Tisch schuld oder die Tür. Meine Mutter, die mich beruhigen wollte, brachte mich zum »Verursacher« meines Wehwehchens zurück und schimpfte mit ihm: »Böser Tisch!«, rief sie aus, und ich haute mal kräftig drauf – für all die Schmerzen, die er mir zugefügt hatte.
Was für ein wundervolles Konzept! »Ich habe mit meinen Schmerzen nichts zu tun. Andere haben mir das zugefügt.« Sogar ein Tisch, der sich nicht bewegt, war schuld. Und mit dieser Idee begann ich, in mir ein »Zimmer« einzurichten: das »Zimmer des Selbstmitleids«.
Als Erstes kam der Tisch herein, und bald war dieses Zimmer ausgestattet, denn ich hielt mich oft dort auf. Die Wände waren voll mit Bildern von Menschen, die mich ungerecht behandelt hatten. Hier konnte ich in meinem Weltschmerz versinken. Mich selbst trösten, etwas, was die anderen offensichtlich versäumten. Denn ich war ja ein guter Mensch. Einfach zu sensibel für diese Welt. Wenn alle nur so wären wie ich, dann wäre mein Leben leichter. Ich weigerte mich standhaft, Verantwortung für den Zustand meines Lebens zu übernehmen.
Mit der Zeit wurde der Gang ins »Zimmer des Selbstmitleids« eine breite Straße, die ich automatisch ging, und ich hielt mich tagelang dort auf. Weinerlich bejammerte ich mein Schicksal, wartete, bis die Wunden verheilt waren. Dummerweise waren sie nicht wirklich ausgeheilt. Denn wie in meiner Kindheit auf den Tisch schimpfte ich einfach nur so lange auf die betreffende Person oder Situation ein, bis es mir dann irgendwann doch zu blöd wurde und ich genug von meiner Frustration herausgelassen hatte. Dann verließ ich das »Zimmer« wieder, um allerdings jederzeit, wenn die Erinnerung an die bestimmte Situation auftauchen sollte, wieder dorthin zurückzukehren.
Ich weiß auch noch gut, wie erleichtert ich war, wenn ich auf die bestimmte Person schimpfen konnte. Ich stellte mir in den schillerndsten Farben vor, wie sie irgendwann einmal leiden würde für das, was sie mir angetan hat. Irgendwann einmal erkennen, wie falsch sie sich verhalten hat, und sich dann bei mir entschuldigen würde. Und vielleicht wäre es dann zu spät. Sie würde an meinem Grab stehen und schluchzen und ihres Lebens nicht mehr froh werden. Und ja, wenn dann im wirklichen Leben dieser Person doch irgendetwas passieren sollte, dann würde ich die Schadenfreude nicht verhehlen können. War das doch meine Rache, mit der ich mich endlich beruhigen konnte. Wie der »Tisch« hatte sie oder er nun endlich ihre oder seine Strafe bekommen, und damit war auch ich zufrieden. Wieder mal wundervoll meine eigene Rolle und meine eigene Verantwortung in meinem Leben umschifft.
Ich begann meinen spirituellen Weg nicht, weil ich endlich Verantwortung übernehmen wollte. Weit gefehlt! Ich wollte die Gabe haben, Menschen zu erkennen. Wäre es nicht herrlich, wenn ich sofort sehen könnte, wer es gut mit mir meint? Wer so ähnlich ist wie ich? Wer mich nie betrügen wird? Wer mich immer unterstützen wird? Ohne Wenn und Aber zu mir steht? Mich für ewig liebt? Nie ein Versprechen bricht?
Das hörte sich gut an, und das wenige, was ich über Spiritualität wusste, schien mir darauf hinzudeuten. Gibt es nicht Engel, mit denen man Kontakt aufnehmen kann? Und würden die mich nicht vorwarnen, wenn da irgendjemand wäre, der mir nicht guttut?
Ich hoffte, dass Spiritualität mich von unangenehmen Erfahrungen befreien würde. Erst später lernte ich, dass ich es bin, die wacher werden wird. Am Beispiel des »Zimmers des Selbstmitleids«: Der erste Schritt war das Erkennen, dass ich mir eins eingerichtet hatte. Der zweite Schritt war zu bemerken, wenn ich mich darin aufhielt. Der dritte Schritt, dass ich es so schnell wie möglich wieder verlassen kann. Im vierten Schritt betrat ich es nicht mehr.
Zarathustra sagte einmal: »Ein Meister lebt in Frieden selbst inmitten von Chaos.« Zarathustra sprach nicht davon, dass es kein Chaos, keinen Aufruhr mehr gäbe. Dieser Satz ist einer meiner Maßstäbe geworden, nach dem ich mein Wachstum beurteile.
»Die Vergangenheit ist ein fremdes Land, die machen Dinge anders dort«, schrieb der britische Autor L. P. Hartley. Das ist eine wundervolle Wahrheit. Wenn wir unsere eigene Vergangenheit betrachten, ist sie häufig mit vielen »Wenns«, »Hättes« und »Wäres« angefüllt: »Hätte ich bloß mit Soundso nichts angefangen!«, »Wäre ich nur nach XY gezogen!«, »Wenn ich doch nur rechtzeitig gekündigt hätte!«, »Hätte ich doch auf meinen Körper gehört, als die Schmerzen noch ganz schwach waren!« …
Unsere Seele sucht Erfahrungen, um zu bestimmten gewünschten Erkenntnissen zu kommen. Und in unserem Leben werden wir mit genau diesen Erfahrungen versorgt.
Annette, eine junge Frau, die zu einem meiner Workshops kam, schickte mir seinerzeit eine E-Mail. »Liebe Sabrina, mein Mann und ich müssen dringendst unser Haus verkaufen. Wir haben es selbst gebaut und hängen sehr daran. Doch wir schaffen das finanziell nicht. Wir haben schon jede Menge Annoncen aufgegeben, aber kaum jemand kommt vorbei. Was stimmt denn da nicht? Langsam wird es wirklich dringend. Kannst Du mir nicht einen Rat geben?«
Ich schlug ihr vor, dass die Familie, auch die Kinder, eine Abschiedszeremonie macht und sich beim Haus bedankt. Schließlich hängen sie alle noch daran. Annette und ihre Familie machten die Zeremonie, doch nichts rührte sich.
Einige Wochen später kam eine weitere E-Mail: »Wir wissen langsam nicht mehr weiter. Was sollen wir nur tun?«
Ich schrieb ihr zurück: »Liebe Annette, dafür gibt es bestimmt einen Grund. Denk daran, Gott ist nicht taub. Er hat Dich beim ersten Mal gehört. Schau mal, ob Du es schaffst, Dich darauf zu verlassen, dass bestimmt irgendetwas rechtzeitig passieren wird. Es mag vielleicht nicht das sein, was Du Dir vorgestellt hast, denn manchmal kennen wir die Wünsche unserer Seele nicht genau.«
Ein halbes Jahr später kam dann ihre E-Mail mit der Betreffzeile »Ein Wunder ist geschehen«. Und so ging es weiter: »Nach über einem Jahr zwischen Hoffen und Bangen und Balancieren am finanziellen Abgrund haben wir heute unser Haus verkauft! Ich danke Gott von ganzem Herzen dafür, und ich danke Dir, dass Du mich immer wieder ermutigt hast zu vertrauen. Wir haben in letzter Zeit alle Bemühungen eingestellt, und ich bejahte nur noch in meinen Gebeten mein Vertrauen, dass Gott uns jemanden sendet, der unser Haus kauft.«
Was war passiert? Eines Morgens hatte Annette plötzlich das Gefühl, sie müsste noch einmal eine Annonce aufgeben. Ihr Mann war überrascht, hatte doch keine von den früheren Anzeigen etwas gebracht. Aber sie folgten Annettes Intuition. Und an diesem Wochenende waren mehr Anfragen da als in dem ganzen Jahr zuvor. Fast jede Stunde war jemand eingeplant, um sich das Haus anzuschauen. Am Sonntagvormittag klingelte das Telefon, und eine Frau fragte ganz aufgeregt: »Kann ich bitte kommen, ich muss unbedingt noch heute das Haus sehen.«
Annette wollte sie eigentlich lieber abwimmeln, aber sie fühlte etwas anderes. Zwischen zwei weiteren Interessenten kam dann diese Frau und machte sofort ein Angebot. Die Frau hatte gerade eben geerbt, sie besaß in der Nähe schon ein Haus, hatte aber zwei Kinder. Sie wollte beiden je ein Haus in der Nachbarschaft vererben. Sie fragte Annette, ob sie denn Interesse hätten, dort zur Miete wohnen zu bleiben. Annette sagte, dass sie nicht so viel Miete zahlen könne, denn sie plante zu kündigen, um eine Ausbildung als Heilpraktikerin zu beginnen. »Wie viel können Sie denn zahlen?« Annette nannte eine Summe, von der sie annahm, dass das nie klappen könnte. Es war einfach zu niedrig. Für die Frau war die Höhe der Miete aber kein Problem. Ihr war es lieber, dass da jemand im Haus war, der es liebte und sich gut darum kümmern würde. Sie hatten zwar ihr Haus verkauft, mussten es aber nicht verlassen. Was für ein Geschenk!
Annette hätte ihre Zeit auch im »Zimmer des Selbstmitleids« verbringen können: Die schlechte Wirtschaftslage, die damals hohen Zinsen, die Zeitung mit den erfolglosen Annoncen. Natürlich sind das alles Faktoren, aber nicht der Grund für das, was uns widerfährt. Der Grund hat etwas mit uns zu tun. Rückblickend erkannte Annette, dass sie auf der Seelenebene lernen wollte, ihrer Intuition zu vertrauen.
Unsere Einstellung zum Leben hängt von zwei Faktoren ab: unseren Genen und unseren Erfahrungen. Als menschgewordene Seele wollen wir gewisse Erfahrungen machen, und dazu braucht es als Basis bestimmte Talente. Angenommen, jemand möchte lernen, mit Ruhm umzugehen, dann braucht er ein Talent, mit dem er berühmt werden kann. Möchte er Sänger werden, sollte er musikalisch sein, will er Erfolg durch Sport, braucht er einen athletischen Körper.
Unsere Erfahrungen wiederum lassen sich in zwei Phasen einteilen. Einmal diejenigen unserer Kindheit und dann die unserer Erwachsenenzeit. Als Kinder sind wir abhängig. Von der Art, wie uns unsere Eltern erziehen und behandeln. Von der Umgebung, in der wir aufwachsen. Wir haben kaum Kontrolle über unsere Kindheit. Wird ein Kleinkind misshandelt, kann es sich nicht wehren. Nur Erwachsene haben die Macht, das zu verhindern.
Allerdings sollten wir auch nicht übersehen, dass wir, als Spirit, als Seele, uns unsere Eltern ausgesucht haben. Also wussten, welchen Situationen wir uns aussetzen würden. Diejenigen von uns, die schreckliche Kindheiten hinter sich haben, Schmerzen und Gemeinheiten erdulden mussten, für die ist es schwer, das als Möglichkeit zu sehen oder sogar zu akzeptieren. Denn wir wünschen uns ein harmonisches, liebevolles Leben. Warum sollten wir dann so dämlich gewesen sein, uns Eltern auszusuchen, die ihre Elternrolle derartig missbrauchen?
Jedes Elternpaar versucht das Beste. Sein persönliches Bestes. Natürlich auch geprägt von seinen Eltern und seinen Kindheitserfahrungen. Und jemand, der selbst nur Gewalt erlitten hat, wird leichter Gewalt weitergeben. Auch Eltern, die wenig bis gar keine Begabung darin haben, Kinder aufmerksam und liebevoll zu behandeln, versuchen, die Kontrolle zu behalten. Und für manche – aus mangelnder anderer Erfahrung – ist Kontrolle nur durch Gewalt zu erreichen. Denn wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. (Mit diesen Ausführungen sollen natürlich keine Grausamkeiten verharmlost werden, es geht vielmehr darum, die Zusammenhänge darzustellen.)
Unsere Kindheitserfahrungen haben uns beeinflusst: Erlebten wir, dass wir uns auf unsere Eltern nicht verlassen können, so haben wir daraus bestimmte Schlüsse gezogen. Entweder glauben wir, dass wir nicht gut genug sind, und bemühen uns vielleicht verzweifelt, liebenswerter zu werden. Oder wir rebellieren und beißen uns durch eine erlebte schlechte Welt. Oder wir haben resigniert, nehmen unsere eigenen Bedürfnisse nicht mehr wahr und erspüren uns kaum noch.
Vielleicht wurden wir aber auch wegen unserer Schönheit bewundert, dann wird unser Aussehen uns Selbstbewusstsein geben, doch eventuell auch die Sorge, es zu verlieren. Erlebten wir als junge Erwachsene, dass wir geliebt und geschätzt wurden, dann bestärkte uns das in unserem Selbstwertgefühl. Wurden wir in unserem Leben oft verlassen, dann haben wir vielleicht kein Vertrauen zu den Menschen in unserer Nähe und versuchen möglicherweise, uns zurückzuziehen oder die Beziehung zu kontrollieren.
Aber da sind wir nun als Erwachsene. Mit unseren Erfahrungen. Unseren Schmerzen. Unserem Selbstwertgefühl. Und jetzt entscheidet es sich, ob wir in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft leben. Die Vergangenheit und die Zukunft sind Zeiten, die für uns nicht wirklich existieren. Es gibt nur das Jetzt. Das Gestern wird immer das Gestern bleiben, und das Morgen wird immer später sein. Das Heute ist das Einzige, in dem wir leben.
Ja, viele von uns hatten eine anstrengende Kindheit. Doch Zarathustra sagte einmal zu einer Frau, die weinend diese Zeit in ihrem Leben beklagte: »Ich weiß, mein Kind, deine Vergangenheit war fürchterlich. Aber ich frage dich, wie wird deine Zukunft sein?«
Auch ich habe meine Vergangenheit immer gern wie eine Fahne vor mir hergetragen. »Kuck mal, ich armes Kind. Was mir nicht schon alles passiert ist.« Ich hoffte auf Mitleid. Mitleid ist die Verwandte vom Selbstmitleid und hat übrigens mit Mitgefühl relativ wenig zu tun. Mitgefühl regt zur Mithilfe an. Mitleid bedauert nur. Und damit sind wir wieder – genau! – im »Zimmer des Selbstmitleids«.
Einige suchen Trost: in immer neuen Beziehungen, im Sex, im Alkohol, in Drogen, in der Macht. Aber Trost heilt nicht. Trost ist für eine bestimmte Zeitspanne nützlich, doch dann wird es Zeit, Verantwortung für den eigenen Zustand und die eigene Heilung zu übernehmen.
Sind wir also bereit, diesen Kreislauf zu durchbrechen? Sind wir bereit, die Vergangenheit loszulassen? Nehmen wir einmal an, dass wir nicht in der Vergangenheit verhaftet bleiben, sondern »geheilt« in die Gegenwart schauen wollen. Da gibt es viele Optionen, etwa Therapien wie die Hypnosetherapie, Kunsttherapien, EFT (die Klopftechnik), aber auch Gespräche mit Menschen aus der Kindheit, Musik oder Yoga.
Musik und Bewegung sind großartige Möglichkeiten, wieder zu gesunden. In seinem Buch Verkörperter Schrecken schreibt der Traumaexperte Dr. Bessel van der Kolk, dass in verschiedenen dramatischen Situationen unser Gehirn quasi einfriert. Es fällt bei Traumata in eine Schockstarre, und der logische Verstand ist ausgeschaltet. Wir sind dann nicht in der Lage, rationale Entscheidungen zu treffen. Deshalb funktionieren häufig Gesprächstherapien nicht. Und immer wenn uns etwas an die damalige Situation erinnert (ein Geruch, ein Lied, eine Farbe), gerät das Gehirn wieder in Panik. Es erlebt diesen Moment – der in der Vergangenheit liegt – wieder, als würde er jetzt passieren. Viele erspüren ihren Körper nicht mehr, denn durch den Körper haben sie diese Schmerzen empfunden und lehnen ihn ab. Um das zu ändern, braucht das Gehirn ein Training. Singen und Bewegung erreichen das Gehirn wieder und lösen es aus der Schockstarre, was den Heilungsprozess schließlich ermöglicht.
Ich vergleiche die verdrängten Schmerzen unserer Vergangenheit gern mit dem Dreck, der unter einen Teppich gekehrt wird. Da liegen sie nun vorerst nicht mehr sichtbar im »Wohnzimmer unseres Lebens«, doch es kommen immer mehr dazu. Schmerzen unserer Kindheit, Schmerzen durch Liebespartner und Krankheiten. Schmerzen des Verlassenwerdens, der Einsamkeit, des Nichtverstandenwerdens. Und mit der Zeit gleicht dieser Teppich einer Hügellandschaft. So viel Dreck ist daruntergekehrt. Natürlich fängt er langsam zu stinken an, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als uns endlich um diesen Müll zu kümmern. Wenn wir den Teppich lüften, wird uns wahrscheinlich erst einmal schlecht werden. Und manchmal lassen wir vor Schreck den Zipfel des Teppichs wieder fallen und hoffen, dass der Unrat von selbst verschwindet.
Aber das tut er natürlich nicht.
Einige Zeit später versuchen wir es noch einmal. Diesmal schaffen wir es, uns den Dreck anzuschauen. Und falls wir uns erlauben, ehrlich mit uns zu sein, erkennen wir dann, warum wir von einer bestimmten Art von Schmutz besonders viel unterm Teppich aufbewahrt haben. Wenn uns die »Erleuchtung« darüber gekommen ist und uns klar wird, warum wir diesen Schmutz aufheben, dann ist es an der Zeit, ihn zu entfernen. Also kommt jetzt alles in die große Abfalltonne, und dann warten wir auf den Donnerstag.
Am Donnerstag wird der Müll abgeholt, und wir schieben die Tonne zum Mann von der Müllabfuhr. Dann wollen wir damit anfangen, den Deckel der Mülltonne zu heben, und nehmen das erste Teil heraus: »Das ist ein Stück Abfall von meiner ersten Beziehung. Das war ein Abschiedsbrief, der mir damals das Herz gebrochen hat.« Und nun überreichen wir dem Müllmann feierlich unser Stück Papier. Wieder greifen wir hinein: »Das ist der Rest von den Tortenstücken, die ich aus Frust in mich hineingeschoben habe, weil ich mich nicht anders zu wehren wusste.« Damit übergeben wir dem Mann den Rest von diesem Matsch. Und erneut greifen wir hinein und holen eine Notiz heraus. »Und das ist der Kommentar, den jemand hinter meinem Rücken über mich losgelassen hat, weswegen ich tagelang geweint habe.« Und wieder überreichen wir dieses Stück Papier.
Mittlerweile wird das dem Mann von der Müllabfuhr zu dumm. »Gute Frau«, sagt er, »bei dem Tempo stehe ich morgen noch hier. Geben Sie mir einfach den ganzen Schrott. Ich bringe das für Sie weg.«
Wollen wir wirklich, wie in dieser Metapher beschrieben, all unsere Schmerzen noch einmal durchleben? Reicht es uns nicht, dass wir wissen, warum wir seinerzeit so gehandelt haben, und dann neue Gedanken und damit neue Entscheidungen treffen, die anders ausfallen? Wenn wir einmal die Tiefe unserer früheren Entscheidungen durchlebt und dadurch erkannt haben, dann ist es Zeit, sie auch loszulassen. Immer wieder die gleichen Schmerzen zu empfinden macht wenig Sinn.
Jetzt ist der Teppich flach. Es stinkt nicht mehr. Wir fangen sozusagen »von vorn« an. Ab und zu ertappen wir uns zwar dabei, dass wir noch mal Sachen unter den Teppich kehren wollen. Aber wir haben etwas dazugelernt. Wir erkennen unsere alten Gewohnheiten schneller. Und können früher mit dem Aufräumen anfangen und nicht erst dann, wenn sich der Dreck unter dem Teppich anhäuft.
Ich habe mal eine Allegorie gelesen, nach der eine Therapie zu machen sei, wie mit einem Boot von einem Ufer zum anderen zu fahren. Wir verstehen auf dieser Bootsfahrt etwas und erreichen endlich ein anderes Ufer. Manche fahren aber so gern in dem Boot hin und her, dass sie vergessen auszusteigen. Sie werden Therapie-Junkies. Immer wieder wird in der Vergangenheit geforscht, und wie im obigen Bild der »Müllentsorgung« wird jeder Schmerz wieder und wieder betrachtet.
Ohne Vergebung zu üben, hängen wir in der Vergangenheit fest. Haben wir vergeben, bedeutet dies jedoch nicht, dass wir uns derselben misslichen Situation immer wieder aussetzen müssen. Ändert sich nichts an der Lage – wiederholt sich eine bestimmte Konstellation immer wieder –, wird das nicht besser werden, wenn wir es immer wieder vergeben.
Eine fünfzigjährige Freundin, die immer wieder unter der Aggression und der Übergriffigkeit ihrer Mutter litt, hatte ihr letztes Jahr zu Weihnachten eine Trennung für ein Jahr angekündigt: »Ich brauche eine Pause, um mich zu erholen. Zwischen uns wird es nicht besser. Vielleicht hast du auch Interesse daran, unsere Beziehung zu verbessern. Ich werde mich für ein Jahr nicht melden, und dann können wir es im Dezember mit einem Treffen noch mal versuchen.«
Ihre Mutter fuhr alles auf, was ihr an emotionaler Erpressung zur Verfügung stand. (»Was bist du nur für eine undankbare Tochter!«, »Wie wagst du es mit mir zu reden!«, »Wenn ich krank werde, bist du schuld!«, »Dein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er sehen könnte, wie du mich behandelst« …) Aber meine Freundin blieb dabei. Obwohl sie wenig Hoffnung hatte, dass sich an dem Zustand in der Zwischenzeit etwas ändern würde, war sie aber nach vielen Jahren des Versuchens nicht mehr bereit, sich bei jedem Treffen von ihrer Mutter schlecht behandeln zu lassen.
Ihre Mutter wusste genau, wie sie die Schuldgefühle ihrer Tochter aufrütteln kann, und doch hat ihre Tochter gelernt, dass sie das Recht hat, gut behandelt zu werden. Auch von ihrer Mutter. Sie muss sich dem nicht aussetzen. Sie ist erwachsen.
Es gibt extrem ungesunde Familienverhältnisse, bei denen man um der eigenen Sicherheit und des eigenen Wohlbefindens willen Abstand braucht. Manche Familienmitglieder sind so übergriffig und gleichzeitig uneinsichtig, dass es außer einer energischen Trennung kaum andere Möglichkeiten gibt. Dem anderen die Chance einzuräumen, dass er sich entwickelt, zeigt Bereitschaft. Dabei hilft ein zeitlicher Rahmen.
Es hat bei mir lange gedauert, bis ich meinem Vater vergeben konnte. In meinem ersten Buch Endlich aufgewacht beschreibe ich das ausführlich. Irgendwann einmal erkannte ich, dass er sehr unglücklich gewesen sein muss. Wer glücklich ist, geht nämlich anders mit seinen Mitmenschen um. Und diese Einsicht war der erste Schritt zur Vergebung. Ich sagte mir damals auch oft: »Ich wünschte, ich könnte vergeben.« Das half mir, meine Gedanken mit der Zeit zu verändern. Der Wunsch war dabei der erste Schritt.
Nachdem ich dann endlich zur Vergebung bereit war, löste sich in meinem Unterleib ein »Knoten«. Ich fühlte das körperlich so stark, dass ich zu weinen begann. Dieser Knoten wäre mir geblieben, wenn ich es nicht geschafft hätte, meinem Vater zu vergeben. Er wäre mir geblieben. Nicht meinem Vater. Ich hätte ihm damit erlaubt, mich noch als Erwachsene durch die unverarbeiteten Erinnerungen weiterleiden zu lassen.
Wenn ich jetzt über meinen Vater spreche, lächle ich. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Vergebung auch wirklich geschehen ist.
Neben der Fähigkeit, den anderen zu vergeben, ist es auch wichtig, uns selbst zu verzeihen. Wenn wir damals gewusst hätten, was wir jetzt wissen, hätten wir uns anders entschieden. Wir haben keine Fehler gemacht. Alles, was wir gestaltet und erschaffen haben, taten wir aus dem Grund, weil wir es nicht besser wussten. Aus diesen Erlebnissen haben wir gelernt und sind dadurch gewachsen.
Ich habe damals in meiner Vergangenheit aufgeräumt und Menschen angerufen, bei denen ich mich entschuldigen wollte. Manche waren überrascht und sprachlos. Andere freuten sich, es begann ein Gespräch, und dadurch kam es wieder zu einer Annäherung. Es war eine große Erleichterung für mich, denn dieses Unerlöste kann uns sehr lange beschäftigen. Zu erkennen, was wir gelernt haben, und es zu schaffen, dass wir dafür dankbar sind – trotz der Narben, trotz der Verzweiflung darüber –, ist die hohe Kunst der Vergebung. Ohne diese damaligen Erfahrungen wären wir jetzt nicht da, wo wir sind.
»Ja, aber wo bin ich denn?«, fragen Sie vielleicht. »Mein Leben ist immer noch sehr anstrengend. Es ist noch lange nicht friedlich!«
Aber Sie sind aufgewacht! Sie haben Verantwortung für Ihr Leben übernommen. Und das sind die ersten Schritte in ein erfülltes und zufriedeneres Leben. Es hat auch Jahre gedauert, bis wir in diesen Zustand hineingekommen sind. Jetzt dauert es natürlich auch, bis wir da wieder herauskommen.
Eine Krise ist das Sprungbrett, das uns herauskatapultiert aus unserem alten Leben. Die meisten von uns haben sich für ein spirituelles Leben interessiert, weil sie in eine Krise geraten waren. Wir haben es einfach nicht mehr ausgehalten. Viele von uns ändern erst dann etwas, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. So war das auch bei mir. Ich bin im Nachhinein dankbar für alle jene, die mich an die Wand gedrängt haben. Sie haben mich dadurch gezwungen, über meinen Schatten, meine alten Erfahrungen, meine aus der Kindheit übrig gebliebenen Verhaltensmuster hinauszuwachsen und mich zu ändern.
Ich möchte das Kapitel nicht beenden, ohne kurz etwas über unsere Vorfahren gesagt zu haben. Gerade in vielen schamanisch angelegten Kulturen werden die Ahnen ähnlich Göttern verehrt. Für manche mag das eine wunderbare Möglichkeit der Annäherung und der Weisheit sein. Mir ist das fremd. Ich glaube an die Entwicklung unserer Spezies. Natürlich bin ich meinen Ahnen dankbar, dass sie überlebten und mir bestimmte Talente und Begabungen schenkten (deren Familienzusammenstellung ich mir als Seele ausgesucht habe), doch suche ich nicht ihren Rat. Ich glaube, wir sind die Spitze der Entwicklung unserer Vorfahren, wie unsere Kinder und Enkelkinder sich weiter als wir entwickeln werden. Es hat für mich keinen Sinn, jemanden um Rat zu fragen, der in der Entwicklung nicht weiter ist als ich.
Vertrauen in das Göttliche
»Alles, was ist«
Gott.
Was nicht alles im Namen Gottes gemacht und getan wird!
Gott.
Für mich ist Gott keine Wesenheit, die über Gut oder Schlecht entscheidet. Niemand, der Söhne haben kann. Keine Autoritätsfigur, vor der ich mich fürchten muss. Keiner, der enge Verhaltensregeln aufstellt. Gott ist nichts, was außerhalb von mir existiert. Ich bin ein Teil Gottes, wie alles ein Teil Gottes ist. Gott ist wie das Meer, und ich bin wie ein Wassertropfen darin.
Gott.
»Alles, was ist.«
So einfach ist das jetzt. Das war es nicht immer.
Ich bin katholisch erzogen worden, war lange in der Kirche aktiv, denn ich schätzte die Gemeinsamkeit und den Wunsch, etwas zu verändern. Vieles an den Dogmen war mir unverständlich (Erbsünde, Männerdominanz, Zölibat und so weiter), und ich habe lange mit mir gerungen, bis ich die Kirche dann beim Aufkommen der Aidskrise verließ, als Kondome immer noch verboten wurden. Ich konnte die kirchliche Entscheidung mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
Als ich mich mit dreißig Jahren der Meditation zuwandte, beschäftigte ich mich ausführlicher mit dem Buddhismus und mit schamanischen Traditionen – bis ich merkte, dass ich mich erst einmal mit meiner eigenen Religion ausführlicher auseinandersetzen musste; denn ich war dabei, Jesus einfach gegen Buddha auszutauschen. Ich hatte meine Fragen und auch Wunden, die mir meine katholische Erziehung auferlegt hatte, noch nicht betrachtet. Aber eben auch nicht die potenzielle Erkenntnis erkannt, die darin liegt.
Ich las mehrmals die Bibel und erkannte die Weisheit in den Worten Jesu. Dadurch entstand eine Verbundenheit und Nähe mit dem weisen Lehrer Jesus. Für mich ist er nicht der Sohn Gottes. Wir alle sind Kinder aus der Göttlichkeit.
Für eine Weile fühlte ich mich als »Christin im weitesten Sinne«. Treffend beschrieb es einmal ein streng katholischer Sitznachbar, als er nach einem gemeinsamen Abendessen schmunzelnd zu mir sagte: »Ich bin die Kammermusik, und Sie sind quasi der Free Jazz des Katholizismus.«
Jeder von uns hat seinen eigenen Weg zu »Gott«. Es ist ähnlich wie bei unserer Ernährung: Ob wir nun Apfelstrudel dem Käsekuchen vorziehen, Käse lieber als Bananen essen, Rohes eher als Gekochtes, Vegetarisches statt Fisch oder Fleisch, so ist es auch unsere Entscheidung, wie wir uns dem Phänomen »Gott« zuwenden. Gott als gütiger Vater. Gott als gütige Mutter. Oder als allmächtige Kraft. Oder das göttliche Prinzip. Oder Jesus, Allah, die Sonne, die Erde, die Luft oder der Stein. Und ob wir es nun in der Kirche, im Tempel, in der Moschee, in einer Ecke unseres Schlafzimmers, im Freien, in der Sonne oder im Regenbogen finden: Das göttliche Prinzip zeigt sich uns so, wie wir es brauchen.
Vor einiger Zeit las ich einmal als Antwort auf die Frage »Wo ist Gott?«: »Du sitzt mittendrin.«
Ich bin ein großer Freund der Logik. Sie ist ein wunderbares Instrument, um mit bestimmten Aspekten des Lebens erfolgreich zu navigieren. Aber manchmal gibt es eben auch Erspürtes. Gefühltes. Erahntes. Vielleicht bar jeder Logik – und trotzdem: Wenn wir diesem Gefühl, dieser Eingebung gefolgt sind, begreifen wir später, warum wir damals intuitiv gezögert, hier gewartet und dort einfach zugegriffen haben. Rückblickend verstehen wir unsere Entscheidungen und erkennen sie als … geglückt. Denn selbst wenn sie uns nach landläufiger Ansicht »Unglück« beschert haben sollten, so lehrten sie uns doch etwas. Und wenn wir wach sein möchten, wenn wir »erleuchtet« sein wollen – was nur bedeutet, dass wir alles in klarem Licht sehen –, dann sind wir dafür sehr dankbar.
Jeder von uns trifft bewusst oder unbewusst eine Entscheidung: Glaube ich an ein intelligentes Universum oder nicht? Glaube ich, dass alles nur aus Zufälligkeiten entsteht, oder nicht? Ich sehe in dem, was sich mir offenbart, Intelligenz. Und in diesem intelligenten Universum und in dieser Schöpfung befinde und bewege ich mich und beteilige mich am Erschaffen. Und somit ist alles, was um mich herum geschieht, intelligent. Ob ich es jetzt im Moment verstehe oder nicht. Ob es mir gefällt oder nicht. Ich nehme die Intelligenz dahinter an, und deshalb kann ich ihr immer mit Neugier und Interesse begegnen.
Die Entscheidung, ob das Universum als intelligent empfunden wird oder nicht, trifft jeder von uns selbst. Ein intelligentes Universum – ein intelligenter Schöpfer, also das Göttliche – braucht weitere intelligente Schöpfer. Und das sind wir. Wir erschaffen täglich neu: unsere Realität, unser Zuhause, unsere Welt.
Je aufmerksamer wir erschaffen, desto angenehmer werden wir in dieser Welt leben. Und zur Aufmerksamkeit gehört die Wachsamkeit.
Ich versuche, wach zu sein. Wach, um mich und meine Gedankengänge zu betrachten. Wach, um meine Entscheidungen zu überprüfen. Ich versuche, mich wach in die Gesellschaft einzubringen, die mich umgibt, und mich wach aus bestimmten Bereichen herauszuhalten. Ich versuche, Automatismen zu vermeiden; und wenn ich auf die letzten knapp dreißig Jahre zurückschaue, dann ist mir das jedes Jahr besser gelungen. Früher war mir nicht aufgefallen, wenn ich täglich in den gleichen Gedankenschlaufen festhing. Heute bemerke ich es. Und ich bekomme es mit, wenn ich mich von den Sorgen anderer anstecken lasse.
Ich habe erfahren, dass alles, was mir geschieht, einen Segen, einen Nutzen hat. Dass mir das Göttliche, das intelligente Universum, die Schöpferkraft – ich als unendliche Seele – Erlebnisse schickt, an denen ich wachsen kann. Immer wieder. Bis ich da bin, wo ich hinwill: wach sein.
Wirklich wach.
Ich habe um mein Verhältnis zum Göttlichen gerungen. Ich habe gezweifelt, geweint, geschimpft, gehofft. Ich habe gesucht, und ich habe gefunden. Mein eigenes Verhältnis zum Göttlichen. Doch wie erreichen wir dieses Verhältnis zum Göttlichen?
Es beginnt in der Stille.
Stille
Durch Meditation Ruhe finden
Vor knapp dreißig Jahren fing ich an, nach mehr Stille in meinem Leben zu suchen. Stille bedeutete früher Einsamkeit, und die wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Doch man ist nur einsam, wenn man sich selbst nicht kennt. Nachdem ich das erkannt hatte, war ich bereit, das Abenteuer der Stille zu suchen. Und es war ein wirkliches Abenteuer.
Ich begann mit einem Tag der Woche, an dem ich regelmäßig nicht sprach und auch nichts tat. Ich las nicht, ich hörte keine Musik und sah nicht fern. Es ging mir darum, aufmerksam zu sein. Mein Verstand beschwerte sich wie ein hysterisches Stehaufmännchen: »Hast du nichts zu tun? Das darf doch nicht wahr sein, da sitzt du hier rum und starrst Löcher in die Luft. Schau doch nur mal auf deinen Schreibtisch! Da sind genug Briefe zu beantworten …« Ich versuchte, diese Gedanken zu ignorieren, konnte aber nicht umhin, mich zu fragen, ob ich nicht doch ein bisschen zu weit ging. Nachdem ich einige dieser stillen Tage hinter mir hatte, merkte ich jedoch, was für einen wichtigen Schritt diese Ruhe in meinem Leben bedeutete. Ich wurde langsamer.
Mein damaliger Mann war aufs Extremste genervt: Regelmäßig an meinem wöchentlichen Stilletag konnte er partout irgendetwas nicht finden und hatte tausend Fragen, die ich, um Gelassenheit bemüht, schriftlich zu beantworten versuchte. Frustriert starrte er auf den Zettel (ich gebe meine schlechte Handschrift durchaus zu) und behauptete, er könne kein Wort davon lesen.
Das folgende Erlebnis ist allerdings seine Lieblingsgeschichte, und er erzählt sie heute noch gern: Wir waren mit Freunden im Urlaub, und auch hier gab es wieder einen Tag, an dem ich nicht sprach. Wir machten ausgerechnet an diesem Tag alle eine kleine Erkundungstour mit einem winzigen offenen Elektroauto auf einer Insel. Ich hatte die Karte, mein Mann fuhr, und um ihm die Richtung anzugeben, wedelte ich immer wild mit den Armen vor seiner Nase herum. Spaß hat es ihm keinen gemacht.
Mir war aufgefallen, dass der Sicherheitsgurt klemmte, und bei der Rückgabe des Autos versuchte ich, das der Frau vom Autoverleih mit Gesten zu erklären. Sie schaute fragend zu meinem Mann hinüber. Der war gerade dabei, das Auto mit den diversen Geschenken zu entladen, und legte mir die ganzen Taschen und Tüten in die Arme. Dabei meinte er trocken: »Meine Frau ist taub und stumm, aber zum Tragen ist sie noch ganz gut zu gebrauchen.« Mir fielen vor Lachen fast die Geschenke aus den Händen.
Heute weiß ich, dass mein erster Versuch in der Stille nicht das war, was ich eigentlich lernen sollte. Ich sprach ja. Nur nicht mit Worten, eben mit Gesten oder mit Zetteln. Ich war nicht still, denn es war fast anstrengender, alles aufzuschreiben, statt mit kurzen Worten zu antworten. Später, als ich mehr verstand und einfach nicht ansprechbar war, merkte ich den Unterschied. Da ich nicht nur Ehefrau, sondern auch Mutter war, versuchte ich meiner damals vierjährigen Tochter Julia zu erläutern, warum ich das machte. Ich sprach ausführlich über die Notwendigkeit von Stille, Meditation und Gebet. Ein paar Monate später fragte eine Frau meine Tochter: »Warum spricht deine Mama denn heute nicht?« Julia schaute nur flüchtig zu mir hoch und sagte kurz und knapp, was ich ihr ein paar Wochen vorher umständlich zu erklären versucht hatte: »Mama spricht heute mit Gott.«
Unser Leben ist angefüllt mit Geräuschen. Es beginnt schon am frühen Morgen, indem wir durch den Wecker aus der Stille gerissen werden. Unsere Smartphones und andere mobile Geräte klingeln und summen. Fernseher, Radio, Gespräche, Meetings und Diskussionen, soziale Medien, Videos, Telefongespräche … unentwegt Geräuschkulissen. Oft sinken wir ins Bett, ohne ein paar Minuten Stille erlebt zu haben. Doch selbst da ist es für viele von uns nicht still, denn die Lautstärke ungelöster Probleme, Menschen, die uns auf die Nerven gegangen sind, Herausforderungen, auf die wir keine Antworten wissen, dröhnen noch lange in unserem Kopf nach. Am nächsten Morgen kommt mit den Geräuschen auch immer gleich das schwere Gefühl in der Magen- oder Herzgegend dazu, weil uns die ungelösten Probleme weiterhin belasten.
Doch wie werden wir diesen Druck los? Es begann bei mir durch Meditation. Die ersten Versuche, in mir Stille zu finden.
Mein damaliger Mann und ich begannen gemeinsam mit einem Meditationskurs. Wissenschaftler hätten bestätigt, dass Meditation gut für die Gesundheit sei, und ein Kollege habe ihm davon erzählt. Meditation war damals noch nicht in der breiten Bevölkerung angekommen, und auch ich besaß keine Vorstellung davon, was das denn eigentlich bedeutete. Wir lernten die transzendentale Meditation, in der man ein Mantra bekommt, das man immer in Gedanken vor sich hin sagt. Der Sinn lag darin, andere Gedanken, die einem natürlich dauernd dazwischenkamen, mithilfe dieses Mantras loszuwerden. Julia, damals ein krabbelndes Kleinkind, lernte bald, dass Mama da nicht ansprechbar war. Nachdem ich mich geweigert hatte zu reagieren, war ihr klar geworden, dass sie sich einfach selbst beschäftigen musste. Ich hielt meine Uhr zwischen meinen Händen, um zwischendurch immer mal wieder darauf zu schielen, ob die Zeit nicht abgelaufen sei; aber ich merkte einen deutlichen Effekt an mir. Ich war ruhiger geworden, konnte besser schlafen, und die Gedanken, die abends beim Zubettgehen durch meinen Kopf schossen, konnten durch dieses Mantra kontrolliert werden. Zweimal am Tag für zwanzig Minuten nahm ich mir diese Zeit.
Meditation ist Konzentration und Fokus. Man trainiert den Geist in eine Ruhestellung. Ein Jahr später hörte ich mehr geführte Meditationen, die mich zu vorgestellten Ruheplätzen in der Natur brachten oder Kontakte mit Engeln oder Geistführern zum Inhalt hatten. Einige Zeit später änderte sich das, und ich wollte lernen, mich ohne zusätzliche Unterstützung einer geführten Meditation in die Stille zu bringen, und begann, nur auf meinen Atem zu hören. Danach half es mir zu tonen, also zu summen. Dazwischen hatte ich immer wieder Meditationen, bei denen ich beobachtete, was ich dachte, und erschuf so ebenfalls Stille in mir.
Gedanken, wenn beobachtet, werden weniger. Ich meditiere im Sitzen wie im Liegen und halte nicht viel von Restriktionen. Es nützt enorm, eine Meditationsart zu wählen, die man gern macht. Und darauf zu hören, wenn sie nicht mehr funktioniert.
Im Laufe meiner über fünfundzwanzigjährigen Meditationserfahrung habe ich festgestellt, dass Meditationen sich verändern. Gelegentlich hatte ich das Gefühl, ich fange wieder bei null an. Während meiner aktiven Wechseljahre war es für mich enorm schwierig, in die Stille zu sinken. Und trotzdem blieb ich dabei. Selbst wenn ich in diesen zwei Jahren mehr Frust als Lust in meinen Meditationen erlebte. Und doch ging es mir besser, wenn ich mir die Zeit der Stille nahm. Seit einigen Jahren gelingt es mir, mich einfach nur zu spüren. Das ist ein wundervolles Gefühl von Weite und Freiheit.
Der Erfolg unserer Meditationen – und damit nicht nur die Entspannung, sondern auch eine stärkere Verbindung mit unserer Intuition – hängt von unserer Bereitschaft zu üben ab. Das ist vergleichbar dem Erlernen eines Instruments. Das geht eben auch nicht von heute auf morgen.
Meditation beginnt mit dem Wissen um unsere Gedanken. Ich nahm mir einmal einen Kassettenrecorder (daran sehen Sie, wie lange das schon her ist), um meine Gedanken »aufzunehmen«. Während ich »dachte«, sagte ich meine Gedanken laut vor mich hin. Das hörte sich ungefähr so an: »Nun bin ich ja gespannt, was ich jetzt denke. Kuck mal, ein Vogel. Mein Magen knurrt, ich habe ja noch nicht gefrühstückt. Habe ich eigentlich genug Brot im Haus? Der Kühlschrank müsste auch mal wieder ausgewaschen werden. Und abgetaut. Mein Rücken tut mir immer noch weh. Die Esther hat doch bald Geburtstag, was schenke ich ihr nur? Was gab es denn letztes Jahr? Dass ich mich da nicht mehr daran erinnern kann! Der Rücken tut immer noch weh. Hab ich falsch gelegen? Ich müsste mich einfach mehr bewegen. Warum fällt es mir nur immer so schwer, regelmäßig zu turnen? Ist da ein Loch im Zahn? Nein, doch nicht, da fühlte sich bloß irgendetwas komisch an.«
Am Nachmittag setzte ich mich in einen Park und konnte andere Gedanken beobachten: »Also was hat denn die für eine komische Jacke an! Wieso kümmert sich dieser Vater nicht um sein weinendes Kind? Warum muss der mit seinem Motorrad so viel Krach machen? Schon wieder hat irgend so ein Idiot diese Parkbank mit Graffiti beschmiert!« Mir fiel auf, wie bewertend viele meiner Gedanken waren.
Die hauptsächliche Aufgabe des Gehirns ist es, unseren Körper am Leben zu erhalten. Und dazu läuft ein »Bewertungsprogramm« ab. Wir schauen uns um und bewerten das, was wir sehen, als gut oder nicht gut. Als erstrebenswert oder nicht erstrebenswert. Als hilfreich oder gefährlich. Der Ursprung unserer Gedanken stammt oft aus unseren Erlebnissen und Erfahrungen während der Kindheit. Wir sind in einem Gedankenpool unserer Eltern oder Betreuer aufgewachsen, und dieser Gedankenpool hat uns beeinflusst. Jetzt – als Erwachsene – ist es unsere Aufgabe, dort aufzuräumen. Warum denke ich das? Und: Will ich das weiter denken?
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: