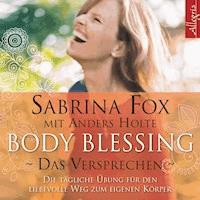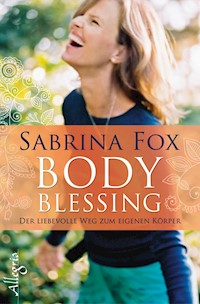12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Das Älterwerden kann doch kein Problem sein, wenn man sein ganzes Leben gesund, ganzheitlich und bewusst gestaltet hat. Von wegen! Um die Fünfzig stellt sich plötzlich doch so etwas wie Ziellosigkeit und Umorientierung ein. Was früher Sinn machte und Sicherheit gab, fühlt sich heute eher schal an, und selbst die verinnerlichten Weisheiten spiritueller Lehren haben plötzlich wenig mit der inneren Wirklichkeit zu tun. Sabrina Fox hat hier ihr wohl intimstes Buch geschrieben. Es begann als eigene Schreibtherapie und entwickelte sich zu einem Buch, das Mut macht und Ausblicke schafft für jede Frau, die selbstbestimmt die Jahre der Veränderung erleben will. Humorvoll und mit dem wachsamen und ehrlichen Blick auf die Herausforderungen beschreibt sie mit einem Schuss Selbstironie das Schleuderprogramm der Wechseljahre. "Mein erster Gedanke nach zwanzig Seiten in Sabrina Fox neuem Buch: 'Das ist kein Sachbuch. Das liest sich wie ein Roman. Was für eine wunderbar fühlbare Sprache, die die Worte zum Leben und Mitfühlen erweckt!' Vor allem lehrt Sabrina Fox ihre Leserinnen, wie sie noch feiner auf ihren Körper hören können. Wenn Sie das Buch zuklappen, haben Sie wahrscheinlich größten Respekt vor diesem feinen Instrument, der Ihr Körper ist." Eva-Maria Zurhorst (Pranahaus-Katalog)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Buch
Selbstbestimmt und selbstehrlich
Das Älterwerden kann doch kein Problem sein, wenn man sein ganzes Leben gesund, ganzheitlich und bewusst gestaltet hat. Von wegen! Um die Fünfzig stellt sich plötzlich doch so etwas wie Ziellosigkeit und Umorientierung ein. Die vertraute Kraft weicht einer ungekannten Antriebslosigkeit und selbst die verinnerlichten Weisheiten spiritueller Lehren haben plötzlich wenig mit der inneren Wirklichkeit zu tun.
Humorvoll und mit dem wachsamen und ehrlichen Blick auf die Herausforderungen beschreibt sie mit einem Schuss Selbstironie das Schleuderprogramm der Wechseljahre. Sie macht Mut und schafft Ausblicke für jede Frau, die selbstbestimmt die Jahre der Veränderung erleben will.
Die Autorin
Sabrina Fox stammt aus München und begann als Sabrina Lallinger ihre berufliche Laufbahn als Fotoredakteurin. Von 1984 bis 1994 arbeitete sie als Moderatorin für das deutsche Fernsehen (ARD, ZDF und SAT 1). 1988 zog sie nach Los Angeles und begann ein intensives spirituelles Training. Sie absolvierte Ausbildungen u.a. als staatlich anerkannte klinische Hypnosetherapeutin, Konflikt-Coach, Mediator und Bildhauerin. Sie ist Mutter einer erwachsenen Tochter und lebt seit 2005 wieder in München. Ihre Bücher haben eine Gesamtauflage von über einer Mio. Exemplaren.
Sabrina Fox
Kein fliegender Wechsel
Jede Frau wird älter, fragt sich nur wie
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN: 978-3-8437-0913-2
© 2014 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Lektorat: Ralf Lay
Umschlaggestaltung: X-Design, München
Titelfoto: © Allegria Verlag (Fotograf: Christian M. Weiß)
Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung,
Verbreitung, Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich
verfolgt werden.
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Dieses Buch ist uns Frauen gewidmet und in Dankbarkeit unseren Freundinnen.
Sie schreiben ein neues Buch. Ist es ein Ratgeber?
»Eher ein Reisebericht.«
Von einer Wellness-Reise?
»Wellness würde ich sie nicht nennen.«
War sie interessant?
»Interessant trifft es eher.«
War es eine Bildungsreise?
»Ja, auf jeden Fall.«
Einweichen
Mit 53 Jahren
Ich sitze in einem Zug, der nicht abfährt. Wenn ich durch das Fenster auf den Bahnhof schaue, dann sehe ich, wie jeder weiß, wo er hinwill, zielbewusst, mit Gepäck, mit einem Plan und mit einer Fahrkarte an mir vorbeiläuft. Doch ich, ich sitze im Zug. In einem Zug, der sich immer noch nicht bewegt. Der immer noch kein Ziel hat. Ein paarmal bin ich ausgestiegen, um zu sehen, ob ich denn überhaupt im richtigen Zug sitze. Doch da steht eindeutig: »Fahrplan: Sabrina Fox. Zeit: jetzt.«
Dann gehe ich zurück in meinen Zug. Manchmal zähneknirschend, manchmal lachend, manchmal genervt. Aber immer ein wenig neidisch, wenn ich die anderen anschaue, die weiterhin an mir vorbeiziehen. Sie wissen, wo sie hinfahren. Sie kennen ihr Ziel. Sie sind auf dem Weg. Ich dagegen kenne mein Ziel nicht, und so betrachte ich ungeduldig die Züge, die neben mir ankommen und wieder abfahren. Nur meiner, so scheint es, bewegt sich nicht.
Ein-, zweimal bin ich in den letzten Monaten kurz ausgestiegen, und mir ging es sofort besser. Ich wusste genau, was zu tun war: irgendein Projekt nehmen, eines, das ein Ziel hat, oder einfach da weitermachen, wo ich vor ein paar Monaten aufgehört hatte. Einfach weiterhin Vorträge halten. Einfach wieder Ja zu Angeboten sagen. Doch dieser verdammte Zug will kein Ja mehr hören. Meine Seele wollte, dass er steht, und weil ich mich vor Jahren meinem inneren Wachstum verpflichtet hatte, musste ich ihn anhalten. Und da steht er nun, mit dreiundfünfzig Jahren, und bewegt sich nicht. Schieben hilft nichts, das habe ich probiert. Weglaufen bringt auch nichts, dazu weiß ich zu viel.
Ich kenne sämtliche Erklärungen auswendig. Schließlich habe ich sie oft genug gelehrt. Oft genug erklärt. Oft genug mir selbst vorgebetet. Das ist auch nicht meine erste Erfahrung darin. Aber die intensivste. Ich hatte mich bisher nicht so komplett darauf eingelassen, im Jetzt zu sein. Was aber, wenn das Jetzt mich eines Zieles beraubt? Was, wenn nie wieder eines kommt? Was, wenn ich meine Begeisterung für das Leben völlig und unwiederbringlich verloren habe? Sehnsüchte waren mein inneres Feuer, und sie sorgten dafür, dass ich mich bewegte. Die Sehnsucht, mich weiterzuentwickeln. Die Sehnsucht nach einem sinnvolleren Leben. Die Sehnsucht nach innigeren Partnerschaften. Die Sehnsucht nach einem friedlichen Miteinander. Jetzt, da das Sehnsuchtsfeuer nicht mal mehr eine Glut ist, geht sie mir ab. Ich suche nach meinen Sehnsüchten wie nach verlorenen Autoschlüsseln.
Wenn ich mich auf die Stille in meinem Zug einlasse, dann spüre ich die beiden Frauen, die mit mir reisen. Zwei Frauen, die ich erst vor ein paar Monaten in einer Meditation wahrgenommen habe. Eine ist meine Vorfahrin. Meine Ahnin. Sie zeigt sich mir nur mit ihrem Kind unter dem Arm, das sie nach vorn schleudert, weil das Kind es besser haben soll. Sie war damals, als Erste, als Ursprung meiner menschlichen DNA, aus einer Höhle gekrochen und wollte raus. Sie hat mir ihren Vorwärtsdrang vermacht. Sie ist es, die mich schubst, die keine Ruhe gibt, bis ich weitermache.
Ich bin ihr dankbar, denn ohne sie wäre ich nicht aus der Enge meines Elternhauses gekommen. Ohne sie hätte ich es nicht geschafft, weiter vorauszugehen und die von mir in der Kindheit gesteckten Grenzen zu überwinden; und doch ist es auch mühsam mit ihr. Sie drängt eben nicht manchmal – nur dann, wenn es notwendig und wichtig ist –, sondern sie drängt immer. Sie will, dass ich weiter vorwärts gehe. Sie kennt keine Pausen. Sie kennt kein Innehalten. Innehalten ist für sie das Ende. Ich erspüre sie als jemanden, der nie mit dem jetzigen Moment zufrieden sein kann. Sie denkt immer an morgen. Immer an das Nächste. Weiter! Komm! Beweg dich! Ihre Forderungen kommen mit Ausrufezeichen, und in diesem Zug, der nicht abfährt, wird sie verrückt.
Gott sei Dank sitzt noch jemand anders in diesem Zug: eine alte, weise Frau. Sie sieht mir ähnlich, denn sie ist – wie meine Vorfahrin – ich.
Sie ist ich am Ende dieses Lebens. Sie hat die Erfahrungen schon gemacht, die mir noch bevorstehen. Sie hat liebste Mitmenschen verabschiedet. Manche hat sie auf dem Weg nach Hause betreut, manche sind in ihren Armen gestorben, und damit starb auch immer eine Erinnerung an sie selbst. Sie hat das Abschiednehmen gelernt, und sie hat gelernt, entspannt im Jetzt zu leben.
Sie schmunzelt, wenn sie sieht, wie ich darauf warte, dass wir abfahren. Sie hat es nicht eilig. Sie weiß, wo wir landen werden. Hier bei ihr. In dieser wunderbaren Innigkeit. Und ich weiß es auch. Und doch, ich – in meinem Jetzt – habe so meine Schwierigkeiten damit, mich auf ihre Ruhe in meinem Zug einzulassen. Sie sitzt, mit einem Bein angewinkelt, mir gegenüber.
Manchmal sitze ich auch in ihr. Dann spüre ich sie. Spüre ihre Leichtigkeit. Ihre Weisheit. Und wenn ich mich mit ihr ganz verbunden habe – wir uns ineinander auflösen, wenn Zeit und Raum nicht mehr existieren –, wenn alles in mir langsamer wird, dann empfinde ich ihre Glückseligkeit. Und dann wundere ich mich, warum ich mich denn in diesem heutigen Moment so verwirren lasse. Immerhin sitze ich in einem Zug. Es regnet nicht herein. Mir ist nicht kalt. Er ist bequem. Ich bin in Gesellschaft und fühle mich mit beiden Frauen so inniglich vertraut: der einen, die drängt, und der anderen, die entspannt lebt. Und beide gilt es zu verbinden: die Weisheit der einen mit der Kraft der anderen.
Ich habe mir eine Kette machen lassen: auf der einen Seite ein Bild von mir als Vorfahrin, auf der anderen eines als alte, weise Frau. Das trage ich um den Hals, um mich daran zu erinnern, beides zu verbinden.
Es gelingt mir nicht wirklich.
Ich war bei einem Abendessen eingeladen, und das Gespräch kam auf Auszeiten. Drei der Gäste träumten beim Nachtisch davon, wie es wohl wäre, sich einmal eine richtige Auszeit zu gönnen. »Die Leichtigkeit des Seins zu erleben«, wie einer es poetisch formulierte, »ohne Termine und ohne Druck.« Der Gesichtsausdruck aller drei schwankte zwischen Sehnsucht, Glückseligkeit und schwärmerischer Vorfreude.
Ich dagegen war mir meiner Stirnfalten bewusst. »Es hört sich … hm … leichter an, als es ist.« Die drei schauten mich an, als hätte ich ihnen den Nachtisch weggelöffelt. Ja, wie erkläre ich das? Ich hätte es damals auch nicht verstanden. Meine Vorstellungen waren deckungsgleich mit denen der anderen Gäste: So eine Auszeit wird – muss! – großartig sein.
Oft hatte ich darüber nachgedacht, wie es wohl wäre, einen leeren Kalender zu haben. Einmal im Leben wirklich im Moment leben zu können. Morgens aufzustehen und sich zu entscheiden: Wozu habe ich denn heute Lust? Würde ich in diesen glückseligen Zustand fallen, in dem angeblich Mönche sind, die in Schweige- oder Zen-Klöstern leben? Würde es mir endlich, endlich wirklich gelingen, in jeder Sekunde meines Lebens im Moment zu leben? Würde ich mich dabei für ein völlig neues Leben entscheiden? Ich will mit offenen Augen in die Welt sehen und Ja sagen können, wenn mir danach ist, und nicht: »In zwei Jahren hätte ich da zwischen dem 15. und 21. Februar noch eine Terminlücke.«
Einige meiner Freunde sehnten sich ebenfalls nach Auszeiten. Manche waren so erschöpft, dass sie einfach nur ein Jahr lang ausschlafen wollten. Einige unglücklich mit dem, was sie sich erschaffen hatten. Beides war bei mir nicht der Fall. Ich war weder knapp vorm Burn-out noch unzufrieden mit meinen Lebensumständen. Und doch spürte ich, dass meine Seele diese Pause von mir verlangte.
Eine Pause ist auch immer mit der Frage verbunden, wie ich denn weitermachen will. Will ich nur eine Auszeit oder brauche ich eine Veränderung?
Ich habe fast zwanzig Jahre lang Vorträge und Workshops über spirituelles und persönliches Wachstum gehalten und war mir nicht sicher, ob es nicht Zeit war, damit aufzuhören. Es gibt so viele neue Autoren und Autorinnen, die mit einer Begeisterung auf Reisen gehen – was vortragen auch bedeutet –, und vielleicht sollte ich Platz machen? Ich bin das, was man einen »Einzelkämpfer« nennt. Ich hatte ab und zu eine Assistentin, aber das meiste organisiere und mache ich alleine. Ich sehne mich nach einem Team. Nach einer Zugehörigkeit. Ich habe Freunde, klar, aber seit meiner Journalisten- und auch Fernsehzeit habe ich mein Büro zu Hause. Vielleicht bietet sich mir ein völlig neues Leben an, wenn ich endlich mal Platz dafür lasse? Und um Platz zu lassen, muss ich mein berufliches Leben reduzieren.
Vorträge in der Schweiz? »Wirklich sehr weit weg.«
Termine für den Herbst? »Den Herbst möchte ich mir freihalten.«
»Die nächste Zeit klappt es nicht, aber probieren Sie es doch in einem Jahr noch mal.«
Ich wollte nicht, dass es klappt.
Meine Antworten auf Anfragen waren ausweichend. Ich fand mich für Wochen unhöflich und unpräzise. Ich musste eine Entscheidung für einen komplett leeren Kalender treffen. Als mir das klar wurde, zwang ich mich, Nein zu sagen.
Nein zu allen Anfragen.
Nein zu allen Angeboten.
Nein zu meinem beruflichen Leben.
Wochenlang nein.
Bis er leer war. Wirklich leer war.
Mein letzter öffentlicher Termin war ein großer Kongress in Hamburg. Ich verabschiedete mich. War sicher, dass ich mich für eine lange Zeit – wenn nicht für immer – zurückziehe. Es wird etwas gänzlich Neues kommen. Dafür wollte ich Platz lassen.
»Weißt du da, was du tust?« Die Stimme in mir war laut und eindringlich. »Du schmeißt alles weg, was du dir in den letzten zwanzig Jahren aufgebaut hast.«
»Nein, ich schmeiße es nicht weg. Ich lege es nur weg.«
»Blödsinn! Du weißt, dass du eine Aufgabe hast.«
»Was ich kann, können viele. So wichtig bin ich nicht.«
»Ah! Mal wieder auf Rückzug.«
»Ja, mal wieder auf Rückzug. Du weißt, dass ich kein Guru sein will.«
»Keine Sorge, so wie du mit deinen Lesern umgehst, wird das auch nicht passieren.«
»Na also, dann sind wir uns ja einig.«
»Sind wir nicht.«
»Was willst du denn von mir?«
»Du bist noch nicht fertig.«
»Es fühlt sich aber so an.«
»Das mag sein. Aber du bist trotzdem noch nicht fertig.«
»Wir werden sehen.«
»Ja, das werden wir. Vergiss nur nicht, dass ich dir das schon immer gesagt habe.«
Vielleicht hat die Stimme in mir recht? Vielleicht ziehe ich mich aus Feigheit zurück? Es gibt einen Aspekt aus meiner Vergangenheit in mir, der fürchtet sich vor zu viel Popularität; vor zu viel Öffentlichkeit. Als ich noch Fernsehmoderatorin war, litt ich häufig darunter. Ein gehässiger Brief konnte mich für Wochen aus dem Gleichgewicht werfen. Eine schlechte Kritik sorgte dafür, dass ich mich nicht mehr aus dem Haus traute. Öffentliches Lob und öffentliche Häme. Die Achterbahnfahrt kenne ich. Doch damals war ich dreißig Jahre jünger. Unsicher in dem, was ich war. Viel zu sehr bemüht, zu gefallen, und leicht zu verwirren.
Mit Facebook- und YouTube-Kommentaren ist es noch mehr geworden. Es hat Jahre gedauert, bis ich mir erlaubt habe, gelegentliche unhöfliche Kommentare von meinen YouTube-Videos zu löschen. Ich war uneinig in mir, da ich jede Meinung anerkenne, bis mir klar wurde, dass ich Unhöflichkeiten nicht anerkennen muss.
Als ich anfing zu schreiben, kam eine andere Art der Popularität. Sie war ruhiger und unter dem Radar der Tageszeitungen. Ich lebte damals in Los Angeles und bekam vieles nicht wirklich mit. Dort war ich völlig unbekannt und wusste, dass ich beim Aufschlagen meiner Zeitung niemals etwas Überraschendes oder Schmerzhaftes über mich lesen würde.
In mir gibt es diese verletzte Sabrina von früher – ein Waisenkind von mir –, der ein völliger öffentlicher Rückzug lieber wäre. Die es mag, ein überschaubares, ein unauffälliges Leben zu führen. Sie zerrt mich gelegentlich aus der Öffentlichkeit zurück.
Zerrt sie jetzt wieder? Ist es nur mein verletzter Aspekt, der sich den Rückzug wünscht, oder folge ich einem gesunden und notwendigen Wunsch?
In mir gibt es nicht nur diese Stimme. Da gibt es die Stimme, die an mir herumnörgelt. Die war früher dauernd da, die ist jetzt relativ ruhig. Ich habe ihr mal einen Namen gegeben: Hans. Das war der Name meines Vaters.
»Ach, Hans, welchem Anspruch von dir genüge ich heute denn schon wieder nicht?« Mit jeder direkten Ansprache wurde die Stimme stiller. Einen Namen hat sie jetzt nicht mehr. Ich höre zu, was sie zu sagen hat, und schaue nach, ob es stimmt.
Manchmal hat sie recht. Dann ändere ich es.
Dann gibt es die Stimme, die mir Mut zuspricht.
Auch diese Stimme war früher oft da. Mut bedeutet nicht, dass man ohne Angst ist. Mut bedeutet, dass man es trotz der Angst macht. Diese Stimme war mein Gegenpol zu Hans. Jetzt meldet sie sich nur, wenn ich sie rufe. Da ich mutig bin, rufe ich sie selten.
Dann gibt es die Stimme, die dafür sorgt, dass ich nicht arrogant werde. Ich mag es, wenn sie immer mal wieder nachschaut, ob ich größenwahnsinnig geworden bin. In meinem Beruf passiert das relativ oft. Wenn man viel um Rat gefragt wird, dann glaubt man gerne, man weiß alles. Das kann man bei Ärzten erleben. Oder manchen Experten. Oder bei engstirnigen Wissenschaftlern – was mir, ehrlich gesagt, ein Rätsel ist. Wissenschaftler müssen ja berufsbedingt offen für überraschende Ergebnisse sein, aber einige scheinen das vergessen zu haben.
Und dann gibt es die Stimme, die alle anderen zum Schweigen bringt.
Das ist die Stimme, die mich daran erinnert, dass ich als Seele für immer bin, hier nur eine zeitlich begrenzte menschliche Erfahrung mache und mich nicht verwirren lassen muss von den Einflüssen von außen.
Die höre ich am liebsten.
»Wir machen jetzt einfach mal eine Pause, verstehst du mich? Schließlich sind wir für immer, und in dem ›Für immer‹ werde ich ja wohl Platz für eine Auszeit haben.«
»Mach nur. Aber beschwer dich später nicht.«
Beschweren? Ich? Das gehört nicht wirklich zu meinen Gewohnheiten. Es hat Jahre gedauert, bis ich mir das abgewöhnt hatte, und ich habe nicht vor, mir das wieder anzugewöhnen.
Ich schrieb an meinem ersten Roman über eine Frau, die durch den Tango ihre Weiblichkeit entdeckt, und konnte mir zum ersten Mal richtig Zeit lassen. Es gab keinen Abgabetermin und nicht einmal einen Verlag. Da es kein Sachbuch ist, war er nicht passend für die Verlage, mit denen ich normalerweise zusammenarbeite. Ich wollte ihn komplett fertig haben und erst dann anbieten. Einfach mal schauen, was sich mit mehr Zeit ergeben kann.
Ohne Zeitdruck hatte ich auch mehr Gelegenheit, länger in meinem Bildhaueratelier zu bleiben. Normalerweise hatte ich nicht mehr als drei, vier, fünf zusammenhängende Tage. Jetzt konnte ich mich wochenlang im Atelier aufhalten und an meinen Köpfen arbeiten. Nichts musste unterbrochen werden. Ich spielte immer mal wieder mit der Idee, mich ganz meiner Bildhauerei zu widmen. Das war eine gute Gelegenheit, es auszuprobieren.
Meine Tochter rief an und fragte mich, ob ich sie nicht in Boston, wo sie im letzten Semester studierte, besuchen könnte. Ich flog ein paar Tage später. Es war ganz einfach. Ich blieb länger als sonst. Wieder ganz einfach.
Mir fiel auf, wie oft die Leute annehmen, dass man im Stress ist. Ich war es auf gar keinen Fall und sagte das auch.
»Ich weiß, Sie haben viel zu tun, aber ich hätte da …«
»Ich habe alle Zeit der Welt.«
Die Überraschung auf diese Antwort war immer wieder köstlich. Ich fühlte mich frei. Gut.
Eigentlich gut.
Oder?
Nach ein paar Monaten merkte ich, dass die Freude weniger wurde. Ich bemerkte in mir eine Unruhe, die ich nicht richtig deuten konnte. Meine Meditationen fingen an, flacher zu werden. Ich erspürte eine leichte Gereiztheit.
Schreiben, das mir normalerweise große Freude bringt, wurde mühsam. Natürlich hat ein Roman einen völlig anderen Aufbau, und normalerweise freut es mich, etwas dazuzulernen – das war auch das Spannendste für mich an meinem Romanprojekt –, hier jedoch fand ich mich in eigenartigen Gewässern wieder.
Wenn ich etwas Neues lerne, empfinde ich eine Freude und Kraft, und diese Kraft trägt mich eine lange, lange Zeit – eben bis zum Ziel dieses Lernens. Ich weiß um das Auf und Ab beim Lernen, um die gelegentlichen Rückfälle, das Üben und das Ausprobieren. Das finde ich alles spannend. Ich erfreue mich an dem, was ich dann verstanden und auch umgesetzt habe. Ich habe einige Schreibkurse für Romane besucht, viel gelesen, viel erklärt bekommen; und doch fühlte ich mich, als ob ich beim Vorwärtsgehen einen schweren Rucksack tragen würde. Einen Rucksack, bei dem ich nicht wirklich wusste, wozu er gut war. Warum fühlte ich mich neuerdings so angestrengt?
Vielleicht ist zu viel unstrukturierte Zeit schwierig für mich? Ich bin das nicht gewohnt. Wie machen andere das denn? Ich fühlte mich unproduktiv. Unausgelastet.
Obwohl ich was machte, machte ich nichts wirklich fertig. Der Roman zog sich wie Kaugummi. Version über Version über Version. Dazwischen arbeitete ich an zwei Theaterstücken. Eines, das ich fertig machen wollte, und ein anderes, das auch nicht richtig vorankam. Selbst an meinen Skulpturen fummelte ich eine Ewigkeit hin.
Ich kam mir vor, als wäre ich schon in Rente.
Ich darf meine E-Mails nicht morgens lesen, weil ich sonst zu nichts anderem mehr komme. Meine E-Mails haben lange Krakenfinger, die sich in mein Gehirn bohren, in meine Zeit bohren und sie nicht mehr loslassen. Facebook-Nachrichten kommen in meine E-Mails, und dann muss ich auf Facebook, um sie dort zu beantworten, und dann kommen die Facebook-Kraken. Die sind kürzer. Lassen sich leichter abschütteln. Doch wenn ich wieder zurück zu meinen E-Mails gehe, wartet der Krake schon auf mich.
Ich kann Stunden damit verbringen, E-Mails zu beantworten, Tage, Monate, Jahre, wenn es sein muss, und habe immer das Gefühl, nichts gemacht zu haben. Nichts Wertvolles. Nichts Produktives. In meinen Meditationen heißt es immer wieder: E-Mails nur einmal am Tag anschauen und erst nachdem deine kreative Arbeit erledigt ist.
Ich komme mir vor wie ein Alkoholiker, der an der Flasche hängt. Ich sitze morgens am Schreibtisch und fühle mich leer. Ein paarmal stöhne ich – auch das nur innerlich, damit ich damit nicht meinem Umfeld auf die Nerven gehe, obwohl ich hier alleine sitze. Ich will nicht einmal, dass meine Möbel etwas von meinem Frust mitbekommen. Mein Tango-Roman. Himmel, was mache ich nur mit dir? Was ist mit dieser Leidenschaft passiert, mit der ich angefangen habe? Jetzt liegst du rum wie ein syphiliskranker Casanova und drehst dich nur noch hin und her, statt aufzustehen und dich charmant der Welt zu zeigen.
Auf meinem Schreibtisch liegen bunte Fotografien von dem Kopf, den ich gestaltet habe und der als Helmhalter gedacht ist. Neuerdings habe ich in meinem Gang zwei Helme für meinen elektrischen Roller liegen und keinen Platz, sie unterzubringen. Ich hatte die Idee, einen Männerkopf zu modellieren, um ihn zu vervielfältigen und zwei davon zur Dekoration an die Wand zu hängen.
Ich liebte diese Idee. Das würde bestimmt auch andere Leute interessieren: Leute mit Fahrradhelmen. Skihelmen. Motorradhelmen. Rollerhelmen. Ein glatzköpfiger Mann mit geschlossenen Augen, der in einer Farbe ihrer Wahl an der Wand hängt und auf dessen Kopf der Helm abgelegt wird. Ich habe sogar schon eine Firma, die die Produktion dafür übernehmen will, und dann verliere ich Saft wie mein Elektroroller, wenn er leer wird. Es ist nur ein blöder Anruf! Ich muss der Firma nur sagen, dass ich eine Kopie des Kopfes (das ist wenigstens schon erledigt!) vom Atelier zu ihnen fahre und … das schaffe ich nicht.
Mein Scheidungsbuch. Das war mal eine Herzensangelegenheit von mir. Ehrenhafte Scheidungen, den Kindern zuliebe. Sich selbst zuliebe. Davon habe ich immer mit Begeisterung erzählt. Jetzt erzähle ich nicht einmal mehr davon. Ich habe auch noch nicht damit angefangen. Beim Verlag habe ich den Erscheinungstermin schon einmal verschoben. Das hatte ich noch nie getan.
Die englische Ausgabe von BodyBlessing – Der liebevolle Weg zum eigenen Körper hat einen Übersetzer gefunden. Wenigstens das habe ich auf den Weg gebracht. Natürlich hätte ich es auch selbst übersetzen können, aber das habe ich einmal gemacht, und das will ich mir nicht noch mal antun. In drei Monaten soll es fertig sein. Ich will es dann als E-Book herausgeben. Selber.
Ach Gott, E-Book. Da liegt noch mal eine volle Kiste von Recherchen. Lulu. Thalia. Amazon. Epubli. Mobi. Epub. Jutoh. Anbieter, Programme, Möglichkeiten. Das Cover der deutschen Ausgabe kann ich mit Erlaubnis des Verlags benutzen.
Ach, Cover … das Tango-Cover fehlt mir … der Titel fehlt mir auch … die Leseraktion habe ich noch nicht gemacht, die ich vor dem Tango-Buch noch machen möchte. Auch diese Idee hat mir gefallen: Die Leser haben die Möglichkeit, ihr eigenes Ende, ihr »Ein Jahr später«, in meinem Roman mit meinem Ende zu veröffentlichen. Dazu muss ich auf meiner Facebook-Fan-Seite noch die Anfrage stellen, wer mitmachen möchte, die Listen erstellen, wer mitgemacht hat, das Manuskript rausschicken und …
Ich stehe auf und schaue aus dem Fenster.
Mein Verstand weiß genau, was zu tun ist, und mein Körper sagt: »Kannst du das auch allein? Muss ich denn dafür anwesend sein?«
»Ja! Das ging doch früher auch. Reiß dich zusammen.«
Da ist es wieder: »Reiß dich zusammen.« Das Motto meiner Kindheit. Mühsam therapiert, verstanden, verweint, erlöst … und jetzt taucht es wieder auf. Ich lache laut aus dem offenen Fenster. Wie eine halb Irrsinnige. Und weine gleich dazu. Nein, wir reißen uns nicht mehr zusammen. Das haben wir uns abgewöhnt (ich habe gelegentlich die Angewohnheit, von mir im Plural zu sprechen). Wir akzeptieren, was ist, und erlauben uns auch Schwäche. Hast du verstanden? (Hier wechsle ich wieder ins Du.)
Ich nicke. Schließe das Fenster. Setze mich an den Schreibtisch.
Ach, ich hole mir erst einen Tee. Ich gehe runter in die Küche und mache das Wasser heiß. Dann mache ich den kleinen Fernseher in der Küche an. Ich habe früher selten ferngesehen. Jetzt mache ich es an, um Leuten beim Leben zuzusehen. Leuten, die begeistert sind – oder verrückt. Leuten, die was erzählen oder erleben.
Ich fülle den Tee in meine Thermoskanne. Dann setze ich mich an den Küchentisch und schaue noch ein paar Minuten fern. Ich drehe mich zur Uhr. Ich mache zögerlich den Fernseher aus und schleppe mich nach oben in mein Büro. Mein Blick fällt auf meine Hängeordner. Wahrscheinlich sollte ich die erst einmal sortieren. So kann ja kein Mensch arbeiten.
»Die hast du erst letzte Woche sortiert.«
»Wirklich?«
»Ja.«
Ich setze mich auf den Boden und ziehe den Rollwagen mit den Hängeordnern zu mir. Erster Ordner: Rechnungen. Er ist leer. Ich habe alle bezahlt. Vorgestern. Das war mein produktivster Tag in der letzten Woche. Zweiter Ordner: Tango-Buch. Ein paar Cover-Ideen liegen drin. Gesammeltes Infomaterial. Absagen von Verlagen.
Das war ich nicht gewohnt. Ich habe sieben Absagen bekommen. Passt nicht ins Programm. Tanzen interessiert die Leser nicht et cetera, et cetera. Vielleicht sollte ich ihn einfach lassen? Ich schreibe erfolgreich Sachbücher, wenn man da ins Romanfach wechselt, wird man trotzdem wie ein Autoren-Anfänger behandelt. Und man ist auch einer.
In dem Ordner gibt es nichts zum Wegschmeißen oder Ablegen. Hier steckt Arbeit drin. Ich lege ihn zurück, wie man schmutzige Sportwäsche in die Waschmaschine legt.
Ich bin selbst wie ein Buch, das nicht mit Leidenschaft gelesen wird, sondern das auf einem Gartentisch halb geöffnet herumliegt, während der Leser weggegangen ist, um sich einen Eistee zu holen oder sich mit dem Postboten zu unterhalten.
Ich bin halb gelesen. Mein Leben ist halb vorbei. Das heißt, falls ich nicht in nächster Zeit von einem Bus überfahren werde. Da ist eine Leere entstanden, und ich weiß nicht, womit ich sie füllen soll. Ich zögere. Ich warte. Warte auf Unbestimmtes. Beschäftige mich ohne die Kraft, die mir so vertraut war. Bisher war mein Leben spannend und aufregend.
War es das jetzt?
Vorwaschen
Vier Jahre vorher
Ich bin immer gern älter geworden. Ich erinnere mich an eine Freundin, die schon an ihrem dreißigsten Geburtstag in Tränen ausbrach. Andere haderten mit ihrem vierzigsten. Ich war jedes Jahr glücklicher. Jedes Jahr wurde es besser. Was ist mit diesem neunundvierzigsten Jahr, dass ich mich neuerdings in Teilen betrachte? Ich sehe nicht mehr den Gesamteindruck von mir, sondern nur noch Puzzleteile: die Falten da, die Schlaffheit dort. Als wenn ich mich mit einer Lupe sezierte.
Wie auf Kommando wird Älterwerden bei meinen Freundinnen ein Gesprächsthema.
Wieso kommen diese Gedanken übers Älterwerden dauernd hoch? Ich will nicht, dass mein Aussehen so wichtig ist. Ich will, dass meine Falten mir egal sind. Warum ausgerechnet jetzt? Falten habe ich doch schon seit einer Weile.
Ich bin mit einer Bekannten beim Essen und beobachte, wie sie beim Tischaussuchen an die Decke starrt und ein paar Tische im Restaurant ablehnt. Ich kenne das von mir selber. Nicht an jedem Tisch möchte ich sitzen, aber ich starre dafür nicht an die Decke, sondern erspüre eher die Umgebung. Als ich nachfrage, erklärt sie mir, dass sie nie an einem Tisch sitzt, wo das Licht von oben kommt, weil sie dann älter aussieht.
Am Abend schaue ich mir meine Lichter im Bad genauer an. Vielleicht ist die Grundidee gar nicht so schlecht? Vielleicht sollte ich meine Glühbirnen austauschen? Weniger Volt, um den Gedanken wenigstens nicht mehr Futter zu geben.
Ich bemerke zu meinem Schrecken, dass ich anfange, mich mit anderen Frauen zu vergleichen. Sieht sie jünger aus, älter? Hat sie was gemacht? Wenn ja, was? Sieht man es? Ich habe mich bisher noch nie in Konkurrenz zu anderen Frauen gesehen. Ich bewundere andere Frauen und sage ihnen das auch, und plötzlich vergleiche ich mich mit ihnen. Was regt sich da nur in mir?
Die ersten Monate tue ich das, was normalerweise gut funktioniert: Wenn ich Gedanken bemerke, die mich nicht unterstützen, akzeptiere ich sie, und dann denke ich bewusst an etwas anderes. Doch diese kommen immer wieder wie ein nerviger Juckreiz. Dann endlich ist mir klar, dass ich darüber meditieren muss. Ich muss vor irgendetwas Angst haben.
Ich setze mich zur Meditation hin, und mit ein paar tiefen Atemzügen gehe ich in die mir vertraute und geliebte Stille. Dort, tief in mir angekommen, frage ich mich: Wer in mir hat Angst vor dem Alter? Eine Weile ist es ruhig, und dann zeigt sich aus der Tiefe meiner erlebten Vergangenheit meine Teenager-Sabrina. Sie ist sechzehn. Unattraktiv. Übergewichtig. Bebrillt. Ich spüre die Unsicherheit von damals in meinem Herzen. Es klopft wild und ängstlich. Meinen ersten Freund habe ich aus Verzweiflung erfunden, und der erste wirkliche Freund ließ mich nach einem Monat und meiner Entjungferung sitzen. Wir hatten zu Hause kein Geld und ich keinen Geschmack. Ich fühlte mich damals unbeachtet, ungeliebt, uninteressant.
»Erinnerst du dich«, fragt mich die Teenager-Sabrina, »wie wir uns gefühlt haben? Erinnerst du dich, wie einsam wir waren? Wie oft wir geflüchtet sind in Tagträume und Liebesromane? Erinnerst du dich, wie wir uns um jede Freundschaft bemühen mussten? Erinnerst du dich, wie alle Jungs immer nur nach deiner schönen Freundin Uschi gefragt haben? Erinnerst du dich an all die Lügen, die wir erfunden haben, um wenigstens ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen? Erinnerst du dich? Das passiert jetzt wieder. Wir werden wieder hässlich, und dann passiert das alles noch mal. Ich muss uns davor bewahren!«
Ich bin gerührt von meiner Teenager-Sabrina, die all die Jahre stillgehalten hat. Ich weiß, was sie braucht. Sie braucht Trost. Ich erkläre ihr, dass wir niemals wieder wie in unserer Teenagerzeit aussehen und fühlen werden. Wir haben in uns selbst Ruhe gefunden. Wir kümmern uns um uns. Wir haben wunderbare Freunde, und wir haben uns ein ausbalanciertes Leben geschaffen. Ich erinnere sie daran, dass wir – als Seele – für immer sind.
»Bist du sicher, ja? Wirklich sicher?«
»Ja. Ich bin sicher. Außerdem bin ich immer für dich da, und ich verlasse dich nicht.«
Mein Herz beruhigt sich.
Ich öffne die Augen und muss lächeln. Wer in der Pubertät so aussah wie ich, muss wirklich keine Angst vor dem Älterwerden haben. Schlimmer als damals kann es nicht werden.
Die Teenager-Sabrina hatte Angst, wieder hässlich zu werden. Und doch war meine Unattraktivität ein Glück. Männerblicke fallen mir dadurch selten auf, denn ich war sie während meiner prägenden Teenagerphase nicht gewohnt. Für manche Frauen, die ihr ganzes Leben lang die aufmerksamen Blicke der Männer auf sich zogen, mag der Verlust ein herber Schlag sein.
Ich saß bei einem Abendessen einer wunderschönen Frau gegenüber. Sie muss wohl Mitte sechzig, vielleicht siebzig Jahre alt gewesen sein, und sie war eine außergewöhnliche Schönheit. Als Bildhauerin konnte ich meine Augen nicht von ihr abwenden. Ihr fiel das natürlich auf, und so entschuldigte ich mich: »Es tut mir leid, aber ich muss Sie die ganze Zeit anschauen. Sie sind so schön.«
Sie warf mir einen traurigen Blick zu: »Ich war schön. Doch seitdem ich fünfzig bin, ist mein Leben vorbei.«
Sie sagte es mit solch einer herzzerreißenden Bitterkeit, dass ich spontan nachfragte: »Was ist passiert?«
»Von da an schaute mir kein Mann mehr nach, wenn ich in den Raum trat.«
Ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte. Stammelte vor mich hin, dass das nicht stimmen kann, sie ist so wunderschön.
Doch es spielte keine Rolle mehr. Sie hörte mich nicht.
Ich war kein Mann.
Ich werde bald eine Frau mit fünfzig Jahren.
Fünfzig.
Klingt nach meiner Mutter, nicht nach mir. Meine Mutter hat sich nicht viel verändert. Sie war mal mehr, mal weniger rundlich. In ihrer Jugend waren kurze Haarschnitte modern, und die Frisur trägt sie immer noch. Sie hatte nie eine andere Haarfarbe – außer jetzt, da sie grauer ist.
Ich war mal blond, mal dunkel, sogar mal rothaarig. Meine Haare waren lang und auch schon mal raspelkurz. Als ich geboren wurde, waren beide Großmütter Ende vierzig. Sie wirkten uralt. Auch sie hatten immer die gleiche Frisur. In meiner Erinnerung haben sie sich nicht verändert. Eine trug schon seit dem Tod ihres Mannes – über zwanzig Jahre vorher – immer noch Schwarz. Lange, fast knöchellange Kleider mit dunkel gemusterten Kittelschürzen drüber. Die leicht ergrauten Haare waren zu einem strengen Dutt gebunden. Lippenstift hatten beide ihr ganzes Leben lang nie benutzt. Meine andere Oma war kleiner und lebenslustiger. Aber auch sie wie eine Bilderbuch-Oma eben: rundlich. Kochend. Kittelschürze. Beide starben, als sie in den Siebzigern waren.
In den Generationen danach hat sich viel verändert. Die 68er sind gekommen und haben rebelliert. Die Frauen vor mir haben für die Gleichberechtigung gekämpft, die für meine achtzehnjährige Tochter eine Selbstverständlichkeit ist. Als ich ihr vor ein paar Jahren erzählte, dass es früher kein Frauenwahlrecht gab, dachte sie, ich nehme sie auf den Arm. Wir Babyboomer haben uns im Berufsleben noch in schwarze Hosenanzüge geschmissen, um ernst genommen zu werden. Die Generation meiner Tochter zweifelt nicht daran, ernst genommen zu werden. Ihre männlichen Counterparts werden sich eher davor fürchten müssen, nicht von ihren zehn Zentimeter hohen Hacken auf dem Weg nach oben zertrampelt zu werden. Gleichzeitig schätzen sie Kerle mit guten Manieren.
In meiner Generation gab es viele Gegenpole zum Leben unserer Mütter. Wir sahen deren Abhängigkeit und entschieden uns oft dagegen.
Ich bin aufgewachsen mit der Einstellung, dass jeder für sich selbst zahlt. Dass ich mir die Türen selbst aufmache und überhaupt mein Leben – Beruf und Privatleben inklusive Finanzen – selbst erschaffe und organisiere.
Meine Mutter führte keine glückliche Ehe, und sich zu trennen war ihr aus zwei Gründen nicht möglich: Einmal war sie katholisch, und sie fühlte sich dem Eheversprechen »… bis dass der Tod euch scheide« verpflichtet; zweitens war ihr nicht klar, wie sie ihre drei Töchter alleine ernähren sollte. Während meiner Kindheit war sie eine typische Hausfrau. Erst später unterstützte sie meinen Vater in seinem Raumausstattergeschäft. Mein Vater gab ihr das Haushaltsgeld – fünfzig Mark jede Woche – wie einem Kind das Taschengeld. Zu einem Urlaub hat es nie gereicht. Wir Töchter schliefen in der Küche.
So wie meine Mutter wollte ich nicht leben. Ich wollte mich nie von einem Mann abhängig machen. Es schien mir als junges Mädchen zu gefährlich.
Ich trage keine tiefen Ausschnitte. Ich konnte es nie leiden, wenn mir jemand in den Ausschnitt starrte; doch plötzlich fällt mir auf, dass dies so oder so bald zu Ende geht. Als ich fünfzehn Jahre alt war, fingen meine Brüste zu explodieren an, und die Aufmerksamkeit der Jungs kam wie ein Gewitter über mich. Da ich das nicht vertragen habe, entschloss ich mich für unförmige Oberteile.