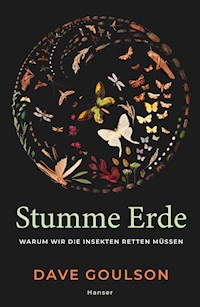Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Wenn wir Bienen und Hummeln retten wollen, müssen wir uns auf die Suche nach ihren seltensten Arten begeben. Um zu verstehen, warum sie verschwinden, aber auch, um diese faszinierenden Geschöpfe in Erinnerung zu behalten. Der Biologe Dave Goulson hat sich an ihre pollenbestäubten Fersen geheftet. Egal, ob er den Kampf der Goldenen Patagonischen Hummel gegen invasive Arten beschreibt oder auf den Äußeren Hebriden die letzten Deichhummeln Großbritanniens aufspürt: Immer ist seine Leidenschaft für die Wildbestäuber ansteckend. Und seine Tipps, wie wir in unserer unmittelbaren Umwelt Bienen vor dem Sterben bewahren, machen unbändige Lust darauf, den heimischen Balkon mit Beinwell zu bepflanzen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Wenn wir die Bienen retten wollen, müssen wir uns auf die Suche nach ihren seltensten Arten begeben. Um zu verstehen, warum sie verschwinden, aber auch, um von ihnen zu erzählen und sie in Erinnerung zu behalten. Der Biologe Dave Goulson hat sich an die pollenbestäubten Fersen von Hummeln und Bienen geheftet. Entstanden ist ein mitreißender Bericht einer Reise zum Planeten der Bienen.
Ob Goulson den Kampf der Goldenen Patagonischen Hummel gegen invasive Arten beschreibt, in Ecuador nach wochenlanger Suche endlich auf die exotischen Prachtbienen trifft oder auf den Äußeren Hebriden die letzten Deichhummeln Großbritanniens aufspürt: Immer ist seine Leidenschaft für die Wildbestäuber ansteckend. Und seine Tipps, wie wir auch die Bienen in der Stadt vor dem Sterben bewahren, machen unbändige Lust darauf, den heimischen Balkon mit Beinwell zu bepflanzen.
Hanser E-Book
Dave Goulson
Die seltensten Bienen der Welt
Ein Reisebericht
Aus dem Englischen von Elsbeth Ranke
Carl Hanser Verlag
Für Mum und Dad. Danke.
Inhalt
Prolog: Naturforschung mit brennendem Taubenkot
Die Salisbury Plain und die Waldhummel
Benbecula und die Deichhummel
Das Gorce-Gebirge und die Achselschweißhummel
Patagonien und Bombus dahlbomii
Kalifornien und die Franklin-Hummel
Ecuador und die Kampfhummeln
Regenwälder im Mündungstrichter der Themse
Knepp Castle und die vergessenen Bienen
Epilog: Bienen im Hinterhof
Register
Prolog: Naturforschung mit brennendem Taubenkot
Den halben Kilometer von der Grundschule bis zum Wald gingen wir zu Fuß, die Kinder in Zweierreihen plapperten aufgeregt durcheinander. Beladen mit einem Bündel Netzen und Klopfschirmen ging ich vorneweg, und die Lehrerin Mrs Sharkey mahnte und drängte am Ende, um die quirlige Schar beieinanderzuhalten.
Es war ein sonniger Nachmittag gegen Schuljahresende im Juni 2009, und ich ging mit der Klasse meines ältesten Sohns Finn an der Newton Primary School Dunblane auf Insektenjagd. Dunblane ist eine hübsche Kleinstadt an der Westflanke der Ochil Hills im Herzen Schottlands, und egal, in welche Richtung man dort losspaziert, man kommt fast überall schnell aufs offene Land. Als wir am Wald waren, reichte ich den eifrigen Sieben- und Achtjährigen Netze und sonstiges Material und zeigte ihnen, wie man sie verwendete. Die Schmetterlingsnetze wirkten riesig in den Händen der kleineren Kinder, die zum Teil sogar selbst ganz hineingepasst hätten. Diese rautenförmigen Netze sind auf den ersten Blick einfach zu bedienen, aber wenn man einmal ein fliegendes Insekt darin gefangen hat, muss man mit einem ganz speziellen Ruck das Ende des Netzes so über den Rahmen schlagen, dass das Tier in einer Stofffalte gefangen wird und nicht einfach wieder hinausfliegen kann. Ich führte vor, wie man einen Klopfschirm (ein großer, rechteckiger Holzrahmen, der mit weißem Stoff bespannt ist) unter einen niedrigen Ast legt und dann diesen Ast ordentlich durchschüttelt, sodass die Insekten auf den weißen Schirm purzeln, wo sie in ihrer Überraschung wild durcheinanderkrabbeln. Meine Demonstration des Wiesenkeschers sorgte für große Erheiterung – dieses robuste weiße Netz wird durch hohes Gras gestreift, und zwar so, dass die Öffnung des Netzes dabei immer nach vorne gerichtet ist. Das geht nach meiner Erfahrung am besten, wenn man es in fließenden Kreisbögen von rechts nach links fahren lässt, aber dazu muss man sich weit vorbeugen und den Hintern in die Luft strecken. Man sieht aus wie ein Folkloretänzer beim Ententanz. Am Ende meiner Tanzdarbietung raffte ich den Beutel des Keschers zusammen, damit die Insekten nicht wieder entkamen, und rief die Kinder herbei, um den Fang zu besehen. Einen Wiesenkescher zu öffnen, ist immer eine spannende Sache – wie bei den hübsch verpackten Geschenken unter dem Weihnachtsbaum weiß man nie, was Wunderbares drinsteckt. Unter lautem Ah und Oh sahen die Kinder zu, wie Scharen winziger Tiere – Ameisen, Spinnen, Wespen, Käfer, Fliegen und Raupen – aus dem Netz krabbelten, flogen und hüpften. Ich zeigte ihnen, wie man die kleinsten, empfindlichsten von ihnen in einen Exhaustor saugt.1 Dann verteilte ich eine Handvoll Becher, in denen jeder seinen Fang sammeln konnte, und die Kinder schwärmten aus, rannten durchs Unterholz, wedelten, kescherten und saugten nach Herzenslust, die Augen vor Aufregung weit aufgerissen. Wir hoben modernde Holzscheite und moosbedeckte Steine an und fanden darunter Asseln, Laufkäfer und Tausendfüßer (und legten hinterher natürlich brav alles wieder an Ort und Stelle). Jeder neue Fang wurde mir stolz zur Begutachtung vorgelegt, und das Spektrum reichte von riesigen roten Nacktschnecken bis hin zu zartgrünen Florfliegen. Mit hellen Begeisterungsrufen wurde der Fang einer riesigen Dunklen Erdhummel-Königin begrüßt, die vor Empörung lautstark herumsurrte. Der gute Finn konnte es nicht lassen und erklärte als kleiner Alleswisser den anderen Kindern, was sie da jeweils gefunden hatten.
Es war ein ziemliches Durcheinander, aber nach ungefähr einer Stunde hatten wir eine großartige Sammlung von Krabbeltieren in allen Formen und Größen, die in ihren Bechern auf einem der Klopfschirme auslagen. Wir sortierten sie nach Familien, lernten dabei den Unterschied zwischen Fliegen und Wespen, Käfern und Wanzen, Hundertfüßern und Tausendfüßern. Ich erzählte ihnen ein bisschen von den so unterschiedlichen und oft merkwürdigen Lebensweisen: welche von ihnen Dung oder Laub fraßen und welche andere Insekten verspeisen; von der Schlupfwespe, die von innen heraus Raupen zerfrisst; und von der Schaumzikade, die den Großteil ihres Lebens in einer Kugel aus ihrem eigenen Speichel verbringt. Als wir alles wieder freiließen, ermunterte ich die Kinder, ein paar von den größeren, robusteren Tieren in die Hand zu nehmen – es gab zum Beispiel eine hübsche Wipfel-Stachelwanze, hellgrün und rostbraun mit spitz zulaufenden Schultern, die bereitwillig von Hand zu Hand spazierte, bis sie mit einem Zucken ihrer Flügel plötzlich davonschwirrte. Eine halb ausgewachsene Punktierte Zartschrecke in kräftigem Laubgrün mit winzigen schwarzen Punkten tastete sich kurzsichtig über die Hände; mit riesigen Fühlern, die ungefähr viermal so lang sind wie ihr Körper. Eine zartgliedrige Frühe Adonislibelle spähte mit ihren vorstehenden Augen misstrauisch zu uns hinauf, als könnte sie ihr Glück, freigelassen zu werden, kaum fassen, und dann schwebte sie auf ihren lautlos schwirrenden, schillernden Flügeln davon.
Das Lächeln auf den Kindergesichtern erinnerte mich an die Worte des weisen Biologen E. O. Wilson, der einmal sagte: »Jedes Kind hat eine Käferphase – ich bin aus meiner nie herausgewachsen.« Es lässt sich interessant spekulieren über die Frage, warum Kinder instinktiv von der Natur fasziniert sind, warum sie so gerne sammeln – Muscheln, Federn, Schmetterlinge, gepresste Blumen, Tannenzapfen oder Vogeleier – und warum sie mit solcher Begeisterung Tiere jeglicher Art fangen, in die Hand nehmen und beobachten. Ich vermute, in unserer Vergangenheit als Jäger und Sammler leistete diese Neugierde uns gute Dienste – selbstverständlich mussten wir uns Kenntnisse über die natürliche Umwelt aneignen, wenn wir überleben wollten; besonders wichtig war zu wissen, welche Tiere und Pflanzen gefährlich oder essbar waren, aber auch, welche subtileren Hinweise sich von der Natur ablesen ließen, indem man etwa das Verhalten von Vögeln interpretierte, das möglicherweise vor einer nahenden Gefahr warnte oder aber auf Wasser- oder Nahrungsquellen hinwies. Ich werde oft gefragt, weshalb ich selbst so früh von der Natur fasziniert war, als wäre das völlig ungewöhnlich; dabei halte ich diese Besessenheit für etwas ganz Typisches – wie E. O. Wilson sagte, die meisten von uns haben eine Käferphase.
Viel schwerer zu beantworten ist doch die Frage, warum die meisten Kinder ihre Faszination für Krabbeltiere und ganz allgemein für die Natur irgendwann verlieren. Was passiert mit einem Kind, das mit acht Jahren völlig versunken zugesehen hat, wie ihm eine Assel über die Handfläche krabbelte? Leider reagieren die meisten bereits als Teenager auf das Summen eines Insekts mit einer Mischung aus Angst und Aggression, die sich auf Unwissen gründet. Mit einiger Wahrscheinlichkeit erschlagen sie das arme Tier, zertreten es oder verscheuchen es bestenfalls mit panischem Wedeln. Was läuft da falsch? Warum ist die kindliche Freude restlos verpufft und hat nur Abscheu hinterlassen? Ich wüsste zu gerne, wie es um die Kids aus der Schulklasse meines Sohnes heute steht. Sind ihnen, inzwischen in der Pubertät, Insekten mittlerweile egal? Haben sie diesen sonnigen Nachmittag vergessen mit allem, was sie so faszinierend und amüsant fanden? Haben sie die Ängste ihrer Eltern übernommen, die absurde Überreaktion auf eine Spinne, die von der Vorhangstange baumelt, oder auf eine Wespe beim Familienpicknick? Ich bin mit meiner Familie inzwischen von Schottland ins südenglische Sussex umgezogen, aber Finn zufolge haben die meisten seiner neuen Freunde nicht das geringste Interesse am Leben der Natur – sie finden ganz einfach, dass sie für sie nicht relevant ist. Sie interessieren sich für Fußball, die Playstation oder das Einstellen von Selfies auf Instagram. Völlig gedankenlos werfen viele von ihnen auf dem Schulweg beiläufig Getränkedosen und Chipstüten in die Hecken. Es ist einfach nicht cool, Vögel zu beobachten; und wenn jemand hobbymäßig Schmetterlinge und Nachtfalter sammelt oder fotografiert oder züchtet, stempeln sie ihn als verrückten Nerd ab.
Ich wage die Vermutung, dass dieser Wandel darauf zurückzuführen ist, dass Kinder in unserer modernen, urbanisierten Welt zu wenig Gelegenheit zur Interaktion mit der Natur bekommen. Unsere heranwachsenden Kinder werden die Natur nie wirklich schätzen, wenn sie sie nicht zuerst selbst erfahren, und zwar hautnah und regelmäßig. Sie können etwas nicht zu lieben lernen, was sie nicht kennen. Wenn sie nie das Glück hatten, im späten Frühling auf eine Wildblumenwiese zu gehen und den Blumenduft zu riechen, die Vögel und Insekten singen zu hören und die Schmetterlinge durch das Gras huschen zu sehen, dann wird es ihnen wahrscheinlich ziemlich egal sein, wenn wieder einmal so eine Wiese zerstört wird. Wenn sie nie das Glück hatten, im scheckigen Licht durch einen alten, wildwüchsigen Wald zu klettern, mit den Füßen durch das muffige Laub oder durch smaragdgrüne Bingelkraut-Bestände zu rascheln und die vielfältigen, pilzigen Gerüche von Verrottung und Wachstum zu vernehmen, dann werden sie nur schwer verstehen können, was für ein schockierendes Sakrileg es ist, diesen Wald abzuholzen und die Bäume zu Sperrholz zu zerfetzen.
Selbst mit shakespearescher Sprachmacht könnte ich das Wunder und die Schönheit der Natur niemals wirklich wiedergeben. In den letzten Jahrzehnten sind etliche großartige Natur-Dokumentarfilme entstanden, in denen wir alle möglichen exotischen Geschöpfe bestaunen können, die wir nie mit eigenen Augen zu Gesicht bekommen werden; aber ich glaube nicht, dass das ausreicht, auch wenn es ein guter Anfang sein mag. Wir müssen die Kinder nach draußen kriegen, sie auf allen Vieren in der Natur herumbuddeln lassen. Für mich sind zehn Minuten mit einer Laubheuschrecke genauso viel wert wie zehn Stunden vor einem Bildschirm, auf dem Paradiesvögel in einem abgelegenen tropischen Regenwald ihren exotischen Paarungstanz vollführen.
Leider haben heutzutage natürlich nur wenige Kinder die Möglichkeiten wie E. O. Wilson oder ich, diese Interessen herauszubilden. Mir scheint, dass heranwachsende Kinder ganz allgemein viel weniger Gelegenheit haben, so herumzuforschen und zu experimentieren, wie ich es in den 1970er-Jahren in einem sehr ländlichen Stück England konnte. Inzwischen lebt die Mehrheit der Weltbevölkerung in Städten – in Großbritannien sind es erschütternde 82 Prozent, die in urbanen Gebieten wohnen –, und Kinder dürfen normalerweise nicht mehr frei herumstreifen so wie früher.
Schon als Siebenjähriger wanderte ich rund um mein Heimatdorf durch die Gegend, verschwand stundenlang mit meinen Freunden, ohne dass meine Eltern eine Ahnung hatten, wo ich steckte. Wir kletterten auf Bäume, angelten in Seen und Bächen und bauten Lager im Wald. Selbst auf dem Land haben kleine Kinder diese Freiheit heute meist nicht mehr, weil ihre Eltern zu Recht die Gefahren des Straßenverkehrs fürchten oder Angst haben, ihr Kind würde entführt werden, was ich für weniger wahrscheinlich halte. Vielleicht klingt es leicht unverantwortlich, aber ich glaube, Kinder brauchen mehr Gelegenheit, auf eigene Faust zu forschen, Risiken einzugehen und dumme, gefährliche Dinge zu tun, aus denen sie etwas lernen können. Ich sollte das wissen, denn in meiner Kindheit habe ich mehr Dummheiten begangen, als mir zustanden, und doch habe ich irgendwie überlebt.
Meine frühesten Erinnerungen gelten Insekten – irgendwie gruben sie sich schon in meine Seele ein, als ich noch nicht einmal aus den Windeln war. Mit fünf entdeckte ich die gelb-schwarzen Raupen des Jakobskrautbärs, die von dem Kreuzkraut in den Rissen unseres Pausenhofs fraßen, und packte viel zu viele davon zwischen die übrigen Krümel in meiner Pausenbrotdose, um sie mit nach Hause zu nehmen. Ich pflückte ihnen mehr Kreuzkraut und war hin und weg, als einige von ihnen sich am Ende tatsächlich in adulte Falter verwandelten, diese nur schwerfällig fliegenden, aber hübschen Tiere mit schimmernden rot-schwarzen Flügeln (die, wie ich viel später lernte, eine Warnung vor ihrer Giftigkeit waren, denn sie hatten die Toxine angesammelt, die das Jakobskreuzkraut vor Fressfeinden schützen soll). Im Garten sammelte ich Tausendfüßer, Asseln und Käfer und die winzigen roten Milben, die an Sonnentagen über das niedrige Betonmäuerchen vor unserem Haus krabbelten, und ich hielt sie alle in Marmeladengläsern, die ich auf der Fensterbank in meinem Zimmer aufreihte. Vermutlich mussten viele der armen Geschöpfe dort sterben, aber ich lernte eine Menge, nicht zuletzt aus dem Oxford Book of Insects, das meine Eltern mir schenkten, damit ich meine Fänge bestimmen konnte. Abends hockte ich über den Aquarell-Illustrationen und schmiedete Pläne für lokale Exkursionen, von denen ich mir ein paar exotischere Fänge erhoffte – Große Kolbenwasserkäfer etwa, Große Königslibellen oder Totenkopfschwärmer.
Als ich sieben war, zogen wir aus unserer kleinen Doppelhaushälfte am Rande von Birmingham in das weiter nordwestlich gelegene Dorf Edgmond in Shropshire, wo es noch viel mehr Gelegenheiten für die Krabbeltierjagd gab. Ich freundete mich mit Gleichgesinnten an, und gemeinsam suchten wir in den Mittagspausen die Weißdornhecken an den Rändern des Schulgeländes nach den hübschen Raupen des Schwans ab, einem samtschwarzen Tier mit einer abgefahrenen Irokesen-Bürste aus roten, schwarzen und weißen Haarbüscheln. Am Wochenende suchten wir nach anderen Raupensorten, durchkämmten Hecken, Wiesen und Wäldchen rund um unser Dorf. Mithilfe des Observer’s Book of Caterpillars, noch ein Geschenk meiner Eltern, fanden wir recht und schlecht heraus, mit welchen Arten wir es dabei zu tun hatten, und holten ihnen das passende Blätterfutter. Mich faszinierte, wie klar sie spezialisiert waren – die meisten Falter- und Schmetterlingsraupen fressen nur eine oder vielleicht zwei Blattsorten und würden eher verhungern, als irgendetwas anderes zu kosten. Nur vereinzelte Arten sind weniger wählerisch – die riesigen, haarigen schwarz-orangenen Raupen des Braunen Bären zum Beispiel fressen fast alles außer Gras.2 Einmal fanden wir auf einer Weide eine Raupe des Großen Gabelschwanzes, ein fantastisches grün-schwarzes Geschöpf, das sich unter Bedrohung aufrichtet und aus seinem gegabelten Schwanz ein Paar einschüchternde rote, sich windende Tentakel herausstreckt. Ich musste fast ein Jahr lang warten, bis ich den adulten Falter im folgenden Frühling zu Gesicht bekam: ein herrliches, fettes, kükenflaumiges Tier, dessen Körper und schneeweiße Flügel mit schwarzen Tupfen besprenkelt sind.
Ebenfalls bereits mit sieben oder acht begann ich, Vogeleier zu sammeln – schon mein Vater hatte das als Junge getan. Meiner Erinnerung nach verfügte fast jeder Junge in meinem Dorf über eine Sammlung (ich habe keine Ahnung, wie das bei den Mädchen war – ich hatte keine Schwestern und ging zudem auf eine Knabenschule; bis ich 14 war, war mir also nicht bewusst, dass es so etwas wie Mädchen überhaupt gab). Wir wetteiferten miteinander, wer die Nester der außergewöhnlichsten Arten aufstöberte, und beneideten uns gegenseitig um unsere Funde. Wieder waren die Naturkundebücher aus der Observer-Reihe Gold wert – mein fast 50 Jahre altes, zerfleddertes Observer’s Book of Birds’ Eggs steht bis heute in meinem Regal. Ich erinnere mich, wie ich auf den Hängen des Long Mynd im südlichen Shropshire einmal ein blaues Ei mit blassbraunen Sprenkeln verlassen auf dem Boden fand und zu der Überzeugung gelangte, dass es sich um ein Ei der Ringdrossel handeln musste, ein spektakulär seltener Moorwaldvogel, den ich noch nie zu Gesicht bekommen hatte. Meine Freunde waren skeptisch, tagelang stritten wir; im Nachhinein bin ich mir freilich relativ sicher, dass es einfach nur ein Amselei war. Bei der ganzen Sache lernten wir Unmengen über die Naturgeschichte der Vögel, denn jede Art bevorzugt zum Nisten ganz bestimmte Orte, baut ihr Nest aus charakteristischem Material und so weiter. Mehrmals fanden wir zum Beispiel Schwanzmeisennester, wunderschöne kugelförmige Konstruktionen aus Spinnenfäden und weichem Moos.
Als Nächstes sattelte ich um aufs Sammeln von Schmetterlingen und weitete das auf Nachtfalter aus, dann auf Käfer, und irgendwann war ich ziemlich gut in der Bestimmung all dieser Tiere. Mein Geschick bei der Aufzucht verhalf mir zu einigen vollkommenen, unbefleckten Schmetterlings- und Nachtfalterexemplaren für meine Sammlung; mit etwa zwölf Jahren war ich es schließlich leid, diese niedlichen Geschöpfe zu töten, und fing an, sie nur noch zu züchten, um sie dann ganz einfach wieder freizulassen. Vor allem züchtete ich Hunderte Pfauenaugen und den Kleinen Fuchs, indem ich die Jungraupen von Brennnesseln sammelte und sie in selbst gebauten Käfigen aufzog, wo sie nicht Raupenfliegen und Erzwespen ausgesetzt waren, die in der freien Natur die meisten von ihnen parasitieren. Es war eine herzerwärmende Erfahrung, den Schmetterlingen zuzusehen, wie sie sich zögerlich an ihren ersten Flugversuch machten, die jungen Flügel kaum getrocknet, wie sie flatternd aufstiegen und sich am Ende aus unserem Garten in die Lüfte schwangen.
Doch nicht nur die Naturkunde faszinierte mich als Jugendlichen. Als ich in die Secondary School kam, liebte ich bald sämtliche Naturwissenschaften, besonders den Kitzel der Gefahr, der mit der Feuerwerkerei im Chemieunterricht und allgemein mit Elektrizität verbunden war. Meine Eltern schenkten meinem großen Bruder Chris und mir einen Chemiekoffer, und wie unendlich viele Kinder vor und nach uns verbrachten wir Stunden damit, beliebige Mischungen von Chemikalien auf dem kleinen Bunsenbrenner zu erhitzen, wobei wir in der Regel nichts weiter erzeugten als ein klebriges braunes Etwas und eine stinkende Rauchwolke. Obwohl wir dafür Nachsitzen und Schlimmeres riskierten, schmuggelten meine Freunde und ich kleine Stücke Magnesiumband aus dem Chemieunterricht und setzten sie in der Mittagspause im Gebüsch ganz hinten im Pausenhof mit Feuereifer in Brand. Sie glühten so hell, dass im Nachmittagsunterricht weiße Flecken vor unseren Augen tanzten. Als unser Lehrer im Versuch einmal kleine Stücke Natrium oder Kalium in ein Wasserbad gesetzt hatte – woraufhin diese höchst instabilen Metalle zischend herumflitzten und kleine Stichflammen samt Rauchschwaden aufsteigen ließen –, brannten wir nur so darauf, an diese Stoffe heranzukommen; aber unser Spielverderber von Lehrer ließ sie keinen Moment aus den Augen und sperrte sie nach der Stunde immer in einem Metallschrank ein.
Zum Glück tolerierten meine Eltern meine frühe chemische Experimentierfreude genauso bereitwillig wie die Begeisterung, mit der ich das Haus mit Marmeladengläsern, Käfigen und Wannen mit allem möglichen Getier bevölkerte, obwohl sie selten bis ins Detail wussten, was meine Freunde und ich wirklich anstellten. Von den ersten paar Chemiestunden an bastelten wir uns abenteuerliche Anordnungen zusammen, mit denen wir zu Hause immer gefährlichere und unterhaltsamere Versuche durchführen konnten. Mein Freund Dave und ich (in meiner Klasse gab es fünf Daves, und überhaupt wäre für die Jungen meiner Generation ein Oberbegriff für solche Gruppen eine nützliche Erfindung gewesen) entwickelten eine Methode, Wasserstoff und Sauerstoff herzustellen, indem wir elektrischen Strom durch Wasser leiteten. Der Transformator meiner Scalextric-Bahn erwies sich als ideale Energiequelle für solche Experimente, lieferte er doch stabile zwölf Volt. Sauer- und Wasserstoff ließen sich in Flaschen auffangen, und beide Gase explodierten zu unserer großen Zufriedenheit mit einem lauten Knall, wenn wir ein Streichholz daran hielten, auch wenn das nicht ganz ohne Risiko war. Ich lernte sogar, in einem komplizierten Experiment auf der Küchenanrichte Chlorgas herzustellen; dafür musste elektrischer Strom durch Chlorreiniger geleitet werden; die braunen Gaswolken, die dabei entstehen, sind hochgiftig, und das Experiment glückte unerwartet so gut, dass ich es kurz vor dem Ersticken gerade noch schaffte, den Strom abzustellen und die Fenster aufzureißen.
Etwa zur selben Zeit sammelten mein Bruder Chris und ich gebrauchte Bücher für einen Flohmarktstand bei einer anstehenden Schulfeier – ich erinnere mich zwar nicht daran, aber ich vermute, dass mein Vater uns dazu verdonnerte, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass wir je von uns aus mit dem Leiterwagen von Tür zu Tür gezogen wären und aussortierte Bücher gesammelt hätten. Jedenfalls ergab sich daraus ein unverhoffter Nutzen; unter den Stapeln vergilbter Liebesromane und Agatha-Christie-Krimis fand sich nämlich ein schmaler Band mit dem einfachen Titel Explosives. Man kann sich meine Erregung beim Heben dieses unerwarteten Schatzes vorstellen; erst recht, als ich feststellte, dass das Buch detaillierte Beschreibungen enthielt, wie sich die verschiedensten hochgefährlichen, manchmal instabilen Verbindungen herstellen ließen. Zu meiner Enttäuschung brauchte man für die meisten Rezepte jedoch Reagenzien, an die ein zwölfjähriger Junge schlicht nicht herankam; zum Beispiel war es von Anfang an klar, dass ich nie genügend konzentrierte Säuren bekommen würde, die man für die Herstellung von TNT gebraucht hätte. Ein Schießpulverrezept dagegen schien realisierbar zu sein. Schießpulver oder Schwarzpulver, wie die Fans es leicht kryptisch nennen, besteht aus nur drei Zutaten: Schwefel, Holzkohle und Kaliumnitrat. Mein Kinder-Chemiekoffer enthielt Schwefel, und Holzkohle war auch kein Problem, obwohl es eine ziemlich dreckige Angelegenheit war, die Grillkohle zu dem erforderlichen Pulver zu zermahlen. Blieb nur das Kaliumnitrat. Dem Buch zufolge waren erhebliche Mengen davon in Taubenkot zu finden, aus dem es sich mit der nötigen Sorgfalt auch isolieren ließ. Bis wir im Dorf einen Taubenzüchter fanden, dauerte es etwas, aber schließlich hatten wir so lange verstohlen über Gartenzäune gespäht, bis wir einen Taubenschlag mitsamt seinen gurrenden Bewohnern ausfindig gemacht hatten. Hätten wir wie Erwachsene gedacht, hätten wir einfach angeklopft und um etwas Taubendreck gebeten – wahrscheinlich hätte der Besitzer uns den gerne gegeben, wenn wir nur eine halbwegs plausible Begründung vorgebracht hätten –, aber wir befürchteten, man könnte unsere wahren Absichten erahnen. Natürlich erscheint es im Nachhinein nicht gerade wahrscheinlich, dass der Züchter vorschnell geschlossen hätte, dass wir den Taubendreck zur Herstellung einer Bombe brauchten, aber in unserer Paranoia hielten wir das doch für durchaus möglich. Und als wir uns einmal gegen den direkten Weg entschieden hatten, blieb uns nur eine heimliche Nachtaktion als Alternative. Mein Komplize Dave (einer von den vielen) und ich schlichen uns eines dunklen Abends in den Garten und fanden den Taubenschlag zu unserer Erleichterung unversperrt vor – wahrscheinlich war Tauben- und Kotdiebstahl im ländlichen Shropshire damals eine Randerscheinung. Es war eine dreckige und extrem geruchsbelastende Arbeit, den Kot in der pechschwarzen Dunkelheit in eine Plastiktüte zu kehren – wir trauten uns nicht, eine Taschenlampe anzuknipsen –, und die Tauben fingen an, herumzukrakeelen, flatterten nervös umher und bespritzten uns von oben mit ihrem Dreck, sodass wir uns, zufrieden mit unserer Ausbeute, eilig zurückzogen. Oft habe ich mich seither gefragt, ob der Taubenzüchter wohl bemerkt hat, dass irgendein mysteriöser Besucher mitten in der Nacht bei seinen Tauben ausgemistet hatte.
Am nächsten Tag machten wir uns daran, das Kaliumnitrat zu isolieren. Das Buch erklärte nicht, wie das gehen sollte, ein äußerst bedauerliches Versäumnis des Autors. Wir wussten, dass Kaliumnitrat wasserlöslich ist; mit unseren rudimentären Chemiekenntnissen meinten wir also, wir müssten das Kaliumnitrat aus dem Kot herauswaschen, dann die Feststoffe abseihen und die Chemikalie schließlich aus der verbleibenden Lösung extrahieren können. In unserem Hintergarten gaben wir also den Kot in einen Eimer warmes Wasser und siebten dann mit einem alten Handtuch die Brocken ab. Es war eine ziemlich unappetitliche Angelegenheit. Am Ende blieb uns ein Eimer extrem stinkende, blassbraune Flüssigkeit. Wir beschlossen, jetzt müssten wir nur noch das Wasser verdampfen lassen, indem wir die Flüssigkeit eine Weile kochten, und dann sollte, so hofften wir, etwas übrig bleiben, was überwiegend Kaliumnitrat war. Ich begann den Prozess in einer alten Pfanne auf dem Küchenherd, aber verständlicherweise verwies uns meine Mutter postwendend des Hauses. Zum Glück hatte ich in weiser Voraussicht im Gartenschuppen einen alten Campingkocher zum Bunsenbrenner umgebaut, auf den wir nun zurückgriffen. Es dauerte Stunden, und je dicklicher das Gebräu wurde, desto entsetzlicher stank es, aber irgendwann war der Inhalt der Pfanne zu einem klebrigen braunen Etwas zusammengeschrumpft. Es sah nicht wirklich wie Kaliumnitrat aus – wir wussten, dass das ein kristalliner weißer Feststoff sein sollte –, aber wir hofften, dass es irgendwie klappen würde.
Vorsichtig mischten wir die braune Schmiere in den vorgesehenen Anteilen mit Schwefel und Holzkohle. Das ergab eine grünlich-schwarze Pampe. Wir nahmen ein Löffelchen davon, platzierten es auf den Boden einer umgedrehten Konservendose, und ich hielt vorsichtig ein Streichholz daran, während mein Herz vor Aufregung lauthals klopfte. Das Streichholz flackerte, das Pulver brutzelte, und dann … nichts. Ich versuchte es wieder und wieder, aber da war nichts zu machen. Offensichtlich war unsere Isolierungsmethode ineffizient, oder vielleicht waren es auch einfach die falschen Tauben gewesen.
Eine kleine Recherche ergab, dass Kaliumnitrat manchmal als Gartendünger verkauft wurde. Tatsächlich war der in einer kleinen Gärtnerei fast direkt neben meiner Schule in Newport auf Lager; allerdings lag er leider zusammen mit etlichen anderen erstrebenswerten Chemikalien auf einem hohen Regal hinter dem Tresen. Meine Freunde und ich spionierten unauffällig den gesamten Vorrat aus, während wir angeblich das Angebot an Samentütchen durchstöberten. Schließlich nahm ich meinen Mut zusammen und versuchte, etwas davon zu kaufen; ich war ganz sicher, dass der Ladenbesitzer mein wahres Ziel augenblicklich durchschauen würde. Er war ein älterer, grauhaariger Mann mit strengem Blick, und tatsächlich fragte er mich sofort, wofür ich den Dünger denn brauchte. Ich lief vor Verlegenheit hellrot an – ich war schon immer ein hoffnungslos schlechter Lügner – und stammelte etwas von einem Schulexperiment, bei dem wir untersuchen sollten, wie sich Kaliumnitrat auf das Pflanzenwachstum auswirkte. Meine Freunde hatten zur moralischen Unterstützung hinter mir einen Halbkreis gebildet, und die Vorwitzigeren unter ihnen steuerten noch ein paar bunte Details bei, erzählten etwas von einem Schulwettbewerb für möglichst großes Gemüse. Es war nicht völlig abwegig, aber doch wenig wahrscheinlich, aber ich hielt bei seinem Kreuzverhör eisern an meiner Aussage fest, und am Ende holte er widerwillig eine Zwei-Pfund-Dose vom Regal herunter. Bestimmt ahnte er, dass wir damit nichts Gutes im Schilde führten, aber er konnte es nicht beweisen und war vielleicht auch froh, überhaupt etwas zu verkaufen, denn sein Laden brummte nicht gerade. Ich reichte ihm mein Geld, packte die Dose, und weg waren wir, bevor er es sich anders überlegen konnte.
Das Schießpulver erwies sich am Ende als Riesengaudi. Es explodierte nicht, aber es brannte wie wild, setzte Schwefelwolken frei und roch damit so verlockend wie ein Feuerwerk an einem kalten Novemberabend. Wir experimentierten mit verschiedenen Anteilen der Zutaten, die wir in kleinen Stapeln auf einen Schieferstein schichteten – ganz hinten im Garten, wo die Augen der Eltern uns nicht so schnell bemerken würden. Als wir die Mischung immer weiter verfeinerten, brannte sie immer schneller, und beim Anzünden mit einem Streichholz verbrannte man sich häufig die Finger; also entwickelten wir Zündschnüre aus aufgewickeltem Klopapier, das wir in Kaliumnitrat-Lösung tunkten und dann trocknen ließen. Wir experimentierten mit der Zugabe anderer Chemikalien aus unseren Chemiekästen, um die Flammen oder den Rauch zu färben, und wir befüllten Papprollen mit Schießpulver und diversen Zugaben, um unser eigenes primitives Feuerwerk herzustellen. Das alles war im Vergleich zu professionellen Raketen ziemlich mickrig, aber wie bei allem Hausgemachten doch viel befriedigender als die gekauften Alternativen.
Mein Freund Dave stellte dann eine ganz neue Feuerwerksformel auf, Grundlage waren hier natriumchlorathaltige Unkrautvernichter und Zucker. Mit dieser Rezeptur machten wir uns daran, die besten Feuerwerke zu basteln. Wochenlang versuchten wir, Raketen zu entwickeln, die tatsächlich in die Luft gingen, aber den Dreh bekamen wir nie heraus; das Höchste, was wir je schafften, war eine Rakete, die ungefähr 1,20 Meter aufstieg, bevor sie kippte und in den Boden raste. Der Rasen in unseren Gärten war bald übersät mit braunen Brandflecken von unseren gescheiterten Raketenstartversuchen.
Die Pulver, die wir mixten, waren zwar hoch entflammbar, aber wirklich explodiert sind sie nie, und das war eine ziemliche Enttäuschung. Irgendwann fanden wir heraus, dass man nur dann Explosionen hervorrufen konnte, wenn man das Pulver in mehr oder weniger luftdichten Behältern einschloss und erst dann entzündete. Das war natürlich eine verzwickte Sache, denn wie sollte man etwas entzünden, das man in einem Behälter eingeschlossen hat, und wie hielt man dabei obendrein eine sichere Entfernung ein, um nicht selbst in die Luft zu fliegen? Mein Buch Explosives war in dieser Frage keine große Hilfe. Nach langen Diskussionen und viel Trial and Error fanden Dave und ich die Lösung in Form der altmodischen Wegwerfblitzwürfel für Fotoapparate. Jüngere Leser mögen sich wundern, dass vor gar nicht allzu langer Zeit nicht jeder Fotoapparat mit einem eingebauten Blitzlicht ausgerüstet war, sondern stattdessen eine Fassung für einen Einwegplastikwürfel mit vier einzelnen Blitzbirnen besaß. Wenn man ein Bild machte, zündete und versengte die nach vorne weisende Blitzbirne, und das dabei erzeugte Licht reichte für genau ein Foto. Danach drehte man den Würfel um 90 Grad weiter, und die nächste Birne war einsatzbereit. Erstaunlicherweise konnte die gesamte benötigte Energie für die Selbstverbrennung dieser Blitzbirnen von einer normalen 1,5-Volt-AA-Batterie geliefert werden.
Wir fanden heraus, dass man diese Blitzbirnen vorsichtig aus ihrem Plastikgehäuse entfernen und damit ohne weiteres mein Schießpulver oder Daves Unkrautvernichter-Mix entzünden konnte. Wir bauten also dicke Pappröhren und füllten sie mit unserem Feuerwerkspulver, dazu steckten wir eine Blitzbirne, deren zwei dünne Anschlussdrähte aus der Röhre herausragten. Dann versiegelten wir die Röhren mit unzähligen Schichten Klebeband. Jetzt brauchten wir die Drähte nur noch an eine Batterie anzuschließen, und dann: PENG! Die Röhren gingen mit einem ohrenbetäubenden Knall hoch und hinterließen nur ein paar qualmende Überreste. Es war toll, und es dauerte nicht lange, da nahmen wir Kupferröhren, damit es noch lauter knallte – da wackelte wirklich der Boden, wenn sie losgingen, und die Erde war übersät mit verbogenen Metallsplittern. Um genügend Abstand zu haben, schlossen wir die Batterie an einen altmodischen Wecker an: Wir schoben einen Draht durch ein Loch, das wir in das Abdeckglas gebohrt hatten, und wenn der Minutenzeiger auf zwölf stand, kam er in Kontakt damit. So konnten wir die Bomben mit bis zu 55 Minuten Verzögerung zünden und uns in ein paar Hundert Metern Entfernung hinsetzen und sie pünktlich hochgehen sehen. Mit diesen selbst gebastelten Rohrbomben amüsierten wir uns köstlich, wir steckten sie in Löcher in Baumstämmen, Spalten in der Felswand eines aufgelassenen Steinbruchs und einmal in die Löcher einer Backsteinmauer an einem verfallenen, unbewohnten Bauernhof. Besonders viel Sprengkraft hatten sie nicht, aber meistens jagten wir doch ein paar Splitter Holz oder Fels oder Backstein in die Luft. Einmal legten wir sogar eine in unseren Dorfkanal, wir hatten nämlich im Fernsehen einen Bericht über die Dynamitfischerei gesehen. Die Explosion tötete keinen Fisch, aber es kam zu einer befriedigenden Wasserfontäne.
Sicher ist Bombenbau nicht gerade die sicherste Freizeitbeschäftigung für Jugendliche, und ich würde nie jemanden zu so etwas ermuntern; aber verglichen mit dem, was wir mit dem Stromnetz anstellten, war es noch relativ harmlos. Eines unseligen Sonntagmorgens, ich war 13, spielten meine Freunde Matt, Tug (Tim) und ich in unserem Garten mit einem Stück altem, rostigem Stacheldraht herum, das wir wer weiß wo gefunden hatten. Es war ein paar Meter lang und produzierte ein interessantes Pfeifen, wenn man es schnell genug über dem Kopf durch die Luft wirbelte. Doch bald schon verlor das seinen Reiz, und aus irgendeinem Grund kam ich auf die Idee, den Draht aus dem Garten über die Straße vor unserem Haus und bis in das gegenüberliegende Feld zu werfen. Nicht gedacht hatte ich an die Stromkabel, die längs der Straße als Freileitung von Telefonmast zu Telefonmast führten. Der Stacheldraht traf eines der Kabel, verhakte sich und schwang so herum, dass er ein zweites Kabel berührte; in diesem Moment gab es einen lauten Knall, einen Sprühregen orangener Funken, und zwei Stücke Stacheldraht fielen zu Boden. Bei genauerer Untersuchung stellten wir fest, dass der Draht in der Mitte regelrecht durchgeschmolzen war und auf dem Asphalt immer noch hellrot vor sich hin glühte. Vermutlich war der starke Strom, der im Kurzschluss durch den Stacheldraht schoss, zu viel für ihn gewesen. Das fanden wir unglaublich spannend, und natürlich wollten wir mehr davon.
Wir ahnten schon, dass es vielleicht besser war, uns einen etwas entlegeneren Ort als unseren Vorgarten zu suchen. Wir verzogen uns also an den Dorfrand und hielten beim Gehen nach weiterem Stacheldraht Ausschau, denn unsere übriggebliebenen Enden waren jetzt zu kurz. Wir suchten relativ lang, aber schließlich fanden wir an der Ecke eines Feldes eine alte Rolle mit Draht, die an einem Zaunpfahl befestigt war; wir bogen den Draht so lange vor- und rückwärts, bis ein Stück davon abbrach.
Mit dieser Beute gingen wir die nächste Straße hinter dem letzten Haus hinauf, bis wir wieder an eine Freileitung kamen. Im Rückblick hätte uns vielleicht auffallen sollen, dass diese Kabel höher verliefen als die vor meinem Haus, und wir hätten überlegen sollen, warum das so war. Wir hätten auch merken sollen, dass die Leitungen um einiges dicker waren, was allerdings bei ihrer Höhe nicht auffiel. Uns waren solche Details jedenfalls völlig egal, und wir fingen an, unser Stück Stacheldraht zu den Kabeln hinaufzuschleudern. Wegen der Höhe war das nun viel schwieriger. Wir wechselten uns ab, wirbelten den Draht um den Kopf und warfen ihn in den Himmel. Wir brauchten beinahe zwei Stunden, bis es zufällig wieder mir gelang, den Stacheldraht so zu schleudern, dass er sich an einem Kabel verhakte, herumschwang und ein zweites Kabel berührte. Was dann passierte, ist für immer und ewig in meine Erinnerung eingebrannt. Es gab einen ohrenbetäubenden Knall und einen weißen Blitz wie bei einem Gewitter. Einer von uns rief »BLOSS WEG HIER!« – vielleicht war ich es, oder vielleicht waren es auch wir alle drei gleichzeitig. Wir flohen. Als wir so auf das Dorf zurannten, sah ich mit einem Blick über die Schulter die beiden Freileitungskabel torkelnd und Funken sprühend zu Boden fallen. So hatten wir uns die Sache eigentlich nicht vorgestellt.
Wir liefen bis zu mir nach Hause (das war am nächsten) und versteckten uns im Gartenschuppen. Dort hockten wir uns auf die Stapel Flohmarkt-Romane, die vom Schulfest übrig waren, und überlegten, was wir tun sollten. Wir wussten, dass wir etwas Schlimmes angestellt hatten, und wir hatten keine große Hoffnung, ohne größeren Ärger davonzukommen. Während wir auf der Straße unter den Stromleitungen gestanden hatten, waren mindestens ein Dutzend Autos vorbeigekommen, und in unserem kleinen Dorf kannte jeder jeden; da würde es nicht lange dauern, bis jemand herausfand, wer die Schuldigen waren. Irgendwann beschlossen wir, dass es keine andere Lösung gab: Jeder von uns würde nach Hause gehen und beichten. Mir hing der Magen in den Kniekehlen, als ich durch die Hintertür ins Haus kam und meine Mutter in ungewöhnlich schlechter Laune vorfand. Sie war gerade mitten bei der Zubereitung des Sonntagsbratens gewesen, und jetzt war der Strom ausgefallen. Im Dorf gab es keine Gasleitung, überall kochte also das Sonntagsessen auf einem elektrischen Herd. Und nun wurden in zahllosen Haushalten halb fertig gebratene Hähnchen und Rinderkoteletts kalt. In den beiden Dorfpubs, im Lion und im Lamb, sollten Dutzende Sonntagsessen ungekocht bleiben. Ende der 1970er-Jahre waren Stromausfälle zwar relativ häufig, aber normalerweise passierte das nachts, und in der Regel gab es auch eine Vorwarnung.
Damit hatte ich nicht gerechnet, und ich lief wieder hinaus, ohne meiner Mutter ein Wort zu sagen; Tug und Matt waren noch in Sichtweite, weil sie beide eher widerstrebend, also langsam in entgegengesetzter Richtung auf ihr Zuhause zugingen. Ich rief sie zurück und erzählte, was los war. Es war noch viel schlimmer, als wir zunächst gedacht hatten, eine Katastrophe biblischen Ausmaßes. Wieder verkrochen wir uns im Schuppen. Matt äußerte ohne große Überzeugung die Vermutung, der Stromausfall könnte ja ein Zufall sein. Doch wir wussten, dass das nicht stimmte. Wie sich später herausstellte, hatten wir unglücklicherweise tatsächlich die 11.000-Volt-Leitung getroffen, die die einzige Stromzufuhr in unser Dorf darstellte. Ein Notfallteam des Stromanbieters brauchte fast bis zum Abend, um sie zu reparieren. Meine Freunde und ich saßen immer noch im Halbdunkel des Schuppens, als der Beamte von der Ortspolizei in seinem Dienst-Mini angefahren kam. Er war sowieso nicht besonders gut auf uns zu sprechen, seit er uns vor ein paar Jahren erwischt hatte, wie wir mit unseren selbst gebauten Katapulten (die er daraufhin konfiszierte und verbrannte) ein Dosenschießen auf seine Gänse veranstalteten, und so machte er sich ein Vergnügen daraus, uns zu der winzigen Polizeiwache im nahen Newport abzuführen.
Am Ende kamen wir mit einem kleinen Bußgeld und einer ordentlichen Zurechtweisung davon. Am schlimmsten war für mich der Ärger, den ich meinem Vater bereitete, der Dorflehrer war und sich als einen der Pfeiler der Dorfgemeinschaft verstand. Er schämte sich in Grund und Boden, dass sein eigener Sohn in Konflikt mit den Behörden geraten war. Und zu allem Übel war auch der Rektor seiner Schule an diesem schicksalhaften Tag um seinen Sonntagsbraten gebracht worden.
Natürlich mache ich mich nicht dafür stark, dass Kinder Bauernhöfe sprengen oder Stromleitungen sabotieren sollen, nicht einmal Vogeleier sammeln finde ich heute akzeptabel. Manches von den vielen Dingen, die wir gemacht haben, war höchst gefährlich und wirklich idiotisch. Und doch weiß ich nicht, ob ich als Erwachsener zum Naturwissenschaftler geworden wäre, wenn ich nicht wenigstens ein paar von diesen jugendlichen Trieben so hätte ausleben dürfen, wie ich es getan habe. Vielleicht waren meine Eltern allzu tolerant und bestimmt auch ein bisschen naiv, aber ich bin ihnen unendlich dankbar, dass sie mir so viel Freiraum gelassen haben (obwohl vielleicht ein paar ernste Worte über die Gefahren von Hochspannungsleitungen ganz nützlich gewesen wären). Ich versuche, meinen eigenen Jungs mit ihren inzwischen fünf, zwölf und 14 Jahren genug Freiheit zu geben, damit sie auf eigene Faust lernen können. Ich zucke zusammen, wenn ich sie hoch oben in den Baumwipfeln an Ästen baumeln sehe, und vielleicht sollte ich den Fünfjährigen nicht mit meinem Beil oder der Schlagbohrmaschine spielen lassen, aber bis jetzt haben sie alle überlebt. Ich habe ihnen die Zutaten für selbst gebasteltes Feuerwerk gekauft, aber zugleich versuche ich, ein Auge darauf zu haben, was sie vorhaben, und habe zum Beispiel Rohrbomben verboten. Auch sie haben bis jetzt noch keine Rakete zum Abheben gebracht, und unser Rasen ist von ihren gescheiterten Startversuchen mit Brandflecken übersät. Ich habe auch versucht, ihnen jede Gelegenheit zu bieten, mit der Natur in Kontakt zu kommen. Wir haben das Glück, mitten im ländlichen Sussex zu leben, umgeben von Wäldern, Weiden und Flüssen, die sie relativ sicher erforschen können – die größten Gefahren sind dabei sie selbst. Im Sommer fahren wir in unser kleines Bauernhaus im tiefsten, dunkelsten Frankreich, wo sie wild herumtollen können. Ich weiß nicht, ob sie wie ich einmal Naturforscher werden, aber zumindest hatten sie ausgiebig Gelegenheit, sich in die Natur zu verlieben. Mein ältester Sohn Finn kann inzwischen die meisten Wildblumen bestimmen, und Jedd ist ein begeisterter Insektenfotograf. Seth, der Jüngste, will einfach nur alles fangen, in eine Tupperdose stecken und anschauen – er ist immer noch mitten in der Käferphase, möge sie noch lange andauern. Ich bin sicher, dass sie sich später einmal nach besten Kräften für die Natur einsetzen werden.
Leider fürchte ich, dass sie damit eine Ausnahme sind. Ich kann es nicht belegen, aber nach meinem Eindruck nimmt Umweltengagement in der Gesellschaft eher ab, und die Generation, die heute heranwächst, hat noch mehr Abstand zu der Welt, von der sie lebt, als die vor ihr – und wenn das stimmt, dann ist das eine Katastrophe. Selbst heute, mitten im großen sechsten Massensterben der Arten, das allein durch menschliche Aktivität verursacht wird, während der Klimawandel große Teile der Erde in nicht allzu ferner Zukunft unbewohnbar zu machen droht und jährlich etwa 100 Milliarden Tonnen Mutterboden verloren gehen, stehen Umweltfragen auf der politischen Agenda immer noch ziemlich weit unten. Sie spielten im britischen Unterhaus-Wahlkampf 2015 kaum eine Rolle, selbst in der Kampagne der Grünen. Die Debatte drehte sich vor allem um die Wirtschaft, aber Geld wird uns kaum nützen, wenn wir keinen Boden und keine Bienen mehr haben.
Wollen wir die natürliche Welt und damit letztlich auch uns selbst retten, dann brauchen wir mehr Menschen, die sich um ihre Zukunft Gedanken machen. Zuallererst müssen wir dafür sorgen, dass unsere Kinder Gelegenheit bekommen, die Natur selbständig zu erforschen, schlammbedeckt nach Fröschen zu jagen oder auf der Suche nach Raupen durch Hecken zu krabbeln. Wir müssen ihnen Gelegenheit geben, ihre natürliche Neugierde auszuleben, sie müssen sehen können, wie ein Schmetterling sich aus seiner Puppe herausarbeitet, wie Kaulquappen winzige Gliedmaßen entwickeln, müssen die aufregende Erfahrung machen, unter einem Holzscheit eine Blindschleiche zu entdecken. Wenn wir ihnen das ermöglichen, werden sie die Natur lieben, wertschätzen und später für sie kämpfen.
Ich hatte das Glück, alles das als Kind tun zu können, und das brachte mich dazu, mein Leben lang meiner Neugierde für die Natur freien Lauf zu lassen. Und heute darf ich durch die Welt reisen, dabei habe ich Vogelfalter durch die Regenwälder auf Borneo flattern sehen und in den Wäldern von Belize gehört, wie Brüllaffen mit lautem Geschrei ihre Reviere verteidigten – und das sind nur ein paar von vielen weiteren unvergesslichen Erfahrungen. Viel näher zu Hause habe ich unzählige Stunden damit verbracht, in den weniger spektakulären, aber ganz genauso wunderbaren Wäldern und Wiesen Frankreichs und Großbritanniens nach Insekten, Vögeln, Reptilien, Säugetieren und Blumen zu jagen. Ich hatte Glück – ich bin auf dem Land aufgewachsen und geriet dann in einen Beruf, für den ich den weltweit interessantesten und seltensten Bienen und Hummeln nachjagen darf und versuche, möglichst viel über sie zu verstehen, ein paar noch unbekannte Details ihrer Lebenszyklen zu entdecken und herauszuarbeiten, wie wir sie so schützen können, dass auch andere sich künftig noch an ihnen erfreuen. Dieses Buch ist die Geschichte dieser Bienenreisen. Beginnen werden sie ganz nah meiner Heimat, in den entlegenen Ecken Großbritanniens, in denen die Natur noch unberührt ist; von da aus geht es in die wilden Berge Polens und dann nach Übersee in die Anden und Rocky Mountains, wo Hummeln sich unausweichlich in ein tragisches Schicksal zu fügen haben. Schließlich kommen wir zurück nach England und erleben dort ein paar Hoffnung machende Beispiele für die Resilienz der Natur. Willkommen bei der Suche nach den seltensten Bienen3 der Welt.
Die Salisbury Plain und die Waldhummel
Irgendwo wartet etwas Unglaubliches auf seine Entdeckung.
Carl Sagan
In früheren Büchern habe ich Adolf Hitler für den Niedergang der Hummeln in Großbritannien verantwortlich gemacht, weil sich das Land im Zweiten Weltkrieg unabhängig machen wollte und die britische Nahrungsproduktion daher drastisch gesteigert werden musste. Damit begannen Jahrzehnte der Intensivierung der Landwirtschaft. Große Teile unserer Landschaften wurden zerstört, um Monokulturen für Nutzpflanzen Platz zu machen. Gehe ich freilich in dieser Logik weiter, muss ich dafür dem letzten deutschen Kaiser (und auch Hitler) zähneknirschend auch ein kleines bisschen dankbar sein. Denn ein ungeplanter Nebeneffekt ihrer Kriegstreiberei war die Einrichtung eines der größten Naturreservate in ganz Europa.
1897 begann das britische Verteidigungsministerium, in der Hochebene nördlich von Salisbury Landflächen zu erwerben, um sie als militärisches Übungsgelände zu nutzen.4 Großbritannien war damals ein Empire, das rund um den Erdball in unzählige Konflikte verwickelt war – es war ziemlich mühsam, in den abgelegensten Weltengegenden neue Territorien zu beanspruchen, und man brauchte gut trainierte Truppen, um schlecht bewaffnete einheimische Völker ordentlich in Schach zu halten. Unter der 63 Jahre dauernden Herrschaft von Queen Victoria waren wir in nicht weniger als 36 ausgewachsene Kriege verwickelt, dazu kamen 18 Militärkampagnen und 98 Militärexpeditionen. Unser stehendes Heer war riesig, und irgendwo mussten all diese Männer ausgebildet werden. Daher erließ die Regierung ein Gesetz, das es dem Heer erlaubte, eigenen Landbesitz zu erwerben, zur Not durch Enteignung. Sinnvollerweise fasste das Militär Gebiete ins Auge, die nicht zu weit von den Transportknotenpunkten, also von London und den Häfen am Ärmelkanal entfernt lagen, die wenig bevölkert und zu günstigen Preisen zu haben waren. Die Salisbury Plain erfüllte all diese Kriterien, denn der Einbruch der Wollindustrie Mitte des 19. Jahrhunderts hatte Wiltshire zu einem der ärmsten Countys des Landes gemacht. Das Heer ging auf eine ausgiebige Shopping-Tour – 1897 wurden in der Ebene etwa 6000 Hektar aufgekauft, dazu kamen noch weitere Gelände anderswo in Großbritannien.
Lange vor der militärischen Nutzung hatte die Hochebene bereits eine lange Geschichte menschlicher Besiedelung aufzuweisen. Die große Kreideplatte entstand vor einigen Hundert Millionen Jahren, als die Schalen von Billionen winzigen toten Meerestieren sich am Boden eines einstigen Ozeans ablagerten; später wurde sie angehoben und bildet jetzt eine hügelige, von Süden nach Norden leicht abfallende Ebene, die in ihren höchsten Lagen nicht mehr als 200 Meter über dem Meeresspiegel erreicht. Als sich nach der letzten Eiszeit die Gletscher von Großbritannien zurückzogen, entstanden dort wohl große Wälder, doch zusammen mit den North und South Downs war dies eine der ersten Regionen, in denen vor etwa 5500 Jahren steinzeitliche Siedler die Bäume rodeten – dank der dünnen Kalkböden war es weniger schwierig, die Wurzeln auszugraben, als in den niedrigeren umliegenden Landschaften. Auch aus noch älteren Zeiten gibt es Spuren menschlicher Aktivität – etwa die verrotteten Stümpfe in Reihen angeordneter Pfosten, die vor 8000 Jahren zu einem unbekannten Zweck in regelmäßigen Abständen senkrecht in den Boden versenkt worden waren. Wir wissen nur sehr wenig darüber, wie Menschen damals lebten, aber ihre Präsenz beweisen die vielen sonderbaren Hügelgräber, Tumuli, Wallburgen und anderen seltsam geformten Anhöhen rätselhafter Herkunft.
Die bekannteste jungsteinzeitliche Struktur ist natürlich Stonehenge, die kultige, mysteriöse Anordnung riesiger behauener Steine, ein Kreis aus senkrechten Pfeilern, die Sarsensteine, überbrückt mit massiven Decksteinen; erbaut wurde die Anlage vor etwa 5000 Jahren. Ich habe Stonehenge schon als Kind besichtigt, in einer Zeit, als die Besucher noch zwischen den Steinblöcken herumgehen und -klettern durften, und meine Erinnerung daran ist bis heute hellwach. Ein unerklärlicher Zauber geht von diesen uralten Steinkreisen aus, die der Legende nach der sagenhafte Zauberer Merlin hierher verbracht und aufgerichtet hat. Natürlich ist nur schwer zu erklären, wie sie tatsächlich transportiert wurden; die vier Tonnen schweren Blausteine, die in Stonehenge den kleineren Innenkreis bilden, stammen nämlich aus dem Westen von Wales – das ist etwa 290 Kilometer entfernt, und dazwischen liegen mehrere größere Flüsse und Gebirgszüge. Wenn wir Zauberei ausschließen, kann man sich vorstellen, welch unglaubliche Mengen an Blut, Schweiß und Tränen stattdessen vergossen wurden; den Menschen muss also die Erbauung von Stonehenge verdammt wichtig gewesen sein. Die Sarsensteine stammen aus der Gegend von Avebury, knapp 40 Kilometer nördlich, aber die 20 Tonnen, die jeder von ihnen wiegt, mussten auch erst einmal umhergewälzt werden. Berechnungen zufolge benötigt man die Arbeitskraft von 600 Männern, um jeden Stein auf Rollen vorwärtszuschleppen, und auch so ging es noch sehr, sehr langsam. Man kann sich denken, dass schon die Zusammenstellung eines solchen Teams ein ziemlicher Aufwand war in Zeiten, als die Gesamtbevölkerung Großbritanniens vielleicht ein paar Zigtausend Menschen betrug. Warum die alten Völker all diese Mühen auf sich nahmen, ist vollständig unbekannt. In Gruben auf dem Gelände wurden eingeäscherte menschliche Gebeine und andere Überreste gefunden, und Messungen mit der Radiokarbonmethode haben ergeben, dass einige dieser Überreste zu Menschen gehören, die von sehr weit her stammten, aus Deutschland, Frankreich, sogar aus dem Mittelmeerraum. Vielleicht waren es Menschenopfer, fremde Sklaven, die geschlachtet wurden, um einen längst vergessenen Gott zu besänftigen. Anderen Theorien zufolge waren die Steine ein gigantisches astronomisches Observatorium oder ein Ort der Heilung oder gar Veranstaltungsstätte einer Feier des Friedens zwischen verschiedenen steinzeitlichen Bevölkerungsgruppen. Höchstwahrscheinlich werden wir es nie herausfinden. Doch egal, wozu die Steine ursprünglich dienen sollten, es fühlt sich so an, als hätten die einstigen Aktivitäten ihren Stempel hinterlassen, denn es lässt sich nicht bestreiten, dass sie über eine ganz eigene Aura verfügen.
Viel später kamen dann die Römer und bauten in der Hochebene Nutzpflanzen zur Ernährung ihrer Legionäre an. Noch später, im Jahr 878, soll König Alfred der Große nahe Westbury eine entscheidende Schlacht gegen die einfallenden Wikinger gewonnen haben; dem Sieg wurde mit dem Scharrbild eines weißen Pferdes ein Denkmal gesetzt, das am Westrand der Ebene in den Kalkstein der Hügelflanke oberhalb von Westbury gegraben wurde. In der ganzen Zeit bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts dürfte sich die Lebensweise der Menschen, die in der Salisbury Plain lebten und arbeiteten, nur relativ wenig verändert haben. Die Schwestern Ella und Dora Noyes bereisten die Gegend Ende des viktorianischen 19. Jahrhunderts und veröffentlichten 1913 einen plastischen illustrierten Reisebericht, Salisbury Plain, Its Stones, Cathedral, City, Villages and Folk. Das Leben in der Ebene kreiste um die Schafzucht – einzelne Herden konnten 1000 Tiere umfassen, und während die Wolle die wichtigste externe Einkommensquelle war, lieferten die Tiere auch Fleisch sowie den einzigen Dünger für den Ackerbau. Die Dörfer schmiegen sich noch immer häufig Schutz suchend in die Täler, rundum liegen eingefriedete Felder, während die umliegende Ebene meist aus offenem Weideland besteht. Diese Weiden wurden über fast die gesamten 5000 Jahre wahrscheinlich für die immer gleiche Extensivhaltung genutzt. So beschrieb Ella Noyes das Dorf Imber:
Das Dorf liegt in einer tiefen Geländefalte im Bett eines weiteren kleinen Winterbachs; auf allen Seiten ist es von den Hängen der Höhenzüge umgeben. Es besteht aus einer einzigen lang gezogenen Straße mit alten Hütten und Gehöften, die sich unter den schützenden Ulmen durch das Tal windet; im Frühling plätschert frisch und klar der schmale Bach vorbei, doch im Sommer liegt das Bachbett trocken und füllt sich mit wilden Gräsern und Kräutern.
Die weiß getünchten Hütten mit ihrem Fachwerk und tief gezogenen Reetdächern liegen in kurzen Reihen oder Haufen beieinander, und in den Ecken und Winkeln dazwischen gibt es üppige Blumengärten; Rosenbüsche, hin und wieder Flieder, Lilien und ein Gewirr aus Bukettwicken.
Eine Siedlung in Imber ist seit mindestens 967 bezeugt, und 100 Jahre später wird das Dorf im Doomsday Book Wilhelms des Eroberers erwähnt. Als die Noyes-Schwestern