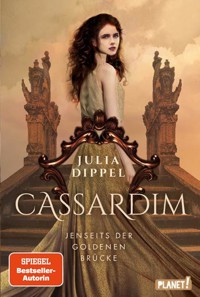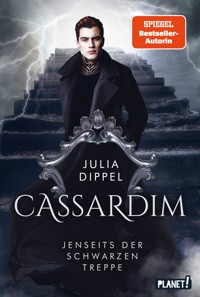13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Manchmal reicht ein Funke, um einen Sturm zu entfachen
Städte, Siedlungen und Straßen gehören den Menschen, die Wälder jedoch sind das Reich der Qidhe, der magischen Wesen. So will es das umstrittene und streng durchgesetzte Friedensabkommen. Aber Sintha pfeift auf diese Gesetze. Halb Mensch, halb Qidhe muss sie sich ohnehin mit dem Misstrauen beider Welten herumschlagen – besonders mit dem der Vakàr, einem dunklen magischen Volk, das die Einhaltung des Friedensabkommens erbarmungslos überwacht. Als eines Tages ein Schneesturm aufzieht und Sintha gezwungen ist, in einem menschlichen Gasthof Schutz zu suchen, ändert sich für sie alles. Denn in dem eingeschneiten Dörfchen ist ein Mord geschehen und ausgerechnet der gefürchtete Anführer der Vakàr ist gekommen, um ihn aufzuklären. Mit Sintha im Sturm gefangen, wirft Arezander nun jedoch nicht nur ein Auge auf ihre ganz speziellen Fähigkeiten …
In A Song to Raise a Storm öffnet Julia Dippel die Pforten zu einer bildgewaltigen Fantasy-Welt mit vielschichtigen Wesen, gefährlichen Intrigen, einer prickelnden Liebesgeschichte und einem blutigen Mordfall, dessen Aufklärung Sintha und Arezander mehr kostet, als sie bereit sind zu geben.
***Wer es spicy mag, findet im Buch einen QR-Code, der zu einem Bonuskapitel führt – aber Achtung, hier wird's heiß***
***Mit wunderschön gestaltetem farbigen Buchschnitt von Alexander Kopainski in limitierter Auflage.***
Alle Bände der Sonnenfeuer-Ballade:
// Band 1: A Song to Raise a Storm
Band 2: A Song to Kill a Kiss
Band 3: A Kiss to End a Song – erscheint im Frühjahr 2025 //
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
Städte, Siedlungen und Straßen gehören den Menschen, die Wälder sind das Reich der Qidhe, der magischen Wesen. Sintha gehört weder zu den Menschen noch in die magische Welt und muss sich mit dem Misstrauen beider Seiten herumschlagen. Doch sie pfeift auf das strenge Friedensabkommen und geht ihren eigenen, nicht immer ganz legalen Weg. Dabei sind ihre erbittertsten Gegner die Vakàr, ein dunkles Volk, das die Einhaltung der Gesetze erbarmungslos überwacht.
Als sie auf der Rückkehr von einem ihrer Streifzüge von einem Schneesturm überrascht wird, ist sie gezwungen, in einem menschlichen Gasthof Schutz zu suchen. Sin muss unerkannt bleiben - ein äußerst schwieriges Unterfangen, denn sie gerät in eine Morduntersuchung und ist nun ausgerechnet mit Arezander, den gefürchteten Anführer der Vakàr, eingeschneit. Um das brisante Verbrechen aufzuklären, scheint er zu allem bereit, und Sin lernt schnell, dass man einem Vakàr auf der Jagd besser nicht im Weg steht. Nicht ohne selbst zur Beute zu werden …
Die Autorin
© Rob Perkins
Julia Dippel wurde 1984 in München geboren und arbeitet als freischaffende Regisseurin für Theater und Musiktheater. Um den Zauber des Geschichtenerzählens auch den nächsten Generationen näherzubringen, gibt sie außerdem seit über zehn Jahren Kindern und Jugendlichen Unterricht in dramatischem Gestalten. Ihre Textfassungen, Überarbeitungen und eigenen Stücke kamen bereits mehrfach zur Aufführung.
https://www.instagram.com/julia_dippel_autorin/
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Planet! auch!Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor:innen und Übersetzer:innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator:innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher und Autoren auf:www.thienemann-esslinger.de
Planet! auf Instagram:https://www.instagram.com/thienemannesslinger_booklove
Viel Spaß beim Lesen!
Für alle Herzen, die tagtäglich kämpfen,um uns am Leben zu halten.
Reines Gewissen und schmutziges Geld
Fluchend stellte ich den Kragen meines Mantels auf. Diese Stadt zog Stürme an wie ein Kadaver die Krähen. Soweit ich mich erinnern konnte, hatte ich Valbeth noch nie bei Sonnenschein erlebt – schon gar nicht zu dieser Jahreszeit. Allerdings wirkte das hier nicht wie eines der üblichen Spätsommergewitter oder herbstlichen Unwetter. Was sich da zusammenbraute, roch bereits nach Winter. Schon jetzt war die Temperatur bedenklich gefallen und das schien erst der Anfang dessen, was auf uns zukam. Die beißende Kälte fand jede noch so kleine Schwachstelle an meiner Kleidung – zwischen Ärmeln und Handschuhen, zwischen Mütze und Kragen, sie kroch sogar durch die Nähte meines Mantels.
Schlecht gelaunt wandte ich mich gen Osten – dorthin, wo der Himmel über den blauen Schindeldächern von Valbeth am dunkelsten war. Jeder meiner Instinkte riet mir, sofort umzukehren. Wenn ich jetzt aufbrach, konnte ich mit etwas Glück die Waldgrenze erreichen, bevor mich der Sturm einholte. Nur was würde es mir bringen, mit leeren Händen dort anzukommen? Gar nichts. Also marschierte ich weiter den dunklen Wolken entgegen, tiefer hinein in das verworrene Labyrinth enger Häuserschluchten.
Mit jedem Schritt wuchs meine Beklemmung. Ich hatte nie verstanden, wie so viele Menschen freiwillig auf so wenig Raum zusammenleben konnten. Valbeth quoll an allen Ecken und Enden über. Jeder Flecken Erde war bebaut, Stockwerk um Stockwerk um Stockwerk. Die wüsten Konstruktionen aus Holzbalken und Lehm neigten sich bedrohlich in alle Richtungen, Balkone wurden als Brücken genutzt, Erker stützten sich auf den Nachbardächern ab und oft konnte man nicht einmal mehr sagen, welche Eingangstür wohin führte. Alles hier nahm mir die Luft zum Atmen. Von den viel zu vielen Menschen ganz zu schweigen.
Ich bog in eine unscheinbare Seitengasse ab. Schon von Weitem war das Quietschen des Tavernenschilds zu hören. Der Wind ließ es so bedenklich in seinen verrosteten Angeln schaukeln, dass es sogar die Auseinandersetzung übertönte, die sich gerade darunter zutrug. Einer von Onnas Schlägern schubste einen Burschen auf die Straße und jagte ihn, untermalt von drohenden Gesten, davon. Ein seltener Anblick vor dem Rostigen Kompass, denn da drinnen konnte man eigentlich jedes Tabu brechen und bekam hinterher trotzdem noch ein Bier. Mit einer Ausnahme.
Ich warf einen näheren Blick auf den Burschen, der mit verärgerten Schritten an mir vorbeistapfte, und fand mich bestätigt. Unter seiner Pelzmütze prangte ein entrücktes Lächeln, dekoriert mit aufgerissenen Augen, in denen ein Hauch von seligem Irrsinn glimmte. Jap, der war völlig zugedröhnt. Und obwohl man im Rostigen Kompass zwar allerlei Drogen kaufen konnte, duldete man dort keine Konsumenten. Das erregte zu viel Aufmerksamkeit.
Kopfschüttelnd widmete ich mich wieder meinen eigenen Problemen und der rot gestrichenen Tavernentür. Daneben hatte sich der Rauswerfer an die Hauswand gelehnt, direkt unter dem quietschenden Schild. Ich hatte ihn hier noch nie gesehen, obwohl sein ramponiertes Gesicht den Eindruck machte, als wäre er bereits mit allen Fäusten der Stadt per Du. Genau Onnas Geschmack. Sie war nicht anspruchsvoll bei der Wahl ihrer Angestellten. Unglücklicherweise schien ich dem Kerl nicht so unbekannt zu sein, wie er mir.
»Hallo, Sintha«, gurrte er und strich sich erst das lichte Haupthaar und dann den abgeranzten Mantel glatt. Dabei musterte er mich von Kopf bis Fuß. Ausgiebig, provokant, widerlich. Ich ignorierte es. Derartige Begrüßungen war ich gewohnt. Den Teil mit dem Anstarren hatte ich meiner Abstammung zu verdanken, die auf Menschen eine unweigerliche Anziehung ausübte. Die provokant widerliche Art dagegen war Standard in gewissen Kreisen, in denen ich hin und wieder verkehrte. Nichts davon brachte mich aus der Ruhe, solange er seine Finger bei sich behielt.
»Ich will zu Onna«, sagte ich, ohne seinen schmierigen Blicken eine irgendwie geartete Aufmerksamkeit zu schenken.
Sein Lächeln wurde wölfisch.
»Kostet dich ’nen Silberling.«
»Was?!«
Der Kerl nahm meine Fassungslosigkeit mit einem Schulterzucken zur Kenntnis. »War nicht meine Idee. Jeder, der zu Onna will, muss zahlen. Sie ist eine viel beschäftigte Frau und kann ihre Zeit nicht verschenken.«
Ein paar Augenblicke lang fehlten mir die Worte. Abgesehen davon, dass diese Forderung lächerlich war, besaß ich keinen Silberling. Genau deshalb war ich ja hier.
»Onna wird mich ganz bestimmt sehen wollen …«
»Das sagen alle. Kostet trotzdem ’nen Silberling.«
Ich fühlte, wie mein Blut zu brodeln begann. Die Finger in meinen Handschuhen ballten sich zu Fäusten und tief in mir stieg der dringende Wunsch auf, dem Idioten die Selbstgefälligkeit aus dem Gesicht zu prügeln.
Ruhig, Sin! Du bringst dich nur wieder in Schwierigkeiten. Erst atmen und bis zehn zählen, dann kannst du ihm im Zweifel immer noch irgendwas brechen.
Diszipliniert folgte ich meiner inneren Stimme, die mich schon so manches Mal vor mir selbst gerettet hatte.
Eins … zwei … drei …
Mit jedem Atemzug drängte ich meine Wut ein Stück weiter zurück. Wut war gefährlich. Wut und Eisen.
Vier … fünf … sechs …
Es funktionierte.
Sieben … acht …
Onnas Schläger beobachtete mich aufmerksam. Jedoch verwechselte er mein Ringen um Kontrolle offenbar mit Verzweiflung, denn auf einmal beugte er sich mir verschwörerisch entgegen. »Du hast nicht zufällig Odem im Blut? Die Lichtsammler zahlen ganz anständig. Nicht so gut, wie es früher mal war, aber ein Silberling sollte drin sein.«
Verdammter Mist! Und schon musste ich von vorne anfangen. Wenig brachte mich so sehr in Rage wie die Erwähnung der Lichtsammler.
Also noch mal.
Eins … zwei …
»Nein«, presste ich zwischen den Zähnen hervor, »ich habe keinen Odem im Blut.«
Drei … vier …
Ich log ohne Gewissensbisse. Eher würde ich meine Gliedmaßen an die Leichenfresser verscherbeln, als auch nur einen Funken meines Lichts aufzugeben.
»Zu schade, zu schade!« Der Kerl schenkte mir ein durchtriebenes Lächeln. »Vielleicht werden wir uns ja auf andere Art einig?«
Bei allen Göttern, er legte es wirklich darauf an! Ich musste hier weg, bevor ich tatsächlich handgreiflich wurde.
»Fein, dann verkaufe ich meine Ware eben woanders«, murmelte ich und machte auf dem Absatz kehrt. Onna zahlte zwar am besten, aber ich hatte durchaus noch ein paar Alternativen, um –
»Warte!« Der bullige Schläger packte mich am Arm. »Vielleicht war ich ein bissch…«
Ich ließ ihn gar nicht erst ausreden, sondern riss mich aus seinem Griff los und fauchte: »Fass mich noch einmal an und du wirst dir wünschen, heute Morgen nicht aufgestanden zu sein.«
Überrumpelt zog er seine Hände zurück. »Nur mit der Ruhe, meine Hübsche. Ich bring dich ja schon zu Onna.«
Mir war klar, dass meine Drohung nichts mit seinem Sinneswandel zu tun hatte. Einzig die Vorstellung, wie seine Chefin reagieren könnte, falls ihr seinetwegen ein lukratives Geschäft durch die Lappen ging, motivierte ihn. Er trat ein Stück zur Seite und gab mit einer angedeuteten Verbeugung die Tür frei, die ganz ohne sein Zutun aufschwang.
»Nach dir.«
Perplex starrte ich den Eingang an. Auch dahinter stand niemand, der die Tür geöffnet haben konnte. Erst auf den zweiten Blick bemerkte ich das Silberglühen an den Türangeln. Odem. Offenbar noch eine neue Errungenschaft der Menschen und wieder einmal diente sie einer völlig sinnbefreiten Dekadenz. Wem bitte war es zu anstrengend, eine Klinke zu drücken?!
»Schick, nicht wahr?«, prahlte Onnas Handlanger.
Mir fiel eine Menge Wörter ein. Schick gehörte nicht dazu. Da ich jedoch keinen neuen Streit vom Zaun brechen wollte, schloss ich meinen Mund und betrat die Taverne.
Die heruntergekommene Schankstube des Rostigen Kompass interessierte mich nicht. Sie diente nur als Deckmantel für das Herzstück von Onnas Imperium, das sich jenseits des Tresens, hinter zwei weiteren Schlägern, einem mottenzerfressenen Vorhang und einem langen dunklen Gang verbarg. Ich kannte den Weg in- und auswendig, auch wenn ich ihn ungern beschritt. Enge Räume ohne Fluchtmöglichkeit lagen mir nicht so.
Keine Ahnung, warum Onna ihr Geschäftszimmer ausgerechnet hier eingerichtet hatte, aber als ich in dem fensterlosen Lager ankam, an dessen Wänden sich schwere Brandweinfässer bis unter die Decke stapelten, wollte ich – wie jedes Mal – am liebsten gleich wieder umdrehen.
Im Licht einer einzelnen Odemkugel, die kaum mehr Helligkeit spendete, als es eine Öllampe gekonnt hätte, kräuselten sich bläuliche Rauchfäden. Sie entstiegen einer langen schmalen Pfeife, ohne die ich Onna noch nie gesehen hatte. Die betagte Ganovin thronte inmitten ihres Dunsts an einem dunklen Tisch, umgeben von vier rot gepolsterten Sesseln.
»Sin!«, schnurrte sie mit einer Stimme, die ihrem Pfeifenrauch glich: umschmeichelnd, kalt und ungesund. »Dich habe ich ja eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Dacht schon, die bissigen Wachköter hätten dich aus dem Verkehr gezogen.«
Onna schob die Unterlagen beiseite, über denen sie gerade gebrütet hatte, und lehnte sich in ihrem Sessel zurück. So zerfurcht ihr Gesicht auch wirkte, so sinnlich waren ihre Bewegungen. Andere Frauen in ihrem Alter genossen oft schon den Ruhestand und das Großmutterdasein, doch Onna pfiff auf Konventionen. Sie war für ihre gnadenlose Härte ebenso bekannt wie für ihren Verschleiß an Liebhabern.
Ich zuckte mit den Schultern. »Die Todbringer interessieren sich nicht für Menschen.«
Ein Lächeln erschien auf Onnas Gesicht, vertiefte sich langsam und verwandelte sich schließlich in ein breites Grinsen voller Spott. »Nur wissen wir beide, dass du mehr bist als ein einfaches Menschenmädchen, nicht wahr?«
Ich war derart vor den Kopf gestoßen, dass mir zu spät einfiel, meine Verblüffung zu verbergen. Woher zum Henker wusste sie …?! Und seit wann? Und wieso hatte sie das nie zuvor erwähnt?
Onna zog genüsslich an ihrer Pfeife und blies mir den Rauch entgegen. »Keine Sorge, du bist nicht die Erste, die vor mir zu verbergen versucht, was sie ist. Dein kleines Geheimnis war von Anfang an bei mir sicher. Sonst hätte ich dich längst an die Wachköter verraten.«
Bei ihrem Tonfall stellten sich mir die Nackenhaare auf. Möglich, dass sie wirklich nicht vorhatte, mich zu melden, aber sie würde im Zweifel ihren Vorteil daraus ziehen. Damit stand zumindest eines fest: Das hier war das letzte Mal, dass ich mit Onna Geschäfte machte. Alles andere käme Selbstmord gleich.
»Setz dich doch«, forderte sie mich mit einer eleganten, aber bestimmten Geste auf.
»Nein, danke.«
Stoff hielt Gerüche besser und länger fest, als Luft es tat. Und ich würde sicherlich keine Spuren hinterlassen, solange ich es vermeiden konnte.
»Immer in Eile. Ganz so, wie ich meine Sin kenne«, lachte sie. »Zu schade! Ich hätte gern ein wenig mit dir geplaudert. Mich würde nämlich brennend interessieren, wie du es an den Wachkötern vorbei schaffst. Seit die Vakàr ihren neuen Syr der Syrs haben, kommt kaum eine meiner Lieferungen mehr durch die Tore. Verfluchter Cjander! Selbst im Grab schafft der Drecksack es noch, mir das Leben schwer zu machen!«
»Baron Cjander ist tot?!«
»Mausetot«, bestätigte Onna. »Wo lebst du, dass du das nicht mitbekommen hast? In allen Städten Enebhas zerreißt man sich das Maul darüber.«
Jetzt war ich baff. Jeder kannte den Namen von Baron Cjander, obwohl ihn wohl nur die wenigsten zu Gesicht bekommen hatten. Er führte schon seit Jahrzehnten die Vakàr Drahyn an, alias die bissigen Wachköter, alias die Dunklen Jäger, alias die Eisernen Schatten, alias die Todbringer. Da sein Volk für die Grenzkontrollen zuständig war, hatte man ihnen im Lauf der Zeit viele Beinamen gegeben. Die wenigsten davon waren schmeichelhaft. Kein Wunder, dass sein Tod das Stadtgespräch Nummer eins war.
»Was ist passiert?«
»Wenn ich das nur wüsste«, grunzte die alte Ganovin. »Ich hab mich wirklich ins Zeug gelegt, um an ein paar Informationen zu kommen, aber all meine Quellen schweigen dazu. Nur eine Sache konnte ich in Erfahrung bringen: Cjander wurde mit einem hübschen scharfen Eisendolch im Rücken gefunden. Angeblich war es jemand aus den eigenen Reihen. Is’ wohl doch nicht so weit her mit der gerühmten Loyalität unter den Wachkötern.«
Erstaunt blinzelte ich gegen den Pfeifenrauch an.
»Ein Vakàr soll seinen Syr der Syrs umgebracht haben?!« Die Vakàr waren nicht zuletzt das mächtigste der magischen Völker, weil sich ihr Zusammenhalt und ihre Integrität durch nichts erschüttern ließen. Selbst als Cjander jede Vernunft über Bord geworfen und diesen hirnverbrannten Friedensvertrag mit den Menschen ausgehandelt hatte, waren sie ihm alle blind gefolgt.
Onna zuckte mit den Schultern. »Wer sollte sonst in der Lage sein, den tödlichsten aller Todbringer hinterrücks zu erstechen? Etwa ein Mensch? Oder ein Bhix? Irgendein anderes magisches Wesen? Ganz bestimmt nicht.«
Auch wieder wahr.
»Wenn du mich fragst, war es sein Bruder höchstpersönlich, der – oh, welch Zufall – nun dessen Nachfolge antritt. Das ist zumindest das, was man sich im Stadtpalais erzählt. Angeblich gab es sogar Beweise gegen ihn, die aber natürlich allesamt spurlos verschwunden sind. Bald wird niemand mehr darüber sprechen. Du wirst schon sehen. Damit das Friedensabkommen nicht ins Wanken gerät, tut die Monarchin alles. Selbst den Dreck hinter ihrem neuen Oberwachköter wegputzen.«
Alarmiert spitzte ich die Ohren. Eine neue Führung bei den Vakàr konnte sich unter Umständen auch auf mich und meine Tätigkeit auswirken.
»Dieser Neue … wie ist der so?«
Onna rümpfte die Nase. »Selbst für einen Wachköter ist er ’n skrupelloser Scheißkerl. Seit er die Befehle erteilt, sind bereits sieben meiner Leute in den Kerker gewandert, drei wurden hingerichtet und obendrein ist jeder mir halbwegs wohlgesonnene Vakàr spurlos verschwunden. Er räumt seinen Laden gründlich auf und beseitigt alle, die ihm gegenüber nicht uneingeschränkt loyal sind. Genau so würde ich es auch machen, wenn ich mir einen fremden Thron angeeignet hätte.«
Falls Onna mit wohlgesonnen eher bestechlich meinte, wovon ich ausging, hatte ich ein Problem. Mein Geschäftsmodell basierte ebenfalls auf einem gewissen Entgegenkommen der Grenzposten.
»Hält er sich gerade in Valbeth auf?«
Onnas Ärger wich einem vergnügten Schmunzeln. »Erzähl ich dir, wenn du mir sagst, wie du durch die Tore kommst.«
Tja … mit Neugier war das so eine Sache. Geheimnisse gaben eine hervorragende Tauschware ab – allerdings nur, solange man bereit war, die eigenen zu offenbaren. Und das war ich nicht.
»Na los, weih’ mich ein! Fälschst du dir Passierscheine? Oder schmierst du die Wachposten?«
»Nichts dergleichen«, erwiderte ich möglichst unbedarft. »Ich scheine einfach einen braven Eindruck zu machen. Der Rest ist reine Nervensache. Da Vakàr Angst riechen, sollte man nicht allzu nervös wirken.«
Letzteres entsprach zwar der Wahrheit, spielte in diesem Fall aber keine Rolle. Ausnahmslos jeder, der die von den Todbringern bewachten Tore passierte, hatte Angst. Das betraf mich ebenso wie menschliche Städter mit einwandfreien Dokumenten. Abgesehen davon hatte ich noch nie einen besonders braven Eindruck gemacht. Nein, meine Taktik war eine gänzlich andere. Und dabei ging ich ein enormes Wagnis ein. Eines, bei dem jeder Mitwisser ein zusätzliches und unnötiges Risiko darstellte.
»Reine Nervensache, hm?« Onna zog erneut an ihrer Pfeife und taxierte mich durch die Rauchschwaden. »Das wird es wohl sein …«
Obwohl sie das Thema damit abzuschließen schien, verriet ihr Tonfall, dass sie mit mir noch lange nicht fertig war. Ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass sie bereits darüber sinnierte, wie sie an die Informationen gelangen konnte, die ich ihr vorenthielt. Zeit, um zu erledigen, weswegen ich gekommen war, und dann schleunigst zu verschwinden.
»Ich hab etwas für dich«, eröffnete ich die Verhandlungen. Aus einem Versteck im Futter meiner Manteltasche zog ich zwei kleine Blechdöschen hervor und stellte sie auf den Tisch.
Sofort richtete Onna sich kerzengerade auf. In ihren schwarzen Augen leuchtete Interesse. Sie war durch und durch Geschäftsfrau und ambitioniert genug, ihren Ärger über meine Verschwiegenheit eine Weile ruhen zu lassen. Zumindest, bis ich keinen anderweitigen Nutzen mehr für sie haben würde.
Sie griff nach den Blechdosen, öffnete sie und stieß einen anerkennenden Laut aus. Dann nahm sie eine der Blutperlen heraus, drehte und wendete sie fachkundig, hielt sie gegen das Licht und zerdrückte sie schließlich zwischen Zeigefinger und Daumen. Die dunkelrote Hülle zerplatzte und gab den darin eingeschlossenen Blutstropfen frei. Onna roch daran und tippte vorsichtig mit ihrer Zungenspitze dagegen.
»Karmesinfuchs?«
Ich nickte. Es gab nicht viele Menschen, die magisches Blut allein am Geschmack zuordnen konnten. Aber Onna verstand ihr Handwerk – so wie ich das meine.
»Hervorragende Qualität«, urteilte sie. »Ich zahl dir drei Silberlinge dafür.«
Das war so lächerlich, dass ich mich nicht einmal zu einem Schnauben herabließ. Ungerührt sah ich die Ganovin an.
»Sie sind zehn wert.«
»Auf der Straße«, gab Onna mir recht. Sie holte ein Taschentuch hervor und wischte sich damit die blutigen Finger sauber. »Aber nicht im Einkauf. Mein Risiko ist gestiegen, wie du gerade erfahren hast.«
»Ich hab auch gerade erfahren, dass du kaum an frische Ware kommst«, erinnerte ich sie liebenswürdig.
Jede noch so aufgesetzte Freundlichkeit verschwand von Onnas Gesichtszügen. Sie lehnte sich erneut in ihrem Sessel zurück und durchbohrte mich mit tödlichen Blicken. Früher hätte ich mir spätestens jetzt vor Angst in die Hose gemacht und meine Forderung zurückgezogen. Aber inzwischen wusste ich, dass man sich auf einem sehr schmalen Grat bewegen musste, um in diesen Kreisen zu überleben. Kriminelle waren wie Raubtiere. Wirkte man zu schwach, sahen sie einen als Beute, wirkte man zu stark, wurde man als Bedrohung empfunden und aus dem Weg geräumt.
»Also gut. Ich gebe dir fünf«, sagte Onna kühl. »Aber nur, weil du es bist.«
»Acht.«
»Sechs und kein Kupferblatt mehr.«
Das entsprach nach wie vor nicht dem eigentlichen Wert der Blutperlen, aber der Sturm saß mir im Nacken und sechs Silberlinge waren genau der Betrag, den ich brauchte.
»Einverstanden.«
Danach ging alles rasend schnell. Onna gab jemandem hinter mir ein Zeichen. Dem Geruch nach war es einer der beiden Vorhang-Wachen. Er brachte eine schwere, geschnitzte Schatulle, deren Inhalt verräterisch klimperte. Während Onna das Geld abzählte, füllte der Kerl die Blutperlen um. Dann reichte er mir die leeren Blechdöschen zurück und verschwand mit der Ware.
»Sag mal …« Onna klappte die Münzschatulle zu und begann, meine Silberlinge zu einem kleinen Turm zu stapeln. »Du hast nicht zufällig auch Dunkelblut?«
Sie stellte diese gefährliche Frage so beiläufig, als würde sie sich nach einem Kuchenrezept erkundigen. Dabei wusste sie ganz genau, was ich lieferte und was nicht. Nicht nur, weil auf den Handel mit Dunkelblut die Todesstrafe stand, sondern aus Überzeugung. Das Blut dunkler Qidhe machte hochgradig abhängig und verursachte, anders als lichtes Qidhe-Blut, keine angenehmen, euphorisierenden Träume. Es zog die Konsumenten in finstere Visionen, in Albträume, die einen selbst nach dem Erwachen nicht losließen. Angstzustände, Halluzinationen, Hörigkeit oder auch völlige Apathie waren eher die Regel als die Ausnahme.
»Man könnte meinen, du hättest schon genug Ärger mit deinen Wachkötern«, erwiderte ich trocken.
Die Vakàr ahndeten generell alle Verstöße gegen das Friedensabkommen, aber den Handel mit Dunkelblut nahmen sie persönlich. Sie hatten ihre Welt schon immer besser gehütet, als die lichten Qidhe es taten.
Onna seufzte schwer. »Was soll ich machen? Die Nachfrage steigt. Auch in mächtigeren Kreisen, die früher oder später gewillt sein werden, schützend ihre Hand über mich zu halten. Allerdings nur, wenn ich eine zuverlässige Quelle bleibe.«
Ihre Worte widerten mich an und ich gab mir wenig Mühe, das zu verbergen. »Von mir wirst du kein Dunkelblut bekommen.«
Onna störte sich an meiner Abscheu nicht. Im Gegenteil, sie schenkte mir ein überhebliches Lächeln.
»Dunkelblut bezahle ich in Gold. Für das Blut einer Raga verdreifache ich den Preis sogar.«
In Gold?! Bei Nheemas schwarzen Fingern. Wer zahlte Gold für einen qualvollen Tod auf Raten?! Raga-Blut war dabei das schlimmste von allen. Ja, es war eine Menge Geld dafür, dass es kaum einen Unterschied machte, ob ich lichte oder dunkle Kreaturen jagte. Geld, das mir einiges erleichtern würde. Aber es gab Grenzen, die zu überschreiten kein Gold der Welt rechtfertigte. Bevor ich es mir anders überlegen konnte, lehnte ich mich über den Tisch und schnappte mir meine Silberlinge.
»Leb wohl«, murmelte ich und wandte mich zum Gehen.
»Wenn du deine Meinung änderst, weißt du, wo du mich findest«, rief Onna mir vergnügt nach. Offenbar war sie davon überzeugt, mich schon bald wiederzusehen. Ich hoffte inständig, dass sie sich irrte.
Drei Verehrer
Onnas Geld ging fast restlos für die Medizin meines Vaters drauf – und meine Geduld für den raffgierigen Apotheker. Als ich die Tür des Kräuterladens hinter mir zuschlug und mürrisch die Straße hinunterstapfte, begann es zu allem Überfluss auch noch zu schneien. Mist!
»Hey, pass auf, wo du hinrennst, Mädchen!«
Erschrocken machte ich einen Satz zurück und musste mich dicht an eine Hauswand pressen, um nicht von einem schweren Ochsenkarren überrollt zu werden, der nur eine Handbreit vor meinem Gesicht vorbeirumpelte. Finster blickte ich dem Karren nach. Von den Achsen ging ein schwaches Silberglühen aus. Odem in einem Fuhrwerk?! Das war sogar noch dümmer als selbstöffnende Türen. Dachte in der Stadt überhaupt jemand mal etwas zu Ende? Was half es dem Fuhrmann, seinen Karren doppelt so schwer beladen zu können, wenn weder seine Tiere noch die Straßen dafür ausgelegt waren? Mal ganz abgesehen davon, dass ihm der Odem nicht zustand, den er so leichtsinnig vergeudete. Das erinnerte mich einmal mehr daran, warum ich Städte mied, wo immer ich konnte. Ich hatte nichts gegen Fortschritt, aber die ignorante Dummheit der Menschen reizte mich bis auf Blut. Und dieser Gemütszustand war … gefährlich. Ich musste ganz dringend raus aus Valbeth!
Unglücklicherweise führte mich der schnellste Weg mitten durch das Rote Viertel und damit auch über den berühmten Platz des Friedens. Wer auf hübsche Fassaden, die Kundgebung sinnloser Gesetze und blutige Hinrichtungen stand, war hier bestens bedient. Ich hasste diesen Ort.
Für das miese Wetter war der Platz erstaunlich belebt. Mit gesenktem Kopf überquerte ich ihn und hoffte inständig, niemandes Aufmerksamkeit zu erregen. Zum einen, weil hier haufenweise Stadtwachen um das Eiserne Palais des Prinzipals patrouillierten – zum anderen, weil der Regierungssitz von Valbeth seinen Namen nicht umsonst trug: Die besten Schmiede ihrer Gilde hatten jeden Backstein, jeden Fensterbogen und jede Tür mit eisernen Verzierungen und Beschlägen versehen. Durch die schiere Menge spürte ich sogar auf die Entfernung die Wirkung des Metalls. Es versetzte mein Blut in Schwingung und machte es schwer, die Reaktionen meines Körpers zu kontrollieren. Umso erleichterter atmete ich auf, als das Eiserne Palais und der Platz des Friedens hinter mir lagen. Jetzt blieb nur noch eine Hürde, die es zu meistern galt: das Südtor. Definitiv nicht mein Favorit unter den sieben Stadttoren Valbeths. Ich bevorzugte das kleinere, mäßig bewachte Küstentor. Aber der Sturm ließ mir ja keine andere Wahl …
Plötzlich packte mich jemand von hinten und zog mich in einen Hauseingang. Ich hatte meinen Dolch schon in der Hand, als ich die kastanienbraunen Locken und den unverkennbaren Geruch von Seife, Leder und Salzwasser erkannte.
»Bei allen Göttern, Wyn! Wenn du mich noch einmal so erschrickst, kann ich für nichts garant…«
Warme Lippen verschlossen meinen Mund, während mich sein angenehm kräftiger Körper gegen den Türstock drängte. Oh Mann, ich hatte vergessen, wie gut sich das anfühlte. Ich ließ den Dolch zurück in meinen Stiefel gleiten und schlang die Arme um Wyns Hals. Wenigstens für einen kurzen Moment gönnte ich mir die Ablenkung, denn der junge Dockarbeiter küsste wirklich gut. Leider hatte er noch nie ein Gespür für Details gehabt – wie den richtigen Augenblick oder den passenden Ort oder die Tatsache, dass es ziemlich riskant war, mich von hinten zu überfallen … Tja, man konnte nicht alles haben.
Als er begann, sich an den Knöpfen meines Mantels zu schaffen zu machen, schaltete sich mein Verstand wieder ein. Seufzend stemmte ich mich gegen seine Brust.
»Ich hab keine Zeit, Wyn. Ich muss –«
Große Pranken, schwielig von der harten Arbeit im Hafen, umschlossen zärtlich mein Gesicht.
»Bleib heute hier. Bei mir.«
Gütige Götter, dieser tiefe, raue Unterton in seiner Stimme besaß jedes Mal das Potenzial, mir die Knie weich werden zu lassen. Wyn war ein bildhübscher Kerl mit sanften braunen Augen und besseren Manieren, als man seiner Zunft nachsagte. Ich mochte ihn und ich mochte diese unverbindliche Sache zwischen uns, wann immer sich unsere Wege mehr oder weniger zufällig kreuzten. Doch ausgerechnet heute hatte ich um diesen speziellen Zufall eigentlich einen großen Bogen machen wollen. Mein Blick flog zu dem schmalen Streifen Himmel zwischen den Hausdächern. Tiefgraue Wolkenberge rangen dort miteinander, verschlangen sich gegenseitig und erwuchsen umso dunkler von Neuem.
»Ich kann nicht«, murmelte ich und verfluchte mich selbst für meine Vernunft. Sein Angebot war verführerisch. Mein letzter Besuch bei Wyn lag schon fast sechs Monde zurück und die Aussicht auf einen warmen Männerkörper in einem weichen Bett klang viel einladender als ein Marsch durch den Sturm. Aber die Zeit lief mir davon. »Ich muss weiter, bevor der Schnee die Straßen unpassierbar macht.«
Wyn nickte und ließ von mir ab. Sosehr er sich bemühte, seine Enttäuschung zu verbergen, sein Gesicht war schon immer ein offenes Buch für mich gewesen. Er strich sich unbeholfen durch die Locken und setzte ein schiefes Lächeln auf.
»Dann«, murmelte er, »vielleicht das nächste Mal?«
Ich konnte mir ein Schmunzeln nicht verkneifen. Auch das war eine Eigenschaft, die ich an Wyn schätzte. Er hielt sich an die Bedingungen unserer kleinen Übereinkunft, fragte mich nicht aus und forderte nie mehr, als ich zu geben bereit war – obwohl ich wusste, dass er nichts dagegen gehabt hätte, unsere Gelegenheitsliebschaft zu etwas Handfesterem auszubauen.
»Das nächste Mal!«, versicherte ich ihm aufrichtig.
Ich gab Wyn einen schnellen Abschiedskuss und ließ ihn stehen, ehe ich es mir anders überlegen konnte. Ab diesem Moment begann meine Laune ins Bodenlose zu sinken. Ich war es ja gewohnt, meine Bedürfnisse zurückzustellen, aber das hieß nicht, dass ich es mögen musste. Außerdem verwandelten sich die vereinzelt herumschwebenden Flocken nach und nach in ein dichtes Schneegestöber, das die Straßen binnen kürzester Zeit unter einer weißen Decke begrub. Noch dazu hatte der Wind gedreht und das düstere Zentrum des Sturms an der Stadt vorbei gen Süden getrieben. Gut für Valbeth, schlecht für mich, denn jetzt führte mich mein Weg direkt in das Unwetter hinein.
Als die zwei spitzen Giebeltürme des Südtors endlich in Sichtweite kamen, erreichte meine Laune dann ihren vorläufigen Tiefpunkt. Dort gab es eine Ansammlung aus dick eingemummelten Menschen, ihren Pferden, Maultieren und überladenen Karren. Ich schien offensichtlich nicht die Einzige zu sein, die aus der Stadt hi-nauswollte.
Heute war wirklich nicht mein Tag.
Missmutig unterdrückte ich den Impuls, mich vorzudrängeln. Damit würde ich nur Aufmerksamkeit auf mich lenken, die ich nicht gebrauchen konnte. Also stellte ich mich dort an, wo ich das Ende der unübersichtlichen Schlange vermutete. Ausgerechnet hinter dem Fuhrwerk eines Lichtsammlers, auf dessen Ladefläche baumstammdicke Glaszylinder thronten – leer und bereit, mit Odem gefüllt zu werden. Odem, den sie den Qidhe für ein Paar Silberlinge abkauften, um ihn dann teuer weiterzuverscherbeln. Ganz toll! Als wäre die Kälte nicht ausreichend, um mir die Wartezeit unerträglich zu machen.
Während ich grimmig auf die Glaszylinder starrte, vergaß ich völlig, dass ich eigentlich den Kopf hätte einziehen sollen. Prompt grinste mich ein riesiger Bursche mit Pelzmütze und Ledermantel an. Es war einer der beiden Lichtsammlergesellen, die sich darum kümmerten, die komplizierte Apparatur ihres Meisters frei von Schnee und Eis zu halten. Mit der Rückhand schlug der junge Geselle seinen Freund in die Rippen und deutete in meine Richtung. Oh, bitte nicht!
Ein glücklicher Zufall rettete mich: Irgendwo jenseits der Menge ertönten die Rufe einer Postillenbotin.
»Extrablatt!Extrablatt!Extrablatt! Die Monarchin hatsich entschieden, ihrThronjubiläum inValbeth zu feiern! Extrablatt! Extrablatt!Außerdem: Ein neuer Anschlagin der Hauptstadt. Cahessbangt um seine Lichtwerke. Wann schlagen die Rebellen vom Aschekreis wieder zu? Alle Einzelheiten in der Valbeth Gazette für nur zwei Kupferblatt.«
Ein Mädchen mit Wollmütze und Pausbacken klapperte die Wartenden ab. Auch bei mir machte sie halt und streckte mir eine ihrer druckfrischen Postillen entgegen. Ich lehnte mit einem Kopfschütteln ab. Zwei Kupferblatt für ein Stück Papier auszugeben, das nach dem Lesen seinen Wert verlor, war ein Luxus, den ich mir nicht leisten konnte.
Das Mädchen zuckte mit den Schultern und lief unbeirrt weiter. »Extrablatt! Extrablatt! Kommenden Vollmond kehrtdie Monarchinnach Valbeth zurück,den Ort ihrer Krönung! Alle Einzelheitenin derValbeth Gazette! Extrablatt! Extrablatt …«
Die Nachrichten verkauften sich wie warmes Brot und sorgten für einige Aufregung. Selbst die Lichtsammlergesellen schienen mich völlig vergessen zu haben. Um ganz sicherzugehen, knöpfte ich meinen Mantelkragen vor Mund und Nase zusammen und lauschte mit gesenktem Kopf, wie alle eifrig die Rebellen vom Aschekreis verfluchten und über den angekündigten Besuch der Monarchin diskutierten. Jetzt wusste ich zumindest, wo ich kommenden Vollmond garantiert nicht sein würde. Massenveranstaltungen lagen mir nicht und die Monarchin konnte mir gleich dreimal gestohlen bleiben.
Ab und an wagte ich mich ein paar Schritte aus der Reihe heraus und versuchte, durch die wartende Menge einen Blick auf die Vakàr am Tor zu erhaschen. Es wäre gut zu wissen, wer dort gerade Dienst hatte. Leider sorgte das Schneetreiben dafür, dass ich nur ein paar pechschwarze Schattenumhänge wahrnahm. Mehr als fünf. Das hieß, dass zwei Skall-Einheiten das Tor bewachten. Ungewöhnlich für einen normalen Tag wie heute. Das hatte ich vermutlich dem neuen Syr der Syrs zu verdanken. Leider blieb das nicht die einzige neue Maßnahme, die ich entdeckte. An den beiden Giebeltürmen, die das Tor flankierten, hingen hoch über den Köpfen der Wartenden zwei schwere Eisenkäfige. Scheiße! Derartige Käfige kannte ich sonst nur vom Gildehaus der Schemenhirten, die ihre Beute darin zur Schau stellten. Ich konnte mir schon vorstellen, warum sie sie ausgerechnet hierher gebracht hatten.
»Unheimlich, hm?«
Perplex sah ich auf und wünschte mir direkt, es nicht getan zu haben. Neben mir stand der Lichtsammlergeselle, dem ich gleich zu Beginn aufgefallen war. Der riesige Bursche wirkte in seinem dicken Pelzmantel wie ein Bär. Ein Bär, der ein Gewehr geschultert hatte und unter seinem Mantel zweifellos noch weitere Waffen trug. Das war ein Privileg seiner Zunft. Schließlich mussten Lichtsammler ja ihre wertvolle Fracht verteidigen können. Pfft! Mir wäre ein echter Bär lieber gewesen.
»Na ja«, log ich mit so viel Naivität, wie ich aufbringen konnte, »es sind halt leere Käfige.«
»Ha!«, lachte der junge Mann gönnerhaft. »Die sind nicht leer. Du kannst die grauenhaften Schemen darin nur nicht sehen. Gequälte Menschenseelen, die brutal ermordet wurden und nun auf ewig dazu verdammt sind, die Lebenden in den Wahnsinn zu treiben. Fürchterliche Kreaturen mit grausamen Fratzen, die sich die struppigen Haare raufen und spitze Zähne haben, länger als meine Finger.«
Fast hätte ich laut aufgelacht. Umso dankbarer war ich dafür, dass ich mein Schmunzeln hinter dem Kragen meines Mantels verbergen konnte. Die Käfige waren in der Tat nicht leer, aber die Schemen darin sahen exakt so aus wie die Menschen, die sie einmal vor ihrem Tod gewesen waren. Durchscheinende, verschwommene, flackernde Abbilder – wie die Spiegelung auf einer von Wellen durchbrochenen Wasseroberfläche. Das machte sie nicht zwangsläufig weniger unheimlich, weil sie in ihren Käfigen randalierten und mit lautlosen Stimmen schrien. Stimmen, die man nicht hören, sondern nur fühlen konnte, als würde man in einem Regenschauer aus Glassplittern stehen. Aber so nervtötend und unberechenbar Schemen auch sein mochten, sie waren bestimmt nicht die Art von Monster, die der Lichtsammlergeselle gerade beschrieben hatte.
»Gütige Götter …«, hauchte ich dennoch voller Ehrfurcht, weil ich wusste, dass es das war, was der Kerl hören wollte. »Hast du denn Odem im Blut, dass du sie sehen kannst?«
»Na klar«, flunkerte er, ohne mit der Wimper zu zucken. »Aber keine Sorge, ich bin keiner dieser Halbblut-Bhix. Nur dritte Generation. Mein Urgroßvater war ein Qidhe. Deshalb bin ich auch zu den Lichtsammlern gegangen. Ich kann durch die Schleier sehen, komm gut klar mit den magischen Völkern, spreche ihre Sprache, versteh ihre Probleme. Und natürlich wollte ich ein bisschen rumkommen und mir die Welt anschauen.« Er zwinkerte mir zu. »In mir steckt ein Abenteurer, weißt du.«
Ich konnte ihn nur aus etwas zu weit geöffneten Augen anstarren, weil ich sonst auf den Schwachsinn hätte reagieren müssen, den er von sich gab. Was für ein Aufschneider! Wenn dieser Kerl auch nur einen Funken Odem im Blut hatte, war ich die Monarchin höchstpersönlich.
»Oh, ein Abenteurer …«, wiederholte ich mit gespielter Bewunderung. Leider gelang es mir nicht, den Sarkasmus aus meiner Stimme zu verbannen. Egal, der Lichtsammlergeselle überhörte ihn sowieso. Oder er verstand ihn erst gar nicht. Stattdessen grinste er mich anzüglich an.
»Absolut. In allen Belangen.«
Okay, nicht nur ein Aufschneider, sondern auch noch ein Kotzbrocken.
»Deshalb wirkst du so gelassen, obwohl die Vakàr dich gleich kontrollieren werden.«
»Klar! Ich hab keine Angst«, plusterte er sich auf. »Die Wachkö…Die Vakàr sind hier, um uns zu schützen. Damit diese unzivilisierten Qidhe nicht über unsere schönen Städte herfallen. Ja, wir sind auf ihren Odem angewiesen, aber die Erfindungen, der Fortschritt … das alles kommt von uns. Und glaub mir, darauf sind da draußen alle scharf. Ohne die Menschen wüssten die Qidhe doch gar nichts mit ihrem Odem anzufangen.«
Atmen, Sin! Atmen und bis zehn zählen!
Eins … zwei … drei …
»Ich bin übrigens Rukash.«
Vier … fünf …
»Und du bist?«
Sechs … sieben …
»Schüchtern, hm?«
Acht … neun …
»Wo soll’s bei dir denn hingehen? Vielleicht können wir dich ja ein Stück mitnehmen? Dann hätten wir auch ein bisschen mehr Zeit, uns kennenzulernen.«
Zehn.
Endlich hatte ich meine aufwallende Wut wieder unter Kontrolle. Rukash ahnte nicht mal, wie knapp er einer unschönen Überraschung entgangen war. Er sah mich nach wie vor erwartungsvoll an. Also rief ich mir ins Gedächtnis, dass der Geselle auch nur ein Opfer war. Ein intolerantes, vollidiotisches Opfer, aber ein Opfer. Letztlich konnte er nichts dafür, dass ich auf Menschen nun mal eine unvermeidliche Faszination ausübte. Meine Haut, meine Augen, meine Bewegungen, meine Stimme … eigentlich alles. Die meisten betrachteten mich einfach nur gerne, wie Onna es mir einmal gestanden hatte. Es gab aber auch ein paar, die – wie Wyn – ihre Faszination mit Verliebtheit verwechselten. Und wieder andere – wie Rukash – wollten mich erobern und besitzen. Das alles klang erst mal schmeichelhaft, konnte aber schnell nervig bis brandgefährlich werden. Genau deshalb durfte ich dem Lichtsammlergesellen auch nicht an den Kopf werfen, dass er sich lieber mit seinen ach so tollen menschlichen Erfindungen vergnügen sollte, weil er nämlich unter gar keinen Umständen eine Chance hätte, bei mir zu landen.
Obwohl ich genau das gern gesagt hätte.
»Nein, danke«, erwiderte ich stattdessen höflich und zwang mich, seine eindeutigen Blicke mit einem zweckmäßigen Lächeln zu erwidern. »Ich reise lieber allein. Aber wer weiß, vielleicht trifft man sich ja mal wieder?«
Nimm ihnen nie die Hoffnung, war die oberste Regel im Umgang mit jenen, die sich von mir angezogen fühlten. Ohne Hoffnung griffen sie immer zu Gewalt – gegen sich, gegen mich oder gegen dritte.
»RUKASH! ICH BEZAHL DICH NICHT FÜRS RUMSTEHEN! ANBÄNDELN KANNST DU IN DEINER FREIZEIT! AN DIE ARBEIT!«
Alle in Hörweite zuckten unter der donnernden Stimme des alten Lichtsammlers zusammen. Selbst der bärige Rukash zog den Kopf ein und machte sich daran, seinem halb so großen Meister zu gehorchen. Im Gehen raunte er mir noch zu: »Überleg es dir. Das Angebot steht. – Und keine Angst vor den Schemen. Die sollen nur die Bhix auffliegen lassen, die so tun, als wären sie echte Menschen.«
Fassungslos starrte ich dem Kerl hinterher.
Die so taten, als wären sie echte Menschen?!
Das klang, als hätten Bhix eine Wahl. Als wären sie schuld daran, Halbwesen zu sein, die das menschliche Aussehen vom einen und die magischen Gaben vom anderen Elternteil geerbt hatten. Als würden sie absichtlich ihre Herkunft verschleiern, um arglose Städter ins Verderben zu stürzen.
Als hätten wir nichts Besseres zu tun.
Dennoch teilten viele Rukashs Meinung. Die meisten Städter verabscheuten Bhix sogar noch mehr als Vollblut-Qidhe – und das mochte etwas heißen. Ihretwegen gab es die Grenzkontrollen und die Registrierungspflicht. Ihretwegen hatte man die Käfige hier platziert. Sie waren die Spreu, die es vom Weizen zu trennen galt.
Jetzt verstand ich auch, warum zwei Skall-Einheiten der Vakàr das Tor bewachten. Eine Einheit führte die Kontrollen durch und die andere beobachtete die Wartenden, ob irgendjemand auf die Schemen reagierte. Noch stand ich weit genug weg, aber schon bald reichte ein Blinzeln im falschen Moment, um mich auffliegen zu lassen.
Gerade als ich noch überlegte, ob es das Risiko wert war, kam Bewegung in die Schlange vor mir. Es ging voran und das nicht nur ein paar Schritte. Ein kompletter Händlerzug aus zwölf Lastkarren wurde durch den Kontrollpunkt gewunken. Von einem Augenblick auf den anderen fand ich mich am Fuße der beiden eingeschneiten Spitztürme wieder – im Schatten des mächtigen Fallgitters und unterhalb der Schemenkäfige. Jetzt nahm ich die Gegenwart der flackernden Gestalten ebenso intensiv wahr wie den Sturm. Ihre lautlosen Schreie scharrten klirrend kalt über meine Nerven. Sie kamen in Wellen, verebbten und setzten ganz unvermittelt wieder ein. Jedes Mal musste ich aufs Neue den Reflex unterdrücken, den Kopf zu heben, und konzentrierte mich verbissen auf den dreckigen, platt getrampelten Schnee vor meinen Stiefeln. Und als wäre das noch nicht genug, stellten sich plötzlich meine Nackenhaare auf. Meine Sinne schärften sich, mein Puls stieg und mein Fluchtinstinkt setzte mit voller Wucht ein. Ich wusste nur zu genau, worauf meine Instinkte da reagierten: Ein oder mehrere Vakàr hatten mich ins Visier genommen. Aus den Augenwinkeln sah ich ihre schwarzen Silhouetten durch den Schnee streifen. Zweifellos rochen sie meine Angst bereits, also versuchte ich, sie auf einem möglichst konstanten Pegel zu halten. Mit etwas Glück würden sie mich als verunsichertes Mädchen abstempeln, dessen Anspannung nichts mit den Schemen zu tun hatte.
Meine Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Unerträglich lange Minuten verstrichen, in denen ich mich weniger um die Vakàr sorgte, die ich sah, als um die, die ich nicht sah. Ähnlich einem Rudel agierten die Dunklen Jäger nämlich niemals allein, sondern immer als Einheit, als Skall, in tödlichem Einklang und gnadenloser Präzision. Wenn ich also einen Vakàr vor mir hatte, konnte ich sicher sein, dass vier weitere in meinem Rücken auf einen Moment der Blöße lauerten.
Plötzlich kam Unruhe auf. Pferde wieherten und alle in meiner unmittelbaren Umgebung wichen kaum merklich zurück. Keinen Atemzug später spürte ich es selbst. Ich fuhr herum. Eine dunkle Gestalt hatte sich hinter mir aufgebaut, nah genug, um das Weiß des Schneesturms fast vollständig zu verdrängen. Der Vakàr lächelte. Und in seinem Lächeln lag das Flüstern des Todes.
»Du warst lange nicht hier.«
Rauskommen und reinschlittern
Wie alle dunklen Qidhe waren Vakàr Geschöpfe der Nacht. Ihre Haut glich fahlweißem Mondlicht, ihre Augen erinnerten an nächtlichen Nebel in allen Grau- und Silber-Nuancen und ihr Haar schien aus dem unergründlichen Schwarz tiefster Schatten gewoben zu sein. Egal, wie menschlich die Vakàr von Weitem wirken mochten, sie waren alles andere als Menschen. Sie besaßen diese ganz spezielle Ausstrahlung, die mich jedes Mal erzittern ließ und mich mit dem unheilvollen Gefühl flutete, dem eigenen Ende ins Gesicht zu sehen. Man konnte sie noch so oft Wachköter nennen und sie als bloße Handlanger der menschlichen Monarchin darstellen, letztlich dienten sie niemandem außer sich selbst – und dem Tod. Er lag in jeder ihrer Bewegungen, er glitzerte in ihren Blicken und schwang in ihren Stimmen mit. Sogar wenn sie auf die Jagd gingen, trachteten sie nicht nach Fleisch, Pelzen oder dem Nervenkitzel. Sie jagten, um zu töten, und töteten, weil sie den Tod brauchten. Der Tod nährte sie.
Auch jetzt konnte ich mich dieser Wirkung nicht entziehen, obwohl mich gleichzeitig große Erleichterung erfüllte, weil ich den Vakàr erkannte, der vor mir stand.
»Ja, ich … ich …«, stammelte ich gegen meine Angst an. »Ich … muss mich um meinen kranken Vater kümmern … deshalb komme ich nicht mehr so oft in die Stadt wie früher.«
Das entsprach der Wahrheit. Ich war nicht so dumm, einen Vakàr anzulügen. Mit ihren feinen Sinnen vermochten sie jedes noch so kleine Stolpern meines Herzschlags und jede Veränderung in meinem Körpergeruch wahrzunehmen. Wenn man also nicht der abgebrühteste Schwindler dieser Welt war, sollte man sich mit Lügen besser zurückhalten.
Dunkelgraue, unmenschliche Augen musterten mich eindringlich. Sie gehörten dem Vakàr, den ich insgeheim »den alten Narbigen« nannte – aus gegebenem Anlass. Er war der Erste gewesen, den ich je darum gebeten hatte, mich ohne Kontrolle durch die Tore zu lassen. Seitdem war ich ihm nur ein paar Mal begegnet – was vor allem daran lag, dass ich ihn gemieden hatte. Eine Vorsichtsmaßnahme. Man wusste nie so genau, was meine Gabe anrichtete. Bis es zu spät war.
»Kommst du zurecht?« Die Strenge in seinem Ton konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass mir mit seiner Frage tiefe Zuneigung und unendliche Sehnsucht entgegenschlugen. Diese Art der Ge-fühle hatte nichts mehr mit der oberflächlichen, unbekümmerten Faszination zu tun, die Rukash mir entgegengebrachte. Das hier spielte in einer anderen Liga und war viel gefährlicher. »Brauchst du Hilfe?«
In genau diesem Moment setzten die Schemen mit ihren stummen Wehklagen wieder ein und ich musste die Zähne zusammenbeißen, um nicht zu erschauern. Schnell schüttelte ich den Kopf. »Nein, nein. Ich komm zurecht.«
Eine bewusste Lüge, denn natürlich brauchte ich seine Hilfe. Aber so konnte ich vielleicht von meiner Reaktion ablenken. Abgesehen davon war es hilfreich, mich wie ein Mensch zu verhalten, was hieß, wie ein Mensch um den heißen Brei herumzureden. Die Initiative musste vom Narbigen selbst ausgehen, damit ich bei den anderen Vakàr keinen Verdacht erregte. Genau deshalb fügte ich scherzhaft und in etwas entspannterem Ton hinzu: »Es sei denn natürlich, Ihr könnt dem Sturm Einhalt gebieten. Da würde ich nicht Nein sagen. Ich hab noch einen weiten Weg vor mir.«
Der Vakàr lächelte und ich wusste sofort, dass sich seine Gedanken überschlugen, um eine Möglichkeit zu finden, mir zu helfen – mir zu gefallen. Er nickte in Richtung Stadttor und meinte: »Komm mit.«
Mit energischen Schritten ging er voran und störte sich weder an der Verwunderung der übrigen Vakàr noch an den skeptischen Gesichtern der menschlichen Torwachen. Unterwegs griff er sich von der Ladefläche der Lichtsammler einen gefütterten Umhang.
»Was hat er damit vor? Er wird doch nicht …«, hörte ich Rukash zu seinem Gesellenfreund murmeln.
Auch das ignorierte der Narbige und hielt erst wieder an, als wir genau in der Mitte des gebogenen Tordurchgangs standen. Dort, wo nachts die schweren eisernen Fallgitter herabgelassen wurden. Als er sich zu mir umdrehte, wirkten seine markanten Gesichtszüge ein kleines bisschen entspannter. Vielleicht lag es daran, dass man durch die dicken Mauern vor den eisigen Winden geschützt war. Oder daran, dass die Schreie der Schemen hier nur gedämpft ankamen. Tatsächlich hatte ich mich schon gefragt, wie die Vakàr den ganzen Tag diese Folter ertragen konnten.
»Sei schnell, bleib auf den Straßen und such in der Nacht Schutz«, sagte der Narbige so leise, dass selbst ich ihn kaum verstand. Gleichzeitig legte er mir den Umhang um die Schultern, den er soeben geklaut hatte. »Ich würde dich gerne begleiten, aber ich habe meine Pflichten. Also besuch mich bald wieder, damit ich weiß, dass du noch am Leben bist.«
Oh, das war gar nicht gut. Zu nah, zu persönlich, zu offensichtlich. Aber wie konnte ich sein Geschenk ausschlagen, ohne seine Gefühle und seinen Stolz zu verletzen? Ablehnung war schon bei Menschen riskant. Was würde dann erst ein Vakàr tun?
In diesem Moment trat ein bäriger Hüne im Pelzmantel an uns heran. Aufschneider hin oder her, Rukash besaß Mut.
»Verzeiht, werter Herr, Euch muss ein Fehler unterlaufen sein! Dieser Umhang gehört nicht Euch. Er ist Eigentum der Gilde der Lichtsammler und –«
Der Kopf des Narbigen fuhr herum. Seine Augen blitzten gefährlich. Mehr brauchte es nicht, um den Gesellen verstummen zu lassen. Lautlos und wie aus dem Nichts erschienen zwei weitere schwarz gekleidete Vakàr. Zweifellos gehörten sie zur Skall des Narbigen. Einer baute sich vor Rukash auf, bis dieser sich kleinlaut zurückzog. Die andere – eine hochgewachsene Frau mit einer schweren Armbrust – versuchte vergeblich, aus dem Verhalten ihres Jagdgefährten schlau zu werden.
Schließlich richtete sie ihre hellgrauen Augen auf mich. »Zeig mir deine Taschen!«
»Das ist nicht nötig«, schritt der Narbige ein. »Ich kenne sie. Das Mädchen verbirgt nichts.«
»Aber der Syr der Syrs hat befohlen –«
Schneller als ich es für möglich gehalten hatte, ging der Narbige auf seine Artgenossin los und stieß sie gegen die Tormauer. Nur einen Fingerbreit vor ihrem Gesicht stoppte er mit gebleckten Reißzähnen und einem Knurren, bei dem sich mir alle Haare aufstellten. In diesem Moment ähnelte der Vakàr viel mehr einem Tier als einem Menschen.
»Stellst du mich infrage?« Sein Tonfall hätte Glas schneiden können.
Und obwohl die Dunkle Jägerin ihn um einen halben Kopf überragte, war sofort klar, dass er in der Rangordnung über ihr stand. Sie senkte ihren Blick und flüsterte: »Nein, Syr.«
Gütige Götter, der Narbige war der Syr seiner Skall?!
Ja, im Moment rettete mir das wohl den Hintern, aber hätte ich das vorher gewusst, wäre ich nie mit einer Bitte an ihn herangetreten. Niemals! Je mächtiger jemand war, desto mehr Ärger konnte er mir bereiten. Am liebsten hätte ich den Umhang abgeworfen und mich einfach aus dem Staub gemacht. Aber ich wagte kaum zu atmen. Als der Narbige schließlich von seiner Untergebenen abließ und auf mich zukam, wollte ich im Boden versinken. Das hier widersprach all meinen Grundregeln: kurze unauffällige Begegnungen, keine zu großen Forderungen, keine Zeugen. Es kam mir vor, als würde jeder der Anwesenden die Zusammenhänge durchschauen können. Jeder außer dem Narbigen.
Die Härte verschwand aus seinen Zügen. Er schenkte mir ein melancholisches Lächeln. »Geh und komm heil wieder.«
Für einen Augenblick schien es, als wollte er seine Hand heben, um mir über die Wange zu streichen. Da packte mich nackte Panik. Ich drehte mich um und rannte los. Raus aus der Stadt. Hinein ins tosende Weiß des Schneesturms. Halb rechnete ich damit, das Schnalzen einer Armbrustsehne hinter mir zu hören, obwohl ich wusste, dass der Narbige das niemals zulassen würde. Eher hätte er seine eigene Skall in Stücke gerissen. Vielleicht tat er das in diesem Moment auch … Was für ein Irrsinn! So bald konnte ich mich in Valbeth nicht mehr blicken lassen. Nicht, bevor Gras über die Sache gewachsen war. Nicht, bevor der Narbige mich wieder vergessen hatte und seinem Alltag nachgehen konnte, ohne nach mir Ausschau zu halten.
Als ich die Brücke zu den Kornhügeln erreichte und mich noch immer kein Eisenpfeil durchbohrt hatte, erlaubte ich mir aufzuatmen. Derart knapp war es schon lange nicht mehr gewesen. Ich hätte erleichtert sein sollen, aber jetzt musste ich einem neuen, großen und eiskalten Problem ins Auge blicken. Die sonst so idyllischen Kornhügel, die die valbether Bauern bestellten, um die Stadt mit Getreide zu versorgen, hatten sich in ein weißes Niemandsland verwandelt. Normalerweise konnte man von hier aus über weite Ebenen sehen und am Horizont die dunkle Baumlinie des Klammwalds erkennen. Jetzt gab es nichts mehr außer grauen Sturmwolken, peitschenden Schneeflocken und einer endlos scheinenden Winterwüste.
Ich wickelte mich fester in den viel zu großen, nach Pferdeäpfeln und billigem Rasierwasser stinkenden Lichtsammlerumhang und musste zugeben, dass der Narbige recht damit gehabt hatte, ihn mir zu stehlen. Außerhalb der Stadt war der Wind so schneidend, dass ich selbst mit dem zusätzlichen Kleidungsstück erbärmlich fror. Da wollte ich mir gar nicht vorstellen, was ich ohne das Ding getan hätte.
Nun gut … wie so oft in meinem Leben gab es kein Zurück mehr. Also verfiel ich in einen leichten Trab und folgte den Fahrrillen der Karren, die vor mir hier entlanggekommen waren. Ich würde die Straße schon bald verlassen müssen, denn die Lichtsammler fuhren mit Sicherheit auch gen Süden und ich wollte gewiss kein erneutes Zusammentreffen riskieren.
Anfangs kam ich gut voran, aber mit jedem meiner Schritte schien der Sturm an Stärke zu gewinnen. Er peitschte mir die harten Schneekristalle ins Gesicht, bis meine Wangen vor Kälte brannten. Es dauerte nicht lange, da war auch von den Karrenspuren nichts mehr zu erkennen. Jetzt kam es einem Glücksspiel gleich, ob meine Füße die Straße fanden oder mich geradewegs in den nächstbesten Graben trugen. Am allerschlimmsten war jedoch der eisige Wind. Er raubte mir den Atem, die Kräfte und jedes bisschen Wärme, das ich noch besaß. Unter diesen Umständen würde ich meinen Unterschlupf nie vor Sonnenuntergang erreichen. Kurzerhand schmiss ich meine Pläne um und setzte mir ein neues Ziel: die Höhlen am Steintränenteich. Dort konnte ich Schutz für die Nacht finden.
Als ich endlich die ersten Ausläufer des Klammwalds erreicht hatte, verließ ich die Straße und damit das Hoheitsgebiet der Menschen. Jetzt befand ich mich im Reich der Qidhe. Obwohl ich genauso wenig hierher gehörte wie in die Städte, fühlte ich mich dennoch in den Wäldern zu Hause. Die magische Welt war in vielen Belangen komplexer und komplizierter als die der Menschen, doch es gab zumindest keine willkürlichen Gesetze, keine sinnlose Etikette oder als Höflichkeit getarnte Missgunst. Hier ging es nur um zwei Dinge: um Gleichgewicht und ums Überleben. Für jedes Wunder, das man bestaunen konnte, existierte ein Albtraum, der bereits darauf lauerte, einen umzubringen. So schlicht, so grausam – und gleichzeitig befreiend.
Den Klammwald kannte ich wie meine Westentasche. Noch heute Morgen hatte er ein spektakuläres Feuerwerk aus Herbstfarben zu bieten gehabt. Nun gab es hier nichts als Schnee und Eis. Selbst die schützenden Laubkronen hatten den Sturm nur bedingt aufhalten können. Der Waldboden lag unter einer knarzenden Schneedecke begraben, während der Wind Stämme und Blätter der uralten Blaueichen unaufhörlich mit einer glitzernden Eisschicht überzog. Das machte die Orientierung schwierig. Ich brauchte eine Weile, um den morschen Baum mit der hohlen Wurzel wiederzufinden, in dem ich meine wenigen Habseligkeiten versteckt hatte: einen Beutel mit allerlei Utensilien und einen magischen Kurzspeer aus eisenverstärktem Cibrill-Stahl, der mir schon so manches Mal das Leben gerettet hatte. Ich schulterte alles und stapfte weiter. Diesmal in gemäßigterem Tempo, denn ein gebrochener Knöchel wäre bei diesem Wetter mein sicherer Tod und abseits der Straßen verbargen sich unter dem Schnee Senken, Wurzeln und andere Stolperfallen. Trotz aller Vorsicht strauchelte ich mehrfach. Dreimal konnte ich mich wieder fangen. Beim vierten Mal wich ich einem herabstürzenden Ast aus, der unter seiner Last nachgab. Ich sprang beiseite und fiel so hart in eine Schneeverwehung, dass es mir die Luft aus den Lungen presste. Schwer atmend blieb ich liegen und verfluchte den heutigen Tag – zum gefühlt hundertsten Mal. Den Tag, den verdammten Sturm und meinen knurrenden Magen, der die Handvoll Nüsse vom Morgen längst verdaut hatte. Kein Wunder, dass mir die Kräfte schwanden. Aber so leicht würde ich mich nicht unterkriegen lassen. Ich hatte schon Schlimmeres erlebt und überlebt. Also gönnte ich mir noch drei friedliche Atemzüge. Mehr war nicht drin. Jeder Augenblick, den ich hier lag, brachte mich dem kalten Tod näher. Dann raffte ich mich auf und beäugte finster den weißen Irrgarten aus vereisten Bäumen.
Soweit ich das beurteilen konnte, war ich nicht einmal in der Nähe der Klamm, die ich überqueren musste, um zum Steintränenteich zu gelangen. Das hieß, mehr als die Hälfte der Strecke lag noch vor mir. Ich gestand mir Schwächen zwar nie gerne ein, aber ich kam einfach zu langsam vorwärts. Schon bald würde die Dämmerung einsetzen und falls ich die Nacht überleben wollte – was ich durchaus vorhatte –, musste ich wohl oder übel eine weitere Alternative in Betracht ziehen. Eine Alternative, die mir ganz und gar nicht gefiel. Besonders, da mir –
Plötzlich drang ein gedämpftes Wimmern an meine Ohren. Erst glaubte ich, mich verhört zu haben. Abgesehen vom pfeifenden Wind, dem Rascheln des eisüberzogenen Laubs und dem gefrorenen Holz, das bedrohlich knarzte, schwieg die Natur. Zumindest fast, denn schon wieder hörte ich diesen leise winselnden Laut. Irritiert folgte ich dem Geräusch und fand schnell seinen Ursprung. Ein paar Bäume weiter hatte sich ein Flammwiesel in einer eisernen Drahtschlinge verfangen. Mit seinem glänzend roten Fell und seinen langen goldgelben Schwanzfedern hob sich der tierische Qidhe wie ein Leuchtfeuer vom weißen Schnee ab.
Verdammte Wilderer! Ja, auch ich benutzte derartige Fallen, aber nur, wenn ich sie stündlich kontrollieren konnte. Den Wilderern war es gleichgültig, ob die Tiere – magisch oder nicht – elendig in ihren Fallen verhungerten. Oder erfroren. Und bei diesem Sturm würden sie ihre verwöhnten Hintern sicher nicht so schnell hier raus bewegen. Warum auch? Lebendig konnten sie dem Wiesel zwar seinen Odem abzapfen, aber das brachte ihnen nur ein oder zwei Silberlinge mehr. Die Drecksäcke waren vor allem an magischen Fellen, Federn und Klauen interessiert. Dafür konnte man in der Stadt etliche Kronen verlangen – selbst bei Flammwieseln, die sich wie Ratten vermehrten und vergleichsweise leicht zu fangen waren.
»Du hast wirklich Glück, dass ich gerade meine Pläne geändert hab, kleiner Freund«, murmelte ich. Ich tötete zwar nicht, um mich daran zu bereichern, aber auch ich brauchte Nahrung. Das Flammwiesel war also nur haarscharf dem Schicksal entronnen, mein Abendessen zu werden.
Trotzdem konnte ich mir eine Gelegenheit wie diese nicht entgehen lassen. Ich kramte ein paar Utensilien aus meiner Tasche und kniete mich zu dem Tier. Beherzt packte ich es am Nacken. So heftig, wie es zappelte, war es bestimmt noch nicht lange gefangen.
»Halt still. Ich lass dich ja gleich frei.«
Ich zog den kleineren meiner beiden Dolche. Den, der nicht aus Eisen bestand. Vorsichtig setzte ich ihn am Hals des Wiesels an und drückte die Spitze ein winziges Stück in seine Schlagader. Sofort quollen einige Blutstropfen hervor. Dann hielt ich das Wiesel über die Büchse mit Eisenpulver, die ich bereitgestellt hatte. Kaum fiel das Qidhe-Blut in das Eisen, formte es sich zu kleinen Kugeln, deren Oberfläche verhärtete. Zehn Tropfen genügten. Schließlich wollte ich das Tier nicht zu sehr schwächen. Anschließend entfernte ich die Dolchspitze und sah dabei zu, wie sich die Wunde wieder schloss. Alle Vollblut-Qidhe besaßen diese beneidenswerte Fähigkeit zur Selbstheilung – solange es kein Eisen war, das sie verletzte.
»Und jetzt mach, dass du davonkommst.«
Ich erlöste das Flammwiesel von der Schlinge und gab es frei. In Windeseile verschwand es zwischen den Bäumen. Nun musste ich nur noch –
»Was machst du da?«
Erschrocken sprang ich auf. Meine Hand glitt automatisch zu dem Kurzspeer, der im Schultergurt meines Beutels steckte. Das war die Stimme eines Qidhe gewesen. Mit meinem Dolch würde ich nicht weit kommen.
»Zeig dich!«, flüsterte ich in den Sturm hinein.
Verlockende Begleitung
»Hier drüben, Menschenmädchen«, piepste das Wesen.
Es vergingen ein paar angespannte Augenblicke, in denen das hohe Stimmchen irgendwie an meinen Erinnerungen kratzte. Dann entdeckte ich eine kleine Lichtkugel, die zwischen den herumwirbelnden Schneeflocken kaum zu erkennen war. Ich stöhnte auf und meine Anspannung verwandelte sich postwendend in miese Laune. Auch das noch!
»Wo warst du? Ich hab dich überall gesucht. Hast du dich im Licht hinter der Mauer versteckt?«
Mürrisch ignorierte ich das Irrlicht – wie meistens, wenn es auftauchte. Stattdessen sammelte ich meine Sachen ein. Die frisch entstandenen Blutperlen verstaute ich in einem der leeren Blechdöschen. Die Büchse mit dem Eisenpulver schraubte ich sorgfältig wieder zu und stopfte alles zusammen in meinen Beutel.
»Was machst du da?«, fragte das Irrlicht erneut. »Du musst weitergehen. Wenn das weiße Wasser vom Himmel fällt, sollten Menschen nicht trödeln.«
»Was du nicht sagst«, murrte ich.
»Komm, ich kenne den Weg.«
Mit einem Kopfschütteln marschierte ich los. Gen Westen. Zurück zur Straße. Prompt fing das Irrlicht an, mich im Zickzack zu umkreisen – wie eine aufgeregte Libelle.
»Nicht da lang! Du musst mit mir mitkommen.«
Ich seufzte schwer. »Wirst du jemals aufgeben?«
»Womit?«, erkundigte es sich unschuldig. Viel unschuldiger, als der findige kleine Lichtball in Wirklichkeit war.
»Seit wann bist du überhaupt tagsüber unterwegs?«, wollte ich wissen.
»Die Dämmerung ist nah, der Himmel ist dunkel genug und weit und breit gibt es keine falschen Lichter. Die sind am schlimmsten. Machen, dass ich verblasse«, trällerte es und flog mit voller Wucht und voller Absicht gegen meine Schulter. Das war in etwa so effektiv wie eine Fliege, die mit einer Hauswand kollidierte. Wieder und wieder. »Komm jetzt, Menschenmädchen. Folge mir!«
Stoisch ertrug ich die Attacken und setzte meinen Weg fort. Auch verzichtete ich darauf, dem Irrlicht zu erklären, dass ich kein Mensch war. Das würde nur zu einer Fragenflut führen, für die mir im Moment die Kraft und die Geduld fehlten.
»Du musst umkehren. Ich kenne den Weg. Ich bringe dich in Sicherheit!«
In Sicherheit?! Von wegen. Zu gern hätte ich das Irrlicht einfach wie ein lästiges Insekt beiseite gewischt, aber ich wusste aus Erfahrung, dass das nichts brachte. Vielleicht würde es ja von mir ablassen, wenn ich erst einmal die Straße erreicht hatte? Immerhin mieden die meisten Qidhe menschliches Territorium.
Ich wurde enttäuscht. Weder die Straße noch der erbitterte Wind, der dort sofort an uns zu zerren begann, konnten das Irrlicht davon abhalten, beharrlich an meiner Seite zu bleiben. Irgendwann gab es zumindest auf, meine Schulter unter Beschuss zu nehmen, und schwebte halbwegs friedlich an meiner Seite durch den Sturm.
»Hast du die Medizin für deinen Vater bekommen?«
Überrascht runzelte ich die Stirn. Es war schon ein paar Monde her, dass ich dem Irrlicht davon erzählt hatte. Seither war ich zweimal in Valbeth gewesen und wieder zurückgekehrt. Ich hätte nicht gedacht, dass es sich daran erinnern konnte. Andererseits … ich hatte ihm damals stundenlang erklären müssen, was Medizin war. Und ein Vater. Da würde wohl irgendwas hängen geblieben sein.
»Ja«, antwortete ich knapp, ohne näher auf die Umstände einzugehen. Ich musste Atem sparen. Inzwischen war die Temperatur so weit gefallen, dass es mir vorkam, als würde die Luft in meinen Lungen gefrieren und sich dort in Abertausende winziger, scharfkantiger Eiskristalle verwandeln.
»Das ist gut«, piepste das Irrlicht. Es war unter dem Heulen des Sturms kaum noch zu verstehen. »Glaubst du, dein Vater überlebt das weiße Wasser?«
Ich verdrehte die Augen. Das nächste Mal würde ich ihm statt irgendwelcher Menschenworte wohl eher erklären müssen, was Feingefühl war.
»Er hat schon viele Winter überlebt«, erwiderte ich grimmig. Allerdings keinen so überraschenden.
»Gut. Würde er mit mir mitkommen?«
Wohl kaum. Schließlich war es mein Vater gewesen, der mich schon als Kind davor gewarnt hatte, Irrlichtern zu folgen.
»Dazu muss er erst wieder gesund werden.«
»Aber dazu ist ja Medizin da, hast du gesagt.«
Das … war richtig. Und dennoch ein wenig komplizierter.
»Holst du die Medizin am hellen Ort hinter der Mauer?«
»Ja.«
»Leben da die Menschen?«
»Ja.«
»Wie sieht es dort aus?«
Ich seufzte schwer. Egal, wie viele seiner Fragen ich beantwortete, es stellte stets eine weitere. So ging es fast zwei Stunden lang, in denen der Schnee auf der Straße immer höher und die Sicht immer schlechter wurde, bis letztlich die Nacht hereinbrach. Mittlerweile spürte ich meine Füße nicht mehr und die Kälte war mir bis in die Knochen gekrochen. Ich kämpfte mich nur noch mit Willensstärke voran. Möglicherweise war es auch dem kleinen Irrlicht zu verdanken, dass ich bislang nicht aufgegeben hatte. So nervig seine Neugier war, seine Fragen hatten mich davon abgelenkt, wie gnadenlos ich meine Grenzen überschritt.
Irgendwann sah ich endlich ein paar Laternen durch das dichte Schneetreiben schimmern.
»Oh nein, nein, nein!«, piepte das Irrlicht entrüstet und startete von Neuem seine Schulterattacken. Diesmal so vehement, dass ich Sorge hatte, es könnte sich selbst verletzen. »Geh da nicht hin! Da sind böse Menschen. Sie machen die falschen Lichter so hell, dass ich verblasse.«