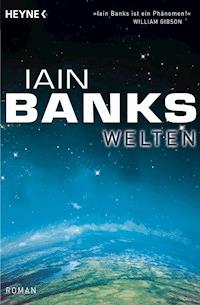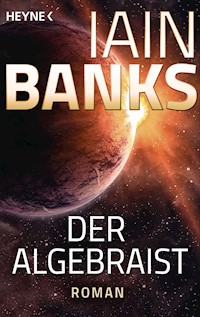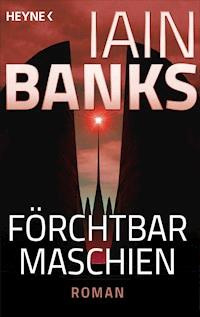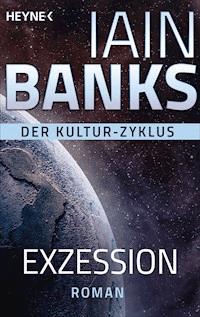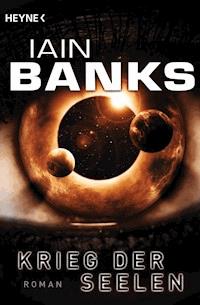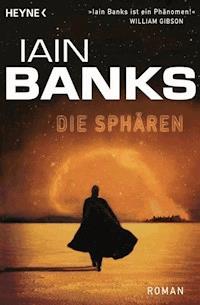
9,99 €
9,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Wozu dienen die Sphären?
Bei ihrem Aufbruch ins All entdecken die Menschen über die ganze Galaxis verstreut künstliche Planeten, riesige Habitate, in deren Innerem sich mehrere Ebenen befinden. Diese Habitate wurden offenbar vor Millionen von Jahren von einem Volk erbaut, das längst verschwunden ist. Zu welchem Zweck, ist unklar. Dennoch besiedeln die Menschen diese Welten, nicht ahnend, dass sie damit ihren eigenen Untergang heraufbeschwören. Denn die Habitate sind eine gigantische Falle für die menschliche Zivilisation.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 940
3,0 (18 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Zum Buch
Zum Autor
Widmung
Danksagung
Prolog
Das Expeditionskorps
Kapitel 1 - Fabrik
Copyright
Zum Buch
Die ferne Zukunft: Auf einer der unzähligen, in den Weiten des Alls verstreuten Schalenwelten wird Prinz Ferbin, der Thronfolger eines niederen Volkes, zum Zeugen an der Ermordung des Königs. In diesem Augenblick muss der Prinz begreifen, dass nicht nur er selbst in höchster Gefahr schwebt, sondern auch sein jüngerer Bruder, der von dem Verrat nichts weiß. Ferbin beschließt, zur Oberfläche der Schalenwelt vorzudringen und das geheimnisvolle Volk der KULTUR um Hilfe zu bitten - wo sich Ferbins Schwester befindet. Jahre zuvor hatten Agenten der KULTUR sie mitgenommen, um sie für geheime Missionen auf fremden Planeten auszubilden. Nur sie kann Prinz Ferbin und seinem Bruder jetzt noch helfen. Doch Ferbin, seiner Schwester und den Agenten der KULTUR bleibt nur wenig Zeit, denn die Schalenwelt birgt ein tödliches Geheimnis …
Monatelang auf den britischen Bestsellerlisten - der neue atemberaubende Science-Fiction-Roman von Kultautor Iain Banks.
Zum Autor
Iain Banks wurde 1954 in Schottland geboren. Nach einem Englischstudium schlug er sich mit etlichen Gelegenheitsjobs durch, bis ihn sein 1984 veröffentlichter Roman »Die Wespenfabrik« als neue aufregende literarische Stimme bekannt machte. In den folgenden Jahren schrieb er zahllose weitere erfolgreiche Romane, darunter »Bedenke Phlebas«, »Exzession« und »Der Algebraist«. Banks gilt heute als einer der bedeutendsten Vertreter der britischen Gegenwartsliteratur.
Für Adèle
Mit Dank für alle, die halfen: Adèle, Les, Mic, Simon, Tim, Roger, Gary, Lara und Dave le Taxi
Prolog
Inder leichten Brise kam ein trockenes Rascheln von einigen nahen Büschen. Der Wind schuf kleine Staubschleier über sandigen Stellen und ließ eine dunkle Locke über der Stirn der Frau flattern, die auf dem Klappstuhl saß, der nicht ganz gerade auf dem nackten Fels stand - von dort reichte der Blick über den Rand des Grats in die Wüste. In der Ferne zitterte die gerade Linie der Straße in der Hitze. Einige dürre Bäume, nur wenige von ihnen höher als zwei aufeinander stehende Männer, markierte ihren Verlauf. Weiter entfernt, Dutzende von Kilometern hinter der Straße, flirrten dunkle, zerklüftete Berge in der heißen Luft.
Nach den üblichen menschlichen Maßstäben war die Frau groß, schlank und recht muskulös. Ihr Haar war kurz, glatt und dunkel, und ihre Haut hatte die Farbe von mattem Achat. In einem Umkreis von mehreren tausend Lichtjahren gab es niemanden sonst von ihrer besonderen Art, doch wenn jemand aus ihrem Volk zugegen gewesen wäre, hätte er vielleicht darauf hingewiesen, dass ihr Alter zwischen Jugend und dem Beginn der mittleren Jahre lag. Vermutlich wäre sie ihm dicklich erschienen in ihrer weiten Hose und der leichten Jacke, beides in der gleichen Farbe wie der Sand. Hinzu kam ein großer schwarzer Hut, der sie vor der Sonne des späten Morgens schützte - ein greller weißer Punkt hoch oben am wolkenlosen, hellgrünen Himmel. Die Frau hob einen sehr alten, abgenutzt wirkenden Feldstecher vor die nachtschwarzen Augen und sah zu der Stelle, wo die Wüstenstraße den Horizont im Westen traf. Rechts von ihr stand ein Klapptisch mit einem Glas und einer Flasche, die kaltes Wasser enthielt. Ein kleiner Rucksack lag darunter. Mit der freien Hand nahm sie das Glas vom Tisch und nippte an dem Wasser, während sie durch den alten Feldstecher blickte.
»Sie sind etwa eine Stunde entfernt«, sagte die links neben ihr schwebende Maschine, die wie ein schmutziger Metallkoffer aussah. Sie bewegte sich ein wenig in der Luft, rotierte und neigte sich zur Seite, als sähe sie die sitzende Frau an. »Und überhaupt …«, fügte sie hinzu, »… mit dem Museumsstück erkennen Sie nicht viel.«
Die Frau setzte das Glas auf den Tisch und ließ den Feldstecher sinken. »Dies gehörte meinem Vater«, sagte sie.
»Ach, wirklich?« Von der Drohne kam ein Geräusch, das nach einem Seufzen klang.
Einige Meter vor der Frau entstand ein Bildschirm und füllte ihr halbes Sichtfeld aus. Aus einer Höhe von etwa hundert Metern zeigte er den vorderen Teil eines Heereszugs auf der Wüstenstraße. Die meisten Männer gingen zu Fuß, aber einige ritten, und alle wirbelten Staub auf, der als dichte Wolke langsam nach Südosten trieb. Sonnenschein spiegelte sich auf erhobenen Speeren und Spießen wider. Fahnen, Standarten und Wimpel wehten. Der Heereszug füllte die Straße auf einer Länge von mehreren Kilometern hinter den Berittenen an der Spitze. Den Abschluss bildeten Gepäckkarren, Planwagen, mit Rädern ausgestattete Katapulte, Bliden und große hölzerne Belagerungsmaschinen, alle gezogen von dunklen, kräftig wirkenden Tieren, deren schwitzende Schultern über die neben ihnen marschierenden Männer aufragten.
»Ts, ts«, machte die Frau und sagte: »Weg damit.«
»Ja, Ma’am«, erwiderte die Maschine. Der Schirm verschwand.
Die Frau blickte erneut durch den Feldstecher und hielt ihn diesmal in beiden Händen. »Ich sehe den Staub«, verkündete sie. »Und zwei weitere Späher, glaube ich.«
»Erstaunlich«, kommentierte die Drohne.
Die Frau legte den Feldstecher auf den Tisch, zog die Krempe des Huts über die Augen, lehnte sich zurück, streckte die Beine und verschränkte die Arme. »Ich mache ein Nickerchen«, teilte sie der Drohne mit. »Weck mich, wenn es so weit ist.«
»Machen Sie es sich nur bequem«, erwiderte die Maschine.
»Mhm.«
Turminder Xuss (Drohne, offensiv) beobachtete die Frau namens Djan Seriy Anaplian eine Zeit lang und überwachte ihr langsames Atmen und die sich nach und nach entspannenden Muskeln, bis sie wusste, dass sie wirklich schlief.
»Träum schön, Prinzessin«, sagte sie leise. Sofort analysierte die Drohne ihre eigenen Worte und konnte nicht feststellen, ob ein unbeteiligter Beobachter in der Lage gewesen wäre, einen Hauch von Sarkasmus darin festzustellen.
Turminder Xuss überprüfte die zuvor eingesetzten sechs Scout- und sekundären Messerraketen. Mit ihren Sensoren beobachtete die Drohne den noch fernen, langsam näher kommenden Heereszug und überwachte mehrere kleine Patrouillen und einzelne Späher, die der Hauptstreitmacht vorausgeschickt worden waren.
Für eine Weile folgte sie den Bewegungen des Heeres. Aus einer gewissen Perspektive gesehen wirkte es wie ein einzelner großer Organismus, der dunkel durch die gelbbraune Weite der Wüste kroch. Etwas Gegliedertes und Zögerliches - Teile davon verharrten gelegentlich aus keinem ersichtlichen Grund, bevor sie sich wieder in Bewegung setzten, und dadurch schien das große Wesen zu schlurfen, anstatt langsam zu fließen -, aber auch entschlossen und ohne jeden Zweifel zielstrebig. Sie alle sind auf dem Weg in den Krieg, dachte die Drohne verdrießlich, um zu erobern, zu verbrennen, zu plündern und zu schleifen. Mit welcher Hingabe sich die Menschen der Zerstörung widmeten.
Etwa eine halbe Stunde später, als sich die Spitze des Heereszugs einige Kilometer westlich im Hitzedunst abzeichnete, ritt ein einzelner Späher über den Kamm des Höhenzugs und näherte sich der Stelle, an der die Drohne wachte und die Frau schlief. Der Mann gab durch nichts zu erkennen, das kleine Lager durch den Tarnschirm erkannt zu haben, aber wenn er nicht den Kurs änderte, ritt er direkt hindurch.
Die Drohne gab ein »Ts, ts« von sich - es klang fast genauso wie zuvor das der Frau - und wies die nächste Messerrakete an, das Reittier zu erschrecken. Das stiftdünne Objekt sauste praktisch unsichtbar heran und stieß an die Flanke des Tiers, woraufhin es kreischte, zur Seite sprang und den Reiter fast abgeworfen hätte. Über den sanft geneigten Hang lief es fort, in Richtung Straße.
Der Späher fluchte, zügelte sein Tier und lenkte es ein ganzes Stück hinter Frau und Drohne zu den Hügeln zurück. Die Entfernung wuchs schnell, und eine dünne Staubfahne blieb in der fast unbewegten Luft zurück.
Djan Seriy Anaplian setzte sich halb auf und lugte unter ihrem Hut hervor. »Was war los?«, fragte sie schläfrig.
»Nichts. Schlafen Sie weiter.«
»Hmm.« Die Frau entspannte sich wieder, und eine Minute später schnarchte sie leise.
Die Drohne weckte sie, als sich die Spitze des Heereszugs fast auf einer Höhe mit ihnen befand. Sie richtete ihren vorderen Teil auf die einen Kilometer entfernte Kolonne aus Menschen und Tieren, während Anaplian gähnte und sich streckte. »Da sind die Jungs«, sagte sie.
»Ja.« Die Frau hob ihren Feldstecher und beobachtete den vorderen Teil der Streitmacht. Eine Gruppe von Männern ritt dort auf besonders großen, mit bunten Satteldecken ausgestatteten Tieren. Diese Männer trugen hohe Federhelme, und ihre polierten Rüstungen glänzten im Sonnenschein. »Sie sehen aus wie bei einer Parade«, sagte Anaplian. »Als erwarteten sie, hier draußen jemandem zu begegnen, den sie beeindrucken müssen.«
»Gott?«, spekulierte die Drohne.
Die Frau schwieg einen Moment. »Hm«, erwiderte sie, ließ den Feldstecher sinken und sah die Drohne an. »Sollen wir?«
»Ein Wort von Ihnen genügt.«
Anaplian sah wieder zum Heereszug und atmete tief durch. »Na schön. Gehen wir’s an.«
Die Drohne kippte nach vorn, was fast wie ein Nicken aussah. Eine kleine Luke öffnete sich in der Seite. Ein etwa vier Zentimeter breiter und fünfundzwanzig Zentimeter langer Zylinder, wie ein konisches Messer geformt, rollte träge in die Luft und raste plötzlich fort. Er blieb dicht über dem Boden, beschleunigte und näherte sich schnell dem Ende des langen Zugs aus Menschen, Tieren und Maschinen. Für einen Moment hinterließ er eine Spur aus aufgewirbeltem Staub, passte dann seine Höhe an. Anaplian verlor das getarnte Objekt fast sofort aus den Augen.
Das bisher unsichtbar gebliebene Aurafeld der Drohne leuchtete kurz rosarot auf. »Dies dürfte interessant werden«, sagte sie.
Die Frau richtete einen skeptischen Blick auf die Drohne. »Diesmal gibt es doch keine Patzer, oder?«
»Natürlich nicht«, antwortete die Maschine sofort. »Möchten Sie zusehen?«, fügte sie hinzu. »Ich meine richtig sehen, nicht durch Ihr antikes Opernglas.«
Anaplian starrte die Drohne aus zusammengekniffenen Augen an. »Na schön«, sagte sie nach einigen Sekunden.
Diesmal erschien der Schirm auf der einen Seite, damit Anaplian mit dem bloßen Auge noch immer das Heer auf der fernen Straße sehen konnte. Der Beobachtungspunkt befand sich irgendwo hinter der Kolonne und viel tiefer als vorher. Staub trieb durchs Blickfeld.
»Die Bilder stammen von der Scoutrakete, die dem Heereszug folgt«, sagte Turminder Xuss. Neben dem Schirm flackerte es, und ein zweiter Darstellungsbereich entstand. »Und das kommt von der Messerrakete.« Die Kamera im Messer zeigte die vorbeihuschenden Schemen von Männern, Uniformen und Waffen, und unmittelbar darauf wurden große Wagen sowie Kriegs- und Belagerungsmaschinen sichtbar. Dann flog die Rakete am Ende der Kolonne vorbei, um etwa einen Kilometer dahinter und einen Meter über der Straße in Position zu gehen. Sie war jetzt nicht mehr fast so schnell wie der Schall, sondern hatte ihre Geschwindigkeit auf die eines schnellen Vogels reduziert. Rasch schloss sie zum Ende des Heereszugs auf.
»Ich synchronisiere den Scout mit dem Messer«, sagte die Drohne. Nach wenigen Augenblicken erschien das runde Rückteil der Messerrakete als Punkt im Blickfeld der Scoutrakete und schwoll an, bis es aussah, als flöge die kleinere Maschine nur einen Meter hinter der größeren. »Da machen sich die Warps auf den Weg!«, sagte Xuss und klang aufgeregt. »Sehen Sie?«
Zwei pfeilspitzenförmige Objekte, eins auf jeder Seite, lösten sich von der Messerrakete, scherten aus und verschwanden. Die monofilen Drähte, die jeden Warp mit der Messerrakete verbanden, waren unsichtbar. Das Bild veränderte sich, als die Scoutrakete zurückfiel, aufstieg und fast den ganzen Heereszug zeigte.
»Ich weise das Messer an, die Drähte brummen zu lassen«, sagte die Drohne.
»Was bedeutet das?«
»Die monofilen Drähte vibrieren. Was sie durchdringen, wird wie von einer unglaublich scharfen Streitaxt durchschnitten«, erklärte die Drohne bereitwillig.
Die von der Scoutrakete übertragenen Bilder zeigten einen Baum etwa hundert Meter hinter dem letzten rollenden Wagen. Er erzitterte, und die oberen drei Viertel rutschten vom Stumpf, kippten und fielen in den Staub.
»Das war ein Klacks«, sagte die Drohne. Sie klang amüsiert, und erneut leuchtete sie kurz rosarot auf. Die Wagen und Belagerungsmaschinen füllten das Blickfeld der Messerrakete. »Und die Anfangsphase ist meistens die schwierigste …«
Die Stoffdächer der Planwagen stiegen wie freigelassene Vögel auf. Unter Spannung stehende Holzreifen sprangen auseinander, als die monofilen Drähte sie durchdrangen. Die riesigen, massiven Räder der Katapulte, Bliden und Belagerungsmaschinen verloren bei der nächsten Drehung ihre Oberteile, und die großen hölzernen Gefährte kamen zum Stehen - bei einigen rutschten dadurch die ebenfalls abgetrennten oberen Hälften nach vorn. Armdicke Seile, eben noch festgezurrt, lösten sich schlagartig und peitschten umher. Die Scoutrakete flog zwischen den gefällten, ruinierten Maschinen, als die Männer in und bei den Wagen und neben den Belagerungsmaschinen zu reagieren begannen. Die Messerrakete beschleunigte und raste den Fußsoldaten weiter vorn entgegen. Sie sprang in das Durcheinander aus Speeren, Spießen, Standarten, Fahnen und Flaggen, mähte durch sie und hinterließ ein Chaos aus zerschnittenem Holz, fallenden Klingen und flatterndem Stoff.
Anaplian erhaschte den einen oder anderen flüchtigen Blick auf Männer, die ebenfalls durchtrennt oder von fallenden Spießen durchbohrt wurden.
»Gewisse Verluste lassen sich nicht vermeiden«, sagte die Drohne.
»Ja«, erwiderte die Frau.
Die von der Messerrakete übertragenen Bilder zeigten verwirrte Gesichter, als Männer weiter hinten Schreie hörten und sich umsahen. Die Rakete befand sich eine halbe Sekunde hinter den Berittenen und flog etwa in Halshöhe, als die Drohne sendete:
- Sind Sie sicher, dass wir nicht …
- Ganz sicher, erwiderte Anaplian und fügte der nonverbalen Kommunikation ein Seufzen hinzu. - Bleib beim Plan.
Die winzige Maschine stieg einen guten halben Meter auf, raste über die Männer auf den Reittieren hinweg und schnitt so durch die Federhelme wie durch einen Wald aus bunten Halmen. Sie sauste über die Spitze der Kolonne hinweg, ließ Verwirrung und eine Wolke aus Federn hinter sich zurück, stieg dann abrupt gen Himmel auf. Die ihr folgende Scoutrakete beobachtete, wie die monofilen Warps zum Messer zurückkehrten, bevor sie ebenfalls aufstieg, langsamer wurde und den Kamerablick auf den Heereszug weiter unten richtete.
Die Szene präsentierte eine nach Anaplians Meinung zufriedenstellende Mischung aus Chaos, Zorn und Konfusion. Sie lächelte, was so selten geschah, dass Turminder Xuss den Moment aufzeichnete.
Die in der Luft hängenden Schirme verschwanden. Die Messerrakete kehrte zurück und schwebte durch eine Luke in der Seite der Drohne.
Anaplian sah über die Ebene hinweg zur Straße und der zum Stillstand gekommenen Streitmacht. »Sind die Verletzungen groß?«, fragte sie, und ihr Lächeln löste sich auf.
»Sechzehn oder so hat es erwischt«, antwortete die Drohne. »Bei etwa der Hälfte dürften sie sich als fatal erweisen.«
Anaplian nickte und beobachtete noch immer die ferne Kolonne aus Menschen und Maschinen. »Na ja.«
»Eben«, bestätigte Turminder Xuss. Die Scoutrakete näherte sich der Drohne und verschwand ebenfalls durch eine Klappe in der Seite. »Trotzdem …«, fügte die Drohne hinzu und klang überdrüssig. »Wir hätten mehr tun sollen.«
»Hätten wir das?«
»Ja. Sie hätten mir richtige Enthauptungen gestatten sollen.«
»Nein«, sagte Anaplian.
»Nur die Adligen«, fuhr Turminder Xuss fort. »Die Burschen ganz vorn. Jene, von denen die ach so tolle Idee mit dem Krieg stammt.«
»Nein«, wiederholte die Frau, stand auf, drehte sich um und klappte den Stuhl zusammen. Sie hielt ihn in der einen Hand. Mit der anderen nahm sie den alten Feldstecher vom Tisch. »Das Modul ist unterwegs?«
»Über uns«, antwortete die Drohne. Sie schwebte um Anaplian herum, hob den Tisch und verstaute Glas und Wasserflasche im Rucksack. »Nur zwei fiese Herzöge? Und den König?«
Anaplian hielt ihren Hut fest, als sie nach oben sah und im Sonnenschein blinzelte, bis sich ihre Augen anpassten. »Nein.«
»Ich hoffe, dies ist keine Art von übertragener Familiensentimentalität, oder?«, fragte die Drohne mit halb vorgetäuschtem Abscheu.
»Nein«, sagte die Frau und beobachtete, wie sich einige Meter entfernt die Konturen des Moduls abzeichneten.
Turminder Xuss näherte sich dem Modul, als sich dessen hintere Luke öffnete. »Wollen Sie irgendwann aufhören, mir dauernd mit ›nein‹ zu antworten?«
Anaplian stand mit ausdrucksloser Miene da.
»Na schön«, sagte die Drohne und seufzte. Sie kippte/nickte in Richtung der offenen Modultür. »Nach Ihnen.«
DasExpeditionskorps
1
Fabrik
Das Gebäude musste eine alte Fabrik beziehungsweise Werkstatt oder etwas in der Art sein. Große Zahnräder aus Metall steckten halb in hölzernen Böden oder hingen an riesigen Spindeln von einem Netz aus eisernen Trägern weiter oben. Bänder und Riemen aus grobem Leinen spannten sich überall durch die Dunkelheit und verbanden kleinere, glatte Räder mit kompliziert wirkenden Maschinen, von denen er glaubte, dass sie etwas mit Weben oder Stricken zu tun hatten. Alles sah staubig und schmutzig aus, und doch war dies eine moderne Anlage gewesen, eine Fabrik! Wie schnell Dinge zerfielen und nutzlos wurden.
Normalerweise hätte er nicht in Erwägung gezogen, auch nur in die Nähe eines so verdreckten Ortes zu gehen. Vielleicht bot er nicht einmal Sicherheit, dachte er, obwohl die Maschinerie unbewegt blieb. Eine Giebelwand war halb eingestürzt. Ziegelsteine lagen auf dem Boden, Bretter waren gesplittert, Dachsparren hingen herab. Er wusste nicht, ob es alte Schäden waren, auf Verfall zurückzuführen, oder das Ergebnis von etwas, das sich an diesem Tag ereignet hatte, während der Schlacht. Letztendlich scherte er sich nicht darum, was dieser Ort war und einst gewesen sein mochte. Er bot sich als Versteck an, und nur darum ging es ihm.
Er gab ihm die Möglichkeit, sich zu sammeln, zu regenerieren und neu zu planen - so klang es besser. Er wollte nicht weglaufen, sagte er sich. Es handelte sich vielmehr um einen strategischen Rückzug, oder wie man so etwas nannte.
Draußen hatte der Rollstern Pentrl vor einigen Minuten den Horizont passiert, und es wurde langsam dunkel. Durch die Lücke in der Wand sah er gelegentliche Blitze und hörte das Donnern von Artillerie, die beunruhigend nahen Einschläge von Geschossen und das kurze Geratter von Handfeuerwaffen. Er fragte sich, wie es um die Schlacht stand. Sie sollten gewinnen, aber es war alles sehr verwirrend. Vielleicht kündigte sich ein triumphaler Sieg an, oder eine verheerende Niederlage.
Er verstand nichts von der Kriegführung, hatte nie einschlägige Erfahrungen gesammelt und keine Ahnung, wie die Leute in der Schlacht bei Verstand blieben. Eine große Explosion in der Nähe ließ das ganze Gebäude erzittern. Er duckte sich und wimmerte, kroch noch tiefer in die dunkle Ecke, die er im ersten Stock gefunden hatte, und zog sich den Mantel über den Kopf. Er hörte, wie er jenes armselige, jämmerliche Geräusch von sich gab, und er hasste sich dafür. Während er unter dem Mantel atmete, nahm er den schwachen Geruch von getrocknetem Blut und Kot war, und das hasste er ebenfalls.
Er war Ferbin otz Aelsh-Hausk’r, ein Prinz des Hauses von Hausk, Sohn des Königs Hausk, des Eroberers. Und obgleich Sohn seines Vaters hatte man ihn nicht dazu erzogen, wie er zu sein. Der König genoss Krieg, Schlacht und Disput, hatte sein ganzes Leben damit verbracht, den Einflussbereich des Throns und seines Volkes aggressiv zu erweitern, immer im Namen des WeltGottes und mit einem Blick auf die Geschichte. Sein ältester Sohn war aufgewachsen, um so zu sein wie er, aber genau die Leute, gegen die sie jetzt kämpften, vielleicht zum letzten Mal, hatten ihn getötet. Der zweite Sohn, Ferbin, war nicht in den Künsten des Krieges unterwiesen worden, sondern in denen der Diplomatie. Sein natürlicher Platz sollte am Hof sein, nicht auf dem Exerzier-, Fecht- oder Schießplatz, vom Schlachtfeld ganz zu schweigen.
Sein Vater hatte das gewusst, und selbst wenn er auf Ferbin nie so stolz gewesen war wie auf Elime, den ermordeten ersten Sohn: Er hatte sich damit abgefunden, dass Ferbins Talente - man konnte sogar von einer Berufung sprechen, hatte Ferbin mehr als einmal gedacht - bei der Politik lagen und nicht im Kriegshandwerk. Was durchaus den Wünschen seines Vaters entsprach. Der König sah der kommenden Zeit entgegen, dem neuen Zeitalter, das er mit seinen kriegerischen Heldentaten herbeiführen wollte, die dann, so hoffte er, als die kruden Notwendigkeiten gesehen würden, für die er sie selbst hielt. Wenigstens einer seiner Söhne sollte auf das bevorstehende Zeitalter des Friedens vorbereitet sein, in der geschickt gewählte Worte mehr Wirkung entfalteten als ein geschickt geschwungenes Schwert.
Ihn traf keine Schuld daran, dass er nicht für den Krieg geschaffen war, sagte sich Ferbin. Und mit der Erkenntnis, dass er jeden Augenblick sterben konnte, dachte er: Ihn traf auch keine Schuld daran, dass er vor kurzer Zeit so erschrocken gewesen war. Ebenso wenig konnte man ihm zur Last legen, dass er die Kontrolle über seinen Darm verloren hatte, als ein Kanonenschuss den Yilim-Burschen - ein Major oder General oder so - ausgelöscht hatte. Lieber Gott, der Mann hatte mit ihm gesprochen, und dann … war die Hälfte von ihm plötzlich nicht mehr da gewesen!
Ihre kleine Gruppe war zu einem niedrigen Höhenzug geritten, um von dort aus einen besseren Blick auf die Schlacht zu haben. Ferbin hatte das für ziemlich unklug gehalten, denn dadurch riskierten sie, von feindlichen Aufklärern gesehen zu werden, was eine noch größere Gefahr bedeutete als die durch Artilleriegeschosse. Trotzdem hatte er als Reittier einen besonders auffälligen Mersicor von den Außenzelten der königlichen Ställe gewählt: ein reinrassiges weißes Geschöpf, groß und stolz, ein Tier, das ihn gut aussehen ließ, wie er hoffte. Kurz darauf musste er feststellen, dass sich Generalmajor Yilim für ein ähnliches Tier entschieden hatte. Hinterher war man immer klüger, eine Erfahrung, die Ferbin schon mehrmals gemacht hatte - er wusste jetzt, dass es alles andere als klug gewesen war, mit zwei so auffälligen Tieren auf den Kamm eines weithin sichtbaren Höhenzugs zu reiten.
Er hatte darauf hinweisen wollen, war dann aber zu dem Schluss gelangt, dass er von diesen Dingen nicht genug verstand, um mahnende Worte zu formulieren. Außerdem hatte er nicht wie ein Feigling dastehen wollen. Vielleicht war Generalmajor oder Majorgeneral Yilim beleidigt gewesen, weil er nicht zur Front durfte und sich stattdessen um Ferbin kümmern und dafür sorgen musste, dass er dem Geschehen nahe genug blieb für die spätere Behauptung, an der Schlacht teilgenommen zu haben, aber nicht so nahe, dass er riskierte, wirklich in Kampfhandlungen verwickelt zu werden.
Vom Kamm aus reichte ihr Blick übers ganze Schlachtfeld, vom großen Turm in der Ferne über das Tiefland, das sich vom kilometerbreiten Zylinder aus erstreckte, bis hin zu ihrer Position bei den ersten niedrigen Hügeln, über die die Straße nach Pourl verleif. Die Sarl-Hauptstadt lag hinter ihnen, im Dunst gerade noch sichtbar und einen Kurztagritt entfernt.
Dies war das alte Land Xilisk, und hier hatten Ferbin und seine Geschwister gespielt, ein seit Langem entvölkertes Land, in königliche Parks und Jagdgebiete verwandelt, voller überwucherter Dörfer und weiter Wälder. Jetzt blitzte in seiner zerrissenen Geografie das Feuer Tausender Kanonen, und das Land selbst schien sich zu bewegen und zu fließen, wo Truppenkonzentrationen und Flotten von Kriegsmaschinen manövrierten. Große, schräge Stängel aus Dampf und Rauch ragten auf und warfen keilförmige Schatten auf den Boden.
Unter Qualm und Wolken flogen hier und dort geflügelte Geschöpfe über der großen Schlacht: Caude und Lyge, die altehrwürdigen Kriegstiere des Himmels, hielten nach Artillerie Ausschau und brachten Nachrichten und Signale von Ort zu Ort. Keins der Geschöpfe störte sich an den Wolken aus geringeren Flugwesen, was den Schluss zuließ, dass sie alle freundlich waren. Nicht zu vergleichen mit den alten Zeiten, als ganze Schwärme und Wolken dieser großen Tiere in der Luft gekämpft und an den großen Schlachten der Ahnen teilgenommen hatten. Vorausgesetzt natürlich, man konnte den Geschichten und Darstellungen alter Gemälde Glauben schenken. Ferbin hielt sie für übertrieben, und sein jüngerer Halbbruder Oramen, der behauptete, sich mit solchen Dingen auszukennen, sagte dazu: Natürlich sind sie übertrieben. Und dann, typisch für ihn, schüttelte er den Kopf über Ferbins Ignoranz.
Sein Diener Choubris Holse hatte sich auf dem Hügelkamm links von Ferbin befunden, in der Satteltasche gekramt und etwas von frischen Vorräten gemurmelt, die es aus dem nächsten Dorf zu holen galt. Major - oder General - Yilim war auf der rechten Seite gewesen und hatte sich darüber ausgelassen, den Kampf eine Stufe tiefer zu tragen, in die Domäne des Feindes. Ferbin hatte seinem Diener keine Beachtung geschenkt und sich allein aus Höflichkeit Yilim zugewandt. Und dann, mitten im Wort, verschwand der ältere Offizier - korpulent, das Gesicht ein wenig gerötet, mit der Neigung, beim Lachen zu schnaufen -, verschwand einfach so, begleitet von einem Geräusch, das so klang, als würde etwas zerreißen. Die untere Hälfte von ihm saß weiterhin im Sattel, doch der Rest war zerfetzt und lag verstreut umher. Ein Teil davon schien sich auf Ferbin geworfen zu haben; plötzlich sah er sich von Blut und schmierigen Körperteilen bedeckt. Ferbin hatte auf die Reste im Sattel gestarrt, als er sich das grässliche Zeug aus dem Gesicht wischte. Der abscheuliche Gestank hatte ihn würgen lassen. Das Mittagessen verließ Bauch und Mund und so schnell, als würde es von etwas verfolgt. Er hatte gekotzt und gehustet, sich dann mit der blutigen Hand das Gesicht abgewischt.
»Verdammter Scheiß«, hatte Choubris Holse mit brüchiger Stimme gesagt.
Yilims Ross - der große, blasse Mersicor, zu dem Yilim sanfter gesprochen hatte als zu seinen Männern - schien plötzlich zu begreifen, was gerade geschehen war, wieherte, richtete sich auf, floh und warf dabei den Rest des Körpers ab. Ein zweites Artilleriegeschoss oder eine Kanonenkugel oder was auch immer landete in der Nähe und fällte zwei weitere aus ihrer Gruppe in einem kreischenden Durcheinander aus Mensch und Tier. Ferbin stellte fest, dass auch sein Diener zu Boden ging, und sein Reittier fiel auf ihn. Da lag Choubris Holse und schrie voller Furcht und Schmerzen, eingeklemmt unter seinem Ross.
»Sir!«, rief einer der jüngeren Offiziere, und plötzlich befand er sich direkt vor Ferbin und drehte sein Tier. »Reiten Sie! Weg von hier!«
Er wischte sich noch immer Blut aus dem Gesicht.
Und er merkte, dass er sich in die Hose gemacht hatte. Er trieb sein Reittier an und folgte dem jüngeren Mann, bis Ross und Reiter in einer Wolke aus plötzlich aufgewirbeltem dunklen Boden verschwanden. Die Luft schien voller ohrenbetäubender Schreie und blendendem Feuer zu sein. Ferbin hörte sich wimmern. Er duckte sich, schlang die Arme um den Hals seines Reittiers und schloss die Augen, überließ es dem trabenden Ross, selbst einen Weg an eventuellen Hindernissen vorbei zu finden; er wagte es nicht, den Kopf zu heben und zu sehen, wohin sie unterwegs waren. Der die Knochen durchrüttelnde schreckliche Ritt dauerte eine Ewigkeit, und immer wieder hörte Ferbin dabei sein eigenes Wimmern.
Schließlich wurde der keuchende Mersicor langsamer. Ferbin öffnete die Augen und stellte fest, dass sie dem Verlauf eines Weges folgten, der an einem Fluss entlangführte. Hohe Bäume schirmten ihn auf der anderen Seite ab. Immer wieder donnerte und blitzte es, aber die Entfernung schien jetzt größer zu sein. Weiter flussaufwärts brannte etwas, vielleicht einige in Brand geratene Bäume. Kurze Zeit später sah Ferbin ein großes, halb verfallenes Gebäude im Licht des späten Nachmittags aufragen, als der müde Mersicor noch langsamer wurde. Er hielt vor dem Gebäude an, stieg ab und ließ die Zügel los. Eine weitere laute Explosion erschreckte das Tier, und mit einem klagenden Blöken trabte es davon. Ferbin hätte vielleicht entschieden, ihm zu folgen, wenn seine Hose nicht voller Kot gewesen wäre.
Durch eine schief in den Angeln hängende Tür watschelte er ins Gebäude, auf der Suche nach Wasser und einer Möglichkeit, sich zu säubern. Sein Diener hätte gewusst, worauf es nun ankam. Choubris Holse hätte ihn schnell in Ordnung gebracht, mit reichlich Gebrumm und Gegrummel, aber doch auf eine sehr tüchtige Weise, und ohne verborgenen Spott.
Ferbin begriff plötzlich, dass er unbewaffnet war. Der Mersicor hatte sich mit seinem Gewehr und dem Zeremonienschwert auf und davon gemacht. Und die Pistole, das Geschenk seines Vaters … Er hatte geschworen, sie erst dann beiseitezulegen, wenn der Krieg zu Ende war, und jetzt steckte sie nicht mehr im Halfter.
Er fand Wasser und einige alte Lappen, säuberte sich damit, so gut es ging. Seine Feldflasche hatte er noch, aber sie war leer, enthielt keinen Wein mehr. Ferbin füllte sie in einer tiefen Mulde im Boden, durch die Wasser floss, spülte seinen Mund aus und trank. Er versuchte, sein Spiegelbild in dem dunklen Wasser zu erkennen, doch das gelang ihm nicht. Er tauchte die Hände hinein, strich mit den Fingern durchs lange, blonde Haar und wusch sich dann das Gesicht. Immerhin galt es, auf das Erscheinungsbild zu achten. Von König Hausks drei Söhnen hatte er die größte Ähnlichkeit mit ihrem Vater: groß, blond, attraktiv, mit einem stolzen, männlichen Gebaren (so meinten die Leute; er selbst kümmerte sich nicht um solche Angelegenheiten).
Jenseits des dunklen, verlassenen Gebäudes tobte weiter die Schlacht, als Pentrls Licht vom Himmel wich. Ferbins Zittern hörte nicht auf, und er roch nach Blut und Exkrementen. Es war undenkbar, dass ihn jemand in diesem Zustand fand. Und der Lärm! Man hatte ihm gesagt, dass die Schlacht schnell zu Ende gehen würde, mit einem Sieg, aber sie dauerte noch immer an. Vielleicht verloren sie. Wenn das der Fall war, sollte er sich besser versteckt halten. Ferbin dachte an die Möglichkeit, dass sein Vater auf dem Schlachtfeld gefallen war - sein Tod hätte ihn zum neuen König gemacht. Eine zu große Verantwortung; er durfte sich erst zeigen, wenn er sicher sein konnte, dass sie den Sieg errungen hatten. Er suchte sich oben einen Platz zum Schlafen, fand aber keine Ruhe. Immer wieder sah er, wie General Yilim direkt vor ihm auseinanderplatzte und ihn mit einem Regen aus Fleischbrocken überschüttete. Er übergab sich noch einmal und trank anschließend aus der Feldflasche.
So dazusitzen, den Mantel eng um sich geschlungen … Allein dadurch fühlte er sich etwas besser. Bestimmt kam bald alles in Ordnung, sagte er sich. Er würde abseits der Dinge bleiben, für den einen oder anderen Moment, bis er sich beruhigt und wieder gefasst hatte. Und dann würde er sich einen Überblick über die Lage verschaffen. Er war noch nicht bereit, König zu sein. Als Prinz hatte ihm das Leben gefallen. Es machte Spaß, Prinz zu sein, doch als König schien man hart arbeiten zu müssen. Außerdem: Sein Vater hatte allen Leuten, die ihm begegneten, den starken Eindruck vermittelt, dass er mit absoluter Gewissheit ewig leben würde.
Irgendwann musste Ferbin eingenickt sein. Von unten kommende Geräusche weckten ihn: Geklapper und Stimmen. Im Halbschlaf glaubte er, einige von ihnen zu erkennen. Sofort fürchtete er, entdeckt zu werden, vom Feind gefangen oder vor den Soldaten seines Vaters in Verlegenheit gebracht. Wie tief er in so kurzer Zeit gefallen war! Vor der eigenen Seite ebenso viel Angst zu haben wie vor dem Feind! Stiefel mit Metallbeschlägen klackten auf den Stufen. Entdeckung stand unmittelbar bevor!
»In den oberen Stockwerken ist niemand«, ertönte eine Stimme.
»Gut. Legt ihn dorthin. Doktor …« (Es folgten Worte, die Ferbin nicht verstand. Er dachte noch immer darüber nach, wie er im Schlaf der Entdeckung entgangen war.) »Nun, geben Sie sich alle Mühe. Bleye! Tohonlo! Reitet los und holt Hilfe, auf mein Geheiß.«
»Sir.«
»Sofort.«
»Priester, Bereitschaft.«
»Der Gepriesene, Sir …«
»Wird zweifellos zu gegebener Zeit bei uns sein. Derzeit sind Sie dran.«
»Natürlich, Sir.«
»Was die anderen betrifft … Hinaus mit euch. Wir brauchen hier Bewegungsfreiheit.«
Ferbin kannte die Stimme. Er war ganz sicher. Der die Befehle erteilende Mann musste tyl Loesp sein.
Mertis tyl Loesp, bester Freund seines Vaters und der Berater, dem er am meisten vertraute. Was ging hier vor? Unten kam es zu Bewegung. Laternen warfen Schatten an die dunkle Decke über Ferbin. Er kroch zu einem nahen Spalt im Boden, durch den Licht kam. Ein breiter Leinenriemen führte dort von einem riesigen Rad weiter oben zu einer Maschine im Erdgeschoss. Ferbin schob sich näher heran und spähte nach unten.
Lieber Gott der Welt, dort lag sein Vater!
Mit erschlafftem Gesicht und geschlossenen Augen ruhte König Hausk auf einer breiten Holztür, die man auf improvisierte Böcke gelegt hatte. Auf der linken Brustseite zeigte sich ein Loch in der verbeulten Rüstung, und Blut sickerte durch eine Fahne, die man um ihn gewickelt hatte. Er schien tot zu sein, oder dem Tode nahe.
Ferbin riss die Augen auf.
Der königliche Arzt Dr. Gillews öffnete eilig Beutel und Kästen. Ein Assistent wuselte um ihn herum. Ein Priester, den Ferbin schon einmal gesehen hatte, dessen Namen er aber nicht kannte, stand neben dem Kopf seines Vaters, der weiße Umhang voller Blut oder Schmutz. Er las aus irgendwelchen heiligen Schriften vor. Mertis tyl Loesp - groß und ein wenig gebückt, noch immer in seine Rüstung gekleidet, den Helm in der einen Hand, das weiße Haar verfilzt - ging auf und ab, und seine Rüstung glänzte im Schein der Laternen. Die einzigen anderen Personen, die Ferbin sah, waren zwei Ritter an der Tür, ihre Gewehre bereit. Durch den schmalen Spalt sah Ferbin nicht weiter als bis zur Brust des hochgewachsenen Mannes auf der rechten Seite, doch das Gesicht des anderen konnte er erkennen, und es war ihm vertraut. Der Bursche hieß Bower, Brower oder so.
Er sollte sich zu erkennen geben, dachte Ferbin. Er sollte die anderen auf seine Präsenz hinweisen. Vielleicht wurde er bald König. Es wäre falsch und absurd gewesen, weiterhin im Verborgenen zu bleiben.
Er beschloss, nur noch einen Moment länger zu warten. Er empfand es wie einen Instinkt, und sein Instinkt war dagegen gewesen, auf den Höhenzug zu reiten.
Sein Vater öffnete die Augen, verzog schmerzerfüllt das Gesicht und tastete mit dem einen Arm nach der verletzten Seite. Der Arzt sah seinen Assistenten an, der daraufhin die Hand des Königs ergriff, vielleicht um ihn zu trösten. Aber bestimmt wollte er auch verhindern, dass Ferbins Vater die Wunde berührte. Der Doktor trat mit Schere und Zange zu seinem Helfer, schnitt durch Stoff und zog Rüstungsteile beiseite.
»Mertis«, brachte der König mühsam hervor, ohne auf den Arzt zu achten. Er streckte die freie Hand aus. Seine Stimme, normalerweise streng und stark, klang so schwach wie die eines Kinds.
»Hier«, sagte tyl Loesp, ging zum König und nahm seine Hand.
»Haben wir den Sieg errungen, Mertis?«
Der andere Mann sah zu den übrigen Anwesenden. »Ja, wir haben gesiegt, Herr«, erwiderte er. »Die Schlacht ist gewonnen. Die Deldeyn haben kapituliert, nur unter der Bedingung, dass das Massaker aufhört und sie ehrenhaft behandelt werden. Bisher sind wir damit einverstanden gewesen. Die Neunte und all das, was sie enthält, liegt offen vor uns.«
Der König lächelte, und Ferbin fühlte Erleichterung. Es schien alles gut gegangen zu sein. Er sollte sich jetzt besser zeigen und holte tief Luft, um zu den Männern unten zu sprechen.
»Und Ferbin?«, fragte der König. Ferbin erstarrte. Was war mit ihm?
»Tot«, sagte tyl Loesp. Ferbin fand, dass es den Worten an Gram und Anteilnahme mangelte. Jemand mit weniger Nachsicht als er hätte vielleicht so etwas wie Genugtuung darin gehört.
»Tot?«, jammerte der König, und Ferbin fühlte, wie seine eigenen Augen feucht wurden. Er musste seinen leidenden Vater jetzt wissen lassen, dass der zweitälteste Sohn noch lebte, ob er nach Scheiße roch oder nicht.
»Ja«, sagte tyl Loesp und beugte sich über den König. »Der eitle und dumme verzogene Mistkerl wurde kurz nach Mittag auf dem Cherien-Kamm von einem Artilleriegeschoss zerfetzt. Ein großer Verlust für seine Schneider, Juweliere und Gläubiger, nehme ich an. Was wichtigere Leute betrifft …«
Der König ächzte. »Loesp? Was sagst du da …?«
»Wir sind uns hier alle einig, nicht wahr?«, entgegnete tyl Loesp glatt. Er ignorierte den König - den König! - und musterte die anderen Männer nacheinander.
Stimmen brummten zustimmend. »Du nicht, Priester, aber das spielt keine Rolle«, sagte tyl Loesp zu dem heiligen Mann. »Lies ruhig weiter.« Der Priester kam der Aufforderung nach, die Augen noch größer als vorher. Der Assistent des Arztes sah den König an und wandte sich dann wieder an den Doktor, der seinen Blick erwiderte.
»Loesp!«, rief der König, und etwas von seiner alten Autorität kehrte in die Stimme zurück. »Was meinst du mit dieser Unverschämtheit? Und meinem armen Kind gegenüber … Welche Ungeheuerlichkeit …«
»Ach, sei still.« Tyl Loesp legte den Helm auf den Boden, beugte sich noch weiter vor und stützte die in einem Kettenhemd steckenden Ellenbogen auf die gepanzerte Brust des Königs. Es war eine solche Respektlosigkeit, dass Ferbin fast noch schockierter war als von dem zuvor Gehörten. Das Gesicht des Königs wurde zu einer Grimasse, als ihm Loesps Gewicht die Luft aus den Lungen presste. Ferbin glaubte, ein gurgelndes Geräusch zu hören. Unterdessen war der Doktor damit fertig, die Wunde in der Seite freizulegen.
»Ich meine, das feige kleine Arschloch ist tot, du alter Narr«, sagte tyl Loesp und sprach so zu seinem Herrn und Meister, als wäre er nichts weiter als ein Bettler. »Oder er wird es bald sein, wenn er durch irgendein Wunder mit dem Leben davongekommen ist. Ich glaube, den anderen Jungen verschone ich vorerst, in meiner Eigenschaft als Regent. Allerdings wird der arme, stille und gelehrsame kleine Oramen nicht die Thronfolge antreten. Es heißt, er ist an Mathematik interessiert. Ich bin es nicht, abgesehen von dem Teil, der die Flugbahn eines Geschosses betrifft, aber wenn ich seine Chancen berechne, den nächsten Geburtstag und damit die Volljährigkeit zu erreichen … Ich fürchte, sie sind umso geringer, je näher das Ereignis rückt.«
»Was?« Der König schnappte nach Luft und keuchte. »Loesp! Um Himmels willen, hab Mitleid mit …«
»Nein«, sagte tyl Loesp und drückte noch mehr auf die Rüstung. Ein Stöhnen kam von den Lippen des Königs. »Kein Mitleid, mein lieber, dummer alter Krieger. Du hast deinen Teil geleistet und deinen Krieg gewonnen. Das ist Monument und Epitaph genug, und damit geht deine Zeit zu Ende. Nein, kein Mitleid. Ich werde anordnen, alle Gefangenen erbarmungslos zu töten und die Neunte mit aller Härte zu erobern, auf dass Gossen, Flüsse - meinetwegen auch Wasserräder - voller Blut sind. Und das Geschrei, möchte ich meinen, wird grässlich sein. Alles in deinem Namen, tapferer König. Um dich zu rächen. Und auch deine dämlichen Söhne.« Tyl Loesp brachte sein Gesicht ganz nahe an das des Königs heran und rief: »Das Spiel ist aus, alter Sack! Es war immer größer, als du geahnt hast!« Er richtete sich auf, indem er sich von der Brust des Königs abstieß, der daraufhin erneut stöhnte. Tyl Loesp nickte dem Arzt zu. Der Mann schluckte sichtlich, nahm ein medizinisches Instrument und schob es tief in die Wunde des Königs. Ferbins Vater erbebte am ganzen Leib und schrie.
»Ihr Verräter und feigen Mistkerle!«, stieß der König hervor, als der Arzt einen Schritt zurückwich, das Gesicht grau. Blut tropfte von dem Instrument. »Will mir niemand helfen? Verräter, ihr alle! Ihr ermordet euren König!«
Tyl Loesp schüttelte den Kopf, starrte auf den zuckenden König hinab und sah dann den Arzt an. »Sie gehen Ihrem Beruf zu gewissenhaft nach.« Er trat auf die andere Seite des Königs, der schwach nach ihm schlug. Als tyl Loesp an ihm vorbeikam, streckte der Priester die Hand aus und griff nach der Manschette des Adligen. Tyl Loesp blickte ruhig auf die Hand an seinem Unterarm.
»Sir«, sagte der Priester heiser. »Dies ist zu viel, Sir. Es ist … falsch.«
Tyl Loesp sah ihm in die Augen und dann wieder auf die Hand, bis der Priester ihn losließ. »Misch dich nicht in Dinge ein, die dich nichts angehen, Schwätzer«, sagte er. »Kehr zu deinen Worten zurück.«
Der Priester schluckte, senkte den Blick und konzentrierte sich wieder auf sein Buch. Die Lippen bewegten sich, aber diesmal las er völlig lautlos.
Tyl Loesp ging um die auf Böcken ruhende Tür herum, schob den Arzt fort und blieb an der anderen Seite des Königs stehen. Er bückte sich ein wenig und betrachtete die Verletzung. »Eine tödliche Wunde, in der Tat, Herr«, sagte er und schüttelte den Kopf. »Du hättest den Zaubertrank unseres Freundes Hyrlis nehmen sollen. Ich hätte das getan.« Er stieß eine Hand in die Seite des Königs, und der Arm verschwand fast bis zum Ellenbogen in der Wunde. Der König heulte.
»Und hier sind wir beim Herzen der Sache«, sagte tyl Loesp. Er brummte und drehte die Hand in der Brust des Mannes. Der König schrie ein letztes Mal, beugte den Rücken und sackte dann in sich zusammen. Der Körper zuckte noch mehrmals, und Geräusche drangen zwischen den Lippen hervor. Doch sie ergaben keinen Sinn, und nach einigen Sekunden herrschte Stille.
Ferbin starrte durch den Spalt im Boden nach unten. Er fühlte sich erstarrt, wie jemand, der in Eis gefangen war. Keine seiner bisherigen Erfahrungen und Erlebnisse hatten ihn auf dies vorbereitet.
Es knallte plötzlich, und der Priester stürzte wie ein gefällter Baum. Tyl Loesp ließ seine Pistole sinken. Blut tropfte von der Hand, die sie hielt.
Der Arzt räusperte sich und trat von seinem Assistenten fort. »Der Junge ebenfalls«, sagte er zu tyl Loesp und wandte den Blick von seinem Helfer ab. Er schüttelte den Kopf und
Titel der engllischen Originalausgabe: MATTER Deutsche Übersetzung von Andreas Brandhorst
Verlagsgruppe Random House
Deutsche Erstausgabe 12/08 Redaktion: Rainer Michael Rahn
Copyright © 2008 by Iain Banks Copyright © 2008 der deutschen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH
eISBN : 978-3-641-03259-3
www.heyne.dewww.heyne-magische-bestseller.de
Leseprobe
www.randomhouse.de