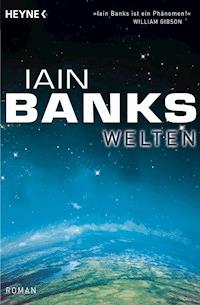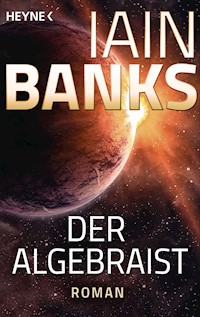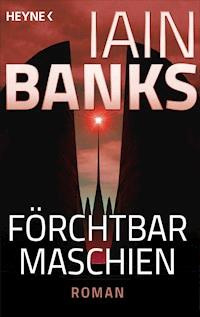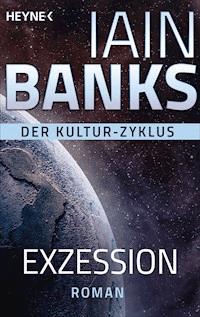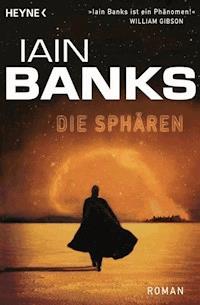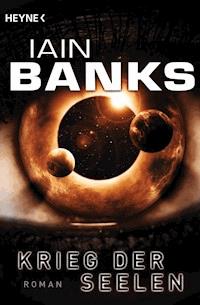5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Alte Feinde
Auf einem fernen Planeten widerstehen die Bewohner seit Jahrhunderten den technischen Errungenschaften der Zivilisation und halten an ihrer uralten Gesellschaftsform fest. Es ist eine archaische, raue Welt, die jedoch zahlreichen „Aussteigern“ aus allen Teilen des Universums – vor allem aus der KULTUR - als Refugium dient. Solange sie sich ruhig verhalten, werden sie von den Einheimischen geduldet – doch wehe, sie mischen sich in die politischen Geschicke dieser Welt ein …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 675
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
IAIN BANKS
INVERSIONEN
Roman
Das Buch
Auf einem fernen Planeten widerstehen die Bewohner seit Jahrhunderten den technischen Errungenschaften der Zivilisation und halten an ihrer uralten Gesellschaftsform fest. Es ist eine archaische, raue Welt, die jedoch zahlreichen „Aussteigern“ aus allen Teilen des Universums – vor allem aus der KULTUR - als Refugium dient. Solange sie sich ruhig verhalten, werden sie von den Einheimischen geduldet – doch wehe, sie mischen sich in die politischen Geschicke dieser Welt ein …
Der Autor
Titel der Originalausgabe
INVERSIONS
Aus dem Englischen von Irene Bonhorst
Überarbeitete Neuausgabe
Copyright © 1998 by Iain M. Banks
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Eine Bemerkung zum Text
Dieser aus zwei Teilen bestehende Text wurde unter den Papieren meines verstorbenen Großvaters entdeckt. Ein Teil enthält die Geschichte des Leibwächters des damaligen Protektors von Tassasen, eines gewissen UrLeyn, und der Erzähler – so wird jedenfalls angenommen – ist eine Person, die zu jener Zeit an dessen Hof gelebt hat, während die andere Geschichte, von meinem Großvater erzählt, von einer Frau namens Vosill handelt, einer Königlichen Leibärztin während der Herrschaft Königs Quience; sie stammte möglicherweise vom fernen Archipel Drezen – oder auch nicht; unbestritten ist jedoch ihre Herkunft aus einem anderen Kulturkreis. Wie mein hochgeschätzter Großvater habe ich mich der Aufgabe gewidmet, den Text, den ich geerbt habe, verständlicher und klarer zu gestalten, und ich hoffe, dass ich dieses Ziel erreicht habe. Dennoch geschieht es im Geiste äußerster Bescheidenheit, dass ich ihn der Gesellschaft darbiete, welche auch immer reif dafür sein mag, ihn zu lesen.
O. DERLAN-HASPID III., Dr. med.
Verdienstorden Erster Klasse;
Prolog
Es gibt nur eine einzige Sünde, und das ist die Selbstsucht. So sagte die treffliche Ärztin. Als sie diese Meinung zum ersten Mal äußerte, war ich jung genug, um anfangs verdutzt und dann beeindruckt von etwas zu sein, von dem ich annahm, es sei ihr tiefsinniger Verstand.
Erst später, in mittleren Jahren, als sie längst nicht mehr unter uns weilte, keimte in mir der Verdacht, dass das Gegenteil gleichermaßen stimmen könnte. Man kann durchaus die Meinung vertreten, dass Selbstsucht in gewisser Weise die einzige wahre Tugend ist und dass deshalb – da sich Gegensätze ihrer Natur nach gegenseitig ausschließen –, Selbstsucht letztendlich wertneutral ist und außerhalb jedes stützenden Moralzusammenhangs steht. In noch späteren Jahren – in der Zeit meiner Reife, wenn man so will, oder im Alter, falls man es lieber so möchte – begann ich mit einigem Zögern, die Ansicht der Ärztin wieder mehr zu achten, und stimmte mit ihr zumindest darin überein, dass Selbstsucht die Wurzel des meisten, wenn nicht gar allen Übels ist.
Natürlich wusste ich immer, was sie meinte. Dass wir nämlich, wenn wir unsere eigenen Interessen über die anderer stellen, sehr wahrscheinlich unrecht handeln und dass Schuld einheitlich ist, ob das Verbrechen nun darin besteht, dass ein Kind aus dem Geldbeutel der Mutter einige Münzen stiehlt oder dass ein Herrscher einen Völkermord befiehlt. Bei beiden Handlungen, und bei allen dazwischen rangierenden, sagen wir: unser eigenes Wohl liegt uns mehr am Herzen als der Kummer oder die Qualen, die wir dem oder den anderen durch unser Verhalten zufügen. Mit anderen Worten, unser eigenes Wohl gilt uns mehr als das Leiden anderer.
Meine Einwände in den mittleren Jahren lauteten, dass wir, wenn wir nach den eigenen Wünschen handeln, wenn wir versuchen, uns jedes Vergnügen zu bereiten, einfach nur weil es angenehm ist, in der Lage sind, Wohlstand, Zufriedenheit, Glück und das, was die Ärztin in ihrer typischen unbestimmten, verallgemeinernden Weise ›Fortschritt‹ genannt hätte, zu schaffen.
Allmählich gestand ich mir jedoch ein, obwohl meine Vorbehalte richtig gewesen sein könnten, dass es eine unzulässige Vergröberung wäre, die Überzeugung der Ärztin einfach völlig vom Tisch zu fegen, und dass Selbstsucht, auch wenn sie manchmal eine Tugend sein mag, ihrem Wesen nach häufiger eine Sünde oder die unmittelbare Ursache für eine Sünde ist.
Wir betrachten uns selbst nur ungern als Missetäter, allenfalls als Missverstandene. Der Gedanke, dass wir sündigen, gefällt uns nicht, lieber stellen wir es so dar, dass wir schwierige Entscheidungen zu fällen haben und danach handeln. Vorsehung ist der Name des mystischen, göttlich unmenschlichen Gerichts, von dem wir unsere Handlungen beurteilt sehen möchten und von dem wir hoffen, dass es in der Einschätzung sowohl unseres eigenen Wertes als auch unserer Schuldhaftigkeit oder unseres Verhaltens insgesamt mit uns übereinstimmt.
Ich vermute, die treffliche Ärztin (wie man sieht, beurteile auch ich sie, indem ich sie so nenne) glaubte nicht an die Vorsehung. Ich war mir nie ganz sicher, woran sie eigentlich glaubte, obwohl ich stets davon überzeugt war, dass sie an irgendetwas glaubte. Vielleicht glaubte sie, trotz alledem, was sie über die Selbstsucht sagte, an sich selbst und an sonst gar nichts. Vielleicht glaubte sie an diesen Fortschritt, von dem sie sprach, oder vielleicht glaubte sie, die Fremde, auf eine seltsame Weise an uns, an die Leute, unter denen sie lebte und die sie mochte, in einem Maße, in dem wir selbst nicht an uns glaubten.
Ging es uns besser, als sie von uns ging, oder nicht? Ich denke, es ging uns unleugbar besser. Beruhte ihr Tun auf Selbstsucht oder Selbstlosigkeit? Ich meine, letzten Endes ist das vollkommen gleichgültig, außer dass es vielleicht ihren eigenen Seelenfrieden beeinflusst haben könnte. Noch etwas brachte sie mir bei: Dass man das ist, was man tut. Für die Vorsehung – oder den Fortschritt oder die Zukunft oder vor jedem anderen, wie auch immer gearteten Gericht neben unserem eigenen Gewissen – ist das Ergebnis dessen, was wir getan haben, und nicht das, was wir gedacht haben, entscheidend für das über uns gefällte Urteil.
Also ist das Folgende die gesamte Chronik unserer Taten. Für einen Teil meiner Erzählung kann ich mich persönlich verbürgen, weil ich selbst dabei war. Was den anderen Teil betrifft, vermag ich für seinen Wahrheitsgehalt nicht geradezustehen. Ich bin rein zufällig auf die ursprüngliche Version gestoßen, und obwohl ich glaube, dass sie einen interessanten Kontrapunkt zu der Geschichte bildet, von der ich selbst betroffen war, sehe ich darin eher einen künstlerischen Schnörkel und nicht so sehr eine bewertende Darstellung, die auf eingehendem Recherchieren und Nachdenken beruht. Dennoch glaube ich, dass die beiden Erzählungen zusammengehören und gemeinsam mehr Gewicht haben als jede einzeln. Es war, und daran kann meiner Meinung nach kein Zweifel bestehen, eine tiefgreifende Zeit. Geografisch war das Kreuz gespalten, aber das traf schließlich damals für vieles zu. Spaltung war die einzige bestehende Ordnung.
Ich habe versucht, die Dinge, über die ich hier geschrieben habe, nicht zu beurteilen, muss allerdings gestehen, dass ich hoffe, der Leser – vielleicht als eine Art Teilvorsehung – wird genau das tun und nicht schlecht von uns denken. Ich bekenne freimütig, dass ein wesentlicher Teil meiner Beweggründe (vor allem durch Verbesserung und Ergänzung meiner früheren eigenen Chronik als auch durch die Verfeinerung der Sprache und Grammatik meines Miterzählers) der Versuch ist sicherzustellen, dass der Leser nicht schlecht von mir denkt, und natürlich ist das ein selbstsüchtiges Bestreben. Dennoch hoffe ich, dass eine solche Selbstsucht zum Guten führen kann, aus dem einfachen Grund, weil es sonst diese Chronik gar nicht geben würde.
Wiederum muss der Leser entscheiden, ob das die glücklichere Wendung gewesen wäre, oder nicht.
1. KapitelDie Ärztin
Meister, es war am Abend des dritten Tages der südlichen Pflanzzeit, als der Gehilfe des Verhörleiters zur Ärztin kam und sie in eine verborgene Kammer holte, wo der Foltermeister wartete.
Ich saß im Wohnzimmer der Räume der Ärztin und war mit einem Stößel und einem Mörser beschäftigt, um einige Zutaten für eines der Medikamente der Ärztin zu zerreiben. Auf diese Arbeit konzentriert, brauchte ich einen Augenblick, um meine Sinne wieder voll und ganz zu sammeln, als ich das laute und aggressive Klopfen an der Tür hörte, und auf dem Weg zur Tür warf ich eine kleine Weihrauchschale um. Das war der Grund sowohl für die Verzögerung beim Öffnen der Tür als auch für irgendwelche Flüche, die Unoure, der Gehilfe des Verhörleiters, gehört haben mag. Diese Schimpfworte waren nicht an ihn gerichtet, ebensowenig wie ich verschlafen oder auch nur im entferntesten erschöpft war, wie meiner Vermutung nach mein guter Meister glauben mag, gleichgültig was dieser Unoure – ein wankelmütiger und unzuverlässiger Kerl, nach allem, was man über ihn hört – behaupten mag.
Die Ärztin war in ihrem Arbeitszimmer, wie meist um diese Zeit am Abend. Ich betrat die Werkstatt der Ärztin, wo ihre beiden großen Wandschränke stehen, in denen sie ihre Pulver, Pasten, Salben, Trünke und verschiedene Instrumente aufbewahrt, die zu ihrem Beruf gehören, wie auch zwei Tische mit einer Vielfalt von Brennern, Stövchen, Glaskolben und Fläschchen. Gelegentlich behandelt sie hier auch Patienten, dann wird der Raum zu ihrem Operationssaal. Während der unangenehm riechende Unoure im Wohnzimmer wartete, sich die Nase am schmierigen Ärmel abwischte und sich mit dem Blick eines Menschen umsah, der seine Auswahl an stehlenswerten Gegenständen traf, ging ich durch die Werkstatt und klopfte an die Tür zu ihrem Arbeitszimmer, das ihr auch als Schlafzimmer diente.
»Oelph?«, fragte die Ärztin.
»Ja, Herrin.«
»Tritt ein!«
Ich hörte das Klatschen, als ein schweres Buch zugeschlagen wurde, und lächelte vor mich hin.
Das Arbeitszimmer der Ärztin war dunkel und roch nach der süßen Istra-Blüte, deren Blätter sie für gewöhnlich in hochhängenden Weihrauchwannen verbrannte. Ich ertastete mir den Weg durch die Düsternis. Natürlich kenne ich die Einrichtung des Arbeitszimmers der Ärztin wie meine Westentasche – besser als sie vielleicht annimmt, dank der weisen Voraussicht und umsichtigen Schlauheit meines Meisters –, doch die Ärztin war berüchtigt dafür, Stühle, Hocker und Regalleitern im Weg herumstehen zu lassen, und deshalb musste ich meinen Weg durch den Raum ertasten, bis zu der Stelle, wo eine kleine Kerze auf ihre Anwesenheit hindeutete; sie saß vor einem Fenster mit schweren Vorhängen an ihrem Schreibtisch. Sie saß aufrecht auf ihrem Stuhl, drückte den Rücken durch und rieb sich die Augen. Der handdicke, unterarmbreite und -hohe Klotz, der ihr Tagebuch war, lag vor ihr auf dem Schreibtisch. Das große Buch war zugeschlagen und verschlossen, doch selbst in dieser höhlenartigen Dunkelheit bemerkte ich, dass die kleine Kette an der Verschlussspange hin und her schaukelte. Ein Federhalter stand im Tintenfass, dessen Deckel offen war. Die Ärztin gähnte und zupfte die feine Kette, die den Schlüssel für das Tagebuch enthielt, an ihrem Hals zurecht.
Mein Meister kennt aus meinen vielen vorherigen Berichten meine Annahme, dass die Ärztin möglicherweise eine Niederschrift ihrer Erfahrungen hier in Haspide für das Volk in ihrer Heimat in Drezen verfasst.
Der Ärztin liegt offenbar viel daran, ihre Aufzeichnungen geheim zu halten. Manchmal jedoch vergisst sie, dass ich im Zimmer bin, im Allgemeinen dann, wenn sie mich mit der Aufgabe betraut hat, irgendeinen Hinweis in einem der Bücher ihrer mit den ausgefallensten Bänden bestückten Bibliothek herauszusuchen und ich mich dieser Arbeit eine Zeitlang schweigend gewidmet habe. Aufgrund des wenigen von ihrem Geschriebenen, auf das ich bei solchen Gelegenheiten einen Blick habe erhaschen können, kam ich zu dem Schluss, dass sie sich beim Schreiben in ihr Tagebuch nicht immer des Haspidianischen oder Imperialischen bedient – obwohl es Kapitel in beiden Sprachen gibt –, sondern manchmal ein Alphabet benutzt, das ich noch nie zuvor gesehen habe.
Soweit ich weiß, hat mein Meister erwogen, mit anderen aus Drezen stammenden Leuten Verbindung aufzunehmen, um herauszufinden, ob die Ärztin in solchen Fällen auf drezenisch schreibt oder nicht, und zu diesem Zweck versuche ich, meinem Gedächtnis soviel wie möglich von den wichtigen Tagebucheintragungen der Ärztin einzuprägen, wann immer ich kann. Bei dieser Gelegenheit gelang es mir jedoch nicht, einen Blick auf die Seiten zu werfen, an denen sie zweifellos gearbeitet hatte.
Es ist immer noch mein Wunsch, meinem Meister in dieser Hinsicht besser zu dienen, und ich möchte wieder einmal mit aller Hochachtung darauf hinweisen, dass eine vorübergehende Entwendung ihres Tagebuchs einem geschickten Schlosser erlauben würde, das Schloss zu öffnen, ohne es zu beschädigen, damit eine genaue Abschrift ihre Eintragungen angefertigt und die Angelegenheit auf diese Weise erledigt werden könnte. Das könnte leicht geschehen, während sich die Ärztin in irgendeinem anderen Teil des Palastes aufhält, oder vielleicht noch besser an irgendeinem anderen Ort in der Stadt, oder auch wenn sie eines ihrer häufigen Bäder nimmt, die sie lange auszudehnen pflegt (es war während eines ihrer Bäder, dass ich eines der Skalpelle der Ärztin – das inzwischen übergeben wurde – für meinen Meister aus ihrer Medizintasche besorgte). Ich möchte hinzufügen, dass ich darauf bedacht war, dieses sofort nach einem Besuch im Armenhospital zu tun, damit jemand dort verdächtigt würde. Doch ich verneige mich diesbezüglich natürlich vor dem überlegenen Urteil meines Meisters.
Die Ärztin betrachtete mich stirnrunzelnd. »Du zitterst ja«, sagte sie. Und das stimmte tatsächlich, denn das plötzliche Auftauchen des Gehilfen des Foltermeisters hatte mich aufgewühlt, was ich keineswegs leugnen möchte. Die Ärztin sah an mir vorbei zur Tür zum Operationssaal, die ich offen gelassen hatte, damit Unoure unsere Stimmen hören konnte und sich dadurch vielleicht von irgendeiner Untat, die er vielleicht im Schilde führte, abhalten lassen würde. »Wer ist das?«, fragte sie.
»Wer ist wer?«, fragte ich und beobachtete sie, wie sie den Deckel des Tintenfasses schloss.
»Ich habe jemanden husten hören.«
»Oh, das ist Unoure, der Gehilfe des Verhörleiters. Er ist gekommen, um Euch zu holen.«
»Wohin?«
»Zur Geheimen Kammer. Meister Nolieti hat nach Euch schicken lassen.«
Sie sah mich einen Augenblick lang schweigend an. »Der Foltermeister«, sagte sie ausdruckslos und nickte. »Stecke ich in Schwierigkeiten, Oelph?«, fragte sie und legte einen Arm über den dicken Lederdeckel ihres Tagebuchs, als ob sie danach trachtete, Schutz zu bieten oder zu suchen.
»O nein«, antwortete ich. »Ihr sollt Eure Tasche mitbringen. Und Medikamente.« Ich warf einen Blick zur Tür des Operationssaals, durch die das Licht aus dem Wohnzimmer fiel. Ein Husten ertönte aus dieser Richtung, ein Husten, das sich wie die Art Husten anhörte, die man von sich gibt, wenn man jemanden daran erinnern möchte, dass man voller Ungeduld wartet. »Ich nehme an, es ist dringend«, flüsterte ich.
»Hmm. Glaubst du, der Foltermeister Nolieti leidet unter einer Erkältung?«, fragte die Ärztin, während sie sich von ihrem Stuhl erhob und ihre lange Jacke anzog, die über der Rückenlehne gehangen hatte.
Ich half ihr in die schwarze Jacke. »Nein, Herrin, ich glaube, wahrscheinlich wird jemand einem Verhör unterzogen, der … ähm … dem nicht wohl ist.«
»Ich verstehe«, sagte sie, schlupfte mit den Füßen in die Stiefel und richtete sich wieder auf. Wieder einmal überwältigte mich die körperliche Ausstrahlung der Ärztin, wie so oft. Sie ist groß für eine Frau, wenn auch nicht übermäßig groß, und obwohl sie für eine Frau breite Schultern hat, habe ich Weiber auf dem Fischmarkt und an Fangnetzen gesehen, die kräftiger wirkten. Nein, das, was an ihr vor allem einzigartig erscheint, ist meiner Ansicht nach ihre Haltung, die Art, wie sie auftritt.
Mir waren schon mehrmals quälend verlockende Halbansichten von ihr vergönnt gewesen – nach einem ihrer vielen Bäder – in einem dünnen Hemd, von hinten vom Licht beschienen, in einem Wirbel gepuderter, parfümierter Luft von einem Zimmer ins andere schreitend, die Arme erhoben, um ein Handtuch um ihr langes, feuchtes rotes Haar zu schlingen, und ich habe sie bei großen höfischen Ereignissen beobachtet, bekleidet mit offiziellen Gewändern und so leicht und anmutig – und mit einem ebenso gezierten Gesichtsausdruck – wie eine der teuer ausgebildeten Debütantinnen der Saison tanzend, und ich bekenne freimütig, dass ich mich genau wie jeder andere Mann (jugendlich oder nicht) im körperlichen Sinn von einer Frau von ihrer Gesundheit und ihrem allgemein guten Aussehen angezogen fühlte. Dennoch ist etwas an ihrem Benehmen, das ich – und ich vermute, die meisten anderen Männer ebenfalls – abstoßend finde und vielleicht sogar ein wenig beängstigend. Vielleicht ist der Grund dafür eine gewisse unbescheidene Direktheit in ihrem Verhalten, und dazu kommt der Verdacht, dass sie, während sie sich mit untadeligen Lippenbekenntnissen zu jenen Tatsachen des Leben äußert, die die unbestrittene und offenkundige Überlegenheit des Mannes bestimmen, dies mit einer Art unangebrachtem Humor tut, der bei uns Männern das beunruhigende gegenteilige Gefühl hervorruft – dass sie uns nämlich auf den Arm nimmt.
Die Ärztin beugte sich über den Schreibtisch und öffnete die Fensterläden, um den abendlichen Glanz des Seigen hereinzulassen. In der schwachen Lichtflut, die durch die Fenster hereinströmte, bemerkte ich einen kleinen Teller mit Gebäck und Käse am Rand des Schreibtischs der Ärztin, auf der dem Tagebuch gegenüberliegenden Seite. Ihr alter, schartiger Dolch lag ebenfalls auf dem Teller, die stumpfen Schneiden mit Fett verschmiert.
Sie nahm das Messer auf, leckte an der Klinge und, nachdem sie mit den Lippen geschmatzt und ihm dabei eine letzte Reibung an ihrem Taschentuch verpasst hatte, schob sie den Dolch in den Schaft ihres rechten Stiefels. »Komm«, sagte sie, »man darf den Foltermeister nicht warten lassen.«
»Ist das wirklich nötig?«, fragte die Ärztin und betrachtete die Augenbinde, die der Gehilfe des Verhörleiters, Unoure, in den schmutzigen Händen hielt. Er trug eine lange Metzgerschürze aus blutgeflecktem Leder über seinem dreckigen Hemd und einer weiten, fettig aussehenden Hose. Die Augenbinde war aus einer langen Tasche in der Lederschürze zum Vorschein gekommen.
Unoure grinste, wobei er eine Mischung aus kranken, verfärbten Zähnen und dunklen Lücken, wo Zähne hätten sein sollen, entblößte. Die Ärztin zuckte zusammen. Ihre Zähne sind so gleichmäßig, dass ich beim ersten Mal, als ich sie sah, selbstverständlich annahm, dass es sich um ein besonders fein gearbeitetes falsches Gebiss handelte.
»Vorschrift«, sagte Unoure, und sein Blick ruhte auf der Brust der Ärztin. Sie zog sich die lange Jacke enger ums Hemd. »Ihr seid eine Fremde«, erklärte er.
Die Ärztin seufzte und warf mir einen Blick zu.
»Eine Fremde«, sagte ich eindringlich zu Unoure, »in deren Händen beinahe täglich das Leben des Königs liegt.«
»Und wenn schon«, sagte der Kerl und zuckte die Achseln. Er schniefte und machte Anstalten, sich die Nase mit der Augenbinde zu putzen, doch dann, als er den Ausdruck im Gesicht der Ärztin sah, nahm er davon Abstand und benutzte stattdessen wieder seinen Ärmel. »So lauten die Vorschriften. Wir müssen uns beeilen«, sagte er und sah zur Tür.
Wir befanden uns am Eingang zu den unteren Stockwerken des Palastes. Der Korridor hinter uns ging von dem wenig benutzten Gang jenseits der Küche und des Weinkellers im Westflügel ab. Es war ziemlich dunkel. Ein schmaler runder Lichtschacht über uns warf einen staubigen Schein schiefergrauen Lichts auf uns und die hohen, verrosteten Metalltüren, während weiter unten im Korridor ein paar Kerzen schwach brannten.
»Also gut«, sagte die Ärztin. Sie beugte sich ein wenig nach vorn und prüfte mit großem Aufhebens die Augenbinde in Unoures Hand. »Aber ich werde dieses Ding nicht tragen, und du wirst es mir nicht umbinden.« Sie wandte sich zu mir um und zog ein frisches Taschentuch aus ihrer Jackentasche. »Hier«, sagte sie.
»Aber …«, wandte Unoure ein und machte einen Satz, als irgendwo hinter den gescheckten braunen Türflügeln eine Glocke ertönte. Er wandte sich ab und stopfte sich fluchend die Augenbinde in die Schürzentasche.
Ich band der Ärztin das wohlriechende Taschentuch vor die Augen, während Unoure die Tür aufschloss. Ich trug mit einer Hand die Tasche der Ärztin, und mit der anderen führte ich sie in den Gang hinter der Tür, die vielen gewundenen Stufen hinunter und durch weitere Türen und Gänge zur Geheimen Kammer, wo Meister Nolieti wartete. Als wir die halbe Strecke dorthin zurückgelegt hatten, ertönte erneut die Glocke irgendwo vor uns, und ich merkte, wie die Ärztin zusammenzuckte und ihre Hand feucht wurde. Ich gebe zu, dass auch meine Nerven nicht ganz unbeeinflusst waren.
Wir betraten die verborgene Kammer durch eine niedrige Öffnung, die wir alle gebückt durchschreiten mussten. (Ich legte die Hand auf den Kopf der Ärztin, um sie sanft hinunterzudrücken. Ihr Haar fühlte sich seidig und glatt an.) Der Raum roch nach etwas Scharfem, Ungesundem und nach verbranntem Fleisch. Ich hatte das Gefühl, keine Herrschaft über meinen Atem mehr zu haben; die Gerüche erzwangen sich einen Weg in meine Nasenlöcher und in meine Lungenflügel.
Der hohe, weite Raum war von einer bunten Sammlung alter Öllampen beleuchtet, die einen krankhaft blauen Schimmer auf eine Vielfalt von Bottichen, Wannen, Tischen und anderen Behältnissen – einige von menschlicher Form – und Instrumenten warfen, von denen ich kein einziges unbedingt näher zu untersuchen begehrte, obwohl sie alle meine weitaufgerissenen Augen auf sich zogen, so wie die Sonnen die Blumen anzogen. Zusätzliches Licht kam von einem großen Kohlebecken, das unter einem hängenden zylindrischen Kamin stand. Neben dem Kohlebecken war ein aus Metallbändern gefertigtes Gebilde, das einem Stuhl glich und das einen blassen, dünnen, nackten, anscheinend bewusstlosen Mann vollkommen umschloss. Der gesamte Rahmen dieses Stuhls war mittels Drehzapfen an einem äußeren Hängegerüst befestigt, so dass es aussah, als schwebe der Mann in der Stellung eines Vorwärtspurzelbaumes, mitten in der Luft auf den Knien verharrend, den Rücken parallel zu den Stäben eines breiten Lichtschachtgitters über ihm ausgerichtet.
Der Foltermeister Nolieti stand zwischen dieser Gerätschaft und einer breiten Werkbank, die mit verschiedenen Metallschüsseln, Gläsern und Flaschen sowie einer Sammlung von Instrumenten bedeckt war, die ihren Ursprung in der Werkstatt eines Maurers, eines Zimmermannes, eines Metzgers und eines Chirurgen hätten haben können. Nolieti schüttelte den massigen grauen Kopf mit dem narbigen Gesicht. Die rauen, sehnigen Hände hatte er in die Hüften gestemmt, und sein Blick haftete auf der verdorrten Gestalt des Mannes im Käfig. Unter dem Metallgestell, das den unglücklichen Kerl umschloss, stand eine große quadratische Steinwanne mit einem Abflussloch in einer Ecke. Dunkle Flüssigkeit, die wie Blut aussah, war dort hineingeplatscht. Längliche weiße Stücke, die in der Dunkelheit nicht genau zu erkennen waren, hätten Zähne sein können.
Nolieti wandte sich um, als er unser Herannahen hörte. »Verdammt höchste Zeit«, fauchte er, und sein starrer Blick fiel zuerst auf mich, dann auf die Ärztin und dann auf Unoure (der, wie mir auffiel, während die Ärztin ihr Taschentuch wieder einsteckte, mit großem Aufhebens die Augenbinde zusammenfaltete, die er, seinen Anweisungen gemäß, bei ihr hätte benutzen sollen).
»Meine Schuld«, sagte die Ärztin mit einem Unterton, der besagte: ›kann man nichts machen‹, während sie an Nolieti vorbeiging. Sie beugte sich über das Hinterteil des Mannes. Sie verzog das Gesicht, rümpfte die Nase und stellte sich dann neben die Gerätschaft, legte eine Hand an die Eisenbänder des stuhlartigen Gestells und drehte dieses unter widerwilligem Quietschen um, bis der Mann sich in einer herkömmlichen Sitzstellung befand. Dem Anschein nach war der Kerl in einem schrecklichen Zustand. Sein Gesicht war grau, die Haut an einigen Stellen verbrannt, sein Mund eingesackt und sein Kiefer offenbar gebrochen. Kleine Blutrinnsale waren jeweils unter beiden Ohren angetrocknet. Die Ärztin streckte die Hände zwischen den Eisenbändern hindurch und versuchte, eines der Augen des Mannes zu öffnen. Er gab ein entsetzliches tiefes Stöhnen von sich. Man hörte eine Art Saugen, Reißen, und der Mann stieß ein jämmerliches Ächzen aus, das wie ein ferner Schrei klang, bevor es in ein abgehacktes, rhythmisches Blubbern überging, das vielleicht Atmen war. Die Ärztin beugte sich vor, um dem Mann ins Gesicht zu sehen, und ich hörte, wie sie leise um Luft rang.
Nolieti schnaubte. »Sucht Ihr das?«, fragte er die Ärztin und hielt ihr eine kleine Schale hin.
Die Ärztin sah die Schale kaum an, lächelte den Foltermeister jedoch dünn an. Sie drehte den Eisenstuhl in seine vorherige Lage und machte sich wieder daran, das Hinterteil des Mannes im Käfig zu betrachten. Sie zog einige blutgetränkten Lumpen weg und verzog wieder das Gesicht. Ich dankte Gott, dass er von mir abgewandt war, und betete, dass das, was immer die Ärztin zu tun beabsichtigte, nicht meine Mithilfe erforderte.
»Wo soll das Problem liegen?«, fragte die Ärztin Nolieti, der für einen Augenblick aus der Fassung geraten zu sein schien.
»Na ja«, sagte der Foltermeister nach einer Pause. »Er hört einfach nicht auf, aus dem Arsch zu bluten, oder?«
Die Ärztin nickte. »Anscheinend habt Ihr die Schürhaken zu kalt werden lassen«, sagte sie scheinbar ungerührt, kauerte sich nieder, öffnete ihre Tasche und stellte sie neben die Abflussmulde aus Stein.
Nolieti stellte sich neben die Ärztin und beugte sich über sie. »Wie das passiert ist, geht Euch, verdammt noch mal, nichts an, Frau«, raunte er ihr ins Ohr. »Ihr sollt diesen Scheißer wieder soweit herstellen, dass er verhört werden und uns verraten kann, was der König wissen will.«
»Weiß der König davon?«, fragte die Ärztin, und als sie aufblickte, war ein Ausdruck unschuldigen Interesses in ihrem Gesicht. »Hat er das hier angeordnet? Weiß er überhaupt etwas von der Existenz dieses Unseligen? Oder war es Wachkommandant Adlain, der meinte, das Königreich könnte zu Schaden kommen, wenn dieser arme Teufel nicht leiden würde?«
Nolieti richtete sich auf. »All das geht Euch nichts an«, sagte er mürrisch. »Macht Eure Arbeit, und verschwindet.« Er beugte sich wieder zu ihr hinab und brachte seinen Mund an ihr Ohr. »Und macht Euch keine Gedanken um den König und den Wachkommandanten. Hier bin ich der König, und ich sage Euch, Ihr tut gut daran, Euch um Eure Arbeit zu kümmern und es mir zu überlassen, mich um meine zu kümmern.«
»Aber das betrifft meine Arbeit«, entgegnete die Ärztin gleichmütig, ohne den bedrohlichen Rumpf des Mannes über sich zu beachten. »Wenn ich weiß, was ihm angetan wurde und wie das gemacht wurde, bin ich vielleicht eher in der Lage, ihn zu behandeln.«
»Oh, ich könnte es Euch zeigen, Doktor«, sagte der Foltermeister, wobei er augenzwinkernd zu seinem Gehilfen aufblickte. »Und wir haben besonders nette Behandlungsmethoden, die wir ausschließlich den Damen vorbehalten, nicht war, Unoure?«
»Nun, wir haben keine Zeit zu flirten«, sagte die Ärztin mit einem stählernen Lächeln. »Sagt mir einfach, was Ihr mit diesem armen Schwein gemacht habt.«
Nolietis Augen verengten sich zu Schlitzen. Er stand auf und zog einen Schürhaken, umgeben von einer Funkenwolke, aus dem Kohlebecken. Seine gelb glühende Spitze war breit, wie die Klinge eines kleinen flachen Spaten. »Neuerdings behandeln wir sie damit«, sagte Nolieti lächelnd, und sein Gesicht war von dem sanften gelborangefarbenen Schein erhellt.
Die Ärztin sah den Schürhaken an, dann den Foltermeister. Sie ging in die Hocke und berührte etwas am Hinterteil des Mannes im Käfig.
»Hat er stark geblutet?«, fragte sie.
»Wie ein Mann beim Pissen«, sagte der Foltermeister und zwinkerte wieder seinem Gehilfen zu. Unoure nickte schnell und lachte.
»Dann solltet Ihr das da besser drin lassen«, murmelte die Ärztin. Sie erhob sich. »Ich bin sicher, es ist gut, dass Euch Eure Arbeit soviel Spaß macht, Erster Folterer«, sagte sie. »Allerdings glaube ich, diesen hier habt Ihr getötet.«
»Ihr seid die Ärztin, heilt ihn!«, sagte Nolieti, wobei er wieder zu ihr trat und den orangeroten Schürhaken schwenkte. Ich glaube nicht, dass er die Absicht hatte, der Ärztin zu drohen, aber ich sah, wie sich ihre rechte Hand langsam zu dem Stiefel senkte, in dessen Schaft ihr alter Dolch steckte.
Sie sah zu dem Foltermeister auf, vorbei an der glühenden Metallstange. »Ich verabreiche ihm etwas, das ihn vielleicht wieder zum Leben erweckt, aber es kann gut sein, dass er Euch alles gegeben hat, was er jemals zu geben in der Lage ist. Verübelt es ihm nicht, wenn er stirbt.«
»O doch, das werde ich«, sagte Nolieti ruhig und warf den Schürhaken zurück in das Kohlebecken. Funken flogen auf den Steinboden. »Ihr sorgt dafür, dass er lebt, Frau. Ihr sorgt dafür, dass er reden kann, sonst bekommt der König zu hören, dass Ihr Eure Arbeit nicht ordentlich erledigt habt.«
»Das wird der König ohnehin hören, zweifellos«, sagte die Ärztin und lächelte mich an. Ich lächelte nervös zurück. »Und auch Wachkommandant Adlain«, fügte sie hinzu, »vielleicht von mir selbst.« Sie drehte den Mann in dem Käfigstuhl wieder in eine aufrechte Stellung und öffnete ein Glasfläschchen in ihrer Tasche, strich mit einem Holzspachtel rund um die Innenwand des Fläschchens, öffnete den blutigen Matsch, der der Mund des Mannes war, und bestrich mit dieser Salbe den Ober- und Unterkiefer des Mannes. Er stöhnte erneut.
Die Ärztin stand eine Weile da und beobachtete ihn, dann ging sie zu dem Kohlebecken und hielt den Spachtel hinein. Das Holz flammte auf und zischte. Sie sah auf ihre Hände, dann zu Nolieti. »Habt Ihr hier unten Wasser? Ich meine sauberes Wasser.«
Der Foltermeister nickte Unoure zu, der für ein paar Augenblicke im Dunkeln verschwand, bevor er eine Schale brachte, in der die Ärztin sich die Hände wusch. Sie wischte sie sich an dem Taschentuch, das ihr als Augenbinde gedient hatte, sauber, als der Mann in dem Käfigstuhl einen schrecklichen Todesschrei ausstieß, ein paar Sekunden lang heftig zitterte, sich dann plötzlich versteifte und schließlich erschlaffte. Die Ärztin trat zu ihm und wollte ihm die Hand an den Hals legen, doch sie wurde von Nolieti beiseite gestoßen; dieser stieß ebenfalls einen Schrei aus, wütend und gequält, und streckte die Hand durch die Eisenbänder, um den Finger an die Halsschlagader des Mannes zu legen – von der Ärztin hatte ich gelernt, dass dies die beste Stelle ist, um zu prüfen, ob in einem Menschen noch der Lebenspuls vorhanden ist.
Der Foltermeister stand bebend da, während sich im Gesicht seines starrenden Gehilfen Begreifen und Entsetzen spiegelten. Die Miene der Ärztin zeigte grimmig-verächtliche Belustigung. Dann fuhr Nolieti herum und stach mit dem Finger in ihre Richtung. »Ihr wart das!«, zischte er sie an. »Ihr habt ihn getötet! Ihr wolltet nicht, dass er lebt!«
Die Ärztin machte ein gleichgültiges Gesicht und fuhr damit fort, sich die Hände abzutrocknen (obwohl es mir so vorkam, als wären sie beide längst trocken – und als ob sie zitterten). »Mein Eid lautet, Leben zu retten, Foltermeister, nicht zu nehmen«, sagte sie kühl. »Das überlasse ich anderen.«
»Was war in dem Zeug drin?«, wollte der Foltermeister wissen, wobei er sich schnell niederkauerte und die Tasche der Ärztin öffnete. Er zog das Fläschchen heraus, dem sie die Salbe entnommen hatte, und hielt es ihr vors Gesicht. »Das hier? Was ist das?«
»Ein Stimulans«, sagte sie und tauchte einen Finger in das Fläschchen, um eine dünne Schicht des weichen braunen Gels auf ihrer Fingerspitze zu präsentieren, die im Licht des Kohlebeckens glitzerte. »Möchtet Ihr es probieren?« Ihr Finger näherte sich Nolietis Mund.
Der Foltermeister packte ihre Hand und drückte den Finger gewaltsam zurück, zu ihren Lippen hin. »Nein. Macht Ihr das! Macht das, was Ihr mit ihm gemacht habt.«
Die Ärztin befreite ihre Hand aus Nolietis Griff und führte ruhig den Finger zu ihrem Mund, wo sie die braune Paste auf ihrem oberen Gaumen verteilte. »Es schmeckt bitter-süß«, sagte sie in demselben Tonfall, den sie gebrauchte, wenn sie mir etwas beibrachte. »Die Wirkung hält zwei bis drei Stunden lang an, und im Allgemeinen gibt es keine Nebenwirkung, obwohl bei einem sehr geschwächten und unter Schock stehenden Körper Anfälle möglich sind und der Tod eine entfernte Möglichkeit ist.« Sie leckte sich den Finger ab. »Besonders Kinder leiden unter ernsten Nebenwirkungen und bleibenden Schäden, und für sie ist die Anwendung unter keinen Umständen ratsam. Das Gel wird aus den Beeren einer zweijährigen Pflanze hergestellt, die auf abgeschiedenen Halbinseln im Inselgebiet weit nördlich von Drezen wächst. Es ist sehr wertvoll und wird meistens als Lösung angewandt, in welcher Form es ebenfalls sehr zuverlässig und langanhaltend wirkt. Ich habe es gelegentlich benutzt, um den König zu behandeln, und er hält es für eines meiner wirkungsvollsten Präparate. Ich habe nicht mehr viel davon übrig, und ich hätte es vorgezogen, es nicht für jemanden zu verwenden, der ohnehin sterben würde, oder für mich selbst, aber Ihr habt darauf bestanden. Ich bin sicher, der König wird Verständnis dafür haben.« (Ich muss berichten, Meister, dass meines Wissens die Ärztin dieses besondere Gel – von dem sie mehrere Gläser voll besitzt – niemals beim König angewendet hat, und ich bin mir nicht sicher, ob sie es jemals bei der Behandlung eines anderen Patienten eingesetzt hat.) Die Ärztin schloss den Mund, und ich bemerkte, wie sie sich mit der Zunge über den oberen Gaumen fuhr. Dann lächelte sie. »Seid Ihr sicher, dass Ihr nicht auch etwas probieren möchtet?«
Nolieti sagte eine Zeitlang nichts, und sein breites, dunkles Gesicht bewegte sich, als ob er auf der Zunge herumkaute.
»Bring diese Hexe aus Drezen raus!«, befahl er schließlich Unoure, dann drehte er sich um, um den Tretblasebalg des Kohlebeckens zu betätigen. Das Kohlebecken zischte und glühte gelb und sprühte ein Funkengestöber hinauf in seinen rußigen Kamin. Nolieti betrachtete den Toten in dem Käfigstuhl. »Dann wirf den Kadaver von diesem Dreckschwein ins Säurebad«, raunzte er.
Wir waren bereits an der Tür, als der Foltermeister, der immer noch den Blasebalg mit regelmäßigen kräftigen Tritten bearbeitete, rief: »Doktor?«
Sie wandte sich zu ihm um, während Unoure die Tür öffnete und die schwarze Augenbinde aus seiner Schürze angelte. »Ja, Foltermeister?«, sagte sie.
Er sah zu uns herüber und lächelte, während er weiterhin das Kohlebecken anfeuerte. »Ihr seid nicht zum letzten Mal hier, Frau aus Drezen«, sagte er leise. Seine Augen funkelten im gelben Licht des Kohlebeckens. »Und nächstes Mal werdet Ihr nicht fähig sein, diesen Raum auf eigenen Beinen zu verlassen.«
Die Ärztin hielt seinem Blick geraume Zeit stand, bis sie schließlich die Augen senkte und die Achseln zuckte. »Oder Ihr erscheint in meinem Operationssaal«, erwiderte sie und sah auf. »Und seid meiner besten Aufmerksamkeit versichert.«
Der Foltermeister wandte sich ab und spuckte in das Kohlebecken, sein Fuß stampfte auf den Blasebalg und hauchte diesem Todesinstrument Leben ein, während wir von dem Gehilfen Unoure durch die niedrige Tür hinausgedrängt wurden.
Zweihundert Herzschläge später wurden wir von einem Lakaien der königlichen Gemächer an der großen Eisentür, die in den übrigen Palast führte, abgeholt.
»Es ist wieder mal mein Rücken, Vosill«, sagte der König und drehte sich auf seinem ausladenden Himmelbett auf den Bauch, während die Ärztin zuerst ihre Ärmel und dann die Tunika und das Hemd des Königs hochrollte. Wir befanden uns im Hauptschlafgemach von König Quiences Privaträumen, tief im Innern des innersten Vierecks von Efernze, des Winterpalastes von Haspide, der Hauptstadt von Haspidus!
Dies war für mich zu einer so regelmäßigen Wirkungsstätte geworden, einem so gewohnten Arbeitsplatz, dass ich zugegebenermaßen dazu neige zu vergessen, welche Ehre es bedeutet, bei derartigen Anlässen zugegen zu sein. Manchmal jedoch wird mir bewusst, Große Götter, dass ich – ein Waise, Spross einer in Ungnade gefallenen Familie – mich in der Gegenwart unseres geliebten Königs befinde! Und das regelmäßig, und in sehr vertraulichen Situationen!
In solchen Augenblicken, Meister, danke ich Euch von ganzem Herzen, mit aller mir zu Gebote stehenden Inbrunst, denn ich weiß, es waren allein Eure Freundlichkeit, Eure Weisheit und Euer Mitgefühl, die mich in eine derart herausragende Lage gebracht und mich mit einer derart wichtigen Mission betraut haben. Seid versichert, dass ich weiterhin mit aller Kraft versuchen werde, mich dieses Vertrauens als würdig zu erweisen und dieser Aufgabe gerecht zu werden.
Wiester, der Kammerherr des Königs, hatte uns in die Gemächer geführt. »Ist das alles, Hoheit?«, fragte er, wobei er sich verbeugte und buckelte, so gut es sein stattlicher Körperbau zuließ.
»Ja. Das ist für jetzt alles. Geh!«
Die Ärztin setzte sich auf den Rand des königlichen Bettes und knetete mit ihren kräftigen, fähigen Fingern seine Schultern und seinen Rücken. Sie gab mir ein kleines Glas mit einer kräftig riechenden Salbe, in die sie hin und wieder die Finger tauchte, die Salbe über den breiten, haarigen Rücken des Königs verrieb und sie mit den Fingern und Handballen in seine blassgoldene Haut arbeitete.
Während ich so dasaß, mit der Medizintasche der Ärztin neben mir, bemerkte ich, dass das Glas mit dem braunen Gel, das sie benutzt hatte, um die jämmerliche Gestalt in der Geheimen Kammer zu behandeln, noch immer geöffnet auf einer der genial gearbeiteten inneren Ablagen der Tasche lag. Ich machte Anstalten, einen Finger in das Glas zu tauchen. Die Ärztin sah, was ich vorhatte, packte schnell meine Hand, zog sie von dem Glas weg und sagte ruhig: »Das würde ich an deiner Stelle nicht tun, Oelph. Schraube lieber den Deckel wieder vorsichtig auf.«
»Was ist das, Vosill?«, fragte der König.
»Nichts, Herr«, sagte die Ärztin, wobei sie die Hände wieder auf den Rücken des Königs legte und sich über ihn beugte.
»Uuchch!«, sagte der König.
»Überwiegend Muskelverspannung«, sagte die Ärztin sanft und warf den Kopf so zurück, dass ihr Haar, das ihr teilweise ins Gesicht gefallen war, sich zurück über ihre Schultern ergoss.
»Mein Vater brauchte niemals so zu leiden«, murrte der König grämlich in sein von Goldfäden durchzogenes Kopfkissen, und seine Stimme klang wegen der Dicke und des Gewichts des Stoffes und der Federn tiefer als sonst.
Die Ärztin lächelte mich schnell an. »Wie meint Ihr das, Herr? Wollt Ihr damit sagen, er brauchte niemals meine ungeschickten Dienstleistungen zu ertragen?«
»Nein«, sagte der König und ächzte. »Ihr wisst, was ich meine, Vosill. Dieser Rücken. Sein Rücken hat ihm nie zu schaffen gemacht. Oder meine Wadenkrämpfe, oder meine Kopfschmerzen, oder meine Verdauungsbeschwerden oder irgendwelche sonstige Beschwerden und Schmerzen.« Er schwieg eine Zeitlang, während die Ärztin seine Haut schob und drückte. »Vater brauchte niemals unter irgendetwas zu leiden. Er war …«
»… in seinem ganzen Leben keinen einzigen Tag lang krank«, ergänzte die Ärztin unisono mit dem König.
Der König lachte. Die Ärztin lächelte mich an. Ich hielt das Glas mit Salbe, in diesem kurzen Augenblick unaussprechlich glücklich, bis der König seufzte und sagte: »Ach, welch süße Folter, Vosill.«
2. KapitelDer Leibwächter
Dies ist die Geschichte des Mannes, der unter dem Namen DeWar bekannt war, des Obersten Leibwächters von General UrLeyn, Erster Protektor des Protektorats Tassasen, während der Jahre 1218 bis 1221 imperialer Zeitrechnung. Der Großteil meiner Geschichte spielt im Palast von Vorifyr, in Crough, der alten Hauptstadt von Tassasen, während des schicksalhaften Jahres 1221.
Ich habe mich dafür entschieden, die Geschichte im Stil der jeritischen Fabeldichter zu erzählen, das heißt in der Form einer in sich geschlossenen Chronik, bei der man – sofern man geneigt ist, derartige inhaltsschwere Informationen zu glauben – die Identität der erzählenden Person erraten muss. Mein Beweggrund für dieses Tun ist, dem Leser Gelegenheit zu geben, sich zu entscheiden, ob er das, was ich über die Ereignisse jener Zeit zu berichten habe, glauben möchte oder nicht – die allgemeinen Tatsachen über diese Zeit sind natürlich allseits hinlänglich bekannt, und zwar in der gesamten zivilisierten Welt – ohne Beweise, allein aufgrund dessen, ob die Geschichte für ihn ›wahr klingt‹ oder nicht, und ohne die Vorurteile, die aus der Kenntnis der Identität des Erzählenden herrühren und den Geist des Lesers für die Wahrheit, die ich darstellen möchte, verschließen könnten.
Und es ist höchste Zeit, dass die Wahrheit endlich erzählt wird. Ich glaube, ich habe alle unterschiedlichen Berichte über die Geschehnisse in Tassasen während dieser bedeutsamen Zeit gelesen, und der auffälligste Unterschied zwischen diesen Berichten scheint der Grad zu sein, in dem sie überaus weitreichend von den eigentlichen Ereignissen abweichen. Insbesondere gab eine Version ein solches Zerrbild wieder, dass sie mich schließlich veranlasste, die wahre Geschichte jener Zeit zu erzählen. Sie war in Form eines Schauspiels geschrieben, das angeblich auf meiner eigenen Geschichte beruhte, doch sein Ende hätte kaum weiter von der Wirklichkeit entfernt gewesen sein können. Der Leser braucht nur zu akzeptieren, dass ich bin, wer ich bin, damit seine Unsinnigkeit offenbar wird.
Ich sage, dies ist DeWars Geschichte, dennoch räume ich freimütig ein, dass es nicht seine ganze Geschichte ist. Es ist nur ein Teil davon, und man kann durchaus der Meinung sein, dass es nur ein kleiner Teil ist, lediglich in Jahren gemessen. Es gab auch einen früheren Teil, aber die Geschichtsschreibung liefert nur ein sehr vernebeltes Wissen über die frühere Vergangenheit.
Also, dies ist die Wahrheit, wie ich sie selbst erlebt habe oder wie sie mir von Leuten, denen ich vertraue, erzählt wurde.
Die Wahrheit, so habe ich gelernt, bedeutet für jeden einzelnen etwas Unterschiedliches. Genau wie zwei Leute niemals einen Regenbogen von genau derselben Stelle aus sehen – und dennoch sehen ihn beide mit Sicherheit, während die Person, die dem Anschein nach genau darunter steht, ihn überhaupt nicht sieht – die Wahrheit ist also eine Frage des Standpunkts und der Richtung, in die man zu einer bestimmten Zeit blickt.
Natürlich mag der Leser in dieser Hinsicht anderer Meinung sein als ich, und das steht ihm frei.
»DeWar? Seid Ihr das?« Der Erste Protektor, Oberster General und Großädil des Protektorats Tassasen, General UrLeyn, hob sich die Hand über die Augen, um sich gegen den hellen Glanz des fächerförmigen Stuck- und Edelstein-Fensters über dem polierten schwarzen Bernsteinboden des Saales zu schützen. Es war Mittag, und Xamis und Seigen schienen draußen hell an einem klaren Himmel.
»Herr«, sagte DeWar und trat aus dem Schatten am Rand des Raums, wo die Landkarten in einem großen Holzgitterverschlag aufbewahrt wurden. Er verneigte sich vor dem Protektor und legte eine Karte auf den Tisch vor sich. »Ich denke, dies ist die Karte, die Ihr vielleicht braucht.«
DeWar: ein großer, muskulöser Mann Anfang der mittleren Jahre, dunkelhaarig, dunkelhäutig mit dunklen Brauen und tiefliegenden, zusammengekniffenen Augen und einem lauernden, grüblerischen Aussehen, das durchaus zu seinem Beruf passte, den er einmal als Mörder-Morden beschrieben hatte. Er wirkte gleichzeitig entspannt und angespannt, wie ein Tier, das ständig bereit zum Sprung auf den Hinterpfoten kauert, jedoch ohne weiteres fähig, in dieser geduckten Stellung so lange zu verharren, bis seine Beute in Reichweite kommen und die Wachsamkeit fallenlassen würde.
Er war in Schwarz gekleidet, wie immer. Seine Stiefel, seine Beinkleider, seine Tunika und die kurze Jacke waren allesamt so dunkel wie eine Nacht bei Mondfinsternis. Ein schmales Schwert in einer Scheide hing an seiner rechten Hüfte, ein langer Dolch an seiner linken.
»Ihr holt jetzt die Landkarten für meine Generäle, DeWar?«, fragte UrLeyn belustigt. Der General der Generäle von Tassasen, der Bürgerliche, der Adelige befehligte, war ein verhältnismäßig kleiner Mann, der aufgrund seines umtriebigen, kraftvoll-emsigen Charakters beinahe jedem das Gefühl vermittelte, selbst nicht größer zu sein als er. Sein Haar war scheckig, grau und schütter, doch seine Augen strahlten hell. Man bezeichnete seinen Blick im Allgemeinen als ›bohrend‹. Er war mit der Hose und der langen Jacke bekleidet, die er bei vielen seiner Kollegen in der Generalität und weiten Teilen der Geschäftswelt von Tassasen in Mode gebracht hatte.
»Wenn mein General mich wegschickt, Herr, ja«, antwortete DeWar. »Ich versuche alles in meiner Macht Stehende zu tun, um zu helfen. Und solche Tätigkeiten helfen mir zu verhindern, dass ich im Geiste bei den Gefahren verweile, denen sich mein Herr aussetzen mag, wenn er mich von seiner Seite wegschickt.« DeWar warf die Karte auf den Tisch, wo sie sich entrollte.
»Die Grenzen … Ladenscion«, hauchte UrLeyn, wobei er die glatte Oberfläche der alten Landkarte tätschelte und dann mit boshaft-schelmischer Miene zu DeWar aufblickte. »Mein lieber DeWar, die größte Gefahr, der ich mich bei solchen Gelegenheiten aussetze, ist wahrscheinlich eine unangenehme Erfahrung mit einem jungen Mädchen, das mir neu zugeführt wurde, oder möglicherweise handle ich mir einen sanften Klaps ein, weil ich etwas vorschlage, das meine spröderen Konkubinen über alle Maßen unanständig finden.« Der General grinste und zog den Gürtel um seinen bescheidenen Schmerbauch hoch. »Oder ein zerkratzter Rücken oder ein angebissenes Ohr, wenn ich Glück habe, wie?«
»Der General stellt uns jüngere Männer in vielerlei Hinsicht beschämend in den Schatten«, murmelte DeWar und strich die Pergamentkarte glatt. »Aber es ist nicht unbekannt, dass Meuchelmörder weniger Achtung vor der Privatsphäre des Harems eines großen Anführers hegen als, sagen wir mal, sein oberster Leibwächter.«
»Ein Meuchelmörder, der sich nicht scheut, sich dem Zorn meiner lieben Konkubinen auszusetzen, hat es beinahe verdient, bei seinem Vorhaben erfolgreich zu sein«, sagte UrLeyn mit einem Augenzwinkern, während er an seinem kurzen grauen Schnauzbart zupfte. »Die Vorsehung weiß, dass ihre Leidenschaft manchmal über alle Stränge schlägt.« Er streckte die Hand aus und schlug dem jüngeren Mann mit geballter Faust gegen den Ellbogen. »Wie?«
»In der Tat, Herr. Dennoch, ich denke der General sollte …«
»Ach, da kommt der Rest der Bande!«, sagte UrLeyn und klatschte in die Hände, während sich die Doppeltür am anderen Ende des Saals öffnete und eine Anzahl Männer einließ – alle ähnlich gekleidet wie der General – sowie eine Begleitmeute von Adjutanten in Militärumformen, Schreiberlingen in Gehröcken und einer Mischung anderer Gehilfen. »YetAmidous!«, rief der Protektor aus und ging zur Begrüßung geschwind auf den großen, grobgesichtigen Mann zu, der die Gruppe anführte, schüttelte ihm die Hand und versetzte ihm einen Schlag auf den Rücken. Er begrüßte jeden einzelnen der anderen adeligen Generäle mit Namen, dann fiel sein Blick auf seinen Bruder. »RuLeuin! Zurück von den Zwirbelinseln? Steht alles zum Besten?« Er schlang die Arme um den größeren, dickeren Mann, der verhalten lächelte, wobei er nickte und sagte: »Ja, Herr.« Dann entdeckte der Protektor seinen Sohn und beugte sich hinab, um ihn hochzuheben. »Und Lattens! Mein lieber Junge! Hast du dein Studium beendet?«
»Ja, Vater«, antwortete der. Er war wie ein kleiner Soldat gekleidet und trug stolz ein Holzschwert zur Schau.
»Gut. Du kannst uns bei der Entscheidung helfen, was wir bezüglich der aufständischen Barone in den Marken tun sollen.«
»Er ist nur für kurze Zeit hier, Bruder«, sagte RuLeuin. »Es handelt sich um einen Sonderurlaub. Sein Lehrer erwartet ihn pünktlich zurück.«
»Genügend Zeit für Lattens, um unsere Pläne grundlegend zu beeinflussen«, sagte UrLeyn und setzte das Kind auf den Kartentisch.
Amtsverwalter und Schreiberlinge hasteten zu dem großen hölzernen Gitterverschlag an der Wand, in dem die Landkarten aufbewahrt wurden, und kämpften darum, als erste dort zu sein.
»Lasst gut sein!«, rief der General ihnen hinterher. »Hier ist die Karte!«, erklärte er, während sein Bruder und die anderen Generäle sich um den großen runden Tisch drängten. »Jemand hat bereits …«, setzte der General an und suchte das Rund des Tisches nach DeWar ab, dann schüttelte er den Kopf und wandte seine Aufmerksamkeit wieder der Karte zu.
Hinter ihm, für den Protektor durch die größeren um ihn versammelten Männer verborgen, doch niemals mehr als eine Schwertlänge entfernt, stand sein Oberster Leibwächter, die Arme lässig verschränkt, die Hände auf die Knäufe seiner offensichtlichsten Waffen gelegt, unbemerkt und beinahe unsichtbar, und ließ den Blick über die Anwesenden schweifen.
»Einst gab es einen mächtigen Kaiser, der sehr gefürchtet war in dem, was damals die bekannte Welt war, mit Ausnahme der äußeren Ödlande, um die sich niemand, der auch nur einen Funken Verstand besaß, kümmerte und wo nur Wilde lebten. Der Kaiser hatte nicht seinesgleichen und auch keine Rivalen. Sein Reich erstreckte sich über den größten Teil der Welt, und alle Könige ringsum beugten sich ihm und boten ihm großzügig Tribut an. Seine Macht war absolut, und seit langem fürchtete er nichts außer dem Tod, der irgendwann alle Menschen ereilt, auch Kaiser.
Er beschloss zu versuchen, auch den Tod hereinzulegen, indem er ein so riesiges Monument in Form eines Palastes baute, so großartig, so überwältigend prächtig, dass der Tod persönlich – von dem man glaubte, er hole jene von königlichem Geblüt in der Gestalt eines großen Feuervogels, der nur für den Sterbenden sichtbar war – sich verlocken lassen würde, in diesem großartigen Monument zu bleiben und dort zu wohnen und nicht mit dem Kaiser in der Umklammerung seiner flammenden Krallen in die Tiefe des Himmels zurückzukehren.
Demzufolge veranlasste der Kaiser den Bau eines derartigen prächtigen Monuments auf einer Insel in der Mitte eines großen runden Sees am Rand der Ebenen und des Ozeans, in einiger Entfernung von seiner Hauptstadt. Der Palast wurde in der Form eines riesigen konischen Turms gestaltet, ein halbes Hundert Stockwerke hoch. Er wurde mit allem nur erdenklichen Luxus und allen Schätzen ausgestattet, die das Reich und die Königtümer hervorbrachten, alles sicher im tiefsten Innern des Monuments untergebracht, wo sie für den gewöhnlichen Dieb unsichtbar, jedoch sichtbar für den Feuervogel sein würden, wenn er käme, um den Kaiser zu holen.
Es waren dort auch magische Statuen aller Lieblingsfrauen des Kaisers aufgestellt, Gattinnen und Konkubinen, von denen seine heiligsten Heiligen Männer garantierten, sie würden allesamt zum Leben erwachen, wenn der Kaiser stürbe und der große Feuervogel käme, um ihn zu holen.
Der leitende Architekt beim Bau des Palastes war ein Mann namens Munnosh, der in der ganzen Welt als größter Baumeister aller Zeiten berühmt war, und es war seinem Können und seinem Geschick zu verdanken, dass das riesige Projekt verwirklicht werden konnte. Aus diesem Grund überhäufte der Kaiser Munnosh mit Reichtümern, Vergünstigungen und Konkubinen. Doch Munnosh war zehn Jahre jünger als der Kaiser, und als der Kaiser alt wurde und sich das große Monument seiner Vollendung näherte, wusste er, dass Munnosh ihn überleben würde und möglicherweise verraten oder zum Verrat gezwungen werden würde, wo und wie die Verstecke mit den Reichtümern innerhalb des Palastes platziert worden waren, nachdem der Kaiser gestorben wäre und dort mit dem großen Feuervogel und den zum Leben erwachten magischen Statuen leben würde. Munnosh hätte vielleicht noch Zeit, ein noch großartigeres Monument für den nächsten König zu bauen, der auf den kaiserlichen Thron aufsteigen und Kaiser werden würde.
Dies bedenkend, wartete der Kaiser, bis das große Mausoleum so gut wie fertig war, und ließ Munnosh dann in das tiefste Geschoss des ausgedehnten Bauwerks locken, und während der Architekt in einem kleinen Raum tief unter der Oberfläche auf etwas wartete, das ihm als große Überraschung versprochen worden war, wurde er von den kaiserlichen Wachen eingekreist, die diesen Teil des tiefsten Geschosses verschlossen.
Der Kaiser ließ Munnoshs Familie durch seine Höflinge mitteilen, dass der Architekt umgekommen sei; ein großer Steinblock sei auf ihn gefallen, während er das Gebäude inspizierte, und sie trauerten laut und schrecklich.
Aber der Kaiser hatte die Schlauheit und die Wachsamkeit des Architekten unterschätzt, der lange den Verdacht gehegt hatte, dass etwas Derartiges geschehen könnte. Deshalb hatte er einen Geheimgang von den tiefsten Kellern des großen Palastes nach draußen eingebaut. Als Munnosh klar wurde, dass er eingemauert worden war, öffnete er den Zugang zu dem Geheimgang und stieg hinauf an die Oberfläche, wo er bis zum Einbruch der Nacht wartete und sich dann auf einem der Boote der Arbeiter davonstahl, indem er über den runden See glitt.
Als er nach Hause kam, hielten ihn seine Frau, die gedacht hatte, sie sei Witwe, und seine Kinder, die gedacht hatten, sie hätten keinen Vater mehr, zunächst für einen Geist und wichen voller Angst vor ihm zurück. Schließlich konnte er sie davon überzeugen, dass er lebte und dass sie ihn ins Exil begleiten sollten, weg von dem Reich. Der ganzen Familie gelang die Flucht in ein fernes Königreich, wo der König Bedarf hatte an einem begabten Baumeister, der die Errichtung von Festungsanlagen beaufsichtigen sollte, um die Wilden aus den Ödlanden abzuhalten, und wo jeder entweder nicht wusste, wer dieser große Architekt war, oder wenigstens um der Festungsanlagen und der Sicherheit des Königreiches willen vorgab, ihn nicht zu kennen.
Dem König kam jedoch zu Ohren, dass ein großer Architekt in diesem fernen Königreich arbeitete, und aufgrund verschiedener Gerüchte und Berichte kam ihm der Verdacht, dass dieser Baumeister tatsächlich Munnosh war. Der Kaiser, der inzwischen sehr gebrechlich und altersschwach und beinahe tot war, befahl die heimliche Öffnung der unteren Geschosse des Mausoleums. Das geschah, und natürlich war Munnosh nicht da, und der Geheimgang wurde entdeckt.
Der Kaiser befahl dem König, seinen Baumeister in die kaiserliche Hauptstadt zu schicken. Der König weigerte sich zunächst und forderte noch etwas Zeit, weil seine Festungsanlagen noch nicht fertig waren und sich die Wilden aus den Ödlanden als hartnäckiger und besser organisiert erwiesen, als er gedacht hatte, doch der Kaiser, der jetzt dem Tod noch näher war, bestand auf seiner Forderung, und schließlich gab der König klein bei und schickte den Architekten Munnosh widerstrebend in die Hauptstadt. Die Familie des Architekten reagierte auf seine Abreise genauso, wie sie damals auf die falsche Nachricht von seinem Tod reagiert hatte, vor so vielen Jahren.
Als der Kaiser Munnosh sah und in ihm seinen ehemaligen Höchsten Kaiserlichen Hofarchitekten erkannte, rief er: ›Munnosh, verräterischer Munnosh! Warum habt Ihr mich und Eure größte Schöpfung verlassen?‹
›Weil Ihr mich darin habt einmauern lassen und mich dem Tod preisgegeben habt, mein Kaiser‹, antwortete Munnosh.
›Das geschah nur, um die Sicherheit Eures Kaisers zu gewährleisten und Euren eigenen guten Namen zu bewahren‹, erklärte der alte Tyrann Munnosh. ›Ihr hättet Euch mit dem Geschehen abfinden und Eure Familie Euch in Anstand und Frieden betrauern lassen müssen. Stattdessen führtet Ihr sie bei Nacht und Nebel ins Exil und habt damit nur erreicht, dass sie jetzt ein zweites Mal um Euch trauern müssen.‹
Nachdem der Kaiser diese Worte ausgesprochen hatte, fiel Munnosh auf die Knie und begann zu weinen und den Kaiser um Vergebung anzuflehen. Der Kaiser streckte eine dünne, zitternde Hand aus, lächelte und sagte: ›Aber das braucht Euch nicht zu bekümmern, denn ich habe meine fähigsten Meuchelmörder zu Eurer Frau und Euren Kindern und Euren Enkeln geschickt, um sie alle zu töten, bevor sie etwas von Eurer Schande und Eurem Tod erfahren können.‹
Nach diesen Worten machte Munnosh, der einen Maurermeißel unter seinem Gewand versteckt hatte, einen Satz nach vorn und versuchte, den Kaiser niederzustrecken, indem er mit dem Meißel direkt auf die Kehle des alten Mannes zielte.
Stattdessen wurde jedoch Munnosh niedergestreckt, bevor er seinen Schlag landen konnte, und zwar vom Obersten Leibwächter, der seinem Herrn niemals von der Seite wich. Der Mann, der einst Höchster Kaiserlicher Hofarchitekt gewesen war, landete tot zu Füßen des Kaisers; sein Kopf war mit einem einzigen schrecklichen Hieb durch das Schwert des Leibwächters vom Leib getrennt worden.
Doch der Oberste Leibwächter schämte sich so sehr, weil Munnosh dem Kaiser mit einer Waffe so nahe gekommen war, und außerdem war er so abgestoßen von der Grausamkeit, mit der der Kaiser die unschuldige Familie des Architekten heimzusuchen beabsichtigte – was nur der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte, denn er war ein Leben lang Zeuge der Grausamkeiten des alten Tyrannen gewesen –, dass er zuerst den Kaiser und dann sich selbst tötete, und zwar mit zwei weiteren kräftigen Hieben seines mächtigen Schwerts, bevor irgendjemand Anstalten machen konnte, ihn an seinem Tun zu hindern.
Dem Kaiser wurde sein Wunsch erfüllt, in dem großen palastartigen Mausoleum zu sterben, das er sich hatte bauen lassen. Ob es ihm gelang, den Tod zu betrügen oder nicht, wissen wir nicht, aber es ist eher unwahrscheinlich, da der Kaiser sehr bald nach seinem Tod zerfiel und das riesige Monument, das er unter so hohen Kosten, dass sein Reich noch lange darunter litt, hatte bauen lassen, innerhalb desselben Jahres vollkommen geplündert wurde und bald dem Verfall anheimfiel, so dass es jetzt nur noch als willkommene Quelle für behauene Steine für die Stadt Haspide genutzt wird, die ein paar Jahrhunderte später auf derselben Insel gegründet wurde, an der Stelle, die heute Kratersee heißt, im Königreich Haspidus.«