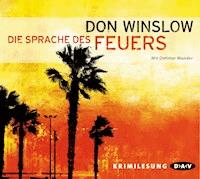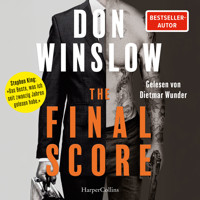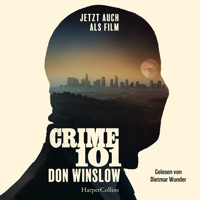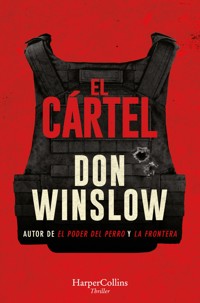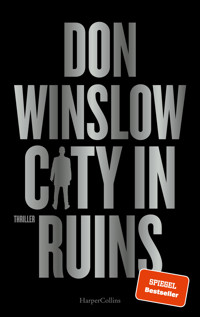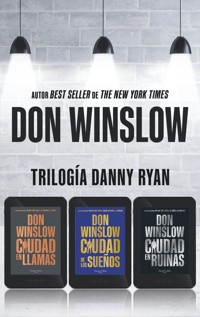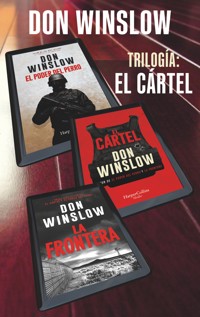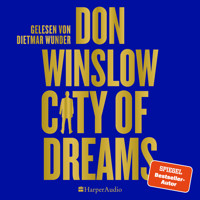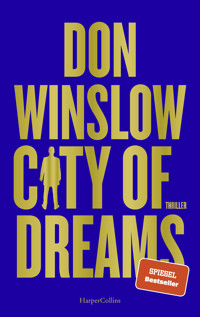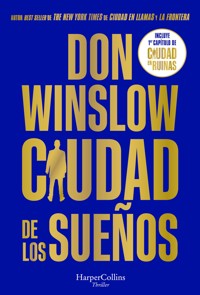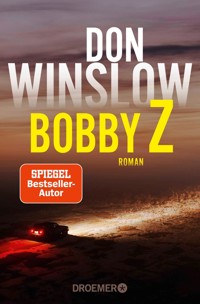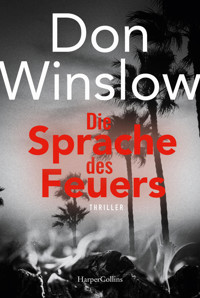
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Grandiose Spannung von Krimisuperstar Don Winslow
Brandspezialist Jack Wade untersucht für die „California Fire & Life“ einen Versicherungsfall. Die Villa des einflussreichen Immobilienbesitzers Nicky Vale ist in Flammen aufgegangen, die Leiche seiner Ehefrau Pamela wurde in den Trümmern gefunden. Der Fall ist klar: zu viel Alkohol und eine brennende Zigarette – zumindest steht das im Polizeibericht. Damit will sich Wade nicht zufriedengeben. Er kennt die Sprache des Feuers, und er hegt den Verdacht, dass Nicky Vale nicht die ganze Wahrheit sagt. Doch sämtliche Ermittlungen führen in Sackgassen. Als die Situation außer Kontrolle gerät beschließt er, Feuer mit Feuer zu bekämpfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zum Buch:
Als das Anwesen eines Immobilienmoguls bis auf die Grundmauern abbrennt, macht die Feuerwehr einen grausigen Fund: Die Leiche der jungen Ehefrau des Hausbesitzers liegt zwischen den Trümmern. Eine brennende Zigarette und zu viel Wodka scheinen den Brand verursacht zu haben, da ist sich die zuständige Behörde schnell sicher. Bis Jack Wade, der Experte für die Sprache des Feuers, Schadensregulierer und ehemaliger Brandermittler des Orange County Sheriff Department, auf Ungereimtheiten stößt. Er entdeckt ein Netz aus Lügen und Intrigen zwischen abtrünnigen KGB-Agenten und russischen Kriminellen. Wie weit ist er bereit, für die Wahrheit zu gehen – in einer Welt, in der nicht nur das Feuer spricht, sondern viel zu oft Geld über Leben und Tod entscheidet?
Zum Autor:
Don Winslow ist Autor von zweiundzwanzig preisgekrönten internationalen Bestsellern, darunter derNew York Times-Bestseller »Corruption«, der internationale Nr.-1-Bestseller »Das Kartell« sowie »Tage der Toten«, »Zeit des Zorns« und »Frankie Machine«. »Zeit des Zorns« wurde von dem dreifachen Oscar-Preisträger Oliver Stone verfilmt. »Tage der Toten«, »Das Kartell« und »Jahre des Jägers« wurden an den TV-Sender FX verkauft, der die Ausstrahlung als wöchentliche Serie plant. Die Filmrechte von »City on Fire« sicherten sich Sony und 3000 Pictures. Winslow, ein ehemaliger Privatdetektiv, Antiterrorausbilder und Prozesssachverständiger, lebt in Kalifornien und Rhode Island.
Die Originalausgabe erschien 1999 unter dem TitelCalifornia Fire & Life bei bei Simon & Schuster, Inc., New York.
© 1999 by Don Winslow Lizenzausgabe im HarperCollins Taschenbuch © 2023 für die deutschsprachige Ausgabe by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Alle Rechte an der deutschen Übersetzung von Chris Hirte bei der Suhrkamp Verlag AG, Berlin. Coverabbildung von Pal Sand, Dogora Sun / shutterstock Covergestaltung von zero Werbeagentur E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck ISBN E-Book 9783749905171www.harpercollins.de
Widmung
Für die Schadensregulierer und ihre Anwälte. Es war mir eine Ehre.
1
Eine Frau liegt im Bett, und das Bett brennt.
Sie wacht nicht auf.
Die Flammen züngeln an ihren Schenkeln hoch, und sie wacht nicht auf.
Unten an der Küste donnert der Pazifik gegen die Felsen. California Fire and Life.
2
Auch der Tischler George Scollins wacht nicht auf.
Er liegt am Fuß der Treppe, mit gebrochenem Genick. Warum, ist unschwer zu erkennen: Sein Häuschen im Laguna Canyon ist ein einziges Chaos. Werkzeuge, Holz, Möbel – alles wild verstreut, man kann sich kaum bewegen, ohne auf irgendetwas zu treten.
Nicht nur Werkzeuge, Holz und Möbel, auch Farbkübel, Büchsen mit Holzbeize, Plastikflaschen mit Terpentin, Putzlappen …
Das ist der Grund, weshalb das Haus lichterloh brennt. Eigentlich kein Wunder.
Alles andere wäre ja …
California Fire and Life.
3
Zwei vietnamesische Knirpse sind mit dem Lastwagen unterwegs.
Der Fahrer, Tommy Do, biegt auf einen Parkplatz ab.
»So eine tote Gegend«, sagt Vince Tranh, Tommys Buddy.
Tommy ist das egal. Er ist froh, wenn er das Zeug loswird. Eine heiße Fuhre.
Tommy hält neben einem Cadillac.
»Die und ihre Caddys«, sagt Tranh auf Vietnamesisch.
»Na und?«, sagt Tommy. Tommy spart auf einen Mazda MX5. Ein MX5 ist cool. Tommy sieht sich schon in dem schwarzen Teil rumdüsen, mit schicker Sonnenbrille, neben sich eine Braut mit langer schwarzer Mähne.
Er sieht es förmlich vor sich.
Zwei Typen steigen aus dem Caddy.
Ein langer Schmaler, der an einen Windhund erinnert – oder einen Afghanen, denkt Tommy, nur dass ihm in seinem dunkelblauen Anzug sehr heiß werden wird hier in dieser Wüste. Der andere ist kleiner, dafür dicker. Trägt ein schwarzes Hawaiihemd, das mit großen Blüten bedruckt ist. Der sieht aus wie ein Idiot, denkt Tommy. Das dürfte der Knochenbrecher sein. Tommy macht drei Kreuze, wenn er das Zeug los ist, sein Geld kassiert hat. Und dann nichts wie zurück nach Garden Grove.
Normalerweise macht Tommy keine Geschäfte mit Nichtvietnamesen, schon gar nicht mit Typen wie diesen.
Aber diesen Job konnte er nicht ausschlagen.
Zwei Mille für eine Tour.
Der Dicke im Hawaiihemd öffnet ein Tor, und Tommy fährt hindurch. Der Dicke macht das Tor wieder zu.
Tommy und Tranh steigen aus.
Der Blaue sagt: »Ladet das Zeug aus.«
Tommy schüttelt den Kopf.
»Erst das Geld«, sagt er.
»Klar«, sagt der Blaue.
»Geschäft ist Geschäft«, meint Tommy. Er will nur höflich sein.
»Geschäft ist Geschäft«, bestätigt der Blaue.
Tommy sieht, wie er in die Brusttasche greift, doch statt der Brieftasche zückt er eine 9 mm mit Schalldämpfer und schießt drei Kugeln dicht nebeneinander in Tommys Gesicht.
Tranh steht mit seinem O-Gott-nein!-Blick daneben, macht aber keine Anstalten, wegzurennen. Steht da wie angewurzelt, weshalb ihm der Blaue ohne viel Umstände die restlichen drei Kugeln verpasst.
Der Dicke im Hawaiihemd wuchtet erst Tommy, dann Tranh in einen Müllcontainer. Übergießt sie mit Benzin und wirft ein brennendes Streichholz hinein.
»Sind Vietnamesen Buddhisten?«, fragt er den Blauen.
»Ich glaube.«
Beide sprechen Russisch.
»Verbrennen die nicht ihre Toten?«
Der Blaue zuckt mit den Schultern.
Eine Stunde später haben sie das Auto entladen und die Fracht im Haus verstaut. Zwölf Minuten danach fährt das Hawaiihemd den Lieferwagen in die Wüste und sprengt ihn in die Luft.
California Fire and Life.
4
Jack Wade sitzt auf seinem alten Hobie-Longboard.
Er paddelt durch Wellen, die keine werden wollen, und sieht eine schwarze Rauchfahne, die drüben hinter dem großen Felsen des Dana Head in den blassen Augusthimmel steigt wie ein buddhistisches Gebet.
Jack ist so in den Anblick der Rauchfahne vertieft, dass er die Welle nicht sieht, die sich hinter ihm aufbaut wie ein fetter Gitarrenriff von Dick Dale. Ein Riesenbrecher, der ihn zu Boden presst und vor sich her wälzt, immer weiter, ohne loszulassen, nach dem Motto: Selber schuld, wenn du nicht aufpasst, Jack. Du frisst Sand und atmest Wasser.
Jack ist fast im Jenseits, als ihn die Welle endlich an Land spuckt.
Keuchend rappelt er sich hoch, als er seinen Pager hört, weiter oben, wo das Handtuch liegt. Er stolpert durch den Sand zu seinem Handtuch, greift sich das Ding und liest die Nummer ab, obwohl er sich denken kann, wer es ist.
California Fire and Life.
5
Die Frau ist tot.
Jack weiß das, bevor er zu dem Haus kommt, denn als er angerufen hat, war Goddamn Billy dran. Morgens um halb sieben, und Goddamn Billy ist schon im Büro.
Hausbrand, eine Tote, hat Goddamn Billy zu ihm gesagt.
Jack hastet die hundertzwanzig Stufen vom Dana Strands Beach zum Parkplatz hoch, duscht kurz, dann schlüpft er in die Arbeitsklamotten, die auf dem Rücksitz seines 66er-Mustang liegen.
Seine Arbeitsklamotten: ein weißes Baumwollhemd von Lands’ End, eine Kakihose von Lands’ End, Mokassins von Lands’ End und eine Eddie-Bauer-Krawatte, die immer fertig geknotet ist, damit er sie überwerfen kann wie eine Schlinge.
Seit zwölf Jahren hat Jack keinen Klamottenladen von innen gesehen.
Er besitzt drei Krawatten, fünf weiße Baumwollhemden von Lands’ End, zwei Kakihosen von Lands’ End, zwei garantiert knitterfreie blaue Blazer (einer in der Reinigung, einer in Benutzung), ebenfalls von Lands’ End, und ein Paar Mokassins von Lands’ End.
Am Sonntagabend macht er große Wäsche.
Wäscht die fünf Hemden und die zwei Hosen und hängt sie gleich auf, damit sie nicht knittern. Knotet die drei Krawatten, und schon ist er für die Arbeitswoche bereit, die damit beginnt, dass er kurz vorm Hellwerden ins Wasser springt, bis sechs Uhr dreißig surft, am Strand duscht, in die Arbeitsklamotten steigt, die Krawatte um den Hals schlingt, sich ans Steuer setzt, eine alte Kassette der Challengers einschiebt und in sein Büro bei California Fire and Life fährt.
Seit fast zwölf Jahren macht er das so, doch heute kommt es anders.
Billys Anruf ist daran schuld, dass er heute direkt zum Brandort fährt – Bluffside Drive 37 –, nur ein Stück die Straße über Dana Strands entlang.
Die Fahrt dauert vielleicht zehn Minuten. Er biegt in die kreisförmige Einfahrt ein – die Reifen im Kies machen ein schlürfendes Geräusch wie eine abfließende Welle –, und er ist noch nicht zum Stehen gekommen, da klopft Brian Bentley schon ans Fenster der Beifahrerseite.
Brian Bentley, auch Unfall-Bentley genannt, ist der Brandermittler der Polizei. Ein weiteres Indiz für einen Todesfall. Sonst hätte Jack hier einen Mann von der Feuerwehr angetroffen und müsste nicht Bentleys feiste Visage ertragen.
Oder sein schütteres rotes Haar, das mit den Jahren zu einem faden Orange verblasst ist.
Jack beugt sich rüber, kurbelt die Scheibe runter.
Bentley steckt seinen roten Kopf durch. »Das ging aber schnell, Jack. Machst du etwa Feuer und Leben?«
»Ja.«
»Na fein«, sagt Bentley. »Doppelt beschissen.«
Jack und Bentley können sich nicht ausstehen.
Wenn Jack brennen würde, würde Bentley auf ihn pissen, aber vorher würde er Benzin saufen.
»Eine Leiche im Schlafzimmer«, sagt Bentley. »Die mussten sie von den Sprungfedern kratzen.«
»Die Ehefrau?«
»Steht noch nicht fest«, sagt Bentley. »Aber weiblich und erwachsen.«
»Pamela Vale, vierunddreißig«, sagt Jack. Goddamn Billy hat ihm die Daten durchgegeben.
»Kommt mir bekannt vor, der Name«, sagt Bentley.
»Rettet die Strände.«
»Hä?«
»Rettet die Strände«, wiederholt Jack. »Sie war in der Zeitung. Sie und ihr Mann sind große Spendensammler für Rettet die Strände.«
Eine Bürgerinitiative, die dagegen kämpft, dass Great Sunsets Ltd. eine Siedlung auf Dana Strands hochzieht, dem letzten unberührten Landstrich der südkalifornischen Küste.
Dana Strands, Jacks geliebtes Dana Strands, ein bisschen Freiland mit ein paar Bäumen hoch über dem Dana Strands Beach. Ein alter Campingplatz, den sich die Natur zurückgeholt hat, in die Breite und Höhe gewuchert und resistent gegen die Mächte des Fortschritts – bis jetzt jedenfalls, denkt Jack.
»Was auch immer«, sagt Bentley.
»Da gibt’s noch einen Mann und zwei Kinder.«
»Nach denen suchen wir.«
»Mist!«
»Im Haus sind sie nicht«, sagt Bentley. »Ich meinte, wir suchen sie wegen der Benachrichtigung. Warum warst du so schnell?«
»Billy hat es aus dem Polizeifunk und mir sofort, als ich reinkam, die Adresse gegeben.«
»Die Herrschaften von der Versicherung«, sagt Bentley. »Können es nicht abwarten, ihre Spuren zu legen.«
Jack hört Hundegekläff hinter dem Haus, was ihn stutzig macht.
»Habt ihr die Brandursache?«, fragt er.
Bentley schüttelt den Kopf und lacht, wie er immer lacht. Es klingt wie eine undichte Dampfheizung. »Da musst du erst mal ’nen Scheck rüberreichen, Jack.«
»Was dagegen, wenn ich mich umsehe?«
»Und ob ich das habe«, sagt Bentley. »Aber ich kann dich nicht hindern.«
»Stimmt.«
So steht es im Vertrag mit der Versicherung. Wenn ein Schaden auftritt, hat die zuständige Versicherung das Recht, den Schaden zu untersuchen.
»Dann reiß dir mal schön den Arsch auf«, sagt Bentley. Er schiebt seinen Kopf noch weiter rein, um Jack in die Augen zu sehen. »Aber mach mir keinen Stress, verstanden? Ich gehe in zwei Wochen in Rente. Ich will Barsche angeln und keine Berichte schreiben. Wir haben hier eine Frau, die geraucht hat und ihren Wodka verschüttet hat. Dann hat sie die Zigarette fallen lassen und sich selbst gegrillt. Mehr ist da nicht.«
»Du gehst in Rente, Bentley?«
»Ich hab meine dreißig Jahre im Kasten.«
»Dann wird’s ja Zeit, dass du’s offiziell machst.«
Ein Grund – von vielen, vielen anderen –, warum Jack diesen Bentley nicht leiden kann, ist der, dass Bentley ein fauler Hund ist. Egal, was brennt, für Bentley ist es immer ein Unfall. Hätte er in der Asche von Dresden gestochert, hätte er ein durchgeschmortes Heizkissen zur Brandursache erklärt. Das reduziert seinen Stress auf ein bisschen Papierkram und eine Zeugenaussage vor Gericht.
Als Angler ist Bentley okay, als Brandermittler ist er eine Katastrophe.
»Hey, Jack«, sagt Bentley. Er grinst, aber es ist ein böses Grinsen. »Ich bin wenigstens nicht rausgeflogen.«
So wie ich, denkt Jack. »Weil kein Schwein mitgekriegt hat, dass du überhaupt da bist.«
»Fick dich«, sagt Bentley.
»Du dich auch.«
Das Grinsen verschwindet aus Bentleys Gesicht. Jetzt wird er richtig ernst.
»Das Feuer, die Tote, eindeutig ein Unfall«, sagt er. »Rumstochern lohnt nicht.«
Jack wartet, bis Bentley weg ist, dann steigt er aus.
Um rumzustochern.
6
Bevor die Spur kalt wird.
Und das im wörtlichen Sinn.
Je kälter der Brandort, umso schlechter die Chance, etwas zu finden.
Oder H & U zu ermitteln, wie man so schön sagt. Herd und Ursache.
H & U sind wichtig für die Versicherung, weil es solche und solche Brände gibt. Hat der Versicherte das Feuer fahrlässig verursacht, muss seine Versicherung den ganzen Spaß bezahlen. Aber wenn es wegen einer kaputten Heizdecke brennt oder einem minderwertigen Lichtschalter oder irgendeinem Elektrogerät, das nicht richtig funktioniert, versucht es die Versicherung mit einer Rechtsübertragung, die im Wesentlichen darin besteht, dass sie den Versicherten entschädigt und den Hersteller des fehlerhaften Teils auf Zahlung verklagt.
Also muss Jack in der Asche stochern. Nicht aus Vergnügen, sondern mit einer bestimmten Absicht.
Er öffnet den Kofferraum.
Da drin hat er eine Klappleiter, ein Sortiment Taschenlampen, eine Schaufel, ein robustes Bandmaß, zwei Kleinbild-Minoltas, einen Sony-Camcorder, ein Diktiergerät zum Anstecken, drei Scheinwerfer mit Klappstativ und eine Feuerausrüstung.
Die Feuerausrüstung besteht aus gelben Gummihandschuhen, einem gelben Schutzhelm und einem weißen Papieroverall, der die Füße bedeckt wie ein zu groß geratener Pyjama.
Der Kofferraum ist also randvoll.
Jack schleppt das ganze Zeug mit sich rum, weil er wie ein Dalmatiner ist – wenn es brennt, ist er zur Stelle.
In dem Overall kommt er sich vor wie in einem billigen Sci-Fi-Film. Lässt er den Overall weg, versaut ihm der Ruß die Klamotten und bringt seinen ganzen Waschzyklus durcheinander.
Also steigt er lieber in den Overall.
Und setzt den Helm auf, den er eigentlich nicht braucht, aber Goddamn Billy (»Ich hafte doch nicht für deine beschissenen Unfälle!«) knöpft ihm hundert Dollar Strafe ab, wenn er ihn ohne Helm erwischt. Jack klemmt sich das Diktafon unters Hemd – sonst kriegt es Ruß ab, und hinterher kann er es wegwerfen –, hängt die Kameras über die Schulter und geht auf das Haus zu.
Das im Versicherungsjargon als »Schadensrisiko« bezeichnet wird.
Aber nur so lange, wie nichts passiert.
Danach ist es einfach »der Schaden«.
Wenn das Schadensrisiko zum Schaden wird, wenn tatsächlich eintritt, was vorher nur ein Risiko war, dann tritt Jack in Aktion.
Das ist sein Job bei der California Fire and Life Mutual Insurance: Er ist Schadensregulierer. Seit zwölf Jahren schon reguliert er Schäden, und über die Auftragslage kann er nicht klagen. Er arbeitet meist allein; keiner geht ihm auf den Nerv, solange er seinen Job macht, und er macht immer seinen Job. Mit anderen Worten, es ist ein relativ entspannter Job.
Manche Regulierer beklagen sich, dass ihnen die Versicherten so viel Ärger machen, aber Jack hat keinen Ärger mit den Versicherten. »Ich sehe das ganz einfach«, sagt er, wenn er ihr Gejammer satt hat. »Die Versicherungspolice ist ein Vertrag. Da drinnen steht genau, wofür gezahlt wird und wofür nicht. Was du zahlen musst, das zahlst du. Und was nicht, das nicht.«
Es gibt also keinen Grund, Gehässigkeiten einzustecken oder auszuteilen.
Man wird nicht persönlich, man wird nicht emotional. Egal, was man tut, man lässt sich in nichts reinziehen. Man macht seinen Job, und man geht surfen. Weiter nichts.
Das ist Jacks Philosophie, und für ihn funktioniert sie. Ebenso für Goddamn Billy. Denn immer, wenn es irgendwo richtig brennt, schickt er Jack los. Und zwar deshalb, weil Jack seinen Job bei der Polizei gelernt hat. Er war dort Brandermittler – bis sie ihn rauswarfen.
Jack weiß also, womit er anfangen muss, wenn er einen Gebäudebrand ermittelt. Er muss um das Gebäude herumgehen.
Das Standardverfahren bei einem Gebäudebrand: Man arbeitet sich von außen nach innen. Was man von außen sieht, verrät viel darüber, was innen passiert ist.
Er schiebt sich durch das schmiedeeiserne Tor und schließt es hinter sich, denn da war doch dieser bellende Hund.
Wenn zwei kleine Kinder ihre Mutter verlieren, denkt er, sollen sie nicht auch noch ihren Hund verlieren.
Vor ihm liegt das Grundstück, das von einer Lehmziegelmauer umgeben ist. Ein Splittweg schlängelt sich zwischen einem Zen-Garten zur Rechten und einem Koi-Teich zur Linken.
Einem ehemaligen Koi-Teich, denkt Jack.
Der Teich ist voller Asche.
Tote Kois – einst gold- und orangefarben – treiben an der Oberfläche.
»Notiz«, sagt Jack zu seinem Diktafon. »Den Wert der Kois ermitteln.«
Er läuft weiter, auf das Haus zu.
Nimmt es in den Blick und denkt: ein wahrer Jammer.
7
Beim Surfen hat er das Haus viele Male gesehen, aber nicht mit dieser Adresse zusammengebracht.
Es ist einer von den älteren Bungalows auf dem Hochufer, gebaut in den Dreißigern, Holzrahmen aus kräftigen Balken, Zedernschindeln an den Außenwänden und auf dem Dach.
Ein Riesenjammer, denkt Jack, denn dieses Haus stammt aus der Zeit, als das Küstenland von Dana vor allem aus grasigen Hügeln bestand und man noch richtige Häuser baute.
Dieses Haus, denkt Jack, hat Hurrikane und Monsune überlebt, auch die Santa-Ana-Winde mit ihren Feuerstürmen. Noch erstaunlicher ist, dass es die Immobilienhaie und Hotelinvestoren und Finanzämter überlebt hat. Viele Jahre hat dieses Juwel unbeschadet über dem Ozean gethront, und es bedurfte nur einer Frau, einer Flasche Wodka und einer Zigarette, um ihm den Garaus zu machen.
Was ein wahrhaftiger Jammer ist, denkt Jack, denn er hat ein ganzes Leben lang von seinem Brett aus das Haus gesehen und gedacht: So ein tolles Haus möchte ich haben.
Es ist aus Holz gebaut, ohne Mörtel oder irgendwelchen Pseudo-Lehmverputz – und sie haben kein frisches Holz für den Rahmen verwendet. Damals, als noch richtige Häuser gebaut wurden, hat man die Balken vorher im Ofen getrocknet. Außerdem wurden richtige Holzschindeln genommen, denen das Ozeanwetter eine graubraune Färbung gab, sodass sich das Haus in die Küstenlandschaft einfügte wie das Treibholz am Strand. Wie ein riesiger Berg Treibholz genauer gesagt, denn für einen Bungalow ist das Haus sehr groß geraten. Ein hoher Mittelteil, flankiert von zwei Flügeln, die sich im Winkel von etwa 30 Grad dem Ozean zuwenden.
Jack steht davor und registriert, dass der Mittelteil und der linke Flügel unzerstört sind. Von Rauch und Löschwasser geschädigt, aber ansonsten intakt.
Vom rechten Flügel, der nach Westen zeigt, kann man das kaum behaupten.
Man muss kein Raketenwissenschaftler sein, um zu erkennen, dass das Feuer im Westflügel ausgebrochen ist. Generell gesagt liegt der Brandherd in dem Teil des Hauses, der am meisten zerstört ist, weil das Feuer dort am längsten gewütet hat.
Jack tritt ein paar Schritte zurück und fotografiert das Haus erst mit der einen Kamera, dann mit der anderen. Einmal in Farbe, einmal in Schwarz-Weiß. In Farbe lassen sich die Schäden besser zeigen, aber manche Richter lassen nur Schwarz-Weiß-Fotos als Beweismittel zu, weil sie meinen, dass Farbbilder, besonders wenn es Tote gegeben hat, den Schaden »unangemessen dramatisieren«.
Die meisten Richter, denkt Jack, sind Idioten.
Viele Schadensregulierer knipsen einfach Polaroids. Jack bleibt bei Kleinbild, weil sich das viel besser vergrößern lässt, wenn man Beweismittel vorlegen muss.
Manche Klägeranwälte akzeptieren daher keine Polaroids und schmeißen sie dir vor die Füße.
»Polaroid hat stets gereut«, lautet einer der markigen Sprüche von Goddamn Billy.
Weil man nie wissen kann, ob die Sache irgendwann vor Gericht landet, hat Jack zwei Kameras dabei. Das ist viel einfacher, als den Film zu wechseln und dann alles noch mal zu fotografieren.
Er notiert sich jedes Bild, dazu Uhrzeit und Datum, die Seriennummern beider Kameras, die Filmsorte und die dazugehörige ASA. Dieselben Daten spricht er noch einmal auf Band, zusammen mit den Beobachtungen, die er eventuell für seine Akte braucht.
Jack macht sich diese Mühe, weil er weiß, dass er sich alleine nicht alles merken kann, was er aufgenommen hat und warum. Man kann es sich nicht merken. Man hat vielleicht hundert Schäden gleichzeitig zu bearbeiten, und man bringt sie schnell mal durcheinander.
Oder, in der blumigen Ausdrucksweise von Billy Hayes: »Willst du keinen Scheiß, liefere schwarz auf weiß.«
Billy kommt aus Arizona.
Daher diktiert Jack: »Bild eins, Haus von Süden. 28. August 1997. Westflügel des Hauses zeigt schwere Schäden. Außenwände sind erhalten, müssen aber wahrscheinlich neu hochgezogen werden. Fensterscheiben geborsten. Loch im Dach.«
Auf die andere Seite des Hauses kommt man am besten, indem man den Mittelteil durchquert.
Jack öffnet die Haustür und blickt direkt auf den Ozean. Denn die andere Wand besteht aus gläsernen Schiebetüren mit einem Panorama, das sich von Newport Beach zur Rechten bis zu den mexikanischen Inseln zur Linken erstreckt. Catalina Island liegt direkt vor ihm, Dana Strands unten links daneben und noch tiefer unten Dana Strands Beach.
Sonst nichts als blauer Ozean und blauer Himmel.
Allein der Blick ist zwei Millionen wert.
Die große Glastür öffnet sich auf eine weitläufige Terrasse, dahinter beginnt der abschüssige Rasen, ein grünes Rechteck, in dessen Mitte sich ein blaues Rechteck befindet, das ist der Swimmingpool.
Eine Ziegelmauer umgibt den Rasen. Bäume und Sträucher säumen die seitlichen Mauern. Schräg unten links liegt ein Tennisplatz.
Der Blick ist absolut traumhaft, aber das Haus, selbst der Mittelteil, der verschont blieb, ist ein einziger Schlamassel. Durchsuppt von Löschwasser und verpestet von beißendem Brandgeruch.
Jack macht ein paar Aufnahmen, hält die Rauch- und Wasserschäden auf Band fest, dann geht er raus auf den Rasen, knipst auch von dort mehrere Fotos, sieht aber nichts, was dagegen spräche, dass der Brand im Westflügel ausgebrochen ist, dort, wo er das Schlafzimmer vermutet. Er geht hinüber zu einem Fenster des Westflügels und entfernt vorsichtig einen Rest der Scheibe aus dem Fensterrahmen.
Als Erstes fällt ihm auf, dass der Glassplitter fettig ist, mit einem dicken, rußigen Ölfilm überzogen.
Jack spricht diese Beobachtung auf Band, aber er sagt nicht, was er denkt – dass ein solcher Belag auf der Innenseite der Scheibe auf brennbare Kohlenwasserstoffe im Inneren des Hauses verweist. Auch ist der Splitter von vielen kleinen unregelmäßigen Sprüngen durchzogen, was darauf schließen lässt, dass der Brandherd in der Nähe liegt und das Feuer sehr schnell sehr heiß wurde. Auch davon sagt er nichts, er hält sich streng an die Fakten: »Glassplitter mit ölig-rußigem Belag, von vielen Sprüngen durchzogen, deren radialer Verlauf auf Gewalteinwirkung durch Feuer aus dem Inneren des Hauses schließen lässt.«
Er sagt nur, was er sieht – das Beweisstück spricht für sich. Jacks Schlussfolgerungen und Vermutungen haben auf dem Band nichts zu suchen, denn kommt es zum Prozess, wird das Band beschlagnahmt, und spekuliert er auf dem Band über brennbare Kohlenwasserstoffe, wird der Klägeranwalt geltend machen, dass er voreingenommen ist, dass er nach Hinweisen auf eine Brandstiftung sucht und die Hinweise auf einen Brandunfall ignoriert.
Er kann den Anwalt förmlich hören: »Sie haben von Anfang an auf Brandstiftung gesetzt, nicht wahr, Mr. Wade?«
»Nein, Sir.«
»Nun, Sie behaupten aber hier auf diesem Band, dass …«
Es ist also besser, nicht zu sagen, was man denkt.
Einfach Schlamperei, den Fakten vorauszueilen, und es gibt auch andere Erklärungen für einen ölig-rußigen Belag. Wenn das Holz im Inneren des Hauses nicht vollständig verbrennt, kann es zu so einem Rückstand kommen, oder es kann andere Kohlenwasserstoffverbindungen im Haus geben, die völlig unschuldig sind.
Und da bellt immer noch der Hund. Steigert sich richtig rein. Kein wütendes Bellen wie bei einem Köter, der sein Revier verteidigt, eher ein verschrecktes Bellen, ein Jaulen, und Jack spürt, dass der Hund Angst hat, außerdem Hunger und Durst.
Der kann einen fertigmachen, denkt Jack.
Er fotografiert die Glasscherbe, etikettiert sie und steckt sie in eine Beweismitteltüte aus Plastik, von denen er einen Vorrat in seinem Overall mitführt.
Statt ins Haus zu gehen, wie er es vorhatte, macht er sich dann auf die Suche nach dem Hund.
8
Der Hund ist wahrscheinlich weggelaufen, als die Feuerwehrmänner ins Haus eindrangen, und steht jetzt unter Schock. Die Kinder werden sich Sorgen machen um ihren Hund, und sicher wird es sie ein bisschen trösten, wenn sie ihn wiedersehen.
Jack mag Hunde, eigentlich.
Was er nicht so mag, sind Menschen.
Die neunzehn Jahre, seit er hinter den Menschen und ihren Katastrophen herräumt (sieben bei der Polizei, zwölf bei der Versicherung), haben ihn gelehrt, dass Menschen zu allem fähig sind. Sie lügen, betrügen, stehlen, töten und machen eine Menge Dreck. Hunde hingegen haben einen gewissen Sinn für Ethik.
Er findet den Hund unter den tiefen Ästen einer Jacaranda. So ein Schoß- und Spielhund, nichts als Knopfaugen und Gekläff.
»He, Kleiner«, sagt Jack, »ist ja gut.«
Ist es nicht, aber Menschen lügen nun mal.
Dem Hund ist es egal. Er ist einfach froh, ein menschliches Wesen zu sehen und eine freundliche Stimme zu hören. Kommt unter dem Baum vor und beschnüffelt Jacks Hand, um rauszukriegen, wer er ist und was er will.
»Wie heißt du denn?«, fragt Jack.
Das wird er mir gerade verraten, denkt er.
»Leo«, sagt eine Stimme, und Jack springt fast aus seinem Papieroverall vor Schreck.
Er blickt hoch und sieht den alten Mann hinter dem Zaun, mit einem Papagei auf der Schulter.
»Leo«, wiederholt der Papagei.
Leo wedelt mit dem Schwanz.
Was sozusagen der Job des Yorkshire Terriers ist.
»Na, komm«, sagt Jack, »so ist’s brav.«
Er nimmt Leo hoch, klemmt ihn unter den Arm, krault ihm den Kopf und geht auf den Zaun zu.
Er spürt Leos Zittern.
Wie war das mit der Behauptung, dass Menschen ihren Haustieren ähneln und umgekehrt? Jack dachte immer, das gelte nur für Hunde, aber der alte Mann und der Papagei sehen irgendwie gleich aus. Beide haben sie kräftige Schnäbel: Bei dem Papagei versteht sich das von selbst, aber warum sieht die Nase des Mannes wie ein Papageienschnabel aus? Mann und Papagei wirken wie speziesübergreifende siamesische Zwillinge, nur dass der Papagei grün ist – mit grellroten und gelben Partien –, der alte Mann dagegen überwiegend weiß.
Weißes Haar, weißes Hemd, weiße Hose. Die Schuhe kann Jack hinter der Hecke nicht sehen, aber er könnte wetten, dass auch sie weiß sind.
»Howard Meissner«, sagt der Mann, »und Sie sind ein Marsmensch.«
»Beinahe«, sagt Jack. Er streckt ihm die linke Hand hin, weil er Leo unterm anderen Arm hält. »Jack Wade, California Fire and Life.«
»Das ist Eliot.«
Womit er den Papagei meint.
Eliot, Eliot, krächzt der Papagei.
»Schöner Vogel«, sagt Jack.
Schöner Vogel, schöner Vogel.
Jack ahnt, dass der Papagei den Spruch nicht zum ersten Mal hört.
»Schrecklich, das mit Pamela«, sagt Meissner. »Ich hab gesehen, wie sie rausgetragen wurde.«
»Tja.«
Meissners Augen werden feucht.
Er greift über den Zaun und streichelt Leo. »Schon gut, Leo. Du hast getan, was du konntest.«
Jack sieht ihn fragend an, und Meissner erklärt: »Leos Gebell hat mich geweckt. Ich ging ans Fenster, sah das Feuer und wählte die 911.«
»Wann war das?«
»Vier Uhr vierundvierzig.«
»Das wissen Sie so genau, Mr. Meissner?«
»Mein Digitalwecker«, sagt Meissner. »Da merkt man sich die Zahlen. Ich rief sofort an. Aber zu spät.«
»Sie haben getan, was Sie konnten.«
»Ich dachte, Pamela war aus dem Haus gegangen, weil Leo draußen war.«
Leo, Leo.
»Leo war draußen?«, fragt Jack.
»Ja.«
»Als Sie ihn bellen hörten?«
»Ja.«
»Sind Sie sicher, Mr. Meissner?«
Schöner Vogel, schöner Vogel.
Meissner nickt. »Ich habe ihn draußen gesehen, er bellte das Haus an. Ich dachte, Pamela …«
»Ist Leo nachts immer draußen?«
»Ich bitte Sie!«
Eine dumme Frage, Jack weiß es. Niemand lässt so einen Hund über Nacht draußen. In dieser Gegend sieht man überall die Suchanzeigen: vermisste Terrier und vermisste Katzen, aber bei den vielen Kojoten, die sich hier rumtreiben, ist das kein Wunder.
»Kojoten«, sagt Jack.
»Allerdings.«
»Mr. Meissner«, fragt er weiter, »haben Sie die Flammen gesehen?«
Meissner nickt.
»Welche Farbe hatten sie?«
»Rot.«
»Ziegelrot, hellrot, knallrot, kirschrot?«
Meissner denkt nach. »Blutrot. Blutrot trifft es.«
»Und der Rauch?«
Kein Zögern, kein Zweifeln: »Schwarz.«
»Mr. Meissner, wissen Sie, wo sich die Familie aufhielt?«
»Die Kinder waren bei Nicky zum Übernachten. Zum Glück.«
»Sind die Eltern geschieden?«
»Getrennt«, sagt Meissner. »Nicky wohnt jetzt bei seiner Mutter.«
»Und wo wohnt die Mutter?«
»Monarch Bay. Das hab ich den Polizisten gesagt, als sie hier waren, wegen der Benachrichtigung.«
Nur dass sie immer noch suchen, wie Jack von Bentley gehört hat.
»Mir tun die Kinder leid«, sagt Meissner. Er seufzt das Seufzen eines Mannes, der schon zu viel gesehen hat. »Werden rumgeschoben wie Schachfiguren.«
»Verstehe«, sagt Jack. »Na, vielen Dank, Mr. Meissner.«
»Howard.«
»Howard«, wiederholt Jack. Dann fragt er: »Kennen Sie den Grund der Trennung? Worum es da ging?«
»Es lag an Pamela«, sagt er traurig. »Sie hat getrunken.«
Das ist es also, denkt Jack, während sich Meissner entfernt. Pamela ist für einen Abend die Kinder los und greift zur Flasche. Irgendwann lässt sie Leo raus zum Pinkeln, vergisst, dass er draußen ist, und geht mit Flasche und Zigarette ins Bett.
Das heißt, sie raucht und trinkt im Bett. Die Flasche kippt um, Wodka läuft aus. Entweder merkt sie nichts, oder es ist ihr egal. Dann schläft sie ein, mit der brennenden Zigarette. Ihre Hand mit der Zigarette sackt nach unten, die Glut entzündet den Wodka, die Flammen greifen auf die Bettwäsche über, und das Zimmer füllt sich mit Rauch.
Normalerweise dauert es zehn bis fünfzehn Minuten, bis die Bettwäsche zu brennen anfängt. Zehn bis fünfzehn Minuten, in denen Pamela den Rauch hätte riechen, die Hitze hätte spüren können. Sie hätte den Brand ersticken können, und gut. Aber Wodka brennt sofort, mit größerer Hitze als eine glimmende Zigarette, die Flammen greifen sofort auf die Bettwäsche über, und da sie fest schläft, hat die Frau keine Chance.
Es ist der Rauch, der sie umbringt, nicht das Feuer.
Jack stellt sich vor, wie sie im Bett liegt, betrunken und im Tiefschlaf. Ihre Atmung funktioniert, obwohl ihr Verstand weggetreten ist, und mit ihrer Atmung saugt sie den Rauch ein, füllt ihre Lunge damit, bis es zu spät ist.
Sie erstickt am Rauch, während sie schläft.
Wie ein Betrunkener, der am Erbrochenen erstickt.
Es gibt also einen winzigen Trost für Pamela Vale. Sie wusste buchstäblich nicht, wie ihr geschah.
Sie mussten sie von den Sprungfedern kratzen. Aber sie war tot, als ihr brennendes Fleisch mit dem Metall verschmolz. Sie wachte nicht mehr auf, das ist alles. Das Feuer brach aus, sie inhalierte eine tödliche Dosis Rauch, und dann wurde das Feuer, genährt vom Mobiliar und den Balken des Hauses, so heiß und so vernichtend, dass es die Stahlfedern der Matratze zum Schmelzen brachte.
Ein bedauerlicher Unfall.
Es liegt eine grausame, aber auch wieder tröstliche Ironie in einem solchen Feuertod. Grausam, weil es die eigenen Gegenstände sind, an denen das Opfer erstickt – Möbel, Bettwäsche, Decken, Tapeten, Kleider, Bücher, Papiere, Fotos, alles, was sich im Laufe einer Ehe, eines Erdendaseins so ansammelt. Der Tod pumpt diese Sachen in die Lungen des Opfers und lässt es daran ersticken.
Bei einem Brand sterben die meisten an Rauchvergiftung. Die ist wie eine Todesspritze – nein, eher wie eine Gaskammer, weil es wirklich ein Gas ist, an dem man stirbt: Kohlenmonoxid.
Der versicherungstechnische Ausdruck dafür lautet »CO-Vergiftung«.
Das klingt grausam, aber das Tröstliche daran ist, dass es viel angenehmer ist, so zu sterben, als bei lebendigem Leibe gebraten zu werden.
Da hätten wir also einen bedauerlichen Unfall, denkt Jack.
Es passt alles zusammen.
Bis auf den rußigen Glassplitter.
Brennendes Holz erzeugt keine blutroten Flammen – die sind gelb oder orange.
Und der Rauch dürfte grau oder braun aussehen, nicht schwarz.
Andererseits sind das die Beobachtungen eines alten Mannes bei Dunkelheit.
Jack geht mit Leo unterm Arm zum Auto zurück, öffnet den Kofferraum und kramt, bis er die alte Frisbeescheibe findet, die er irgendwann hineingeworfen hat. Holt die Wasserflasche vom Fahrersitz und gießt etwas Wasser in die Frisbeescheibe. Setzt Leo davor, und der kleine Racker fängt sofort an zu schlabbern.
Jack holt ein altes Sweatshirt mit dem Aufdruck Killer Dana aus dem Kofferraum und breitet es über den Beifahrersitz. Kurbelt die Scheibe halb runter, kalkuliert, dass es um diese Morgenstunde nicht allzu heiß im Auto wird, und setzt Leo auf das Sweatshirt.
»Bleib sitzen!«, sagt Jack und kommt sich blöd vor. »Äh, Platz!«
Der Hund ist offensichtlich dankbar für einen Befehl und macht es sich auf dem Sweatshirt bequem.
»Mach keinen Blödsinn, hörst du?«, sagt Jack. Das ist ein klassischer 66er-Mustang, und Jack hat so manche Stunde darauf verwendet, das Interieur originalgetreu herzurichten.
Leos Schwanz klopft auf den Sitz.
»Was war da drinnen los, Leo?«, fragt Jack den Hund. »Du weißt es doch, oder? Also sag’s mir!«
Leo blickt ihn treu an und klopft eifriger mit dem Schwanz.
Aber sagt kein Wort.
»Schon gut«, sagt Jack.
Plaudertaschen kennt Jack zur Genüge. Kein Wunder, bei sieben Jahren Polizei und zwölf Jahren Versicherung. Man braucht die Plaudertaschen, und trotzdem verachtet man sie.
Wieder ein Plus auf dem Konto des Hundes.
Hunde sind aufrechte Wesen, Hunde plaudern nicht.
Leo verrät nichts außer der Tatsache, dass er noch am Leben ist. Was bei Jack ungute Assoziationen auslöst.
Er weiß, dass Brandstifter nie ihre Hunde verbrennen.
Sie verbrennen ihre Häuser, ihre Sachen, ihr Geschäft, ihre Papiere, sie verbrennen sich sogar gegenseitig, aber ihren Hund verschonen sie um jeden Preis. Bei jedem Feuerschaden, der sich als Brandstiftung herausstellt, ist der Hund zufällig irgendwo anders.
Andererseits, denkt Jack, trifft das auch auf die Menschen zu.
Pamela Vale war ein guter Mensch.
Hat viel Geld zur Rettung der Strände gesammelt.
Also lassen wir’s dabei.
Er pellt sich aus dem Overall und legt die Ausrüstung in den Kofferraum zurück.
Die Untersuchung des Schadens muss noch ein Weilchen warten.
Da sind zwei Kinder, deren Eltern getrennt leben, dann stirbt die Mutter, und das Haus brennt ab. Sollen sie wenigstens ihren Hund bekommen.
Ein kleiner Trost für einen beschissenen Deal.
9
Goddamn Billy Hayes schützt das Streichholz mit der hohlen Hand vorm Wind und zündet seine Zigarette an.
Er sitzt auf einem Metallsessel im Kaktusgarten vor seinem Büro, hat Akten auf den Knien, eine Lesebrille auf der Nase und eine Camel im Mundwinkel.
Der Kaktusgarten war seine Idee. Seit die Volksrepublik Kalifornien das Rauchen am Arbeitsplatz verboten hat, ist Billy Vorsitzender des BdKFR, des Bunds der kalifornischen Freiluftraucher. Da er sowieso meistens draußen hockt und raucht, dachte er sich: Warum soll ich’s mir hier nicht gemütlich machen? Und ließ die Freifläche vor seinem Büro mit Kakteen und Felsblöcken bestücken.
Wenn Billy nicht im Büro ist, sitzt er draußen auf dem Stahlklappsessel, wühlt in den Akten und qualmt vor sich hin. Einmal ist Jack am Sonntagabend zu ihm ins Büro gegangen und hat den Schreibtisch rausgeschleppt. Das fand Billy genauso witzig wie Zigaretten mit Filter.
Billy ist vor zwanzig Jahren aus Tucson nach Kalifornien gekommen, um die Schadensabteilung von California Fire and Life zu übernehmen. Gegen seinen Willen, aber die Firma hat gesagt: »Up or out« – Karriere oder Rauswurf. Da sitzt er nun zwischen einem Ocotillo und einem Barrel-Kaktus im Sand, umwabert von Salbeidüften, Zigarettenrauch und den Kohlenmonoxidwolken, die vom Freeway 405 rüberwehen.
Goddamn Billy Hayes ist ganze eins achtundsechzig groß und schmächtig wie eine Marionette, die nur Drähte unter den Kleidern hat. Sein Gesicht ist sonnenverbrannt und schrumplig wie eine Backpflaume, er hat einen silbergrauen Bürstenschnitt und Augen so hellblau wie arktisches Eis. Zu seinen Cowboy-Boots trägt er gute blaue Anzüge – und früher, in Phoenix, als ständig Mafia-Immobilien abbrannten, trug er auch einen 44er-Colt am Gürtel. Die Trescias hatten ihm diskret zu verstehen gegeben, dass auch ihm ein kleiner Unfall passieren könnte, wenn er kein Schutzgeld zahlte.
Und so hat Billy die Sache gelöst: Er betrat Joe Trescias Maklerbüro, den 44er in der Hand, spannte den Hahn, hielt Joe junior den Lauf unter die Nase und sagte: »Wenn schon Unfall, dann jetzt und hier!«
Fünf Ganoven standen um ihn rum und trauten sich nicht, ihre Schießeisen rauszuholen, weil sie wussten, dass dieser Irre keine Hemmungen hatte, Joe juniors Gehirn an der Wand zu verspritzen. Was Joe senior sehr verdrossen hätte. Also standen sie einfach da und schwitzten und sandten Stoßgebete zum heiligen Antonius.
Joe junior blickte an dem blauen Stahllauf entlang in Billys stahlblaue Augen und sagte: »Wir suchen uns eine andere Versicherung.«
Aber das waren die alten Zeiten, heute läuft das so nicht mehr, erst recht nicht in Kalifornien, wo es einfach als unangemessen gelten würde. (»Ich meine, verdammt noch mal«, sagte Billy, als er Jack die Geschichte eines Abends bei einer Flasche Jack Daniel’s und ein paar Bier erzählte. »Wie soll ich hier in einem Staat, wo man nicht mal rauchen darf, jemandem das Gehirn rauspusten?«) Folglich lagert der Colt jetzt im obersten Fach von Billys Schlafzimmerschrank.
Statt Kanonen, denkt Billy, haben wir jetzt Anwälte.
Die sind nicht so schnell, aber mindestens genauso tödlich und viel, viel teurer.
Noch teurer, als Anwälte zu haben, ist es, keine zu haben, denn heutzutage sind Versicherungen, wenn sie Versicherungen verkaufen und auszahlen, vor allem damit beschäftigt, Klagen abzuwehren.
Wir werden verklagt, denkt Billy, wenn wir nicht genug zahlen, wenn wir zu langsam zahlen, wenn wir zu schnell zahlen, aber vor allem, wenn wir gar nicht zahlen.
Was dann der Fall ist, wenn es sich um Brandstiftung handelt, einen vorgetäuschten Diebstahl, einen Autounfall, der nicht passiert ist, oder eine Lebensversicherung für einen Toten, der gar nicht tot ist, sondern seine Piña colada in Botswana schlürft oder irgendeinem anderen gottverlassenen Weltwinkel.
Solche Schadensforderungen muss man ablehnen. Man muss sagen: Sorry, Charlie, es gibt kein Geld, und dann wird man natürlich verklagt, wegen »bösem Willen«.
Die Versicherungen haben eine Heidenangst vor solchen Prozessen.
Sie zahlen am Ende mehr für Anwälte und Gerichtskosten, als der verdammte Schaden sie gekostet hätte. Aber zahlen, wofür man nicht zahlen muss, das wäre das Allerletzte.
Auch so ein Spruch von Goddamn Billy: »Wir bezahlen die Leute doch nicht dafür, dass sie ihre eigenen Häuser abfackeln!«
Außer natürlich, ein Richter und/oder die Geschworenen wollen es so. Und finden, dass die Ablehnung »unbegründet« ist oder die Entschädigung zu niedrig. Dann wird dir »böser Wille« unterstellt, und du gerätst in Teufels Küche, weil sie dir nicht nur mit »Vertragsverletzung« kommen, sondern auch mit »Zahlungsverzug« und – wenn sie dir richtig eins reinwürgen wollen – mit Geldbußen.
Dann bezahlst du als Versicherer dafür, dass die Versicherten ihre Häuser abbrennen, und entschädigst sie für den Ärger, den du ihnen gemacht hast, und zahlst ein paar Millionen Strafe obendrein – falls der Drecksack von Klägeranwalt es schafft, die Geschworenen gegen dich aufzuhetzen, weil du den armen Versicherten, die ihr eigenes Haus angezündet haben, schuldhaftes Verhalten anhängen wolltest.
Es ist also absolut möglich – was heißt möglich? Es passiert wirklich! –, dass man eine Diebstahlentschädigung von 10000 Dollar ablehnt und dafür eine schlappe Million an Kompensationen, Gerichtskosten und Strafen zahlen muss.
Wer einen guten Anwalt hat, den richtigen Richter erwischt und die richtige Jury, kann sich gar nichts Besseres wünschen als eine Versicherung, die seine Schadensforderung ablehnt.
Genau deshalb hat Billy die Brandsache Vale an Jack Wade übergeben, denn Jack Wade ist der beste Schadensregulierer, den er hat.
Das geht Goddamn Billy so durch den Kopf, während er die Versicherungspolice der Vales durchblättert und feststellt, dass er es mit einem wahren Juwel zu tun hat: Das Haus ist mit 5 Millionen versichert, sein Inhalt mit 750000, die um weitere 500000 aufgestockt wurden.
Nicht zu vergessen die Lebensversicherung der Frau: 250000.
Alles Gründe, Jack Wade auf den Fall anzusetzen.
Er kennt Jack, und Jack wird die Sache regeln, komme, was wolle.
10
Jack ist in Dana Point aufgewachsen, was damals ein kleiner Badeort war. Ein paar Motels, ein paar Imbisslokale – und Wellen, für die man sich wegschmeißt. Tatsächlich haben sich schon so viele Surfer für diese Wellen weggeschmissen, dass der Strand bei denen, die Bescheid wissen, Killer Dana heißt.
Jacks Vater ist Baudienstleister, also ist Jack mit der Arbeit groß geworden. Jacks Mutter ist die Frau eines Baudienstleisters. Sie musste sich damit abfinden, dass ihr Kleiner, sobald er den Hammer halten konnte, nach der Schule, an Sonn- und Feiertagen und auch in den Ferien zu Daddy auf den Bau ging. Jack war erst sieben, als er für seinen Dad den Hammer schwang und, als Dad mal nach hinten langte, ihm – zack! – mit dem Hammer auf die Finger schlug, denn der kleine Jack nahm seinen Job ernst. Und er wuchs an seinen Aufgaben. Mit dreizehn verfugte er Balken, verbaute er Gipskarton, goss er Fundamente: Mit sechzehn hockte er auf dem Dachstuhl und nagelte Schindeln fest.
Jack weiß, was Arbeiten ist.
Arbeitet er mal nicht, macht er, was alle in Dana Point machen – er surft.
Auch das hat er bei seinem Dad gelernt, denn John senior war einer der Ersten, die dort mit dem Longboard rausgingen. John senior hat schon ein hölzernes Velzy-Ten-Foot-Longboard geritten, als Surfer noch als Gammler beschimpft wurden, aber John senior konnte das egal sein, denn er verdiente sein Geld mit ehrlicher Arbeit, und das taten Gammler nicht.
Etwa eine Million Mal, ob am Strand oder auf dem Bau, hat John senior seinem Sohn Jack erklärt: »Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Surfen ist schöner, aber man muss arbeiten, um sich das Surfen zu verdienen. Mir ist egal, was du wirst, aber arbeiten musst du. Du musst dir deinen Lebensunterhalt verdienen.«
»Ja, Dad.«
»Ja, ja, ja!«, sagt Dad. »Wenn du deinen Job machst, und du machst ihn gut, dann verdienst du dein Geld. Dann gehört dir deine Freizeit, du schuldest keinem was, und du machst, wozu du Lust hast.«
Mit anderen Worten: Sein Dad bringt ihm das Arbeiten und das Surfen bei und zeigt ihm all die anderen guten Sachen: In-and-Out-Burgers, Dick Dale & His Del-Tones, tacos carne asada bei El Maguey, Longboards, den Break von Lower Trestles – und den alten Trailerpark von Dana Strands.
Für Jack junior ist dieser Hügelrücken über dem Dana Strands Beach der schönste Flecken der Erde. Der Trailerpark ist seit Jahren weg, bis auf ein paar Bruchbuden und ein paar Stellplätze, aber wenn er dort oben steht, zwischen Eukalyptusbäumen und Palmen, und den Strand sieht, die geschwungene Küstenlinie, die sich bis Dana Head erstreckt, dann kann es gar keinen Zweifel geben: Er steht auf dem schönsten Flecken der Erde.
Jack junior verbringt Stunden – wenn nicht Tage – hier oben auf dem letzten unerschlossenen Baugrund der südkalifornischen Küste. Er surft eine Weile, dann steigt er die Schlucht zum Hochufer rauf, duckt sich unter einem alten Zaun durch und läuft da oben rum. Oder setzt sich in die Mehrzweckhalle, wo es früher Tischtennisplatten gab und eine Jukebox und einen Imbiss, wo man Burger und Hotdogs und Chili bekam. Manchmal bei Gewitter setzt er sich rein und sieht die Blitze über Dana Head zucken, manchmal während der Walwanderung setzt er sich raus auf die Klippe und verfolgt die großen Grauen auf ihrem Weg nach Norden. Oder er sitzt einfach da, starrt auf den Ozean und macht gar nichts.
Nur darf er das nicht zu lange tun, wenn es nach seinem Dad geht. John senior deckt ihn immer schön mit Arbeit ein, besonders als er größer wird und größere Sachen schultern kann.
Aber wenn sie mal wieder einen schwierigen Job erledigt haben, fahren sie mit dem Truck runter nach Baja, in ein kleines mexikanisches Fischerdorf. Schlafen auf der Ladefläche, surfen an den meilenlangen leeren Stränden, machen in der tödlichen Mittagshitze Siesta unter Palmen. Am Nachmittag bestellen sie ihren Fisch zum Abendessen, und die Fischer fahren raus, fangen den Fisch und haben ihn bei Sonnenuntergang fertig. Jack und sein Dad sitzen dann draußen und essen den Fisch und die Tortillas direkt vom Grill, schlürfen eiskaltes mexikanisches Bier und reden über die Wellen, die sie erwischt haben oder von denen sie erwischt wurden und über alles Mögliche. Dann greift vielleicht einer aus dem Dorf zur Gitarre, und wenn Jack und sein Dad ein bisschen angeheitert sind, singen sie die canciones mit. Oder legen sich in ihren Truck und hören auf Mittelwelle ein Spiel der Dodgers, oder sie quatschen, während im Hintergrund ein Mariachi-Sender dudelt. Oder glotzen in den Sternenhimmel und schlafen einfach ein.
Nach ein paar Tagen fahren sie zurück nach el norte und machen sich wieder an die Arbeit.
Jack bringt die Highschool zu Ende, studiert ein paar Semester an der Uni von San Diego, stellt fest, dass Studieren nicht sein Ding ist, und bewirbt sich bei der Polizei. Erzählt seinem Dad, er will mal eine Weile was anderes machen als Trockenbau.
»Ich kann’s dir nicht verübeln«, sagt sein Dad.
Jack besteht die schriftliche Aufnahmeprüfung mit Bravour, vom Bauen und vom Surfen hat er eine kräftige Statur, also kommt er gut zurecht bei der Polizei von Orange County. Macht ein paar Jahre die üblichen Sachen, schreibt Anzeigen, nimmt Verhaftungen vor, fährt Streife – aber Jack ist ein kluger Junge, er will was werden, und da bei der Mordkommission kein Platz frei ist, bewirbt er sich an der Feuerwehrschule.
Denkt, wenn er was vom Bauen versteht, versteht er auch was vom Gegenteil.
Und damit hat er recht.
11
»Prometheus«, sagt der kleine Professor im Tweed-Anzug.
Pro… wer?, fragt sich Jack – und was zum Teufel hat der mit Feuer zu tun?
Der Professor starrt in lauter fragende Gesichter.
»Dann lesen Sie mal Aischylos«, sagt er, was die Verwirrung noch größer macht. »Als Prometheus der Menschheit das Feuer brachte, ketteten ihn die anderen Götter an einen Felsen und schickten Adler, die für alle Ewigkeit von seiner Leber fraßen. Doch wenn man bedenkt, was die Menschen mit dem Feuer alles anstellen, ist er noch gut weggekommen.«
Jack hatte geglaubt, auf einer Feuerwehrschule von Feuerwehrleuten unterrichtet zu werden, doch da steht nun dieser Professor Füller mit Schlips und Kragen und faselt von Göttern und Ewigkeit und erklärt den Studenten mit seinem irischen Akzent, dass sie das Verhalten des Feuers niemals begreifen werden, wenn sie die Chemie des Feuers nicht begreifen.
Was ist Feuer? Mit dieser Frage geht es los.
Immer schön beim Urschleim anfangen.
Also …
»Feuer ist das aktive Stadium der Verbrennung«, verkündet Füller. »Verbrennung ist die Oxidation eines Brennstoffes, bei der eine Flamme, Hitze und Licht entstehen.«
»Also Verbrennung gleich Flamme, Hitze plus Licht?«, fragt Jack.
Füller nickt, dann fragt er: »Aber was ist eine Flamme?«
Der Hörsaal stöhnt auf.
Es ist leicht, eine Flamme zu beschreiben – sie ist rot, gelb, orange, manchmal blau –, aber zu definieren? Füller lässt die Studenten eine Weile schmoren, dann fragt er sehr unprofessoral: »Erzählen Sie mir nicht, dass hier keiner sitzt, der nicht schon mal einen Furz angezündet hat!«
Ahhh!, macht der Hörsaal.
Ahhh!, denkt Jack. Eine Flamme ist brennendes Gas.
»Brennende Gase«, sagt Füller. »Verbrennung ist also die Oxidation von Brennstoffen, die brennende Gase, Hitze und Licht erzeugt. Was zu welcher Frage führt?«
»Was Oxidation ist«, antwortet Jack.
»Ein Pluspunkt für das Surfer-As«, sagt Füller. »Wie heißen Sie?«
»Jack Wade.«
»Nun, Master Jack«, sagt Füller, »Oxidation umfasst eine Reihe chemischer Reaktionen, die ablaufen, wenn ein Atom – das heißt, Materie – eine chemische Verbindung mit einem Sauerstoffmolekül eingeht. Jetzt werden Sie alle bereuen, dass Sie in Chemie nicht besser aufgepasst haben.«
Allerdings, denkt Jack, denn jetzt schreibt Füller mit quietschender Kreide chemische Gleichungen an die Tafel und doziert weiter: »Damit eine Oxidation stattfindet, muss ein brennbarer Stoff – darüber reden wir noch – mit Sauerstoff zusammengebracht werden. Dieser Vorgang wird als exothermische – also Wärme erzeugende – Reaktion bezeichnet.«
»Eine einfache Oxidation«, sagt Füller. »Wenn man Wasserstoff und Sauerstoff zusammenbringt, bekommt man zwei Wassermoleküle und Wärme. Die Wärme wird in BTU gemessen – British thermal units. Ein BTU ist die Wärmemenge, die benötigt wird, um ein Pfund Wasser um ein Grad Fahrenheit zu erwärmen. Je mehr Wärme entsteht, desto größer also die Temperatur. Oder, einfach gesagt: je mehr BTUs, desto heißer das Feuer.«
Füller doziert weiter: »Sehen Sie, Gentlemen, bei einem Feuer müssen drei Dinge zusammenwirken: Sauerstoff, Brennstoff und Wärme. Ohne Sauerstoff keine Oxidation – also kein Feuer. Ohne Brennstoff kein Gegenstand der Oxidation – also kein Feuer. Ein Brennstoff ohne ausreichende Wärmeenergie – das Feuer erlischt.«
»Sehen Sie her«, sagt Füller und zündet ein Streichholz an. »Wir haben Sauerstoff, wir haben Brennstoff, wir haben Wärmeenergie.«
Das Streichholz brennt ein paar Sekunden und geht aus.
»Was ist passiert?«, fragt Füller. »Wir hatten jede Menge Sauerstoff, aber nicht viel Brennstoff und nicht viel Wärmeenergie.«
Er zündet ein neues Streichholz an.
»Ich versuche jetzt, den Hörsaal anzuzünden.«
Er hält die Flamme an den Metalltisch.
Die Flamme hinterlässt einen Rußfleck und erlischt.
»Was ist passiert?«, fragt Füller. »Wir haben Sauerstoff, wir haben Wärmeenergie und eine Menge Brennstoff – der Tisch ist groß. Wo ist das Feuer geblieben?«
»Die meisten Metalle brennen nicht so leicht«, sagt Jack.
»Die meisten Metalle brennen nicht so leicht«, wiederholt Füller. »So sagt es der Laie, wenn er von Entflammbarkeit spricht. Andere Substanzen sind leichter entflammbar. Zum Beispiel…«
Er reißt eine Seite aus seinem Schreibblock, zündet wieder ein Streichholz an und hält es an das Blatt. »Papier brennt sofort«, sagt er, wirft das Blatt in einen Blecheimer und klappt den Deckel zu.
»Damit habe ich der Flamme den Sauerstoff entzogen«, kommentiert er. »Sehen Sie, der Flammpunkt des Papiers ist niedriger als der des Tisches. Der Flammpunkt ist die Temperatur, bei der sich ein Brennstoff entflammen lässt. Mit einem einfachen Streichholz kann man Papier entflammen, aber es hat bei Weitem nicht genug BTUs, um den Flammpunkt des Metalltischs zu erreichen. Es kann nicht die Oxidation starten, die den Tisch in Brand setzt und weiterbrennen lässt.
Wenn wir dem Feuer mehr Brennstoff hinzufügen und damit genügend BTUs entwickeln, kommt der Punkt, bei dem der Tisch zu schmelzen beginnt. Das ist eine Kettenreaktion, Gentlemen – eine chemische Kettenreaktion. Schwierig im Einzelnen zu beschreiben, weil es ein endloser Zyklus von Kettenreaktionen ist, die in ihren Einzelheiten sehr beeindruckend sind. Aber aus praktischen Gründen reden wir hier von Brennstoffmenge, vom Flammpunkt des Brennstoffs und der Wärmeleitfähigkeit des Brennstoffs.
Also, die Menge des Brennstoffs – in korrekter Terminologie die Brandlast. Warum ist es wichtig, die Brandlast eines abgebrannten Gebäudes zu ermitteln? Wenn Sie zum Beispiel einen geschmolzenen Stahltisch in einem abgebrannten Gebäude vorfinden, und die Brandlast des Gebäudes hätte nicht genügend BTUs erzeugen können, um das Metall zum Schmelzen zu bringen, dann entsteht Klärungsbedarf.
Und Sie sollten lieber mitschreiben, weil Sie die Terminologie brauchen, wenn Sie den Test bestehen wollen.«
Jack schreibt mit.
Er will den Test nicht nur bestehen – er will der Beste sein.
12
Deshalb muss er gewisse Begriffe auswendig lernen.
Wie Brandlast.
Die Brandlast sind die potenziellen BTUs pro Quadratfuß des fraglichen Gebäudes. Man errechnet sie, indem man die Gesamtmasse des Gebäudes ermittelt und mit den gesamten BTUs der verwendeten Materialien multipliziert – 8000BTUs pro Pfund Holz, 16000BTUs pro Pfund Plastik usw. usw.
Unterschiedliche Materialien erzeugen unterschiedliche Wärme. Holz etwa 8000BTUs, Kohlen etwa 12000BTUs, brennbare Flüssigkeiten zwischen 16000 und 21000BTUs.
Ein weiterer Terminus: die Wärmefreisetzungsrate. Das ist die Geschwindigkeit, mit der ein Feuer zunimmt, und sie hängt von dem Brennstoff ab, von dem es zehrt. Manche Materialien brennen schnell und heiß, andere eher langsam. Die Wärmefreisetzungsrate wird in BTUs pro Sekunde gemessen – eine Energie, die auch in Kilowatt angegeben wird. Ein Müllsack, der mit den üblichen Abfällen gefüllt ist, liefert zwischen 140 und 350 Kilowatt, ein Fernsehapparat etwa 250, eine Petroleumpfütze von zwei Quadratfuß Größe etwa 400. Petroleum erzeugt ein schnelles, heißes Feuer.
Jack lernt, dass Brandlast nicht gleich Brandlast ist, sondern in tote und lebende Brandlast unterteilt wird. Die tote Brandlast ist die Gesamtmasse des Bauwerks mit allen festen Einbauten. Die lebende Brandlast ist die Gesamtmasse aller beweglichen Gegenstände im Bauwerk – Möbel, Geräte, Kunstwerke, Spielsachen, Menschen und Haustiere. Die Ironie liegt darin, dass die »lebende Brandlast« nach einem Brand mit ziemlicher Sicherheit tot ist.
Die Wärmeleitfähigkeit ist sozusagen die Wärmemenge, die eine brennende Substanz abgibt. Manche Substanzen halten einen Großteil ihrer Wärme fest, manche übertragen sie auf andere Substanzen. Jack lernt, dass ein Feuer auf Substanzen mit hoher Wärmeleitfähigkeit treffen muss, damit es sich ausbreiten und seine BTUs steigern kann. Papier zum Beispiel besitzt eine hohe Wärmeleitfähigkeit, während Wasser die Wärme eher schluckt, als sie weiterzuleiten. Die Luft ist wiederum sehr wärmeleitfähig, weil sie 21 Prozent Sauerstoff enthält, daher breiten sich die meisten Gebäudebrände durch Konvektion aus, worunter man die Wärmeübertragung durch ein zirkulierendes Medium – gewöhnlich Luft – versteht. Brände klettern von unten nach oben, weil oben die Luft ist.
»Das Wichtigste ist der Brennstoff«, doziert Füller. »Sag mir, was du isst, und ich sage dir, wer du bist. Bei Bränden ist es nicht anders. Aus der Brennstoffmasse oder Brandlast eines Bauwerks kann man die Schwere des Brandes, den Brandherd, die Ausbreitungsrichtung und -geschwindigkeit, die Branddauer ermitteln.«
Jack bekommt ein A im Chemietest.
Während er die Tests zurückgibt, steigert sich Füller zu neuen rhetorischen Höhenflügen.
»Also«, fragt er, »was passiert bei einem Feuer? Es verläuft genau nach der Dramenkurve eines klassischen Dreiakters, Gentlemen. Und zwar im Rhythmus einer Liebesaffäre: Oxidation, erster Akt: die Schwelphase. Die Liebeswerbung, wenn Sie so wollen, die chemische Reaktion zwischen dem Sauerstoff und festen Molekülen, wobei der Sauerstoff versucht, Wärme in der Festmaterie zu erzeugen. Die Werbephase kann einen Sekundenbruchteil dauern – wenn es eine heiße Affäre mit Benzin oder Petroleum und einem anderen flüssigen Brandbeschleuniger ist, den leichten Mädchen an der entflammbaren Straßenecke, könnte man sagen. Oder, um die Metaphern zu wechseln, flüssige Brandbeschleuniger sind die Aphrodisiaka der Werbephase. Sie sind die legendäre Spanische Fliege, das betörende Glas Wein, der Herrenduft, die Platinum Card, die ganz zufällig neben der Couch liegt. Diese Dinge können die Leidenschaft im Nu entfachen.
Aber die Schwelphase kann auch Stunden oder gar Tage dauern. Das brennbare Material muss hofiert und verwöhnt werden, zum Essen ausgeführt, ins Kino eingeladen werden. ›Komm am Sonntag zum Dinner, meine Eltern möchten dich gern kennenlernen.‹ Das Feuer ist ein geduldiger Verführer! Mit Ausdauer versucht es, ein bisschen Hitze zu erzeugen, und wenn es genügend Luft bekommt, hält es durch. Ein Kuss in den Nacken, ein Griff unter die Bluse, eine Fummelei im Autokino, immer baggern, baggern, baggern, Gentlemen, bis die spröde Materie weich wird, sich verflüssigt und in brennendes Gas verwandelt. Eine tastende Hand unterm Rock, die versucht, den Zündpunkt herbeizuführen … und dann:
Zweiter Akt, die Brandentwicklung. Der Zündpunkt ist erreicht. Jetzt bricht das Feuer aus, flammende Leidenschaft, Gentlemen. Das erhitzte Gas ist leichter als Luft, es steigt auf wie ein Zeppelin. Es reißt den Sauerstoff an sich und staut sich an der Decke. Ist es heiß genug, entflammt es die Deckenmaterialien, es kann auch ein Loch ins Dach schlagen, um an die würzige Frischluft heranzukommen. Die heißen Gase strahlen ihre Hitze auch nach unten ab und entflammen Gegenstände, die sich unter ihnen befinden. Weshalb es passieren kann, dass erst die Zimmerdecke brennt und dann die Möbel.
Es hängt alles nur vom Brennstoff ab, Gentlemen. Ist er eine kühle Blondine mit hohem Flammpunkt und niedriger Wärmeleitfähigkeit, dann erkaltet die Beziehung wegen mangelnder Leidenschaft. Sie können machen, was Sie wollen, Gentlemen, die frigide Zicke springt nicht an. Oder ist sie eine heiße Nummer? Niedriger Flammpunkt, hervorragende Wärmeleitfähigkeit? Dann bleiben Sie dran, dann geht die Post ab. Ist sie heiß genug, erreicht Ihr Feuer schnell die kritische Temperatur. Die Hitzestrahlung an der Decke übersteigt den Zündpunkt aller Gegenstände im Raum, und jetzt fangen die Feen an zu tanzen.
Was meine ich mit dieser esoterischen und etwas weibischen Bezeichnung? Kurz vor dem Flashover, der Durchzündung, Gentlemen, sehen Sie, wie sich kleine Gasflämmchen in der Luft entzünden. Das sind die tanzenden Feen, und wenn man die sieht, ist es Zeit, den Rückwärtsgang einzulegen, Gentlemen. Denn die tanzenden Feen kündigen den dritten Akt an – wuuusch! –, die Flashover-Phase. Alle brennbaren Oberflächen erreichen den Zündpunkt, und jetzt ist das Feuer völlig außer Kontrolle. Eine rasende Leidenschaft, die alles verschlingt. Nichts kann ihr widerstehen, alles Brennbare macht die Beine breit und ergibt sich der Feuerorgie. Die Hitze steigt mit der Luft nach oben, sie strahlt nach unten ab und wird seitlich durch Wärmeleitung übertragen. Sie wütet in alle Richtungen. Bei jedem Temperaturschritt von etwa 10 Grad verdoppelt sich die Wärmeintensität. Die Hitze beschleunigt das Feuer, die Beschleunigung steigert die Hitze. Das ist der Orgasmus, Gentlemen, der ekstatische Höhepunkt der Affäre. Das Feuer brüllt und tobt und stöhnt und röchelt. Es heult wie tausend Furien und brennt, bis nichts Brennbares mehr da ist – oder jemand kommt, der es löscht. Und jetzt rauchen wir erst mal eine.«
Er zündet sich eine Zigarette an und lehnt sich in einer Parodie sexueller Erschöpfung an den Tisch. Nach ein paar Zügen fasst er zusammen: »Also drei Phasen, Gentlemen: die Schwelphase, die Brandentwicklung und der Flashover. Die erste Phase kommt oft zum Stillstand, aus Mangel an Energie, aus Mangel an Sauerstoff, die zweite Phase kann durch beherztes Eingreifen gestoppt werden, doch für die dritte Phase, den Flashover, gilt nur eines: Macht die Schotten dicht!
Was ist also ein Feuer? Eine trockene chemische Interaktion von Molekülen. Ein Dreiakter mit oftmals tragischem Ausgang. Eine Metapher für Sex, die auch unseren Sprachgebrauch beherrscht: eine ›flammende Leidenschaft‹ ›Du machst mich ganz heiß, Baby!‹ Die stereotype Verführungsszene auf dem Bärenfell vor dem lodernden Kaminfeuer. Ein Feuer, das nur durch Absonderung kühlender exothermischer Flüssigkeiten gelöscht werden kann.
Das ist die Chemie, die der alte Prometheus instinktiv begriff«, sagt Füller. »Er gab sie an die Menschen weiter, die sie nun benutzen, um ihre Höhlen zu heizen, ihr Essen zu kochen – und ihre Mitmenschen auf jede erdenkliche Art ins Jenseits zu befördern. Die Funken sprühen, und die Adler fressen sich satt.«
Er drückt die Zigarette aus und wirft sie in den Blecheimer. »Wagen wir also ein Tänzchen!«
Ein Tänzchen?
13
Der verrückte Hund schickt sie in ein brennendes Haus.
Jack ist begeistert.
Feuerwehrschule – das ist der Hammer!
Der kleine Mann mit dem irischen Akzent führt sie zu einem Platz mit einem zweistöckigen Betonkasten, der aussieht wie von einem sowjetischen Architektenkollektiv entworfen. Das Ding hat Türen und Fenster und überall Feuertreppen, und es stehen dort Feuerwehrleute rum, die sich schon die Lippen lecken, als sie die Studenten kommen sehen.
Sie haben so ein Schmunzeln im Gesicht, die Feuerwehrleute, als wollten sie sagen: Willkommen in der Welt des Feuers. Unsere Schläuche warten schon.
Da liegt auch ein Haufen Atemschutzmasken – der die Studenten ein klein wenig nervös macht.
Ein älterer Feuerwehrmann zeigt ihnen, wie man die Masken aufsetzt und wie man sie benutzt.
Fünf Minuten später steht Jack mit seinen Mitstudenten dicht gedrängt im Obergeschoss des Betonkastens, es ist heiß und stickig, und dann wird es stockdunkel, weil die Tür zuknallt. Ein paar fangen an, hektisch ihre Masken aufzusetzen, doch eine Lautsprecherstimme brüllt: Noch nicht!!!
Erst sollen Sie eine Erfahrung machen, Gentlemen.
Das Ersticken oder die Asphyxie.
Als Erstes spürt Jack die Hitze, dann füllt sich der Raum mit Rauch. Das ist der Irrsinn, denkt Jack, und Irrsinn deshalb, weil er hier mit einem Haufen Kerle in einem finsteren Raum eingesperrt ist, in dem es irgendwo brennt.
Jack weiß, was hier gespielt wird.
Wer jetzt die Maske aufsetzt, bevor der Befehl dazu kommt, ist draußen – aus dem Haus, aus der Schule, aus dem Rennen. Also hockt er sich so tief wie möglich auf den Boden, wo es noch ein bisschen Luft gibt. Schon fangen seine Augen an zu brennen und zu stechen, er würgt und schnappt nach Luft wie alle anderen, und er spürt eine Urangst – das, was man gemeinhin Panik nennt. Er spürt sie und kostet sie aus. Sie wollen, dass ich das spüre, mit diesem Gefühl wollen sie mich konfrontieren. Wollen, dass ich aufgebe, durchdrehe, ausraste.
Was tatsächlich ein paar machen – doch die sind Geschichte, längst vergessen. Jack sagt sich: Scheiß drauf. Mehr als einmal in seinem jungen Leben war er unter einer Welle begraben. Er weiß, wie das ist, wenn man keine Luft kriegt. Also sagt er sich: Nur zu, Jungs. Eher krepiere ich, als dass ich nach der Maske greife.
Er ist trotzdem sehr erleichtert, als er Füller brüllen hört: Masken auf, ihr blöden Hunde! Nur dass das im Dunklen und in dem Gedränge gar nicht so einfach ist, wenn sie mit den Ellbogen aneinanderstoßen, wenn das Gehirn den Händen befiehlt, sich verdammt noch mal zu beeilen, und die Hände dem Gehirn mit dem Fingern Fuck you signalisieren, bis – aaaahhhhhhh! – die Maske endlich sitzt.
Nie war Sauerstoff so köstlich.
Dann geht die Tür auf, ein erlösender Lichtstrahl dringt in diese Ersatzhölle, und Jack sieht ein paar Jungs stehen, ein paar sind umgefallen, einer hockt am Boden und fummelt immer noch an seiner Maske. Der ist gleich erledigt, denkt Jack, duckt sich und presst ihm die Maske vors Gesicht, schnallt sie ihm fest, und in dem Moment kommt Füllers Stimme über den Lautsprecher: Raus mit euch, ihr Vollidioten!
Jack reißt sich kurz die Maske runter und brüllt: »Immer mit der Ruhe, Jungs!«