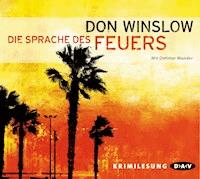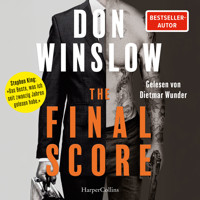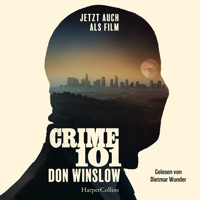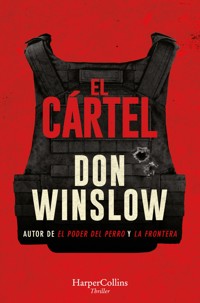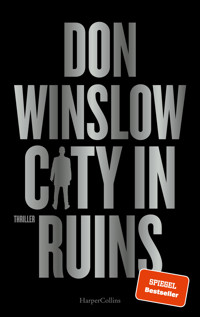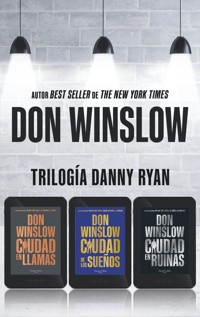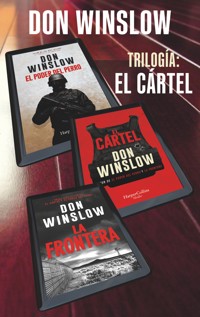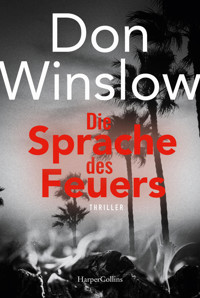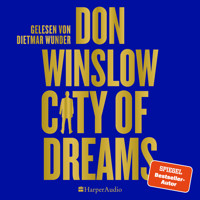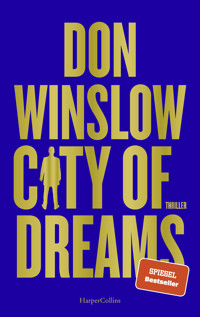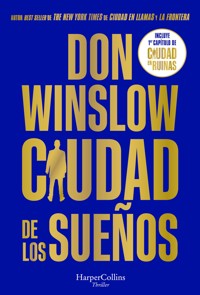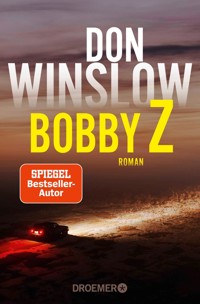9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die City on Fire-Saga
- Sprache: Deutsch
Band 1 der neuen furiosen Trilogie von Bestsellerautor Don Winslow
Es ist das Jahr 1986: Danny und sein bester Freund Pat kontrollieren mit ihrer Gang die Straßen von Providence, Rhode Island. Sie machen ihr Geld mit Raub, Schmuggel und Schutzgelderpressung und leben in friedlicher Koexistenz mit der italienischen Mafia-Familie Moretti. Doch als der Bruder von Pat einem Moretti die Frau ausspannt, herrscht Krieg in Dogtown. Morde erschüttern die Stadt. Als das Oberhaupt der Murphys brutal getötet wird, rückt Danny an die Spitze des Clans. Doch er will raus dem Business, raus aus Dogtown. Ein letzter Deal soll ihm das Startkapital für ein neues Leben beschaffen. Dafür lässt er sich auf ein Angebot des Feindes ein.
Ein grandioser Thriller über Loyalität, Betrug, Ehre und Korruption auf beiden Seiten des Gesetzes.
»Der beste Thrillerautor unserer Tage.« DIE WELT am Sonntag
»Ein Meister der Spannung zeigt sein Können.« The New York Times
»Ich kann es kaum erwarten, das zu lesen. Winslow in Bestform.« Stephen King zu Jahre des Jägers
»Mit eindringlicher Menschlichkeit in den tragischen Details und mit einer epischen Monumentalität, die geradezu an Shakespeare erinnert – vermutlich der beste Cop-Roman aller Zeiten.« Lee Child zu Corruption
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem TitelCity on Fire bei William Morrow, New York.
© by Don Winslow Deutsche Erstausgabe © 2022 für die deutschsprachige Ausgabe by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Published by arrangement with HarperCollins Publishers L.L.C., New York Covergestaltung von Deborah Kuschel nach einem Originalentwurf von Gregg Kulick Coverabbildung von Magdalena Russocka / Trevillion Images E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck ISBN E-Book 9783749903214www.harpercollins.de
WIDMUNG
GEWIDMET DEN TODESOPFERN DER PANDEMIE
REQUIESCAT IN PACE
ZITAT
JETZO FÜRWAHR SCHIEN GANZ MIR HINABZUSINKEN IN FEUER ILIUM …
VirgilAeneis Zweiter Gesang
ERSTER TEIL
ERSTER TEIL
Pasco Ferris Clambake
Goshen Beach, Rhode Island August 1986
Doch nun geht zum Mahle, damit wir rüsten den Angriff!
HomerIlias
EINS
Danny Ryan sieht die Frau dem Wasser entsteigen, sie taucht auf wie ein Bild aus einem Traum vom Meer, wie eine Vision.
Nur dass sie real ist und es wegen ihr Ärger geben wird.
Wie meistens mit schönen Frauen.
Danny weiß das; nur ahnt er nicht, was für einen Wahnsinnsärger diese hier lostreten wird. Wüsste er, was passieren wird, würde er vielleicht zu ihr in die Wellen waten und ihren Kopf unter Wasser drücken, bis sie sich nicht mehr rührt.
Aber er weiß es nicht.
Die grelle Sonne knallt ihm ins Gesicht. Danny sitzt im Sand vor Pascos Strandhaus und mustert die Frau hinter dem Schutz seiner Sonnenbrille. Blonde Haare, tiefblaue Augen und ein Körper, den der schwarze Bikini eher hervorhebt als verdeckt. Ihr Bauch ist straff und flach, die Beine muskulös und schlank. Unvorstellbar, dass sie von Kartoffeln und Sonntagsbraten mit Soße in fünfzehn Jahren breite Hüften und einen dicken Hintern bekommen wird.
Sie steigt aus dem Wasser, und ihre salzige Haut glitzert in der Sonne.
Terri Ryan stößt ihrem Mann einen Ellbogen zwischen die Rippen.
»Was?«, fragt Danny, gespielt unschuldig.
»Ich seh doch, dass du guckst«, sagt Terri.
Alle gucken – Pat, Jimmy, er und die Frauen auch – Sheila, Angie und Terri.
»Kein Wunder«, sagt Terri. »Bei dem Vorbau.«
»Wo du auch wieder hinschaust«, sagt Danny.
»Das sagt der Richtige – ich will gar nicht wissen, was du denkst«, erwidert Terri.
»Gar nichts.«
»Ich geb dir gleich gar nichts«, sagt Terri und pumpt mit der rechten Hand rauf und runter. Sie setzt sich, um die Frau besser in den Blick zu nehmen. »Wenn ich solche Titten hätte, würde ich auch einen Bikini anziehen.«
Terri trägt einen schwarzen Einteiler. Danny findet, sie sieht gut darin aus.
»Ich mag deine Titten«, sagt Danny.
»Gute Antwort.«
Danny beobachtet die schöne Frau, die jetzt ihr Handtuch nimmt und sich abtrocknet. Sie verbringt bestimmt viel Zeit im Fitnessstudio, denkt er. Achtet auf sich. Garantiert arbeitet sie irgendwo im Verkauf. Irgendwas Hochpreisiges – Luxuswagen, vielleicht Immobilien. Oder Anlageberatung? Welcher Mann würde ihr etwas abschlagen, sie runterhandeln und vor ihr knauserig wirken wollen? Das wird nicht passieren.
Sie geht, und Danny schaut ihr hinterher.
Als würde man aus einem Traum aufwachen, aus dem man nicht aufwachen will, weil er so schön ist.
In der vergangenen Nacht hat er leider nicht viel Schlaf bekommen und ist jetzt müde. Sie haben einen Laster mit Armani-Anzügen ausgeräumt, Pat, Jimmy MacNeese und er, drüben im Westen von Massachussetts. Ein Kinderspiel, über Peter Moretti hatten sie einen Insidertipp erhalten. Der Fahrer war eingeweiht, alle machten mit, und niemand wurde verletzt, trotzdem war’s eine lange Fahrt, und sie waren erst bei Sonnenaufgang zurück an der Küste.
»Schon okay«, sagt Terri und legt sich wieder auf ihr Handtuch. »Die soll dich ruhig heißmachen, das kommt mir nur zugute.«
Terri weiß, dass ihr Mann sie liebt, und Danny Ryan ist sowieso treu wie ein Hund. Er bringt es gar nicht fertig, sie zu betrügen. Ihr egal, wenn er beim Anblick anderer Frauen Appetit bekommt, solange zu Hause gegessen wird. Viele verheiratete Männer brauchen hin und wieder Abwechslung, aber Danny nicht.
Und selbst wenn, hätte er ein viel zu schlechtes Gewissen.
Darüber haben sie schon Witze gemacht. »Du würdest es dem Priester beichten«, hat Terri gesagt, »und mir. Wahrscheinlich würdest du sogar eine Anzeige in der Zeitung schalten, um dein Gewissen zu entlasten.«
Recht hat sie, denkt Danny, streckt den Arm aus und streicht mit dem Rücken seines Zeigefingers über Terris Oberschenkel, signalisiert ihr, dass sie richtigliegt, dass er Lust hat und es Zeit wird, zurück zum Cottage zu gehen. Terri schiebt seine Hand weg, aber nicht sehr energisch. Sie ist selbst heiß, spürt die Sonne und den warmen Sand auf ihrer Haut und die sexuelle Energie, die die Unbekannte verströmt.
Es liegt in der Luft, sie fühlen es beide.
Und da ist noch etwas anderes.
Rastlosigkeit? fragt Danny sich. Unbehagen?
Als wäre diese sexy Person dem Meer entstiegen, und plötzlich sind sie alle nicht mehr zufrieden mit ihrem Leben.
Ich nicht, denkt Danny.
Jedes Jahr im August kommen sie von Dogtown nach Goshen Beach, weil ihre Väter das so gemacht haben und sie es gar nicht anders kennen. Danny und Terri, Jimmy und Angie Mac, Pat und Sheila Murphy, dazu Liam Murphy mit seinem gerade aktuellen Mädchen. Sie mieten die kleinen Cottages entlang der Straße am Strand, die so dicht stehen, dass man seine Nachbarn niesen hört und sich nur aus dem Fenster lehnen muss, um sich was für die Küche zu borgen. Aber genau darin besteht ja der Spaß, in der Nähe.
Mit Einsamkeit kommt keiner von ihnen klar. Sie sind alle in Providence aufgewachsen, in demselben Viertel wie ihre Eltern, sind dort zur Schule gegangen und leben heute immer noch dort, sie sehen sich fast jeden Tag und fahren im Sommer zusammen nach Goshen in die Ferien.
»Dogtown am Meer«, nennen sie es.
Danny denkt immer, dass der Ozean im Osten liegt, aber er weiß, dass man vom Strand eigentlich nach Süden schaut und er sich in einem sanften Bogen über eine Meile gen Westen bis nach Mashanuck Point erstreckt, wo einige größere Häuser gefährlich nahe am Rand des Steilufers stehen. Im Süden, vierzehn Meilen entfernt, draußen im offenen Meer, befindet sich Block Island, an klaren Tagen kann man die Insel sehen. In der Sommersaison fahren Fähren vom Hafen in Gilead, dem Fischerdorf auf der anderen Seite des Kanals, den ganzen Tag bis spätabends dorthin.
Danny ist früher, als er noch nicht verheiratet war, ständig nach Block Island rausgefahren, nicht mit der Fähre, sondern mit den Fischerbooten, auf denen er damals gearbeitet hat. Wenn Dick Sousa gute Laune hatte, legten sie in New Harbor an und tranken noch ein Bier, bevor sie nach Hause sind.
Das waren gute Zeiten, als er mit Dick auf Schwertfischfang ging, und Danny vermisst sie. Er vermisst das kleine Cottage, das er hinter Aunt Betty’s Clam Shack gemietet hatte, obwohl es darin zog und im Winter scheißkalt war. Er vermisst die Bar im Harbor Inn, dort zu stehen, mit den Fischern zu trinken und sich ihre Geschichten anzuhören. Er vermisst die körperliche Arbeit, nach der er sich stark und rein gefühlt hatte. Mit neunzehn Jahren hatte er gestrotzt vor Kraft. Jetzt nicht mehr; um seinen Bauch hat sich eine Speckschicht gelegt, und er ist nicht sicher, ob er überhaupt noch eine Harpune werfen oder ein Netz einholen könnte.
Er ist jetzt Ende zwanzig und wirkt wegen seiner breiten Schultern ein bisschen kleiner, als er mit einsdreiundachtzig tatsächlich ist, und durch das dichte braune Haar mit dem leichten Rotstich, das ihm bis tief auf die Stirn reicht, auch nicht besonders helle.
Danny sitzt im Sand und schaut sehnsüchtig aufs Wasser. Inzwischen geht er dort höchstens noch schwimmen oder surfen, wenn es Wellen gibt, was im August kaum vorkommt, es sei denn, ein Wirbelsturm zieht auf.
Wenn er nicht hier ist, vermisst Danny den Ozean.
Er geht einem ins Blut über, als würde Salzwasser in den Adern zirkulieren. Die Fischer, das weiß Danny, lieben und hassen das Meer, sie sagen, es sei wie eine grausame Frau, die einem andauernd wehtut, zu der man aber trotzdem immer wieder zurückkehrt.
Manchmal denkt er, er sollte wieder fischen gehen, aber damit lässt sich kein Geld verdienen. Jedenfalls nicht mehr, seit die vielen neuen Vorschriften erlassen wurden und die japanischen und russischen Fabrikschiffe dreißig Meilen vor der Küste den ganzen Kabeljau, den Thunfisch und die Flundern abfischen; und die Regierung unternimmt einen Scheiß dagegen, schikaniert stattdessen immer nur die Einheimischen.
Das kann sie.
Deshalb fährt Danny jetzt nur noch zum Spaß im August mit den anderen aus Providence hierher.
Morgens stehen sie spät auf, frühstücken in ihren Cottages, dann ziehen sie über die Straße und verbringen den Tag zusammen am Strand vor Pascos Haus, einem von ungefähr einem Dutzend auf Betonpfeilern errichteten Schindelhäusern an der Mole auf der Ostseite von Goshen Beach.
Sie stellen Strandliegen auf oder legen sich einfach auf Handtücher, die Frauen trinken Weinschorle, lesen Zeitschriften und unterhalten sich, die Männer trinken Bier oder werfen Angeln aus. Es ist immer eine nette kleine Truppe da, Pasco und seine Frau, die Kinder und Enkelkinder, die ganze Moretti-Crew – Peter und Paul Moretti, Sal Antonucci, Tony Romano, Chris Palumbo, ihre Frauen und Kinder.
Ständig kommen Leute vorbei, gehen wieder, und alle haben eine gute Zeit.
An Regentagen sitzen sie in den Cottages und puzzlen, spielen Karten, halten Mittagsschläfchen, lauschen den Sox-Kommentatoren, die sich irgendwie durch die Regenpause quatschen. Oder sie fahren in die nächste größere Stadt, zwei Meilen landeinwärts, und gehen ins Kino, Eisessen oder kaufen ein.
Abends grillen sie auf den Rasenstreifen zwischen den Cottages, werfen ihre Vorräte zusammen, es gibt Hamburger und Hot Dogs. Manchmal geht auch einer der Männer zur Anlegestelle und schaut, was es Frisches gibt, dann wird am Abend Thunfisch oder Blaubarsch gegrillt, hin und wieder auch Hummer gekocht.
An anderen Abenden gehen sie zu Dave’s Dock runter und sitzen dort an einem Tisch auf der großen Terrasse mit Blick auf Gilead, auf der anderen Seite der schmalen Bucht. Dave hat keine Alkohollizenz, deshalb bringen sie sich ihren Wein und ihr Bier selbst mit. Danny liebt es, da draußen zu sitzen, Chowder, Fish’n’Chips und fettige frittierte Muscheln zu essen und die Fischerboote, die Hummerfischer oder die Block-Island-Fähre zu beobachten. Wenn die Sonne nicht mehr so sticht und das Wasser in der Abenddämmerung schimmert, ist es schön und friedlich dort.
Manchmal gehen sie abends nach dem Essen einfach nach Hause, treffen sich in einem der Cottages, um weiter Karten zu spielen und zu reden; oder sie fahren nach Mashanuck Point, wo’s eine Bar gibt, das Spindrift. Dort sitzen sie, trinken was und hören sich eine der einheimischen Livebands an, vielleicht tanzen sie sogar, vielleicht auch nicht. Meistens landet die ganze Gang dort, und dann wird viel gelacht, oft bis der Laden dichtmacht.
Wenn sie in Stimmung für Aufregenderes sind, zwängen sie sich in die Autos und fahren nach Gilead – übers Wasser sind das nur fünfzig Meter, aber vierzehn Meilen über Land. Dort gibt es einige größere Bars, die fast schon als Clubs durchgehen könnten und in denen den Morettis ihre Drinks nie berechnet werden. Anschließend fahren sie wieder nach Hause in ihre Cottages, wo Danny und Terri entweder sofort einpennen oder erst übereinander herfallen und dann einpennen. Am nächsten Tag wachen sie spät auf und fangen wieder von vorne an.
»Ich brauch mehr Sonnenmilch«, sagt Terri jetzt und gibt ihm die Flasche.
Danny setzt sich auf, drückt sich Sonnenmilch in die Hand und massiert sie ihr auf die sommersprossigen Schultern. Mit ihrer irischen Haut bekommt Terri schnell einen Sonnenbrand. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen und Haut wie eine Porzellantasse.
Die Ryans haben dunklere Haut, und Marty, Dannys Vater, sagt, das liege an ihrem spanischen Blut. »Von damals, als die Armada gesunken ist. Ein paar von den Matrosen haben es an Land geschafft und sich gleich munter ans Werk gemacht.«
Aber sie sind alle Black Irish wie die meisten Iren, die in Providence gelandet sind. Hervorgegangen aus dem steinigen Boden des immer wieder in die Knie gezwungenen Donegal. Nur dass die Murphys inzwischen doch ganz schön was angehäuft haben, denkt Danny. Dann hat er ein schlechtes Gewissen wegen dieses Gedankens, denn Pat Murphy ist sein bester Freund, seit sie beide Windeln trugen, ganz zu schweigen davon, dass sie inzwischen verschwägert sind.
Sheila Murphy hebt die Arme, gähnt und sagt: »Ich gehe ins Haus duschen, Nägel machen, Mädchenkram.« Sie steht von ihrer Decke auf, streicht sich den Sand von den Beinen. Auch Angie erhebt sich. So wie Pat der Anführer der Männer ist, ist Sheila die Chefin der Frauen. Alle richten sich nach ihr.
Sie schaut zu Pat und fragt: »Kommst du mit?«
Danny schaut Pat an, und beide grinsen – die Paare werden alle zurück in ihre Häuser gehen, sie wollen Sex haben, und niemand macht einen Hehl daraus. In den Cottages wird am Nachmittag ganz schön was los sein.
Danny ist traurig, dass der Sommer zu Ende geht. Ist er immer. Das Ende des Sommers bedeutet auch das Ende der langen, trägen Tage, der ausgedehnten Sonnenuntergänge, der gemieteten Strandcottages, des Biertrinkens, des Spaßhabens, des Lachens und der Clambakes.
Dann heißt es zurück nach Providence, zurück zu den Docks und an die Arbeit.
Zurück in die kleine Wohnung im obersten Stockwerk eines dreistöckigen Giebelhauses in der Stadt, eines von Tausenden alten Wohnhäusern, die während der Hochphase der Industrialisierung in ganz New England hochgezogen wurden, als man dringend billige Unterkünfte für die italienischen, jüdischen und irischen Arbeitskräfte benötigte. Die alten Fabriken sind größtenteils verschwunden, aber die dreistöckigen Wohnhäuser haben überlebt, und bis heute haftet ihnen der Ruch der Unterschicht an.
Danny und Terri haben ein kleines Wohnzimmer, eine Küche, ein Bad und ein Schlafzimmer mit einem kleinen Balkon nach hinten raus und Fenstern auf allen Seiten, was schön ist. Nichts Großartiges – Danny hofft, dass er eines Tages ein richtiges Haus kaufen kann –, aber vorerst reicht es, und so schlecht ist es nicht. Mrs. Costigan ein Stockwerk unter ihnen ist eine ruhige alte Dame, und der Besitzer Mr. Riley lebt selbst im Erdgeschoss und hält alles gut in Schuss.
Trotzdem denkt Danny darüber nach wegzuziehen, vielleicht sogar raus aus Providence.
»Vielleicht sollten wir irgendwohin ziehen, wo immer Sommer ist«, hatte er erst am Vorabend zu Terri gesagt.
»Wohin denn zum Beispiel?«, hatte sie gefragt.
»Wie wär’s mit Kalifornien.«
Sie hatte ihn ausgelacht. »Kalifornien? Wir haben überhaupt keine Familie in Kalifornien.«
»Ich hab eine Cousine zweiten Grades in San Diego.«
»Das ist doch keine richtige Familie«, hatte Terri widersprochen.
Vielleicht ja gerade deshalb, denkt Danny jetzt. Vielleicht wär’s ja ganz gut, wohin zu ziehen, wo sie nicht so viele Verpflichtungen hätten – all die Geburtstagsfeiern, die Kommunionen und jeden Sonntag ein Essen mit der Familie. Aber er weiß, dass es dazu nicht kommen wird – Terri hängt viel zu sehr an ihrer Sippschaft, und sein eigener Vater braucht ihn auch.
Niemand zieht aus Dogtown weg.
Und wenn, dann kommt er wieder zurück.
Danny ist wieder zurückgekommen.
Jetzt will er ins Cottage.
Er will Sex und danach ein Mittagsschläfchen.
Danny kann ein bisschen Schlaf gebrauchen, um später fit zu sein für Pasco Ferris Clambake.
ZWEI
Terri fackelt nicht lange.
Sie geht in das kleine Schlafzimmer, zieht die Vorhänge zu und schlägt die Tagesdecke zurück. Dann schält sie sich aus ihrem Badeanzug und lässt ihn einfach fallen. Normalerweise duscht sie, wenn sie vom Strand kommt, weil sie weder Sand noch Salz im Bett haben will. Normalerweise bittet sie Danny darum, es ihr gleichzutun – aber jetzt ist es ihr egal. Sie schiebt die Daumen unter den Bund seiner Badehose, grinst und sagt: »Oha, die Schlampe am Strand hat dich scharf gemacht.«
»Dich aber auch.«
»Vielleicht bin ich ja bi«, frotzelt sie. »Oh, ich merke schon, wie’s dich anturnt, wenn ich das sage.«
»Dich selbst aber auch.«
»Ich will dich in mir.«
Terri kommt schnell – das tut sie meistens. Früher war es ihr peinlich, sie dachte, das macht sie zur Hure, aber dann hat sie mit Sheila und Angie darüber geredet und sich erklären lassen, was für ein Riesenglück sie hat. Jetzt hebt sie ihr Becken, hilft Danny, damit er auch kommt, und sagt: »Wehe, du denkst an die.«
»Tu ich nicht. Mach ich nicht.«
»Sag mir, wenn’s so weit ist.«
Das ist ein Ritual – seitdem sie’s zum ersten Mal miteinander gemacht haben, will sie immer vorher wissen, wann er kommt, und als er jetzt merkt, dass es bald so weit ist, sagt er’s ihr, und wie immer fragt sie: »Ist es gut? Ist es gut?«
»Irre gut.«
Sie hält ihn fest, bis er aufhört zu stoßen, dann lässt sie ihre Hände auf seinem Rücken liegen, und als Danny spürt, dass ihr Körper schläfrig und schwer wird, rollt er von ihr runter. Er schläft nur ein paar Minuten, dann wacht er neben ihr auf.
Er liebt sie wie sein Leben.
Aber nicht, wie manche Leute denken, weil sie die Tochter von John Murphy ist.
John Murphy ist ein irischer König, ungefähr so wie das Oberhaupt der O’Neills in der alten Heimat. Er hält im Hinterzimmer des Glocca Morra Hof, als wäre es Tara.
In Dogtown hat er das Sagen, seit Dannys Vater Marty im Alkohol ersoffen ist und die Murphys die Geschäfte von den Ryans übernommen haben.
Ich hätte Pat oder Liam sein können, denkt Danny, aber ich bin’s nicht.
Danny ist kein Prinz, eher ein kleiner Fürst oder so. Wenn am Hafen die Crews zusammengestellt werden, wird er immer aufgerufen, ohne dass er den Hafenbossen etwas dafür abdrücken muss. Außerdem achtet Pat darauf, dass er hin und wieder andere Aufträge zugeschoben bekommt.
Einige Hafenarbeiter leihen sich Geld von den Murphys, um die Bosse zu bezahlen, und kommen dann mit den Raten nicht hinterher, oder sie verspielen ihren Lohn bei Basketball-Wetten. Dann stattet ihnen Danny, der laut John Murphy ein »strammer Bursche« ist, einen Besuch ab. Nach Möglichkeit klärt er das Problem in der Kneipe oder auf der Straße, um sie nicht vor ihren Familien bloßzustellen, den Frauen Kummer zu bereiten oder die Kinder zu verschrecken, aber manchmal muss er auch zu ihnen nach Hause, und das hasst Danny.
Normalerweise genügt ein ernstes Wort, und dann arbeiten sie einen Zahlungsplan aus, aber manche dieser Männer sind nun mal einfach Versager oder Trinker, versaufen die Raten und die Miete, und Danny muss sie dann ein bisschen aufrütteln. Aber er ist niemand, der anderen die Beine bricht. So was passiert sowieso nur ganz selten – mit gebrochenen Knochen kann niemand arbeiten, und wer nicht arbeiten kann, kann nichts zurückzahlen, keine Zinsen und schon gar keine Hauptschuld. Kann schon sein, dass Danny ihnen wehtut, aber nicht allzu schlimm.
Er verdient sich nur ein bisschen was dazu. Außerdem noch mit den Waren, die aus dem Hafen oder von den Lastern verschwinden, die er mit Pat und Jimmy Mac manchmal auf den dunklen Straßen zwischen Boston und Providence ausräumt.
Bei diesen Aufträgen arbeiten sie mit den Morettis zusammen, bekommen Tipps von den Brüdern. Die steuerfreien Zigaretten wandern in deren Automaten, der Alkohol in die unter ihrem Schutz stehenden Clubs, das Gloc und andere Bars in Dogtown. Anzüge wie die von letzter Nacht werden in Dogtown aus dem Kofferraum verkauft, und die Morettis bekommen einen Anteil. Alle haben was davon, außer den Versicherungsunternehmen, aber scheiß auf die, die knöpfen einem das letzte Hemd ab und erhöhen die Beiträge, sobald man einen Unfall baut.
Danny kann ganz gut davon leben, aber nicht annähernd so gut wie die Murphys, die Prozente von den Hafenbossen kassieren, mit den Phantom-Jobs an der Werft verdienen, den Kreditgeschäften, dem Glücksspiel und den Provisionen aus ihrem Gebiet, zu dem auch Dogtown gehört. Von all dem fällt auch ein bisschen was für Danny ab, aber er sitzt nicht mit den Murphys im Hinterzimmer am Tisch.
Ganz schön peinlich.
Sogar Peter Moretti hat schon mal was zu ihm gesagt.
Neulich sind sie zusammen am Strand entlanggegangen und Peter meinte: »Nichts für ungut, Danny, aber als dein Freund muss ich mich schon wundern.«
»Worüber denn, Peter?«
»Du hast doch die Tochter geheiratet«, fuhr Peter fort. »Wir dachten alle, du wirst ein bisschen befördert, wenn du verstehst, was ich meine.«
Danny spürte, wie ihm die Hitze in die Wangen stieg. Er dachte an Morettis Leute im Automaten-Büro in Federal Hill, wie sie dort saßen, Karten spielten, Espresso tranken und Mist laberten. Danny gefiel es nicht, dass sein Name dabei erwähnt wurde, schon gar nicht in diesem Zusammenhang.
Er wusste nicht, was er Peter entgegnen sollte. In Wahrheit hatte er selbst gedacht, dass man ihn befördern würde, aber das war nicht passiert. Er hatte damit gerechnet, dass sein Schwiegervater ihn auf eine »kleine Unterhaltung« ins Hinterzimmer des Gloc rufen würde, dass er ihm einen Arm um die Schulter legen und ihm die Verantwortung für einen Teil der Geschäfte, etwas vom Glücksspiel oder einen Platz am Tisch anbieten würde – irgendetwas.
»Ich dränge mich nicht gerne auf«, sagte Danny schließlich.
Peter nickte und schaute an Danny vorbei zum Horizont, wo Block Island wie eine tief hängende Wolke zu schweben schien. »Versteh mich nicht falsch, ich liebe Pat wie einen Bruder, aber … ich weiß nicht, manchmal denke ich, die Murphys … na ja, weißt du, weil es früher die Ryans waren … Vielleicht haben sie Angst, dich aufsteigen zu lassen, weil du auf die Idee kommen könntest, die alte Dynastie wieder aufleben zu lassen. Und wenn du und Terri einen Jungen bekommt … einen Murphy, der gleichzeitig ein Ryan ist? Ich meine, komm schon.«
»Ich will einfach nur davon leben können.«
»Wollen wir das nicht alle?« Peter lachte und ließ das Thema ruhen.
Danny weiß, dass Peter Politik macht. Er mag ihn, betrachtet ihn als Freund, aber Peter kann es einfach nicht lassen. Und Danny muss zugeben, dass was dran ist. Er hatte den Gedanken auch schon – dass der alte Murphy ihn ausschließt, weil er sich vor dem Namen Ryan fürchtet.
Pat gegenüber macht Danny das alles nichts aus, der ist ein guter Typ, arbeitet hart, führt die Docks anständig und spielt sich nicht als Chef auf. Pat ist der geborene Anführer, und Danny, na ja, wenn er ehrlich ist, der geborene Mitläufer. Er will die Familie gar nicht führen, will nicht den Platz seines Vaters einnehmen. Er liebt Pat und würde ihm mit einer Wasserpistole in die Hölle folgen.
Sie sind Kids aus Dogtown, kennen sich schon ewig – Pat, Jimmy und er. St. Brendan’s Elementary, dann St. Brendan’s High School. Sie spielten zusammen Eishockey und wurden von den Frankokanadiern von der Mount St. Charles geschlachtet. Sie spielten zusammen Basketball und wurden von den Schwarzen auf der Southie geschlachtet. Aber das war egal – sie ließen sich nicht unterkriegen und hatten vor niemandem Schiss. Sie aßen fast immer zusammen zu Abend, manchmal bei Jimmy, meistens bei Pat.
Pats Mom, Catherine, rief sie zu Tisch, als wären sie eine einzige Person: »PatDannyJimmyyyyy!« Die Straße runter, quer über die kleinen Hinterhöfe. »PatDannyJimmyyyyyy! Essseeeeeennnn!« Wenn es bei Danny zu Hause nichts gab, weil Marty mal wieder zu besoffen war, um was auf die Reihe zu kriegen, saß Danny am großen Tisch der Murphys, ließ sich Schmorbraten und Kartoffeln, Spaghetti mit Fleischbällchen und freitags Fish and Chips schmecken – auch als der Papst längst gesagt hatte, dass Fleisch am Freitag okay ist.
Da er selbst keine richtige Familie hatte – Danny war das, was es in Irland eigentlich gar nicht gibt, ein Einzelkind –, liebte er den großen Haushalt der Murphys. Da waren Pat und Liam, Cassie und natürlich Terri, und sie nahmen Danny auf, als gehörte er dazu.
Genau genommen war er kein Waisenkind, aber so was ähnliches. Seine Mutter hatte sich aus dem Staub gemacht, als er noch ein Baby war, und sein Vater hatte ihn mehr oder weniger ignoriert, weil er immer nur sie in ihm sah.
Als Marty Ryan immer mehr der Verbitterung und dem Alkohol verfiel, war er kaum noch in der Lage, dem Jungen ein Vater zu sein, und so suchte dieser mit Pat und Jimmy immer öfter Zuflucht auf der Straße oder zu Hause bei den Murphys, wo immer gelacht und kaum geschrien wurde, eigentlich nur dann, wenn sich die Schwestern um das Badezimmer stritten.
Danny ist ein einsamer Junge, dachte Catherine Murphy immer, ein einsamer, trauriger Junge, und wer konnte es ihm verdenken? Wenn er also ein bisschen häufiger bei ihnen war, als normal gewesen wäre, schenkte sie ihm gerne ein Lächeln und eine mütterliche Umarmung, ein paar Kekse und ein Erdnussbuttersandwich, und als er älter wurde und augenscheinlich Interesse an Terri hatte … na ja, Danny Ryan war ein netter Junge aus der Nachbarschaft, und Terri hätte es schlechter treffen können.
John Murphy war sich da nicht so sicher. »Der hat das Blut.«
»Welches Blut?«, fragte seine Frau, obwohl sie es wusste.
»Das Blut der Ryans«, erwiderte Murphy. »Auf denen liegt ein Fluch.«
»Sei nicht albern«, sagte Catherine. »Als es Marty gut ging …«
Sie beendete den Satz nicht, denn als es Marty gut ging, hatte er über Dogtown geherrscht, nicht John. Ihrem Mann gefiel der Gedanke nicht, dass er seinen Aufstieg dem Niedergang von Martin Ryan zu verdanken hatte.
John war also gar nicht unglücklich darüber, als Danny nach der Highschool ins South County zog, um ausgerechnet als Fischer zu arbeiten. Wenn der Junge das wollte, dann wollte er’s eben, auch wenn er gar nicht wusste, wie schwer es eigentlich war, einen Job auf einem Boot zu ergattern, und dass er nur deshalb auf diesem Schwertfischfänger anheuern konnte, weil der Besitzer geglaubt hatte, die Celtics würden zu Hause locker gegen die Lakers gewinnen, aber das taten sie nicht. Wenn er sein Boot behalten wollte, musste er Danny Ryan mit an Bord nehmen.
Es gab keinen Grund, weshalb Danny das erfahren musste. Warum sollte man dem Jungen den Spaß verderben?
Pat hatte wenig Verständnis für Dannys Entscheidung.
»Wieso machst du das?«, fragte er.
»Weiß nicht«, sagte Danny. »Ich will mal was anderes probieren. An der frischen Luft arbeiten.«
»Ist dir die Luft im Hafen nicht frisch genug?«
Doch, schon, dachte Danny, aber es ist nicht der Ozean, und er meinte es so, wie er es sagte – er wollte was anderes als Dogtown. Er wusste, was für ein Leben ihm bevorstand: der Gewerkschaft beitreten, im Hafen arbeiten und sich nebenher als Eintreiber für die Murphys was dazuverdienen. Freitagsabends Eishockey bei den P-Bruins, samstagabends ins Gloc, sonntags Mittagessen bei John. Er wollte mehr – oder zumindest was anderes. Er wollte seinen eigenen Weg machen in der Welt. Saubere, harte Arbeit verrichten, eigenes Geld verdienen, eine eigene Wohnung haben, niemandem was schuldig sein. Natürlich würde er Pat und Jimmy vermissen, aber Gilead war nicht weit weg, eine halbe Stunde, vielleicht vierzig Minuten mit dem Auto, und im August würden sie sowieso alle dorthinkommen.
Also suchte er sich einen Job auf einem Schwertfischfänger.
Stellte sich am Anfang wie der letzte Blödmann an, hatte keine Ahnung, was er da machte, Dick brüllte sich heiser bei dem Versuch, Danny beizubringen, was er zu tun und zu lassen hatte, machte ihn regelmäßig zur Schnecke. Ein gutes Jahr lang glaubte Danny, sein Vorname wäre »Scheiße verdammt!«.
Aber er lernte es.
Wurde ein anständiger Arbeiter und widerlegte die Vorurteile der meisten Alten, dass niemand auf einem Boot ordentlich mit anpacken könne, der nicht mindestens in dritter Generation Fischer war. Und Danny fand’s super. Er mietete sich ein zugiges kleines Cottage, lernte kochen – oder besser gesagt Eier mit Speck, Clam Chowder und Chili zuzubereiten –, verdiente sein Geld und trank mit den Männern.
Im Sommer arbeitete er auf dem Schwertfischfänger, im Winter heuerte er auf den Booten an, die auf Grundfischfang gingen – Kabeljau, Schellfisch, Flundern –, was auch immer sie ins Netz bekamen, was auch immer die Russen und Japaner nicht schon abgefischt hatten und ihnen die Regierung noch erlaubte.
Im Sommer machte es Spaß, im Winter war’s scheiße.
Dann war der Himmel grau, der Ozean schwarz, und Gilead konnte man nur als trostlos bezeichnen. Der Wind pfiff durch sein Cottage, als hätte man ihn eingeladen, und nachts im Bett trug Danny ein dickes Kapuzenshirt. Wenn die Boote überhaupt rausfahren konnten, unternahm das Meer jede erdenkliche Anstrengung, die Männer umzubringen, und wenn man an Land blieb, brachte einen die nackte Langeweile um den Verstand. Es gab nichts zu tun, außer zu saufen und der eigenen Wampe beim Wachsen zuzusehen, während die Brieftasche immer schmaler wurde. Man schaute aus dem Fenster in den Nebel, als würde man in einer Milchflasche leben. Vielleicht konnte man noch fernsehen, dann wieder ins Bett, später Mütze auf, Hände in den Jackentaschen vergraben und zum Hafen gehen, das Boot anschauen, das dort herumlag und genauso erbärmlich wirkte wie man selbst. Wieder in die Kneipe, herumsitzen und schimpfen, sonntags die Patriots ansehen, als wäre man nicht sowieso schon schlecht drauf.
Aber an den Tagen, an denen sie rausfahren konnten, oh Gott, war das kalt, kälter als am Arsch der Arktis – selbst wenn man so viele Klamottenschichten übereinanderzog, dass man aussah wie ein scheiß Michelin-Mann. Lange Thermounterhose und ein langärmeliges Unterhemd, dicke Wollsocken, Wollpullover, ein Sweatshirt und eine Daunenjacke, dicke Handschuhe, und trotzdem war es noch eisig. Draußen am Anleger musste er um vier Uhr morgens Eis von der Verankerung und der Schiffsschraube schlagen, während Dick, Chip Whaley, Ben Browning oder für wen auch immer er gerade arbeitete, versuchte, den Motor in Gang zu setzen.
Dann ging es raus, durch die Schleuse und den Harbor of Refuge, die schaumigen Wellen schlugen an die vereiste Mole, dann durch das West Gap oder das East Gap, je nachdem, wo die Fische waren. Manchmal blieben sie drei oder vier Tage draußen, manchmal eine Woche, wenn es gut lief. Wie die anderen legte sich Danny zwischendurch für zwei oder drei Stunden aufs Ohr, dann warf er wieder Netze aus oder holte sie ein, warf den Fang in den Schiffsraum. Unter Deck umklammerte er mit zitternden Händen einen dampfend heißen Becher bitteren Kaffee oder schlang eine Schüssel Chili oder Chowder runter. Morgens gab es immer Eier mit Speck und Toast, so viel sie essen konnten, denn am Essen wurde nicht gespart; wer so hart arbeitete, musste essen.
Wenn sie Glück hatten und ihre Quote gefangen, gab der Kapitän den Befehl zur Umkehr, und es war ein herrliches Gefühl, nach getaner Arbeit belohnt zu werden, dann gab es für jeden einen dicken Scheck mit einem Anteil an der gesamten Ladung. Die Männer kehrten stolz zu ihren Frauen und Freundinnen zurück, konnten Essen auf den Tisch bringen, sie ins Kino oder ins Restaurant ausführen.
Manchmal aber lief es schlecht, dann war kaum etwas in den Netzen, oder sie blieben sogar ganz leer, und es kam ihnen vor, als gäbe es im gesamten dunklen Atlantik keinen einzigen Fisch mehr. Das Boot schipperte zurück in den Hafen, und die gesamte Mannschaft schämte sich, als hätten die Fischer etwas falsch gemacht, als wären sie einfach nicht gut genug, und die Frauen und Freundinnen wussten, dass sie vorsichtig sein mussten, weil ihre Männer wütend zurückkamen und mit dem Gefühl, keine richtigen Männer zu sein, sie würden die Hypotheken und Mieten nicht bezahlen können und nötige Autoreparaturen würden warten müssen.
Und das kam immer öfter vor.
Aber der Sommer.
Der Sommer war wunderbar.
Im Sommer fuhr Danny auf dem leichten und schnellen Schwertfischfänger mit. Unter blauem Himmel jagten sie den Edelfisch über das blaue Meer, und Dannys Posten war direkt vorne am Bug, weil er ein guter Harpunierer war. Dick konnte Schwertfische aufspüren, als wäre er selbst einer. Er war eine Legende, weit über den Hafen hinaus. Manchmal nahmen sie Gäste zum Sportfischen mit raus – reiche Leute, die es sich leisten konnten, ein Boot samt Mannschaft zu chartern und Schwert- und Thunfische mit Angelruten zu fangen, dann war Dannys Aufgabe, Köder zu schneiden und dafür zu sorgen, dass die Kunden kaltes Bier bekamen. Sie hatten ein paar ganz schön berühmte Leute an Bord, aber Danny wird nie vergessen, wie Ted Williams mitkam – verdammt noch mal, Ted Williams! Er war ein guter Typ und gab Danny zum Schluss hundert Dollar Trinkgeld.
Aber manchmal fuhren sie auch einfach raus und fingen Schwertfische, um sie auf den Märkten zu verkaufen, und dann ging es ausschließlich ums Geschäft. Danny stand mit der Harpune am Bug, und wenn sie auf einen Schwarm trafen, warf er den Speer, der mit einer schweren Boje verbunden war, damit die Schwertfische müde wurden. Manchmal hatten sie fünf oder sechs an der Leine, bevor sie zurückfuhren und die erschöpften Fische ins Boot holten, und das waren verdammt wunderbare Tage, weil sie dann in der Abenddämmerung zurückkamen, feierten und tranken und Danny kaputt ins Bett fiel, fix und fertig, aber glücklich. Am nächsten Tag stand er auf, und alles ging wieder von vorne los.
Gute Zeiten waren das.
In einem dieser Sommer, im August, als die Gang aus Dogtown unten am Strand war, stieß Danny zu ihnen, trank mit ihnen, aß Hotdogs und Burger und merkte plötzlich, dass Terri mehr war als nur Pats kleine Schwester.
Ihre Haare waren schwarz wie das Meer im Winter und ihre Augen nicht blau, sondern violett – Danny schwor drauf. Ihr kleiner Körper war an manchen Stellen schlanker und an anderen fülliger geworden. Damals hatte sie kein Geld für Parfüm, und ihre Mutter hätte ihr sowieso nicht erlaubt, welches zu benutzen, deshalb tupfte sie sich Vanilleextrakt hinter die Ohren. Danny behauptet heute noch, dass er von bestimmten Keksen einen Ständer bekommt.
Er erinnert sich noch an das erste Mal Fummeln mit ihr, wie sie sich hinter den Dünen fest umklammert hielten. Heiße, feuchte Küsse, ihre Zunge eine flinke Überraschung, die immer wieder in seinen Mund eindrang. Er war so glücklich, als sie ihm erlaubte, zwei Knöpfe ihrer weißen Bluse zu öffnen, die Hand hineinzuschieben und sie anzufassen.
Ein paar Wochen später, in einer heißen, schwülen Augustnacht in seinem Wagen am Strand, öffnete er ihre Jeans, und sie überraschte ihn erneut, indem sie ihr Becken hob, seine Hand hineingleiten ließ. Als er sie unter ihrem schlichten weißen Baumwollhöschen berührte, wurde ihre Zunge schneller, und sie zog ihn fester an sich, sagte: »Ja, mach weiter, mach weiter.« An einem anderen Abend streichelte er sie, sie versteifte sich, wimmerte, und er begriff, dass sie gekommen war. Er war so hart, dass es wehtat, und er spürte ihre Hand, die den Reißverschluss seiner Jeans herunterzog und hineinfuhr, unsicher und ungeschickt, aber dann packte und streichelte sie ihn, und er kam in seiner Shorts. Als sie wieder zurück zu den anderen gingen, die draußen vor dem Cottage saßen, musste er sein Hemd über die Jeans ziehen, um den dunklen Fleck zu verdecken.
Danny war verliebt.
Aber Terri wollte nicht die Freundin eines Fischers sein, keine Fischersfrau.
»Ich kann nicht hier unten leben«, sagte sie.
»Ist nur eine halbe Stunde«, sagte Danny.
»Fünfundvierzig Minuten«, sagte Terri. Sie hing sehr an ihrer Familie, ihren Freunden, ihrem Friseur, der Kirche, ihrer Straße, ihrem Viertel. Terri war ein echtes Dogtown-Mädchen und würde es immer bleiben. Für ein paar Wochen im Sommer war Goshen okay, aber sie würde niemals dort leben können, schon gar nicht, wenn Danny nächtelang fort war und sie sich Sorgen machen musste, ob er überhaupt wiederkommen würde. Und es stimmte, das wusste Danny, dort draußen starben Freunde und Ehemänner, rutschten aus und fielen ins eisige Wasser oder wurden von einem wild im Wind herumschleudernden Schiffsbaum erschlagen. Oder sie soffen sich zu Tode, weil die Fischerei nichts einbrachte.
Man konnte kein Geld damit verdienen.
Jedenfalls nicht als Deckarbeiter.
Wenn einem ein Boot gehörte und es über längere Zeit gut lief, dann vielleicht, aber inzwischen hingen selbst die Bootseigner in den Seilen, weil es immer weniger Fisch zu fangen gab.
Terri hatte sich in ihrem Elternhaus um Geld nie Sorgen machen müssen, und sie konnte sich nicht vorstellen, als armes »Fischweib«, wie sie es nannte, zu enden.
»Daddy kann dich in die Gewerkschaft bringen«, sagte sie, »und dir einen Job am Hafen besorgen.«
Womit sie den Port of Providence meinte, nicht Gilead.
An den Docks, wo er den Haken schwingen würde.
Gutes Geld verdienen mit einem guten Gewerkschaftsjob, und dann, wer weiß? Weiter aufsteigen bei den Murphys. Vielleicht als Gewerkschaftsfunktionär im Büro oder so. Oder mal in Murphys andere Unternehmenszweige reinschnuppern. Was er sowieso getan hätte, hätte sein Vater nicht alles versoffen. Sein alter Herr hatte sich so häufig abgeschossen, dass er zum Sicherheitsrisiko geworden war, weshalb ihn die anderen erst von der Spitze und schließlich ganz aus dem Geschäft verdrängt hatten. Um der guten alten Zeiten willen ließen sie ihm gerade noch genug zum Leben, und das war’s dann.
Als Danny klein war, hatte der Name Marty Ryan Angst und Schrecken verbreitet. Jetzt rief er nur noch Mitleid hervor.
Aber Danny wollte das sowieso nicht, er wollte nichts mit dem ganzen Mist zu tun haben, mit den Wucherkrediten, dem Glücksspiel, den Überfällen und der Gewerkschaft. Das Problem war nur, er wollte Terri – sie war witzig und schlau und hörte ihm zu, ohne sich irgendwelchen Blödsinn gefallen zu lassen. Aber sie würde ihn niemals ranlassen, bevor sie nicht mindestens verlobt waren, und was er auf den Booten verdiente, reichte nicht für einen Diamantring, geschweige denn für eine Ehe.
Also nahm Danny den Gewerkschaftsausweis und zog zurück nach Dogtown.
Pat war der Erste, dem er erzählte, dass er Terri einen Antrag machen wollte.
»Schenkst du ihr einen Ring?«, fragte Pat.
»Wenn ich genug Geld für was Anständiges zusammenhabe.«
»Geh zu Solly Weiss.«
Weiss hatte ein Juweliergeschäft im Zentrum von Providence.
»Ich hatte an Zales gedacht«, sagte Danny.
»Das ist doch Wucher«, sagte Pat. »Geh zu Solly, sag ihm, du gehörst zu uns und für wen der Ring ist, dann macht er dir einen guten Preis.«
Das inoffizielle Staatsmotto lautete nicht umsonst »Ich kenne jemanden«.
»Ich will Terri keinen gestohlenen Diamanten schenken«, sagte Danny.
Pat lachte. »Die sind nicht gestohlen. Oh Mann, für was für einen Bruder hältst du mich? Wir passen auf Solly auf. Hast du schon mal gehört, dass er ausgeraubt wurde?«
»Nein.«
»Und was glaubst du, woran das liegt?«, fragte Pat. »Hör zu, wenn du dich nicht traust, komm ich mit.«
Also gingen sie zusammen zu Solly, und der verkaufte Danny einen hochkarätigen Diamanten im Prinzessschliff zum Einkaufspreis, zinsfrei und auf Raten, Danny musste nur eine Anzahlung leisten.
»Was hab ich dir gesagt?«, fragte Pat, als sie den Laden verließen.
»So läuft das?«
»So läuft das«, sagte Pat. »Aber als Nächstes musst du zu meinem Alten gehen, und da komme ich nicht mit.«
Danny fand John Murphy im Gloc – wo sonst – und bat ihn um ein kurzes Gespräch. John ging mit ihm nach hinten, setzte sich an den Tisch und sah Danny einfach nur an; er würde es ihm nicht leicht machen.
»Ich bin gekommen, weil ich dich um die Hand deiner Tochter bitten will«, sagte Danny und kam sich dabei vor wie ein Vollidiot, gleichzeitig hatte er eine Scheißangst.
John wünschte sich Danny Ryan als Schwiegersohn ungefähr so wie schmerzende Hämorrhoiden, aber Catherine hatte ihn bereits vorgewarnt, dass es so kommen würde, und ihm erklärt, wenn er eine glückliche Familie haben wollte, solle er lieber einwilligen.
»Ich suche ihr einen anderen Mann«, hatte John gesagt.
»Sie will aber keinen anderen«, hatte Catherine erwidert, »also lass es uns hinter uns bringen, bevor sie in einem geblümten Wallekleid vor den Altar treten muss.«
»Hat er sie geschwängert?«
»Noch nicht«, sagte Catherine. »Wenn man Terri glauben darf, schlafen sie nicht mal miteinander, aber …«
Also spielte John das Spiel mit Danny. »Wovon gedenkst du denn meine Tochter zu ernähren?«
Was glaubst du wohl? dachte Danny. Ihr habt mir meinen Mitgliedsausweis besorgt, den Job im Hafen und ein paar Sachen nebenher.
»Ich arbeite hart«, sagte Danny. »Und ich liebe deine Tochter.«
John hielt ihm den ganzen »Liebe-ist-nicht-genug«-Vortrag, gab ihm aber schließlich doch seinen Segen, und am Abend führte Danny Terri zu einem schönen Essen bei George’s aus. Sie tat überrascht, als er auf ein Knie ging und ihr die Frage stellte, obwohl sie ihren Bruder vorher gebeten hatte, er möge darauf achten, dass Danny ihr einen guten Ring besorgt, ohne dafür Schulden zu machen.
Die Hochzeit wurde aufwendig gefeiert, wie es sich für die Tochter von John Murphy gehörte.
Nicht so aufwendig wie eine italienische Hochzeit, so weit wollten sie nicht gehen, aber die Italiener waren alle eingeladen und brachten Umschläge mit – Pasco Ferri und seine Frau, die Morettis, Sal Antonucci mit seiner Frau und Chris Palumbo. Alle wichtigen Iren aus Dogtown waren da, und sogar Marty ließ sich bei der Trauung in der St. Mary’s Kirche und dem anschließenden Empfang im Biltmore blicken. John bezahlte alles, nur nicht die Flitterwochen, weshalb Danny und Terri einfach für ein verlängertes Wochenende über die Blackstone Bridge nach Newport fuhren.
Niemand freute sich mehr darüber, dass Danny und Terri heirateten, als Pat.
»Wir waren immer schon Brüder«, sagte Pat beim Essen am Vorabend der Hochzeit. »Und jetzt ist es ganz offiziell.«
Ja, es war offiziell, und deshalb ließ Terri Danny auch endlich ran.
Enthusiastisch und energisch – Danny konnte sich nicht beklagen. Und dabei ist es geblieben. Fünf Jahre sind sie jetzt verheiratet, und der Sex ist immer noch gut. Das einzige Problem ist, dass sie immer noch nicht schwanger ist und alle sie ständig danach fragen. Danny weiß, dass ihr das wehtut.
Er selbst hat es nicht so eilig mit dem Kinderkriegen, er weiß nicht mal, ob er überhaupt welche will.
»Weil du bei Wölfen aufgewachsen bist«, hat Terri einmal zu ihm gesagt.
Was nicht stimmt, denkt Danny.
Wölfe würden niemals ihr Rudel verlassen.
Jetzt schaut er zu dem kleinen Wecker auf der alten Kommode und sieht, dass es Zeit für das Treffen im Spindrift ist. Danach gehen sie alle zu Pascos Clambake.
Am Samstagabend des Labor Day Weekends schmeißt Pasco Ferri immer eine Party und lädt alle ein. Selbst Leute, die einfach nur vor seinem Haus am Strand entlanglaufen und ihn ein Loch graben sehen; er bittet sie alle dazu, es ist ihm völlig egal. Den ganzen Tag verbringt er damit, dieses Loch zu graben und die Kohle auszulegen, dann holt er die Muscheln und Meeresfrüchte frisch aus dem Wasser.
Manchmal kommt Danny mit, steht mit ihm bis zu den Knöcheln in den warmen Gezeitentümpeln und gräbt mit dem langen Muschelrechen im Matsch. Die Arbeit ist mühsam, man zieht den Rechen aus dem Boden, sucht mit den Fingern im Schlamm zwischen den Zinken nach den Meeresfrüchten und wirft sie in den Eimer, der auf einem Schwimmreifen treibt, den Pasco mit einem zerschlissenen Stück von einer alten Wäscheleine an seinem Gürtel befestigt hat. Pasco arbeitet stetig wie eine Maschine – mit freiem Oberkörper, die mediterrane Haut von der Sonne gebräunt, trotz seiner über sechzig Jahre ist er immer noch muskulös und sehnig. Der Mann hat im ganzen Süden von New England das Sagen, und trotzdem macht es ihn glücklich, hier in der Sonne in den Tümpeln zu waten und zu schuften wie ein alter Italiener.
Wenn er ihn so friedlich und zufrieden arbeiten sieht, fragt Danny sich manchmal, wie viele Menschen dieser alte paisan in seinem Leben wohl schon beseitigen ließ. Oder eigenhändig getötet hat? Gerüchten zufolge hat Pasco Joey Bonham, Remy LaChance und die McMahon-Brüder aus Boston persönlich umgebracht. Bei whiskeyseligen Gesprächen wisperten Peter und Paul schon mal, dass Pasco keine Schusswaffen mag und lieber mit einem Draht oder einem Messer arbeitet, dabei so nah rangeht, dass er den Angstschweiß riechen kann.
Ein paarmal fuhr Danny auch mit Pasco zu Almacs, wo sie Hühnerbeine kauften, die sie mit zum Narrow River nahmen. Pasco band ein langes Stück Schnur um ein Hühnerbein, warf es ins Wasser und zog es ganz langsam wieder heraus. Riesige Krabben gruben ihre Scheren ins Fleisch und ließen erst los, wenn Pasco sie in das Netz warf, das Danny bereithielt.
»Eine Lektion für dich«, hatte Pasco einmal gesagt, als sie zusahen, wie eine Krabbe im Eimer wild um sich schlug und entkommen wollte. Er wickelte erneut ein Stück Schnur um ein Hühnerbein und wiederholte den Vorgang so lange, bis der Eimer voller Krabben war, die sie am Abend kochten.
Die Lektion lautete: Klammer dich nicht an etwas, das dir zum Verhängnis werden kann. Wenn du sowieso loslassen musst, dann tu’s am besten gleich.
Oder noch besser, lass dich erst gar nicht ködern.
DREI
Danny und Liam springen zu Pat in den Camry und fahren die fünf Minuten rüber nach Mashanuck Point.
»Worum geht’s denn bei dem Treffen?«, fragt Pat seinen Bruder.
»Die Morettis wollen im Spindrift abkassieren«, erklärt Liam.
»Ist doch ihr Gebiet«, sagt Pat.
»Das Drift nicht«, erwidert Liam. »Das ist ausgenommen.«
Stimmt, denkt Danny und schaut aus dem Fenster. Die anderen Kneipen an der Küste drücken an die Italiener ab, aber das Spindrift war schon zu Zeiten seines Vaters in irischer Hand. Er kennt es gut, hat dort oft und viel getrunken, als er noch auf den Booten gearbeitet hat. Manchmal hat er sich die Bluesbands angehört, die an den Sommerwochenenden dort auftreten.
Der Besitzer Tim Carroll ist ein Freund von ihm.
Sie fahren an Maisfeldern vorbei, und Danny wundert sich wieder einmal, dass das Land hier noch nicht bebaut wurde. Es gehört seit dreihundert Jahren derselben Familie, und die bleibt stur, diese Provinzler bauen lieber Mais an, als ihr Land zu verkaufen und sich mit einem Vermögen zur Ruhe zu setzen. Aber Danny ist ihnen dankbar dafür. Es ist schön hier. Das Ackerland reicht direkt bis an den Ozean.
»Ja und?«, fragt Pat Liam. »War Tim bei dir?«
Das ist ein Regelverstoß. Wenn Tim ein Problem hat, sollte er damit zu John gehen, oder wenigstens zu Pat. Nicht zum jüngeren Bruder, nicht zu Liam.
»Er war nicht bei mir«, wiegelt Liam ab. »Ich hab ein Bier getrunken, wir haben uns unterhalten …«
Es gibt so viele kleine Halbinseln und so viel Marschland an der Küste, denkt Danny, wenn man irgendwohin möchte, muss man erst mal landeinwärts fahren, dann parallel zur Küste weiter und später wieder zurück zum Wasser. Würde schneller gehen, wenn die das Land trockenlegen und ein paar Straßen bauen, aber so was macht man in Connecticut, nicht hier in Rhode Island.
In Rhode Island hat man’s gerne, wenn was schwer zu finden ist.
Das andere inoffizielle Staatsmotto lautet: »Hättest du’s wissen sollen, wüsstest du’s«.
Die Fahrt zum Spindrift dauert also ein paar Minuten, obwohl sie auch einfach zu Fuß über den Strand hätten gehen können. Aber sie nehmen die Straße vorbei an den Maisfeldern und dem kleinen Supermarkt, dem Hotdogstand, dem Waschsalon, dem Eisstand. Als sie den Bogen entlangfahren, der sie wieder zur Küste führt, befindet sich links ein Wohnwagenpark, und dahinter liegt die Bar.
Sie halten davor.
Wenn man reinkommt, sieht man sofort, dass es keine Goldgrube ist. Eine alte holzverkleidete Hütte, die rund sechzig Jahre der salzigen Meeresluft und zahlreichen Winterstürmen ausgesetzt war – eigentlich ein Wunder, dass sie überhaupt noch steht. Eine kräftige Böe könnte genügen, denkt Danny, und bald ist wieder Orkansaison.
Tim Carroll steht hinter dem Tresen und zapft ein Bier für einen Touristen.
Der dürre Tim Carroll, denkt Danny, an dem bleibt kein Pfund hängen, nicht mal, wenn man’s anklebt. Tim ist jetzt wie alt? Dreiunddreißig? Aber er sieht aus, als hätte ihn die Verantwortung für den Laden, die er seit dem Tod seines Vaters trägt, vorzeitig altern lassen. Er wischt sich die Hände an seiner Schürze ab und kommt hinter dem Tresen hervor. »Peter und Paul sind schon da«, sagt er und weist mit dem Kinn Richtung Terrasse. »Chris Palumbo auch.«
»Was ist denn das Problem, Tim?«, fragt Pat.
»Die kommen her und machen sich wichtig«, sagt Tim. »Fast jeden Nachmittag sind sie da, trinken krügeweise Bier, das sie nicht bezahlen, bestellen Sandwiches, Burger … Hast du dir mal angesehen, was Rindfleisch neuerdings kostet? Und Brötchen?«
»Ja, okay.«
»Und jetzt wollen sie auch noch einen Umschlag«, sagt Tim. »Ich hab im Prinzip nur zehn, elf Wochen im Sommer, in denen ich was einnehme, den Rest des Jahres bin ich gearscht. Ein paar Einheimische und Fischer, die sich zwei Stunden lang an einem Bier festhalten. Nichts für ungut, Danny.«
Danny schüttelt den Kopf, als wollte er sagen: Schon gut.
Sie gehen durch die geöffnete Schiebetür raus auf die Terrasse, die gefährlich über ein paar Steinblöcke ragt, die der Staat dort hingesetzt hat, um zu verhindern, dass das ganze Gebäude ins Meer rutscht. Von da draußen kann Danny den gesamten südlichen Küstenstreifen sehen, vom Leuchtturm in Gilead bis runter nach Watch Hill.
Es ist wunderschön.
Die Morettis sitzen an einem weißen Plastiktisch an der Brüstung, auf die Chris Palumbo seine Füße gelegt hat.
Peter Moretti sieht aus wie ein typischer Mafioso – dichte, schwarze Haare, glatt zurückgekämmt, ein schwarzes Hemd, die Ärmel hochgekrempelt, damit die Rolex besser zur Geltung kommt, dazu Designer-Jeans und Slipper.
Paulie Moretti ist ein dürrer Spaghettifresser, ungefähr einssiebzig, karamellfarbene Haut, die hellbraunen Locken von blonden Strähnen durchsetzt. Dauerwelle, denkt Danny, ist jetzt angesagt, aber er kann sich damit nicht anfreunden. Danny findet, Paulie sah schon immer ein bisschen puerto-ricanisch aus, auch wenn er ihm das nicht sagen würde.
Chris Palumbo ist ein ganz anderer Typ. Knallrote Haare, als käme er aus dem beschissenen Galway, ansonsten aber ist er so italienisch wie Pizza und Pasta. Danny weiß noch, was der alte Bernie Hughes über ihn gesagt hat: »Trau keinem rothaarigen Itaker. Das sind die schlimmsten von der ganzen Brut.«
Peter ist clever, aber so schlau er auch sein mag, Chris ist schlauer. Peter rührt keinen Finger ohne ihn, und wenn Peter an die Spitze aufsteigt, wird Chris sein consigliere, keine Frage.
Die Iren ziehen sich Stühle heran, und die Kellnerin bringt zwei Krüge, stellt sie auf den Tisch. Die Männer schenken sich Bier ein, dann sagt Peter zu Tim: »Du bist also zu den Murphys gerannt.«
»Ich bin zu niemandem ›gerannt‹«, sagt Tim. »Ich hab nur Liam erzählt …«
»Wir sind hier ja unter Freunden«, sagt Pat, der sich nicht auf die Diskussion einlassen will, wer wem was gesagt hat.
»Wir sind unter Freunden«, sagt Peter, »aber Geschäft ist Geschäft.«
Liam sagt: »Diese Kneipe zahlt keine Abgaben an euch. Hat sie noch nie und wird sie auch nie. Tims Vater und mein Vater …«
»Sein Vater ist tot«, sagt Peter, dann sieht er Tim an. »Möge er in Frieden ruhen, ich will nicht respektlos sein. Aber die Vereinbarung ist mit ihm gestorben.«
»Es gibt eine Ausnahmeregelung«, erklärt Pat.
Peter legt los: »Du meinst, der Laden bleibt bis in alle Ewigkeit von allen Abgaben befreit, nur weil hier vor dreißig Jahren mal eine sommersprossige Torfnase Kartoffeln gekocht hat?«
»Pete, komm schon …«, sagt Pat.
Chris schaltet sich ein: »Was glaubst du wohl, wer dafür gesorgt hat, dass das Umweltamt den Felsblock hier hinsetzt, damit die Kneipe nicht zum Floß wird? Dann wärst du jetzt nämlich Huckleberry Finn. Das sind dreißig-, vierzigtausend allein an Material, von den Arbeitsstunden ganz zu schweigen.«
Pat lacht. »Und? Hast du das bezahlt?«
»Wir haben es veranlasst«, sagt Chris. »Da hab ich Tim jedenfalls nicht jammern hören.«
»Ich bestell doch schon bei euren Lieferanten«, sagt Tim. »Wisst ihr, was die mir für Fleisch berechnen? Woanders würde ich viel besser fahren.«
Das stimmt, denkt Danny. Die Morettis verdienen sowieso Geld an dem Laden, durch ihre Automaten und die Abgaben der Großhändler. Das ganze gratis Essen und Bier noch gar nicht mitgerechnet.
»Das erste Mal, dass das Gesundheitsamt sich deine Küche genauer ansieht«, sagt Chris, »wird auch das letzte Mal sein.«
»Dann esst mein scheiß Essen halt nicht, okay?«
Peter beugt sich über den Tisch zu Pat. »Wir sagen ja nur, dass wir in letzter Zeit ein paar Ausgaben wegen der Kneipe hier hatten, und wir finden, Tim sollte ein bisschen was dazu beitragen. Ist das denn wirklich zu viel verlangt?«
»Ich kann euch nicht geben, was ich nicht habe«, jammert Tim. »Ich hab das Geld nicht, Peter.«
Peter zuckt mit den Schultern. »Vielleicht finden wir ja eine andere Lösung.«
Jetzt kommt’s, denkt Danny. Die Forderung nach Abgaben war bloß der erste Ansatz. Die Morettis wissen, dass Tim kein Geld hat. Damit haben sie nur die Tür geöffnet, um durchzusetzen, was sie wirklich wollen.
»Was schwebt euch vor?«, fragt Pat.
»Einer unserer Leute«, sagt Peter, »hat letzte Woche hier auf der Herrentoilette Geschäfte gemacht, und Tim hat Krach geschlagen.«
»Er hat Koks gedealt«, sagt Tim.
»Du bist handgreiflich geworden«, entgegnet Paulie. »Du hast ihn höchstpersönlich rausgeschmissen.«
»Ja, und das werde ich auch wieder tun, Paulie«, sagt Tim. »Wenn mein Vater wüsste, was hier los ist …«
Danny erinnert sich an einen Streit zwischen Pat und Liam über Liams Kurztrips nach Miami. Angeblich fährt er nur wegen »sexueller Eskapaden« dorthin, so nennt er das, aber Danny hat seine eigenen Vermutungen, was Liams Miami-Aufenthalte betrifft.
Pat auch.
Danny war dabei, als Pat Liam zur Rede gestellt hat: »Hand aufs Herz, Liam, wenn du noch was anderes aus Florida mitbringst außer Herpes …«
Liam lachte. »Was, meinst du Koks?«
»Ja, ich meine Koks.«
»Koks bringt viel Geld ein, Bro.«
»Aber auch hohe Gefängnisstrafen«, meinte Pat. »Und jede Menge Druck vom FBI und der Polizei. Das können wir nicht gebrauchen.«
»Ja, mein Pate«, antwortete Liam und brachte seine Brando-Nummer. »Wir verlieren unsere Richter, unsere Politiker …«
»Das ist kein Spaß, kleiner Bruder.«
»Mach dir nicht ins Hemd«, erwiderte Liam. »Ich verschieb kein Koks, Herrgott noch mal.«
»Pass auf, dass du’s wirklich nicht tust.«
»Du meine Güte! Es reicht.«
Jetzt denkt Danny an dieses Gespräch und fragt sich, worum es hier eigentlich wirklich geht.
»Hör mal«, meldet sich Peter zu Wort, »vielleicht können wir bei den Abgaben ein bisschen nachsichtiger sein, wenn Tim sich dafür in anderer Hinsicht flexibel zeigt.«
»Warum hier?«, fragt Pat. »Im Winter sind hier nur Fischer.«