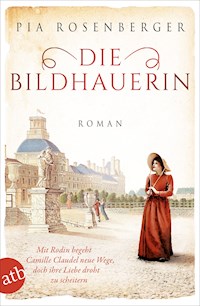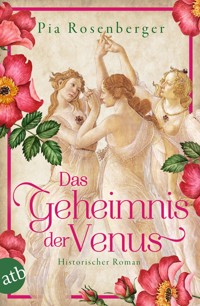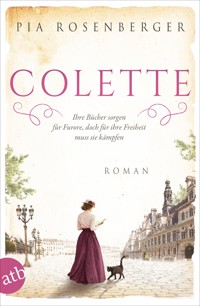8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
ULTRAMARIN – das Blau, das die Farbe des Himmels spiegelt Gent 1431: Der Maler Jan van Eyck braucht für seine Arbeit am Genter Altar das Pigment Ultramarin. Das jedoch ist in ganz Flandern nicht zu kriegen, da es nahezu unerschwinglich ist. Nur der Neffe seines Auftraggebers, Adrian Borluut, ein verkrachter Medizinstudent, sieht im Handel mit Ultramarin eine Chance, sich etwas aufzubauen. Er macht sich auf die Reise nach Venedig. In Esslingen lernt er den Apotheker Christoph Appenteker kennen, der sein Geschäftspartner wird. Als dieser mitsamt dem Geld spurlos verschwindet, macht Adrian sich mit dessen Tochter Catharina auf eine gefahrvolle Suche, nach der nichts in ihrem Leben mehr so sein wird wie zuvor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 677
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
PIAROSENBERGER
Die Spur des Ultramarins
HISTORISCHER ROMAN
FISCHER E-Books
Inhalt
Für meine Mutter Lucia Weber
Prolog
Das Abwasser prasselte durch ein Rohr in den Fluss und stank zum Gotterbarmen. Neben dem Auslass stand ein Mann. Er schob sich den Mantel vor die Nase und versuchte, durch den Mund zu atmen, um dem unerträglichen Geruch nach Exkrementen zu entgehen. Weiter unten, wo sich das Wasser braun und schwer durch sein Bett wälzte, verdünnte sich die Brühe langsam, und der Geruch lag nur noch als fauler Dunst in der Luft, an den man sich fast gewöhnen konnte. Aber hier … Wie hatte der Fremde ihn nur an diesen Treffpunkt locken können? Es war, als hätte er ihn jetzt schon über den Tisch gezogen und ihm seine Bedingungen aufgezwungen.
Er versuchte, nicht zu genau hinzusehen, was da aus dem Fallrohr mit der braunen Brühe in den Fluss geschossen kam. Und doch konnte er nicht anders. Kohlreste, Knochen, eine Lederbörse, die sicher ein Beutelschneider einem Zecher abgenommen hatte, alles fand sein letztes Ruhebett im Fluss. Ich gehe jetzt, dachte der Mann. Lange genug hatte er sich die Beine in den Bauch gestanden. Und Fisch, der aus diesem Fluss stammte, würde er sicher niemals wieder essen. Auch sein Plan war sinnlos, denn sein Opfer hatte sieben Leben wie eine Katze. Am Ufer warteten die billigen Wirtshäuser auf ihn und vielleicht die eine oder andere Hure, mit der er einen Teil des Goldes verprassen konnte, das eigentlich für den gedungenen Mörder bestimmt gewesen war.
In diesem Augenblick manifestierte sich aus dem Nebel eine unheimliche Erscheinung, die direkt aus der Hölle zu kommen schien. Die Gestalt war so groß, dass er zurückschreckte.
»Woher kommt Ihr so plötzlich?«
»Berufsehre!«, sagte der Fremde. Sein Gesicht lag im Schatten seiner Kapuze.
Ihm lief es eiskalt den Rücken hinunter. Unwillkürlich kreuzte er die Finger gegen den bösen Blick.
»Ich komme und gehe mit dem Wind.« Der Verhüllte lachte heiser. »Habt Ihr das Gold mitgebracht?«
»Natürlich.« Er nestelte den Beutel unter seinem Mantel hervor, in dem es leise klimperte. Sein Inhalt war das Lockmittel, aber bevor er ihn übergab, mussten die Bedingungen geklärt werden, diesmal nach seinen Regeln.
»Die Sache ist heikel«, sagte er.
»Das sind solche Dinge immer«, gab der Fremde gelassen zurück.
Er zuckte die Schultern. Angeekelt stellte er fest, dass er in etwas Schmierigem stand. Er würde seine Stiefel putzen lassen müssen.
»Es darf niemand merken …«
»Dass Ihr damit zu tun habt.« Der Fremde amüsierte sich köstlich.
»Worüber lacht Ihr?«
»Alle glauben immer, dass sie die Ersten sind, die einen andern vom Leben in den Tod befördern wollen. Aber glaubt mir, Ihr seid einer von vielen. Sogar Herzog Johann Ohnefurcht hat seinen Rivalen Louis von Orléans ermorden lassen.«
Der Mann schaute sich unruhig um. »Seid leise!«
»Warum? Hier ist das Territorium der Diebe, Halsabschneider und Huren.«
»Ich sage noch einmal: Es muss heimlich geschehen, damit keine Spuren zurückbleiben. Und dafür müsst Ihr ihn beobachten.«
»Nichts leichter als das«, sagte der Mörder.
»Und noch etwas. Er darf nicht hier sterben. Nicht der Schatten eines Verdachts soll auf mich fallen. Er ist ein Zugvogel, bleibt nie lang an einem Ort, so dass sich schon eine Möglichkeit für Euch auftun wird.«
»Dann folge ich ihm, wenn er die Stadt verlässt«, sagte der Mörder gleichmütig.
Er war sehr groß, und als er seinen Kopf neigte, drang neben dem Gestank nach Unrat und Exkrementen noch ein anderer in die Nase des Auftraggebers, ein fremder Geruch, den dieser nicht einordnen konnte und der ihm einen kalten Schauer über den Rücken trieb. Er riss sich zusammen und berichtete, was es über das Opfer zu sagen gab, wo es wohnte, womit es sich beschäftigte, was seine Vorlieben waren. Zuletzt legte er ihm den Beutel in die Hand. Der Mörder lockerte den Verschluss und holte eine Münze heraus, die im Abendlicht trübe glänzte.
»Den anderen Teil bekomme ich nach der Tat«, sagte er. »Wenn sie zu Eurer Zufriedenheit ausgeführt ist.«
»Sagt mir Euren Namen!«, verlangte er mit klopfendem Herzen und wunderte sich selbst über seinen Mut.
»Ihr habt Schneid.« Der Fremde lachte. »Man nennt mich den Namenlosen.« Damit war alles gesagt. Mit dem nächsten Windhauch löste er sich in Luft auf.
Aus dem Rohr platschte etwas in den Fluss. Etwas Großes, das den Auftraggeber, als es auf die Wasseroberfläche traf, mit einem Regen stinkender Tropfen bespritzte. War es ein Katzenkadaver gewesen, erstarrt in der Kälte des Todes? Er nahm es als gutes Zeichen.
1
Das Blau hatte die Farbe der Dämmerung kurz nach Sonnenuntergang. Jan van Eyck tauchte den Pinsel in die Farbpfütze auf seiner Palette und betrachtete die Spitze, die im Licht des Nachmittags feucht schimmerte. Im Atelier roch es nach dem Nussöl, mit dem er seine Farben anrieb. Der blaue Pinsel näherte sich der Holztafel mit der Eva, die auf der Staffelei stand, so nackt, wie Gott sie geschaffen hatte. Adrian Borluut, sein Bruder Cornelis und sein Onkel Josse Vijd standen hinter dem Maler und schauten ihm über die Schulter. Die Mutter der Menschheit sah so lebensecht aus, als hätte sie der Künstler direkt aus dem Paradies auf sein Bild gebannt.
Adrian hielt den Atem an. Seine Augen glitten über Evas lange Beine, den birnenförmigen Bauch, die kleinen Brüste. Sie war so kunstvoll gemalt, als könne sie, wenn ihr danach war, aus dem Bild heraustreten und sich lächelnd zu ihnen gesellen. »Ultramarin«, sagte er.
»Ich will keine Nackigen auf meinem Altar.« Onkel Josse ließ sich schwer atmend auf den Schemel neben dem groben Holztisch fallen. »Und schon gar keine blauen.«
Ein Lächeln trat in van Eycks Augen. »Keine Angst. Ich verwende die Farbe nur für einen zarten Schimmer auf der Oberfläche. Aber für andere Aufgaben werde ich mehr davon brauchen. Das hier ist leider der Rest.« Er deutete auf den blauen Farbklecks auf seiner Palette
Cornelis sog scharf die Luft ein. »Ihr wisst, dass Ultramarin in hochreiner Form in Gent schlecht zu bekommen ist«, sagte er. »Und dass es in Gold aufgewogen wird.«
Jan van Eyck ließ sich Zeit mit einer Antwort. »Ultramarin ist die Farbe Gottes. Und genau dieses Pigment brauche ich. Wenn Ihr denn einen Altar haben wollt.«
Sein Pinsel aus weichem Dachshaar glitt sanft über die Fläche und vertiefte einige Schatten auf dem zarten Körper der Frau. Dann tauschte er ihn aus und malte ihr eine täuschend echt aussehende schwarzbraune Haarsträhne. Fast so naturgetreu, als hätte sie unter der Oberfläche darauf gewartet, freigelegt zu werden, oder als habe er sie abgeschnitten und aufs Bild geklebt. »Ich brauche Ultramarin«, wiederholte der Künstler.
Adrian wusste, dass sie als Auftraggeber für die Beschaffung der Farbstoffe zuständig waren, die Jan van Eyck benötigte. An der Wand lehnten die fertigen Tafeln. Doch der riesige Altar, den sein Onkel bestellt hatte, war noch lange nicht vollendet. Und das würde er auch nicht werden, solange der Künstler nicht das Pigment bekam.
Er konnte seine Augen nicht von der Gestalt der Eva wenden. Sie hat uns allen die Erbsünde eingebrockt, dachte er. Und doch sieht sie so unschuldig aus wie ein Lamm. Das helle Licht des Nachmittags fiel in das Atelier des Künstlers und ließ die kalkweißen Wände aufleuchten. Im Hintergrund mörserte der Lehrling ein grünes Pigment, bis sich eine Staubwolke über seiner Schale zusammenballte. Aber van Eyck wollte Blau. Ultramarinblau! Mit seinem Bruder Hubert hätten sie diesen Ärger nicht gehabt.
Doch der war vor der Staffelei tot zusammengebrochen, und so hatten sie bei Jan angefragt, der als Kammerherr am Hof des Herzogs von Burgund diente, um das Werk zu vollenden, den prächtigen Altar, den Onkel Josse und Tante Elisabeth für ihre Kapelle in der Johanneskirche stiften wollten. Es hatte einige Jahre gedauert, bis Jan van Eyck zwischen den Aufträgen Herzog Philipps die Zeit gefunden hatte, sich dem begonnenen Altar zu widmen. Sie hatten nicht erwartet, dass er Hubert das Wasser reichen konnte, doch jetzt bewies er ihnen das Gegenteil. Er war mehr als der Höfling, für den sie ihn gehalten hatten, mehr als der glatte Diplomat, der in Portugal als Teil einer Delegation die herzogliche Heirat mit der Infantin Isabella eingefädelt hatte. Er war ein wirklicher Maler. Evas Haare flossen aus seinem Pinsel, und sie sahen echter aus als seine eigenen.
Jetzt jedoch hob er seine Augen und ließ sie prüfend über die Runde seiner Auftraggeber wandern. Sie blieben an Adrian hängen, der widerwillig spürte, wie er errötete.
»Ihr müsstet das doch verstehen, Adrian Borluut. Seid Ihr nicht der Gelehrte in der Familie?«
»Ähm, nein« sagte er und überhörte den Anflug von Spott in der Stimme van Eycks. Er war nichts weiter als ein verkrachter Medizinstudent, der sein Studium abgebrochen hatte.
»Ultramarin kommt aus Outremer«, wandte er ein, und seine Verwandten stimmten ihm zu. »Man kann in Gent alles kaufen. Malachitgrün …« Er schaute in Richtung des Lehrlings, der sich die grünen Finger an seinem Wams abputzte und ihr Gespräch fasziniert verfolgte, »Zinnober, Bleiweiß, Beinschwarz, Krapplack für ein prächtiges Rot und sogar Azurit, wenn man einen Blauton benötigt und das nötige Kleingeld hat. Aber mit Ultramarin wird es schwierig.«
»Noch ist es hier nicht gebräuchlich.« Der Maler schaute sie alle der Reihe nach an. Aus welchem Grund auch immer schien er diese Auseinandersetzung zu genießen. »Ehrenwerte Herren – wollt Ihr gar nicht wissen, wofür ich das Ultramarin zu verwenden gedenke?«
»Nun rückt schon damit raus!«, sagte der Onkel bärbeißig.
»Bei Adam und Eva nur für die Vertiefung der Schatten«, sagte van Eyck geduldig, als würde er einer Horde Kindern die Welt erklären. »Ansonsten besteht ihre Leibfarbe aus Ocker, Bleiweiß und Schwarz. Aber die neue Eva, Maria, die Himmelskönigin, sie soll ein Gewand bekommen, wie man es noch nicht gesehen hat. Tiefblau wie das Himmelszelt an einem sonnigen Tag, blau wie die Dämmerung, bevor die Sonne aufgeht, oder nachdem sie untergegangen ist. Verheißung. Sehnsucht. Gottesnähe. Nicht umsonst lautet ihr Name Meeresstern.«
Adrian nickte widerwillig, von sich selbst überrascht. Früher hatte man für ein schönes Blau einfach den Grundstoff Lapislazuli gerieben und die daraus entstehende Farbe auf den Malgrund aufgetragen. Das Ergebnis war wegen der Kalkeinlagerungen im Blau insgesamt unbefriedigend ausgefallen. Dann jedoch wurde im Osten ein Verfahren entwickelt, mit dem man alle Unreinheiten und alles Katzengold aus dem Halbedelstein entfernen konnte. In Italien verwendete man den Farbstoff Ultramarin in hochreiner Konzentration schon länger. War da nicht einer gewesen, der den Mauerputz al fresco in diesem Blau gestaltet hatte, gleichsam, als wolle er die Wand durchlässig für den Himmel machen? Ja, natürlich – sein Name war Giotto gewesen, Giotto di Bondone. Und auch die Brüder Limburg hatten ihr Stundenbuch damit hinterlegt. Wenn hochreines Ultramarin nur nicht so teuer wäre!
»Ich brauche nicht allzu viel«, fuhr der Maler nun bescheiden fort.
»Ob Ihr eine Unze braucht oder eine ganze Wagenladung«, sagte Cornelis ungehalten. »Das ändert nichts daran, dass wir kein Ultramarin besorgen können. In ganz Gent gibt es nicht einen Fingerhut voll davon.« Er griff nach dem Pokal mit Wein, der unter dem Fenster stand, und trank einen großen Schluck.
»Nein?«
Hatte Adrian sich verhört, oder schlich sich in das Wort nicht doch ein spöttischer Ton? Van Eyck hatte nichts dagegen, den Pfeffersäcken, die für sein Ultramarin ihre fetten Ärsche in Bewegung setzen mussten, eins auszuwischen. Im Hintergrund hörten sie die rhythmischen Geräusche des Mörsers. Der Lehrjunge hatte seine Arbeit wieder aufgenommen und rieb geduldig den grünen Farbstoff mit dem Bindemittel an. »Euch schert also nicht, dass wir das Pigment wer weiß wo besorgen müssen?«, fragte Onkel Josse bedrohlich leise. Adrian sah förmlich, wie die Zornesader auf seiner Stirn anschwoll.
»Und gleichfalls ist es Euch egal, wie viel wir dafür hinblättern müssen?«, fügte Cornelis hinzu.
Ein schiefes Lächeln stahl sich in Jan van Eycks Mundwinkel. »Habt Ihr nicht eine Bank und ein gutgehendes Handelskontor?«, fragte er. »Und Bedienstete, die für Euch reisen können?«
Er strich sich eine braune Haarsträhne hinter die Ohren, in die sich einige Fäden Grau gemischt hatten. »Und wenn Ihr selbst nach Outremer fahren müsst und im Wüstensand grabt – ich brauche es«, sagte er schlicht. »Und auch der Herzog wird sicherlich befürworten, dass an dem Altar nicht gespart wird.«
»Und was tut Ihr, wenn wir es nicht besorgen können?« Der Onkel schnappte nach Luft und lockerte seinen Halsausschnitt.
Adrian runzelte die Stirn. Onkel Josses Kurzatmigkeit bereitete ihm Sorgen.
Jan van Eyck zuckte mit den Schultern. »Ihr wollt einen Altar, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Einen Altar, der selbst Herzog Philipp den Zwist vergessen lässt, den Eure Familie mit der seinen hatte, und ich male ihn Euch. Vorausgesetzt, Ihr stellt mir das Material dafür zur Verfügung.«
Ohne ein Wort erhob sich der alte Mann und verließ am Arm seines Neffen Cornelis den Raum. Adrian fand sich plötzlich allein an der Seite des Malers wieder, der in aller Ruhe seinen Pinsel in die Farbe tauchte und eine weitere feine Haarsträhne auf das Bild zauberte.
»Ihr seid kein Künstler?« Van Eyck wandte ihm seinen Blick zu.
»Nein«, sagte Adrian.
»Dann ist Euch das Gefühl nicht vertraut, und das ist vielleicht auch besser so.«
»Welches Gefühl?«
»Das Gefühl, dass alles richtig ist«, sagte Jan van Eyck, und Adrian fühlte sich plötzlich so nackt wie Eva auf der Staffelei.
»Und wie nennt Ihr es? Dieses Gefühl?«
Van Eycks graue Augen waren sehr kühl. »Vollkommenheit«, sagte er.
Adrian verließ den Raum und schloss die Tür hinter sich.
Der Künstler zog sich von der Staffelei mit dem Bildnis der Eva zurück, ging zum Tisch und reinigte sorgfältig die Dachshaarpinsel – eine Arbeit, die er nur ungern seinen Gehilfen überließ. Dieser Adrian Borluut – er interessierte sich für ihn und das nicht nur, weil er ein ideales Modell für einen der Ritter auf dem Seitenflügel des Altars abgeben würde. Adrian Borluut war anders als sein geiziger Onkel und unterschied sich auch von diesem Bullen von Bruder, der in die Fußstapfen des alten Pfeffersacks treten würde.
Trotz seiner hellbraunen Locken und der blaugrünen Augen sah man ihm an, dass er kein Flame war. Er hatte eine dunklere Hautfarbe und ein Gesicht, das auf eine Herkunft jenseits der Alpen hindeutete. Wie man munkelte, strömte das Blut seiner italienischen Mutter heißer durch seine Adern, als es sollte. Er machte mit seinen Freunden bei Nacht die Straßen unsicher. Einmal hatte ihn sein Bruder gegen Geld aus dem Kerker im Grafensteen holen müssen, weil er seine ganze Barschaft verspielt hatte. Auch gegenüber den Reizen der Frauen war er nicht unempfindlich. Hatte ihn nicht sein Onkel in Köln rauspauken müssen, weil er eine Ratsherrentochter verführt und damit für einen handfesten Skandal gesorgt hatte?
Jan van Eyck schüttelte den Kopf. Die Familie Vijd-Borluut hatte ihn, ohne es zu ahnen, mit dem Auftrag für diesen Altar an die Grenzen seiner Schaffenskraft geführt. Sie hatte ihn mit Visionen aus Licht und Schatten über sich selbst hinaus in die Weiten des Himmels geschleudert. Sie hatte ihn um den Schlaf und um seinen Frieden gebracht, und niemand, nicht der alte Vijd oder seine Frau, und auch nicht die Neffen, konnte die Größe des Werkes erahnen. Er würde Gott ein Gesicht geben. Sie durchschauten nicht, was er hier tat. Dass die Kraft des Altars mit dem Wasser des Lebensbrunnens aus dem Bild in die Welt hinausrinnen würde, langsam und stetig wie eine Quelle, die nie versiegte. Wie vermessen, wie unglaublich hochmütig, wie vollkommen würde sein Werk sein? Nur dieser Adrian hatte ansatzweise die Fähigkeit dazu, das zu verstehen. Weil er ebenso wie der Maler auf der Suche war.
2
Aus der Küche roch es nach Braten und frisch gebackenem Brot, das die Köchin zusammen mit den Backäpfeln in den Ofen geschoben hatte.
Das Haus der Familie Vijd hatte eine imposante Steinfassade zur Gouvernementstraat hin und war um einen Innenhof herum angelegt. Von den zierlichen Galerien im ersten und zweiten Stock konnte man Hof und Einfahrt überblicken. Adrian stand unter der Arkade im ersten Stock, als sich das Tor für eine Fuhre Tuche öffnete. Die Bediensteten liefen herbei, um die Ladung sicher in ihren Kellern zu verstauen. Neben den Bankgeschäften seines Onkels war es der Handel, der die Familie reich gemacht hatte: Wein vom Rhein, aus Frankreich und aus dem Burgund, mit dem sie die Genter Patrizier belieferten, erstklassige Wollstoffe aus Flandern, die sie nach Osten schickten. Außerdem war sein Onkel Herr über die Ortschaft Pamele und Ratsmitglied in Gent.
Adrian bemerkte nicht wirklich, was sich unten im Hof abspielte. Seine Gedanken waren bei dem Maler Jan van Eyck und seinen Ansprüchen. Vollkommenheit! Jeder Pfaffe würde auf sein Streben mit Entsetzen reagieren und die Inquisition benachrichtigen. Gott allein käme dieser Zustand zu, würden sie sagen, und vielleicht noch der Mutter Kirche, in die Onkel Josse so viel Geld investierte, um seiner Seele Eintritt in den Himmel zu verschaffen. Vollkommenheit. Allein das Wort zu denken war vermessen. Dennoch konnte Adrian den Maler verstehen. Und das erstaunte ihn mehr als alles, was in den letzten Wochen passiert war. Vollkommenheit … Es gab kaum etwas, das weniger zu seinem Leben passte. Er hatte es geschafft, sein Studium in den Sand zu setzen, hatte sich selbst und sein Ziel, Arzt zu werden, irgendwo in Köln verloren, zwischen Hörsälen, Wirtshäusern und den Schenkeln einer süßen und willigen Patriziertochter, die darauf spekuliert hatte, dass er sie heiraten würde.
Um den Zwist mit ihrer Familie wieder zu bereinigen, war eine Menge von Onkel Josses Geld den Bach heruntergegangen, oder sollte man besser sagen, den Rhein hinaufgeflossen? Vor drei Wochen hatte ihn der Onkel persönlich aus Köln abgeholt und unter die Aufsicht seines älteren Bruders Cornelis gestellt, dessen Benehmen stets vorbildlich war. Adrian stieß zornig mit der Fußspitze gegen die Mauer. Er hasste es, Cornelis mit seinen Büchern zur Hand zu gehen. Sie waren sehr wohlhabend, und doch fühlte er sich gefangen zwischen den düsteren Wänden des Kontors und den Ansprüchen der Familie Vijd, die nicht die seinen waren. Und jetzt hatte er noch einen Besuch zu machen, der ihm Magenschmerzen bereitete.
Als er die Klinke zum Zimmer seiner Tante herunterdrückte, sah er, dass ihm schon jemand zuvorgekommen war. Cornelis saß auf der Kante des hohen Betts und hielt ihre Hand. Adrian schob sich schweigend in den Raum und wusste nicht, wohin mit seinem Blick. Elisabeth Borluut litt unter Gichtanfällen, die sie immer wieder ans Bett fesselten. Adrian wusste, dass sie Schmerzen hatte und den Mohnsaft dankbar einnahm, den er ihr in der Apotheke besorgte. Mehr konnte er nicht tun. Wann die Besserung eintreten würde, konnte niemand sagen, nur, dass die Tante meistens viel zu früh ihr eisernes Regiment im Haus wieder aufnahm.
»Mein Adrian, komm her! Und du, Cornelis, setz dich auf den Stuhl am Fenster!«
Als Cornelis aufstand, sah er aus, als hätte er in einen sauren Apfel gebissen. Die Tante saß aufrecht in ihrem hohen Bett, eine Nachtmütze aus feinster Spitze umrahmte ihr schmales Gesicht. Adrian wusste nicht, wo sie die Flamme hernahm, die sie am Leben hielt. Und doch war sie nicht zu schwach, um sich von ihrem Krankenzimmer aus den Überblick über das Geschäft und die Familie zu bewahren. Er setzte sich und spürte als Nächstes ihre vogelzarten Finger in seinen wirren Locken.
»Cornelis hat gesagt, der van Eyck braucht Ultramarin«, sagte sie.
Irritiert schaute er zu seinem Bruder hinüber, der mit gerunzelter Stirn am Fenster saß und nickte. Warum hatte er das brühwarm der Tante erzählen müssen?
»Das stimmt«, erklärte er zögernd.
»Hochreines Ultramarin ist in Gent nicht zu kriegen«, fügte sein Bruder überflüssigerweise hinzu.
»Nein!«, sagte die Tante, die bestens über Waren und Preise Bescheid wusste. »Und wahrscheinlich in ganz Flandern nicht.«
»Irgendwo zwischen hier und Venedig würde man es schon finden.« Cornelis schüttelte den Kopf und lachte leise. »Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist umständlich und zeitaufwändig.«
»Und was hat euer Onkel dazu gesagt?«
»Nichts«, sagte Cornelis. »Er ist ziemlich sauer abgezogen.«
Die Tante nickte langsam, als hätte sie nichts anderes erwartet. »Er ist geizig und eigensinnig, und der Maler will ihm seinen Willen aufzwingen. Das kann er überhaupt nicht leiden.« Sie schützte Onkel Josse, stellte sich trotz seiner Bärbeißigkeit und seinem Jähzorn vor ihn wie eine Löwin, die ihr Junges verteidigte. »Aber schon heute Abend wird es ihm leidtun.«
»Das glaube ich nicht«, widersprach Adrian. »Sein Nein war klar und deutlich.«
Die Tante schüttelte den Kopf wieder und wieder wie eine Taube, die sich nach Futter drehte. »Ihr versteht ihn nicht. Das ist einer der Vorzüge des Alters, dass man die Dinge plötzlich sieht, wie sie wirklich sind. Für euch ist Onkel Josse nur der strenge Bankier und Patrizier, der sein Geld zusammenhält.«
»Hat er uns je eine andere Seite gezeigt?«, warf Cornelis bitter ein.
»Dieser Altar bedeutet ihm viel.«
Adrian nickte. Wenn van Eyck konsequent blieb, würde es keinen Altar geben.
»Wir stehen beide am Ende unseres Lebens, er und ich«, fuhr die Tante fort. »Der Altar mit der Anbetung des Lammes ist nicht nur ein Weg, der ihn in den Himmel führen wird, und er ist auch mehr als nur die Möglichkeit, die Aussöhnung zwischen uns und Herzog Philipp voranzutreiben. Er ist das Einzige, was von ihm bleiben wird, wenn der stolze Josse Vijd einmal gegangen ist.«
Langsam lichtete sich das Dunkel in Adrian. Onkel und Tante hatten keine Kinder. Sie hatten zwar ihre beiden Neffen bei sich aufgenommen, als deren Eltern gestorben waren. Aber sie waren keine leiblichen Nachkommen für den Onkel, kein Fleisch von seinem Fleisch. Was zählte da schon, dass er reich war und sich als Ratsmitglied in Gent einen Namen gemacht hatte?
»Er will etwas, das ihn überdauert«, folgerte er düster. »Und jetzt ärgert er sich wahnsinnig, dass ihm der Maler seine Bedingungen aufzwingen will.«
Und heute Abend kriegt er wieder einen roten Kopf, dachte er, und ich kann sehen, dass ich ihm schnell sein Herzmittel besorge, weil er das Fläschchen sicher wieder verlegt hat. Cornelis stand auf und begann, im Zimmer auf und ab zu gehen. »Was willst du damit sagen, Tante Elisabeth?«
»Nun.« Ihre Augen schauten schlau von einem zum anderen. »Es ist nicht unmöglich, das Pigment zu besorgen. Das habt ihr eben selbst gesagt.«
»Du meinst doch wohl nicht, dass wir uns von diesem dahergelaufenen Maler erpressen lassen sollten?« Cornelis ließ sich schwer auf seinen Stuhl fallen und schüttelte den Kopf.
Und plötzlich wusste Adrian, was er zu tun hatte. Es stand so sonnenklar vor ihm, als hätte es jemand auf die grünlichen Butzenscheiben des Fensters geschrieben. Es war nicht unmöglich, das Pigment zu besorgen – nicht, wenn man ihm geduldig entgegenreiste, immer nach Süden, wenn es sein musste sogar bis nach Venedig. Seit vor drei Wochen die Tür des Kontors zum ersten Mal hinter ihm ins Schloss gefallen war, hatte er von hier fortgewollt.
»Ich mache es«, sagte er und fühlte sich plötzlich wie befreit.
»Du bist verrückt!«, rief sein Bruder. »Willst du nach der Pfeife dieses Malers tanzen wie ein dressierter Bär?«
»Ich will, dass es einen Altar gibt«, sagte er nachdenklich. »Einen Altar, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat.«
Seine Schritte führten ihn noch einmal in Jan van Eycks Atelier. Der Maler schaute auf und senkte dann die Augen wieder auf seine Palette, auf der er einen Rotton mischte, der intensiv nach Nussöl roch. Krapplack, dachte Adrian.
»Ich gehe«, sagte er. »Ich mache das.«
Van Eyck vertiefte sich weiter in die Herstellung seiner Farbe. »Auch andere Maler werden bald Ultramarin benötigen, da bin ich mir sicher. Flandern ist voll von Künstlern, die nach der neuen Schule malen, lebensechte Bilder. Kein anderes Blau ist so lichtecht und gibt den Glanz des Himmels so klar wieder.«
Und plötzlich entstand da eine Idee in Adrian, winzig klein wie ein Samenkorn, das keimte und sich zu verzweigen begann. Er starrte Eva an, die gelassen und, ohne von ihm Notiz zu nehmen, seitlich aus dem Bild herausschaute. Trotzdem war er sich später sicher, dass seine Eingebung nicht ohne sie zustande gekommen wäre.
»Man könnte richtig viel Geld damit verdienen. Wir wären die ersten Händler, die es in Gent vertreiben würden. Also brauchen wir nicht nur einen Fingerhut voll davon.«
Van Eyck schaute auf. In seinen grauen Augen stand ein triumphierendes Funkeln. »Nein?«
»Wir brauchen einen Handelszug.«
3
Es war der Tag vor Allerheiligen. Die Reichsstraße spannte sich wie ein Bogen von der äußeren bis zur inneren Esslinger Brücke und war wie immer gedrängt voller Menschen. Der Herbstwind hob ihre Mäntel und Umhänge, spielte mit den Bändern der Hauben der Frauen und wirbelte einen Haufen rotbraune Herbstblätter in die Luft. Die Fernhändler mit ihren Wagen voller kostbarer Gewürze und Stoffe, die Bauern mit ihren Karren voller schrumpliger Äpfel, die Bürgerinnen und kostbar gekleideten Ratsherren, sie alle schoben sich im Gedränge langsam voran.
Catharina Appenteker war mitten unter ihnen und spürte, dass sie jemand verfolgte. Sie konnte seine Gestalt in der Menge nicht ausmachen. Und doch war er da. Seine Gegenwart war wie eine Insel der Stille mitten im Getriebe und Lärm der Menschen. Es war nicht weit bis zur Apotheke in der Webergasse. Erst hatte sie nicht glauben können, dass das Gefühl der Bedrohung ihr galt. Doch dann war sie sich plötzlich sicher gewesen. Sie fragte sich nur, weshalb. Hatte es jemand auf den Inhalt ihres Korbes abgesehen, aus dem es bittersüß nach Kräutern duftete? Über Mittag hatte sie, natürlich nicht ohne kunstgerecht zu feilschen, den Sammelweibern auf der anderen Seite des Neckars ihre Ware abgekauft. Sie brauchten die Zutaten für ihre Arzneien, doch Menschen, die nicht kräuterkundig waren, würden nicht viel damit anfangen können.
Das Gefühl, verfolgt zu werden, hatte schon nach dem Torhaus begonnen, als die Brücke auf der Höhe der Bäckermühle in die Straße überging, und wurde immer stärker, je näher sie der Stadtkirche mit ihren beiden Türmen kam. Es war, als ob der Fremde sie in die Dunkelheit ziehen wollte, in der der Tod auf sie lauerte.
Catharina durchschritt das Finstere Tor, in dem ihre Schritte widerhallten, und fürchtete sich. Zurück im Tageslicht drückte sie entschlossen den Korb fester an sich, zog ihre Kapuze zurecht und trat in den Windschatten einiger flandrischer Fuhrleute, die ihre Karren mit kostbaren Stoffen beladen hatten. Rücksichtslos bahnten sie sich ihren Weg mit der Peitsche durch die Menge, schwangen sie nach links und rechts gegen das Bettelvolk, das sie bedrängte, und machten sich so den Weg frei. Sie ging weiter, Schritt für Schritt folgte sie den quietschenden Rädern und spürte dabei noch immer den Blick des Fremden in ihrem Rücken. Eisige Kälte kroch ihr den Rücken hinauf, und sie wusste nicht, ob sie sich mehr vor ihrer Vorahnung fürchtete oder mehr vor dem, was der Fremde ihr antun konnte. Vielleicht wurde sie ja zu allem Überfluss noch verrückt. Nimm dich zusammen!
Die Flamen fluchten, weil es auf der Handelsstraße so langsam voranging. Der Ochse, der vorn in der Deichsel des Wagens hing, kotete auf die Straße, Mistgeruch kroch in ihre Nase, und sie machte einen großen Satz, um nicht in den warmen Haufen zu treten. Einen Moment lenkte der Vorfall sie ab, aber dann spürte sie ihn wieder, ihren Verfolger, dessen böse Absichten ihr die Haut verbrannten wie eine Kerzenflamme. Angst schnürte ihr die Kehle zu. Sie versuchte, den Karren zu überholen und schneller zu gehen, doch plötzlich war der Fremde an ihrer Seite wie ein Schatten, riesig, gehüllt in einen dunklen Umhang, unter dem sie nichts wahrnahm als die Ahnung eines Schwertes, das schwer an seiner Seite hing. Er hob den Arm, und sie sah, wie sich sein Kopf in ihre Richtung wandte. Sein Gesicht konnte sie unter der Kapuze nicht erkennen. So musste der Tod aussehen, bevor er seine Sense schwang.
Catharina schnappte nach Luft und taumelte gegen die Brust eines fuchsfarbenen Pferdes, das hinter ihr im Schritt ging. Es wieherte panisch, stieg hoch, so dass sein Reiter es kaum bändigen konnte, tänzelte zur Seite und krachte mitten in einen Marktstand hinein. Die Händlerin, die heiße Honigkrapfen an die Reisenden verkaufte, kreischte laut auf, als ihre Ware im Dreck der Gasse landete. Catharina sah nicht mehr, wie die Straßenkinder sich auf die willkommene Beute stürzten. Die Welt drehte sich, ihre Knie knickten unter ihr weg, und sie fand sich plötzlich am Boden wieder.
»Geht es Euch gut?«, fragte eine Stimme neben ihr. Der Reiter war abgestiegen und kniete neben ihr in einer Pfütze, ohne darauf zu achten, dass sich sein brauner Reisemantel voll Wasser sog. Sein Fuchs stand quer und versperrte den Weg für den Durchgangsverkehr, der sich unaufhaltsam um ihn herum seinen Weg bahnte, wie Wasser, das einen Felsen umrundete.
»Könnt Ihr aufstehen?«
Als sie nickte, zog er sie am Arm hoch und angelte umständlich nach ihrem Korb, der mit seiner Unterseite voran auf den Boden gefallen und zum Glück nicht ausgekippt war. Sie schaute hinein. Es war alles noch da. Sonnenhut, Thymian, Engelwurz und Beinwell. Sogar die getrocknete Schafgarbe lag noch obenauf. Welch ein Segen!
»Danke!« Sie seufzte erleichtert. »Ihr habt sogar meine Kräuter gerettet.«
Der Reiter war noch jung, nicht viel älter als sie. Blaugrüne Augen blickten sie forschend an. Über seinem freundlichen Gesicht stand ein Wust goldbrauner Locken. Versuchsweise probierte sie, ihren Arm aus dem festen Griff zu lösen, mit dem er sie noch immer hielt.
»Ihr seid ganz dreckig und nass obendrein, und außerdem könnt Ihr mich jetzt loslassen.«
»Wann ich Euch loslassen will, entscheide ich allein.« Der Reiter lachte sorglos, führte sie an den Straßenrand und schnalzte mit der Zunge, bis der Fuchs ihm folgte. »Aber warum fallt Ihr am helllichten Tag meinem Pferd vor die Füße? Vielleicht habt Ihr ja zu wenig gegessen. Davon wird Mädchen manchmal schwarz vor Augen. Ihr solltet einen Arzt aufsuchen.«
Catharina biss sich auf die Lippen. »Nein«, sagte sie dann. »Da war ein Mann.« Sie schüttelte den Kopf und schaffte es nicht, ihm von ihrer Angst zu erzählen. Sie schaute sich nach dem Fremden im schwarzen Mantel um, der in der Menge untergetaucht war. »Ich gehe jetzt besser«, sagte sie.
»Seid Ihr dazu denn in der Lage?« Der junge Mann hatte seine Hand auf die Nüstern des Pferdes gelegt, dessen Atem weiß in die kühle Luft stieg. »Schhh, Träumer«, sagte er beruhigend.
»Aber ja. Außerdem bin ich gleich daheim.« Sie winkte ihm zum Abschied und ging davon, etwas wacklig, aber ihre Beine trugen sie Schritt für Schritt. Auf der Höhe der Türme von St. Dionys, die mächtig bis zum Himmel aufragten, fiel ihr ein, dass sie ihren Helfer gar nicht nach seinem Namen gefragt hatte.
4
Der Herbststurm pfiff durch Esslingens Gassen, wehte die Blätter von den Bäumen und rüttelte an der Tür der Stadtapotheke. Drinnen hatte die Dämmerung Einzug gehalten, die an den Tagen rund um Allerheiligen bereits kurz nach Mittag einbrach. Tapfer leuchtete das Öllämpchen auf dem Verkaufstisch gegen die Dunkelheit an.
Catharina klappte den dicken Folianten zu, in dem sie gelesen hatte, warf ihren braunen Zopf über die Schulter und rieb sich die Augen. Den Vorfall von heute morgen hatte sie über der Lektüre der alten Schrift schon beinahe vergessen. Doch jetzt brannten ihr die Augen, auch wenn das Buch über die Heilkunde noch so kostbar war. Die heilige Hildegard selbst hatte es geschrieben. Es war ihr Werk über die Heilkunde, die »Causae et Curae«, und sie war neben der »Physica« schon länger als hundert Jahre im Besitz der Familie. Catharina konnte die Ausführungen der Äbtissin vom Disibodenberg mit Leichtigkeit verstehen, denn ihr Vater hatte sie Lesen, Schreiben, Latein und die freien Künste gelehrt, seit sie acht Jahre alt war. Im hinteren Teil des Ladens war der Lehrjunge Jacob damit beschäftigt, die Kräuter von jenseits der Mauer in Tongefäße umzufüllen, und pustete sich grauen Thymianstaub von den Fingern. Sein bitterer Duft vermischte sich mit den süßen Dünsten aus der Küche, wo ihre Köchin Mira gerade Apfelringe dörrte. Catharina legte das dicke Buch auf dem Verkaufstisch ab.
»Jacob. Du kannst mir helfen, unsere Vorräte an Farbstoffen zu überprüfen!«
Der blonde Junge putzte sich missmutig die Hände an seinem Kittel ab. »Was soll ich tun?«
»Einfach achtgeben, was ich sage.« Catharina reichte ihm einen festverschlossenen Behälter aus Ton. Er drehte verbissen am Deckel, der sich verkantet hatte.
»Vorsicht!«, warnte sie. »Das ist Auripigmentum.«
»Klingt kostbar.« Er lauschte dem Klang des Wortes nach. Jetzt ließ sich der Deckel öffnen. Im Innern des Behälters befanden sich einige gelbgrüne Brocken, die er zweifelnd anstarrte. »Welche Farbe soll das geben?«, fragte er misstrauisch.
Catharina lachte leise. »Es färbt gelb und ist giftiger als jedes andere Pigment, das wir verkaufen. Mach es gleich wieder zu, hörst du! Und wenn du das Behältnis das nächste Mal öffnest, ziehst du dir ein Tuch vor die Nase, damit du die Dünste nicht einatmest!«
Das würde er im Ernstfall sicher vergessen. Mit dem Sortieren der Kräuter und dem Studium der Schriften Hildegards hatten sie den Nachmittag verbracht, denn Kundschaft kam fast keine. Nur Marie, die kleine Tochter des Schusters, hatte eine von Catharina frisch angemischte Salbe gegen Warzen geholt. Wenn die nicht half, hatte sie gesagt, würde ihre Mutter sie zum Warzenbesprechen zur alten Margrete schicken. Außer dem kleinen Mädchen zogen es alle anderen Esslinger Bürger bei dem Herbststurm vor, sich zu Hause hinterm Ofen zu verkriechen. Keine Sorge, dachte sie. Die nächste Erkältungswelle rollte so sicher heran wie das Amen in der Kirche, und dann würde die Kundschaft schon wieder herbeiströmen und ihre Heiltränke gegen Triefnasen, Husten und Verschleimung kaufen.
Sie schaute sich um. Auf den Regalen standen die Gefäße mit den Kräuterauszügen und Tinkturen eng an eng bis zur Decke gestapelt. Doch eine ganze Wand war den Pigmenten vorbehalten, die vor allem die Mönche aus den Schreibstuben der Klöster für ihre prächtig illuminierten Codices kauften. Sie seufzte. Es war beinahe zu dunkel, um zu erkennen, welcher Farbstoff in welchem Behältnis war. Wenn sie vorankommen wollten, würde sie ein weiteres Licht anzünden müssen. Blinzelnd hob sie den Beutel mit dem roten Ocker an und stellte am Gewicht fest, dass sie das Erdpigment dringend nachbestellen musste. »Fehlt!«, murmelte sie.
»Und wo steckt der Meister mal wieder?« Jacob kratzte sich am Kopf. »Dein Vater lässt sich gar nicht mehr blicken.«
»Keine Ahnung.« Catharina seufzte. Als Stadtapotheker sollte sein Platz eigentlich im Laden sein. Er und nicht sie hatte die Pflicht, seinem jungen Lehrling das Handwerk beizubringen.
Sie seufzte noch einmal, als sie über die unterste Regalreihe putzte und eine Staubwolke aufwirbelte. Jacob hatte natürlich recht, aber auch das änderte nichts daran, dass ihr Vater sich lieber in der Stadt herumtrieb, als hinter dem Ladentisch zu stehen. Noch schlimmer war es, dass er gar nicht so sehr dem Wein, sondern seinen Träumen nachhing, die ihn in ein Land jenseits des Sonnenaufgangs entführten, das Catharina nie gesehen hatte. Zum Glück konnte er wenigstens nachts nicht mehr in seiner brodelnden Alchemistenküche voller stinkender Dämpfe und wabernder Flüssigkeiten verschwinden, denn die war ihm vor gut einem Jahr über dem Kopf wegexplodiert. Dennoch suchte der Vater überall nach irgendetwas, von dem nicht einmal er selber wusste, was es war. Niemand ahnte, wohin das noch führen sollte.
»Ich werde dich heiraten«, sagte Jacob tiefernst.
Catharina lachte und stieg vom Stuhl. »Wenn du endlich deine eigene Apotheke hast, bin ich eine alte Schachtel ohne Zähne«, sagte sie und verwuschelte sein helles Haar. Er schüttelte den Kopf und schaute sie aus seinen blauen Augen an, die ein einziges Versprechen waren. »Du wirst immer wunderschön sein, Cathie. Das schönste Mädchen in der Stadt und die beste Lehrerin.«
»Sogar, wenn ich keine Zähne mehr habe?« Hinter dem Scherz verbarg sich eine Menge Ratlosigkeit.
Bis vor einem Jahr hatte die Großmutter noch gelebt, die Catharina ab ihrem zwölften Lebensjahr in das Wissen und den Erfahrungsschatz der Apotheker eingeweiht hatte. Jetzt war sie siebzehn und eine ausgebildete Apothekerin. Auch wenn es ihr als Frau nicht gestattet war, selbständig das Geschäft zu führen, würde ihr das Heilwissen, das sie auf diese Weise gewonnen hatte, niemand streitig machen. Und immer häufiger ertappte sie sich dabei, wie sie ihre Kenntnisse an den Lehrjungen weitergab.
In diesem Moment sprang die Tür auf. Mit einem Schwall kalter Luft drängte sich eine Gruppe Männer in den Raum. Bevor sie die Tür schließen konnten, blies der Wind ihnen einen Haufen rotbunter Ahornblätter hinterher. Das Öllicht auf dem Verkaufstisch flackerte und verlöschte im Wind.
»Kalt da draußen.« Christoph Appenteker griff nach dem Leuchter mit den teuren Wachskerzen, holte einen Kienspan aus dem Ofen in der Küche und zündete eine nach der anderen an, bis ihr heller Schein auch die finstersten Ecken erleuchtete.
»Vater«, sagte Catharina hilflos und ärgerte sich über die Verschwendung und den Weindunst, der ihn und seine Kumpane umgab. Hoffentlich hatte ihr Vater nicht so viel getrunken. Er wusste doch, dass er das nicht vertrug.
»Da wären wir also.« Der Apotheker rieb sich unternehmungslustig die Hände, während die anderen beiden sich neugierig umsahen. »Das hier ist mein hoffnungsvoller Lehrling Jacob.« Er deutete auf den Jungen, der puterrot wurde und sich am liebsten in Luft aufgelöst hätte. »Und das da meine zauberhafte Tochter.« Er zog sie vor seine Brust. »Catharina.«
»Hast du den Hustensirup schon angesetzt, Cathie?«, fuhr er dann fort und hielt sich schwankend am Ladentisch fest. »Thymian, Salbei, Honig. Er verkauft sich sicher gut.«
»Das werde ich morgen tun«, sagte sie und taxierte die Ankömmlinge.
Der eine war Eckhard Weckmann, der die zweite Esslinger Apotheke in der Apothekergasse führte. Der andere – Catharinas Herz begann zu klopfen – war ihr Retter von der Handelsstraße, und er hatte das unternehmungslustige Funkeln in den Augen, das man sich besser verkniff, wenn man gefahrlos mit ihrem Vater verkehren wollte. Christoph machte eine großspurige Bewegung, die beide Gäste mit einschloss.
»Meister Eckhard kennst du ja.« Sein Weindunst flutete Catharina ins Gesicht, und sie rümpfte die Nase.
Und ob sie Weckmann kannte. Der blonde Hüne, fassbreit und bärtig, begrüßte sie mit einer spöttischen Neigung seines Kopfes und näherte sich dann ungefragt dem Verkaufstisch, wo die Schrift der heiligen Hildegard lag. Sie erinnerte sich daran, wie er ihr Rezept für eine Arznei gegen Leibdrücken kurzerhand kopiert und den Kräutersud dann günstiger verkauft hatte, kratzte die Reste ihrer Höflichkeit zusammen und nickte zurück.
»Ich wusste gar nicht, dass du mit der Konkurrenz verkehrst«, flüsterte sie so leise, dass es ihr Vater vielleicht gar nicht gehört hatte. Weckmann öffnete das Buch, und Catharina ärgerte sich. Nimm deine schmutzigen Pfoten weg!, dachte sie.
Der Einband knallte, als er ihn zuklappte.
»Gelehrte Weibsbilder«, sagte er verächtlich. »Frauen, die lesen, und Hühnern, die krähn, sollt man beizeiten die Hälse umdrehn.«
Zornig stemmte sie ihre Hände in die Hüften und öffnete den Mund für eine schlagkräftige Entgegnung, doch ihr Vater kam ihr zuvor.
»Und das hier ist Adrian Borluut aus Gent«, sagte er und drehte sie zur Seite, so dass sie dem fremden jungen Mann ins Gesicht schauen musste.
»Wir kennen uns schon«, sagte dieser jetzt.
Da war er nun also. Catharina holte nach, was sie heute Mittag versäumt hatte, und betrachtete ihn genauer. Unter dem warmen Reisemantel war seine teure Kleidung verborgen geblieben. Er trug einen knielangen Wappenrock aus schwarzem Samt von erster Qualität. Darunter schaute allerfeinstes, gefälteltes Leinen hervor. Seine Beine steckten in roten Beinlingen, und die Stiefel aus weichem Leder hatten sicher ein Vermögen gekostet. Sie löste sich aus dem Griff ihres Vaters und trat einen Schritt zur Seite.
»Meister Borluut ist auf der Suche nach einem Pigment«, sagte ihr Vater. »Ultramarinblau.«
Es wurde so still, dass sie den Wind vor der Tür pfeifen hören konnten. Das Wort stand als gestaltgewordene Verheißung zwischen ihnen, als könne man nach ihm greifen.
»Oh«, sagte Jacob.
»Wir haben kein Ultramarin.« Catharina machte eine umfassende Geste, die den ganzen Laden einschloss. »Wir waren gerade dabei, unsere Bestände zu überprüfen. Wir führen Blauholz und Azurit. Und Ihr?« Unwillig wandte sie sich Weckmann zu, der die Schultern hochzog.
»Nein«, gab er nach kurzem Zögern zu. »Kleine Mengen für die Buchmalerei besorge ich in Ulm. Niemand hier kann sich Ultramarin in größerem Umfang leisten.«
»Nein, denn es wird mit Gold aufgewogen! Manchmal auch mit seinem Wert hoch drei.« Christoph Appenteker lachte ihnen siegessicher zu und verschwand in seinem Alchemistenkeller.
Catharinas dunkle Vorahnungen verstärkten sich. Das alles sah nach einem neuen Heldenstück aus, einer Reise oder einer irrwitzigen Idee, wie man zu Geld kommen konnte. Beim letzten Mal hatte er versucht, einem magyarischen Händler das Rezept für den Theriak der Pharaonen abzujagen, und war dem Mann bis nach Wien gefolgt, wo sich herausstellte, dass sein Allheilmittel keineswegs Schlangenextrakt enthielt, sondern lediglich aus Alraune und Kräuterauszügen hergestellt war. Bei dieser Gelegenheit hatte er wenigstens einen Betrüger entlarvt, doch normalerweise scheiterte ihr Vater mit solchen Vorhaben grandios. Ultramarin – das Pigment war eine Nummer zu teuer für das kleine Esslingen.
Doch egal, wohin sie ihn führen würde, die Idee hatte von ihm Besitz ergriffen, und die Flügel seiner Begeisterung trugen ihn in Windeseile in den Keller und zurück. In seiner Hand hielt er ein kostbar aussehendes Kästchen aus goldfarbenem Metall. Deckel und Seitenwände waren mit fein ziselierten Ornamenten und fremdartigen Blütenmustern geschmückt, deren Machart Catharina noch nie gesehen hatte.
»Dieses Schatzkästchen kommt weit aus dem Osten, genau wie sein Inhalt«, sagte er stolz und öffnete es im Kerzenschein. Unwillkürlich traten Catharina, Weckmann und Jacob heran und lenkten ihren Blick hinein. Sieben Arme hatte der teure Silberleuchter; in jedem steckte eine duftende Wachskerze, und ihr Licht brachte das unglaublichste Blau zum Leuchten, das sie je gesehen hatte. Nicht einmal der Sommerhimmel strahlte in einer solchen Farbe. Der Fremde aus Gent stand derweil lässig an den Tresen gelehnt da, sein rechtes Bein locker aufgestellt. Das Licht der Kerzen spiegelte sich in seinem klaren Blick, der sich ohne Scham und Anstand mit dem ihren traf. So konnte sich nur jemand gebärden, dem Reichtum und Sorglosigkeit in die Wiege gelegt worden waren. Missbilligend zog sie ihre Brauen zusammen.
Christoph sah erwartungsvoll in die Runde. »Dieses Ultramarin kommt von einem Ort weit im Osten. Badakshan am Ursprung der Seidenstraße. Dort sind die großen Lapislazuliminen, die einzigen in der bekannten Welt.«
»Bist du schon einmal dort gewesen?«, fragte Catharina.
»Oh ja! Ich stand am Fuße dieser Berge und habe in die Dome aus blauem Stein geschaut«, antwortete ihr Vater und war in Gedanken schon weit weg.
5
Als alle gegangen waren, blieb Jacob allein in der Apotheke zurück und spürte der plötzlichen Stille nach.
Nachdenklich machte er sich daran, die Säcke mit den Pigmenten zu verschließen und wieder an ihren Platz im Regal zurückzuräumen. Es war so leise im Laden, dass er eine Maus unter den Schrank in der Ecke huschen hörte. In ihrer Begeisterung über das Schatzkästchen hatte Catharina sich nicht mehr für ihn interessiert; er war unsichtbar für sie geworden, und das, wo er ihr doch heute gesagt hatte, was er für sie fühlte. Es tat weh, so jung zu sein, dass man übersehen wurde. Zornig trat er mit dem Fuß gegen den Ladentisch und stieß sich übel den Zeh.
»Au, verdammt!«
Mit dem rechten Fuß in der Hand hüpfte er auf einem Bein im Laden herum, bis der Schmerz nachließ. Es war nicht einfach, dreizehn zu sein, ein Junge, dessen Stimme kiekste und der jeden Tag etwas mehr aus seinem alten Kittel herauswuchs, bis die Ärmel knapp unterhalb der Ellbogen endeten. Aber das Schlimmste war, dass er Catharina nicht helfen konnte, obwohl er nichts anderes sein wollte als ihr Ritter.
Und dabei hatte sein Leben durch die Lehre bei dem Apotheker eine so gute Wendung genommen. Seit er acht Jahre alt war, hatte er mit seiner verwitweten Mutter und seiner kleinen Schwester im Spital gelebt.
Sie waren zu viert aus dem fernen Straßburg gekommen, der fahrende Scholar Jacques Berthier, seine junge Frau Marie und die Kinder Jacques und Adeline, die damals noch in den Windeln gelegen hatte. Ihr Vater war einer der wenigen Gelehrten gewesen, die sich nicht für den geistlichen Stand, sondern für eine Heirat entschieden hatten, und war fortan mit ihnen und dem Esel von einer Anstellung zur nächsten gezogen. In Esslingen hatte er sein Amt als Lehrer an der Lateinschule angetreten, woraufhin sich ihr Leben zum Guten gewendet hatte. Doch dann war er an dem gefährlichen Darmfluss gestorben, der damals in der Stadt grassierte, und Marie hatte bitter lernen müssen, dass eine Witwe ohne Familie und Zunft in der Reichsstadt ihrem Schicksal schutzlos ausgeliefert war. Schließlich hatten sie sich ins Armenhaus des Spitals gerettet und waren im großen Saal zwischen den Bettlern untergekommen, die keinerlei Habe besaßen. Jacob und Lina hatten sich dort wegen der Läuse fast zu Tode gekratzt. Und dann wäre Lina im ersten Winter beinahe am Lungenfieber gestorben. Dank der Hilfe der Priorin und der guten Pflege ihrer Mutter hatte die Kleine überlebt. Und so erkannten die Schwestern vom heiligen Augustinus, was sie an der fleißigen Marie hatten, und steckten sie zu den Herrenpfründnern, wo sie die Wäsche wechselte, Nachttöpfe leerte und Essen an die Alten verteilte, die sich oft nicht einmal mehr an ihren Namen erinnern konnten.
Zu dritt waren sie kurz darauf in eine winzige Stube im Spital gezogen, und Jacob hatte seinen Schulunterricht an der Lateinschule fortgesetzt, den die Schwestern der Mutter als Gegenleistung für ihre Arbeit bezahlten. Dort war er vor allem durch seine Streiche aufgefallen. Eines Tages – er hatte zum Spaß im Unterricht ein Frettchen laufen lassen, und der Schulmeister hatte ihn dafür zuerst verprügelt und dann vor die Tür gestellt –, war Christoph Appenteker, der gerade eine Lieferung ins Spital brachte, zufällig auf ihn aufmerksam geworden.
»Wie heißt du?«, hatte der Mann mit den dunklen Haaren gefragt und verwundert auf seine rotgeschwollenen Hände gestarrt, auf die eben hundert Streiche niedergeprasselt waren. »Jacob Berthier«, hatte er gesagt.
»Berthier?«, war als Frage zurückgekommen. »Ich habe auch hier gestanden, meine halbe Schulzeit lang. Und meine Hände konnte ich kaum je gebrauchen.«
Er hatte ihm auf die Schulter geklopft und danach lange mit dem Schulmeister gesprochen. Noch an diesem Tag hatte er ihn als Lehrling in sein Haus geholt, ohne dass seine Mutter für ihn Lehrgeld entrichten musste. Später erzählte ihm Marie, dass Christoph Appenteker gemeinsam mit seinem Vater den Geheimnissen der Alchemie nachgegangen war und den »roten Drachen« gesucht hatte, was auch immer das sein sollte. Jedenfalls waren sie gute Freunde gewesen.
Christoph Appenteker tat oft seltsame Dinge. Manchmal verschwand er wochenlang. Und wenn er da war, schloss er sich nachts in seinem Alchemistenkeller ein, aus dem es furchterregend qualmte und nach Schwefel stank, als hätte der Apotheker ein Loch zur Hölle gegraben. Eines Tages hatte es eine Explosion gegeben, die das Haus bis in die Grundfesten erschüttert und einige der Glasphiolen in den Regalen zum Platzen gebracht hatte. Mira, Catharina und Jacob waren durch den dichten Rauch nach unten gestürzt und hatten Christoph Appenteker bewusstlos und rußgeschwärzt vor seinem zerstörten Alembic, dem alchemistischen Destilliergefäß, gefunden.
»Der hetzt uns allen noch die Inquisition auf den Hals«, hatte Mira geklagt, bevor sie ihn mit vereinten Kräften in sein Schlafzimmer getragen und alle Fenster zum Hof und zur Stadtmauer hin aufgestoßen hatten.
Wenn Christoph sich aber die Zeit dazu nahm, war er ein kundiger Apotheker, kannte seine Rezepte auswendig und bildete seine Tochter und seinen Lehrling geduldig aus. Catharina war ebenso wie Jacob im Alter von zwölf Jahren in die Lehre gekommen und ihm in der Ausbildung weit voraus. Wenn der Apotheker nicht da war, hatte seine betagte Mutter diese Aufgabe mit Sorgfalt übernommen. Bis sie vor einem Jahr gestorben war. Da hatten die Schwierigkeiten begonnen. Der Meister ließ sich immer seltener zu Hause blicken, und Catharina musste die Apotheke alleine führen, auch wenn ihnen die Zunftmeister mit essigsaurer Miene aufs Dach stiegen. Und dann hatten Jacobs Gefühle begonnen, verrückt zu spielen. Bewusst geworden war es ihm ausgerechnet, als sie süße Latwerge einkochte und ihre Wangen vom Dampf gerötet waren. Natürlich hatte er schon immer gewusst, wie hübsch sie war, aber plötzlich klopfte ihm sein Herz bis in den Hals, wenn er nur neben ihr stand und ihren Duft einatmete. Wie anmutig die Linie ihres Nackens in ihren Haaransatz überging! Wie ausdrucksvoll ihre blauen Augen waren! Er liebte sie mit der ganzen Leidenschaft seiner dreizehn Jahre.
Seufzend schob er den Sack mit dem Grünspan unters Regal und schreckte damit die Maus auf, die panisch über den Steinboden flitzte. Mira, die im Hause Appenteker Köchin und Mädchen für alles war, würde eine Falle aufstellen müssen.
6
»Gelehrte Frauen sind gefährlich.« Eckhard Weckmann streckte seine langen Beine genüsslich unter dem Wirtshaustisch aus. »Sie widersprechen dem Hausherrn und vernachlässigen ihre Pflichten, weil sie ihre Nase in Bücher stecken und vor der Zeit kurzsichtig werden.« Sein dicker Bauch stieß an die Tischkante. »Was meint Ihr dazu, Mijnheer Borluut?«
»Mich stört es nicht, wenn ich mich mit einer Frau über andere Dinge unterhalten kann als über das Wetter und ihre Kleidung«, sagte Adrian. »Und was ist Eure Meinung, Meister Appenteker?«
»Klugheit ist in meiner Familie keine Schande. Auch bei Frauen nicht.« Appenteker musterte sein Gegenüber aufmerksam. »Daran solltet Ihr Euch beizeiten gewöhnen, Meister Eckhard. Meine Tochter ist nicht umsonst nach der klügsten Frau der Christenheit benannt worden, der heiligen Catharina von Alexandria.«
Warum beizeiten gewöhnen? Beunruhigt fragte sich Adrian, welche Pläne die beiden Männer mit der schönen Catharina verfolgten.
Weckmann beugte sich vor. »Sagt, Appenteker. Teilt Ihr alle Geheimnisse mit Eurer Tochter?«
Christoph faltete seine Hände auf dem Tisch. »Catharina ist in mein ganzes Wissen eingeweiht und wahrscheinlich eine bessere Apothekerin als ich.«
Sie hatten sich in der besten Schenke Esslingens niedergelassen. Die Wände des Goldenen Löwen waren frisch geweißelt. Über dem Feuer köchelte ein verlockend duftender Eintopf, und die Köchin beugte sich schwitzend über einen Spieß mit brutzelnden Fleischstücken. Der Wirt und die drei Schankmädchen hatten alle Hände voll zu tun, um die Gäste zu bedienen, die den Raum bis auf den letzten Platz füllten. Eine Gruppe Ratsherren und Patrizier drängte sich um ihren Stammtisch und prostete sich angeheitert zu. In einer Ecke hockten zwei hochgestellte Benediktinermönche, die wohl Gäste eines der Pfleghöfe in der Stadt waren, nagten hungrig an ihren Schweinshaxen und ließen sich nicht lumpen. »Brot, bitte«, rief einer von ihnen mit vollem Mund in Richtung der Bedienung. »Und einen Krug vom besten Wein!«
Am Tisch neben ihnen saß ein einzelner Mann und widmete sich ganz dem Inhalt seines Bechers. Einen Moment lang wunderte sich Adrian, warum er seine Kapuze nicht zurückgeschlagen hatte.
Das Schankmädchen kam und setzte einen Krug mit heißem Würzwein vor sie auf den Tisch. Weckmann nutzte die Zeit, um der jungen Frau auf den Po zu klatschen. »Unsere brave Rieke hier verschwendet ihre Zeit sicher nicht mit Büchern.«
»Finger weg!« Kopfschüttelnd verließ sie ihren Tisch, nicht ohne Adrian verschwörerisch zuzublinzeln, der seine Wirkung auf Frauen zur Genüge kannte.
»Bildung ist an das weibliche Geschlecht verschwendet«, fuhr Weckmann fort. »Passt nur auf, Christoph, dass Eure Tochter sich damit nicht ihre Chancen auf dem Heiratsmarkt verdirbt.«
»Wer die Hand meiner Tochter will, muss sich ihrer erst würdig erweisen«, sagte dieser nachdenklich. »Catharina ist etwas ganz Besonderes. Doch jetzt sollten wir andere Dinge besprechen.«
In seinen Augen glomm ein dunkles Feuer. Die Sache mit dem Azurstein hatte ihn gepackt. Endlich, dachte Adrian. Endlich ein Verbündeter, endlich ein gangbarer Weg.
Auf der Spur des Ultramarins war er mit einem Handelszug voller feinster flandrischer Wollstoffe auf der Handelsstraße über Speyer und Vaihingen an der Enz immer weiter nach Südosten gereist. In jeder Stadt hatte er nach Kontakten gesucht, die es ihm ermöglichen würden, eine größere Menge des kostbaren Pigments zu beschaffen, doch nirgendwo war er fündig geworden, nicht am Rhein und auch nicht am unteren Neckar. Die Stoffe hatte er in Esslingen verkauft, kurz nachdem ihm Catharina im Trubel der Reichsstraße buchstäblich vor die Füße gefallen war. Nach diesem Geschäft hatte er auf dem Kornmarkt die beiden Apotheker getroffen und war mit ihnen ins Gespräch gekommen. Und dann hatte sich herausgestellt, dass der eine der Vater des Mädchens war, dessen Augen blauer leuchteten als jedes Ultramarin.
»Wofür benötigt Ihr das Pigment?« Appenteker beugte sich neugierig vor.
»Für einen Altar, den mein Onkel in Auftrag gegeben hat. Christus, Maria, Adam und Eva und jede Menge Heilige. Jan van Eyck, der Hofmaler Herzog Philipps, malt ihn für unsere Familie. Aber das ist nicht alles.«
Die beiden Apotheker hörten ihm aufmerksam zu. Sogar die Augen von diesem großen Schnösel, diesem Weckmann, leuchteten bei seiner Schilderung.
»Was wollt Ihr denn noch?«, fragte Appenteker neugierig.
»Ich will das Pigment in großem Stil in Flandern einführen.«
»Ultramarin ist nicht gleich Ultramarin«, begann der Apotheker langsam. »Auf dem Markt gibt es jede Menge ungereinigten Farbstoff, der voller Kalk und Katzengold ist. Wenn man die beste Qualität haben will, muss man seinen Gegenwert in Gold aufwiegen.«
Adrian nickte unwillig, und Appenteker sprach weiter. »Soweit ich weiß, sind die Perser als Einzige mit dem aufwändigen Prozess der Reinigung vertraut. Und das nutzen sie aus, indem sie die Preise diktieren.«
Adrian lehnte sich vor, stützte seine Ellbogen auf die Tischkante und lauschte aufmerksam. Und dann sprach Christoph weiter. »Was wäre, wenn wir den Prozess der Herstellung auf diese Seite der Alpen verlagern würden? Nach Gent, oder vielleicht auch nach Esslingen?«
»Dann«, begann Weckmann, »hätten wir den Esel gefunden, der Gold scheißt.«
»Aber müsste man dazu nicht Unmengen von Azurstein besorgen?«, fragte Adrian.
»Und ob man das müsste«, antwortete Christoph. »Und man braucht Kapital, um irgendwo zwischen Badakshan und Venedig genügend Rohstoff aufzukaufen. Den Transport könnte man vor Ort organisieren.« Er lehnte sich zurück und betrachtete sie nachdenklich. »Ich reise nach Venedig, wo ich einen Geschäftspartner habe, der sich auskennt.«
Adrian spürte die Blicke der beiden Männer an sich kleben wie Bienen an einem Honigglas, denn eine wichtige Frage stand noch offen. »Geld ist kein Problem«, sagte er leise und überschlug, wie viel er aus dem Erbe seiner Mutter lockermachen konnte. Genug. Über den Tisch hinweg schüttelten sie sich die Hände und besiegelten so ihren Vertrag.
Die Schankmagd kam erneut und stellte eine große Platte voller Schweinefleisch mit Brot vor ihnen ab. Christoph Appenteker verteilte die verlockend duftenden Portionen auf die Teller seiner neuen Geschäftspartner. Adrian griff herzhaft zu und biss in das Fleisch, das die Wirtin aufs Köstlichste mit Rosmarin gewürzt hatte.
In diesem Moment öffnete sich die Tür, und die Stimmen im Raum erstarben. Eine Frau stand auf der Schwelle und zog alle Blicke auf sich. Selbst die Mönche an ihrem Tisch verstummten. Sie war von so großer Schönheit, dass die Kerzen auf den Tischen neben ihr verblassten, während sie den Raum durchschritt. Appenteker stand auf und rückte ihr einen Stuhl zurecht. Elegant raffte sie ihr goldfarbenes Seidenkleid und setzte sich. »Guten Abend, die Herren – Christoph, Meister Weckmann«, sagte sie mit einem Lächeln in der Stimme, von dem Adrian wärmer wurde als vom heißesten Würzwein. »Und wer seid Ihr?«
»Adrian Borluut.« Fast wäre er ins Flämische gefallen, so sehr brachte ihn ihr Anblick aus der Fassung. Sie war groß und trug eine hauchzarte Haube, die ihr lockiges, dunkelblondes Haar nur unzureichend bedeckte. Das Kleid ließ ihren Brustansatz frei und entblößte die milchig weiße Haut ihres Halses. Die Frau lächelte, als sie sah, dass Adrians Blick sich kaum von ihr lösen konnte. Natürlich, sie musste eine Kurtisane sein! Es war ihr Beruf, ihm schönzutun. Er ärgerte sich über seine Dummheit und errötete unwillkürlich, was Weckmann, der sich gerade ein Stück Fleisch abschnitt, mit einem belustigten Grinsen registrierte. »Und, wie gehen die Geschäfte?«
»So, wie sie gehen sollten«, sagte die Dame unverfroren.
Adrian, der sich unwillkürlich den Kopf über ihren Preis zerbrach, spürte, wie sich seine knallrote Gesichtsfarbe vertiefte. Er war aus Köln einiges gewohnt, aber nicht, dass die Huren mit den Herren zu Tisch saßen und sich mit ihnen über ihr Einkommen unterhielten.
»Was führt dich zu uns?«, fragte Appenteker.
»Mir war ein wenig einsam ums Herz«, sagte sie vorsichtig. »Ich habe dich gesucht.« Sie griff nach einem Kanten Brot, tunkte den kräuterduftenden Bratensaft vom Teller des Apothekers damit auf und begann zu essen. »Sonst finde ich dich eher im Schwarzen Eber als hier.«
»Christoph, nun stellt die Dame unserem Gast aus Flandern doch schon vor!«, sagte Weckmann.
Der Apotheker räusperte sich verlegen. »Nun, lieber Herr Adrian. Das ist meine Schwägerin Antonia Truhlieb, die Schwester meiner verstorbenen Frau.«
Adrian starrte sie neugierig an. Dass die hochanständige Familie Appenteker mit einem übel beleumdeten Weibsbild verwandtschaftliche Beziehungen pflegte, wollte ihm nicht recht in den Kopf. Aber vielleicht pflegten sie ja mit dieser Schwägerin keinen allzu intensiven Umgang. War der Apotheker nicht sogar ein Stück von ihr weggerückt? Am Feuer begann ein Spielmann, trunken auf einer verstimmten Laute zu klimpern. »Aus Flandern kommt Ihr, Meister Borluut?«, fragte die Dame. »Gerade heute habe ich eine Ladung allerfeinste flandrische Tuche aufgekauft.«
Adrian verschluckte sich, und sie schien geneigt, ihm auf den Rücken zu klopfen, wartete dann aber zum Glück ab, bis er sich mit Hilfe eines großen Schlucks Wein selbst geholfen hatte.
»Ich habe sie einem Cannstatter Händler abgejagt, für teures Geld. Fast meine ganze Schatulle ist leer.« Sie seufzte, doch das Lächeln, das auf ihrem Gesicht erschien, sprach Bände. »Aber es hat sich gelohnt.«
Er hatte sich geirrt. Sie war keine Kurtisane. »Ihr seid Tuchhändlerin?«
Sie nickte zufrieden. Auch wenn sie nicht ehrbar aussah, so hatte sie doch einen anständigen Broterwerb. Lag es am Wein oder an seiner Verlegenheit, die Luft war auf einmal so dick, dass er den Kragen seines Übergewands lockern musste. »Hatte Euer Geschäftspartner sie gerade heute erworben?«
Sie nickte noch einmal und sah so zufrieden aus wie eine Katze, die ein Schälchen Sahne bekommen hatte. »Frisch aus Gent eingetroffene Ware.«
»So«, sagte Adrian.
»Ihr dürft das nicht missverstehen.« Sie setzte sich auf ihrem Stuhl zurecht und schlug die Beine übereinander. »Seit dem Tode meines Mannes beschäftige ich mich zwar mehr mit seinen Geschäften. Aber ich führe unser Handelshaus nicht. Das tut der Verwalter. Nur bei den edlen flandrischen Wolltuchen konnte ich nicht widerstehen. Vielleicht lasse ich sie sogar in Esslingen verarbeiten. Einen kleinen Teil könnte man hier walken lassen, für erstklassige Wintermäntel.«
»Ihr habt einen guten Blick«, gab Adrian zu.
Weckmann beugte sich über den Tisch, und der Schalk stand in seinen Augen. »Nur keine falsche Bescheidenheit, meine Dame! Ihr habt einen Ruf zu verlieren.«
»Und was für einen.« Sie lachte, und ihre Augen funkelten.
»Auch wir sind dabei, ein Geschäft abzuschließen, liebe Antonia«, sagte Appenteker geheimnisvoll. »Und dafür werde ich nach Venedig reisen müssen und vielleicht sogar noch weiter.«
»Was für ein Geschäft?« Sie klang misstrauisch.
Appenteker schaute von einem zum andern und schüttelte dann den Kopf. »Das ist noch nicht spruchreif.«
Zwischen Antonias Augenbrauen erschien eine steile Falte. »Und was ist mit deiner Tochter?«
»Catharina ist fast erwachsen, und Meister Weckmann hier wird sicher ein Auge auf sie haben«, sagte der Apotheker bedachtsam.
Die Frau zog vielsagend die Augenbrauen hoch. Weckmann nickte, und Adrian spürte einen Stich bitterster Eifersucht. Mühsam rief er sich zur Ordnung. Die Leute in der Brückenstadt gingen ihn nichts an. Er sollte sich aus ihren Belangen heraushalten, sogar, wenn Appenteker seine lesehungrige Tochter an einen Mann verheiraten würde, der gebildete Frauen nicht ausstehen konnte. Schade um die schöne und eigenwillige Catharina! Adrian war froh, als Platten und Krüge leer waren und sie aufbrechen konnten.