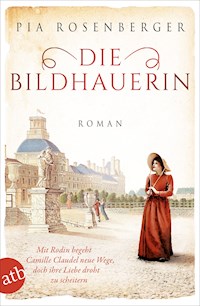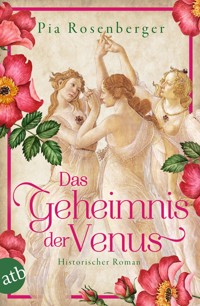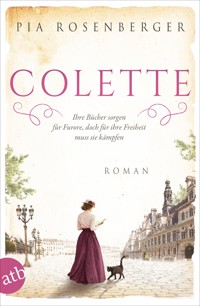Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Beginn der Hexenverfolgung im Schwabenland. Esslingen am Vorabend der Reformation. Während die Höfe armer Bauern Brandstiftern zum Opfer fallen, sucht die junge Leontine im Zwiespalt zwischen ihrer Sehergabe und ihrer adligen Herkunft ihre Bestimmung. Als ein Anschlag auf sie verübt wird, rettet sie der geheimnisvolle Matthis, der mehr mit den Mordbrennern zu tun hat, als sie wahrhaben will. Ausgerechnet Leontines Ziehvater Corentin Wagner verfolgt ihn gnadenlos. Nach einer Anschuldigung wegen Hexerei flieht Leontine unter den Schutz der ehemaligen württembergischen Herzogin Sabina nach Urach. Doch auch dort ist sie nicht sicher.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Pia Rosenberger wurde in der Nähe von Osnabrück geboren und hat nach einer Ausbildung als Handweberin Kunstgeschichte, Pädagogik und Literaturwissenschaft studiert. Seit über zwanzig Jahren lebt sie im mittelalterlich geprägten Esslingen und arbeitet als Autorin, Journalistin, Museumspädagogin und Stadtführerin.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2018 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/SuperStock/Fine Art Images
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-418-6
Historischer Roman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literaturagentur Thomas Schlück GmbH, Hannover.
Das Herz und die Rosesind das einzig Unvergängliche.
Theophrastus Bombastus von Hohenheim,genannt Paracelsus
PROLOG
Februar 1530
Der Schnee knirschte unter Leontines Stiefeln. Hals über Kopf floh sie aus den engen Gassen der Stadt in die Neckarauen und kam völlig außer Atem am Ufer des Flusses an. Die Welt drehte sich um sie.
Atmen, langsam ein und aus, dachte sie, atmen, bis die Panik weicht und der Boden unter den Füßen zum Stillstand kommt.
Nicht weit entfernt wölbte sich die große Steinbrücke über den Fluss, auf dem graue Eisschollen trieben. Ein Stück flussabwärts gruben sich die Wasserräder der Mühle in die Fluten und übertönten das Rauschen in ihrem Kopf. Vor ihr stakste ein Reiher am Ufer entlang und lauerte auf Beute.
Ich gehe nicht zurück, dachte sie trotzig und schluckte an ihren Tränen.
Seit drei Jahren half sie regelmäßig in Peter Riexingers Apotheke in der Webergasse aus, wo sie die Grundlagen der Arzneimittelherstellung gelernt hatte. Außerdem hatte Riexingers Schwester Friede ihr reiches Kräuterwissen mit ihr geteilt. Leontine liebte diese Arbeit über alles. Doch seit einigen Wochen lief es nicht mehr rund. Eine reiche Patriziergattin hatte sich geweigert, den Hustensaft zu kaufen, den Leontine aus den Extrakten von Eibisch, Efeu, Thymian und Spitzwegerich gemischt hatte.
»Nicht aus deinen Händen«, hatte sie gesagt und den Laden verlassen.
Es war nicht bei einer Kundin geblieben. Die Leute fürchteten sie, die junge Leontine von Absberg, die seit dem Tod ihrer Mutter Theophila die Ziehtochter der reichen Gewürzhändlerin Tessa Wagner war. Immer mehr Kunden kreuzten bei ihrem Anblick die Finger gegen den bösen Blick.
Heute hatte die Welle der Ablehnung ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Weil in der Stadt der übliche Spätwinterkatarrh umging, war der Laden gedrängt voll gewesen. Da hatte sich die Gattin des Stoffhändlers Ägidius Marchthaler durch die Tür gedrückt. Als sie sich der Aufmerksamkeit aller Kunden sicher sein konnte, rauschte sie heran und wollte Peter Riexinger persönlich sprechen. Ihr Sohn, sagte sie zum Meister, sei durch Leontines Arznei gegen Durchfall noch kränker geworden, als er ohnehin schon gewesen war. Sie müsse ihn verwünscht haben.
»Von dem Hexenkind nehme ich nichts mehr entgegen«, verkündete sie schnippisch und warf die Ladentür hinter sich ins Schloss. Die Kundschaft schwieg betroffen. Nichts war Leontine je so peinlich gewesen.
»Geh für heute nach Hause«, hatte ihr Peter Riexinger geraten, den sie als besonnenen Mann schätzte.
Jetzt stand sie am Flussufer und hackte mit ihrer Stiefelspitze ein Loch in den schmutzigen Schnee. Hexenkind. Wenn die Marchthalerin mit ihrer Behauptung nur unrecht hätte.
Noch bevor sie diesen Gedanken zu Ende gedacht hatte, hörte Leontine die Schatten durch den violetten Schleier flüstern, der die Wirklichkeit von der anderen Seite trennte. Manchmal verstand sie, was sie sagten.
Dann sah sie ihn und schrak zusammen. Auf einer der Schaufeln der Mühle saß ein grüner Nix, nackt, mit Schwimmhäuten zwischen Zehen und Fingern, und winkte ihr heiter zu. Leontine wandte sich um und floh durch die graue Dämmerung zum Haus ihrer Familie am Rossmarkt.
1
Anfang März 1530
Nichts hatte darauf hingedeutet, dass der Hof in dieser Nacht zum Raub der Flammen werden würde. Vielleicht waren die beiden Kühe und die Ziegen im Stall an diesem Abend unruhiger gewesen als sonst. Aber die Familie hatte die Anzeichen nicht zu deuten gewusst und sich wie immer zur Nacht auf die klammen Strohmatratzen gelegt. Doch als der Mond untergegangen war und die Welt in Finsternis zurückließ, kamen die Brandstifter, um den roten Hahn unter das Dach des Hauses und ins Gebälk des Stalls zu setzen.
Die Eltern und die vier Kinder schliefen fest, während die Feuerblume erwachte, sich genüsslich entrollte und ihre lodernden Blütenblätter in den Himmel streckte. Der gelähmte Großvater aber schaute wissenden Auges dem Tod entgegen, den er so lange herbeigesehnt hatte.
Schon ehe sie das Knistern auf dem Speicher gehört hatte, hatte die Bäuerin Hedwig wach gelegen und in die Dunkelheit gestarrt. Die Mäuse haben es bis ins Gebälk geschafft, dachte sie und nahm sich vor, morgen den Kater hinaufzuschicken, damit er für Ordnung sorgte. Da wusste sie noch nicht, dass ihr gewohntes Leben in dieser Nacht zu Ende gehen würde.
Der kleine Jacob lag neben ihr auf der Strohschütte, schlafwarm und tröstlich. Hedwig strich ihm über die weichen Haare. Die anderen drei schnarchten selig auf ihrer Bettstelle.
Noch ein bisschen weiterschlafen, dachte sie sehnsüchtig, bis der Hahnenschrei sie für den nächsten harten Tag aus den Federn treiben würde. Das tägliche Einerlei wartete auf sie. Melken, buttern, kochen, den Schwiegervater füttern, den der Schlagfluss ans Bett gefesselt hatte, unbeweglich wie ein Stück Holz.
Hedwig tastete nach den verlässlichen Fingern von Jerg, ihrem Mann, der an ihrer anderen Seite schlief, als das leise Knistern zu einem Prasseln anschwoll und etwas mit einem Knall explodierte. Da war dieser leuchtende Schein vor dem Fenster wie von einem verfrühten Sonnenaufgang und die Spur von Rauch, die, zart wie Nebel, unter dem Türspalt hindurchkroch. Ungläubiges Entsetzen lähmte sie.
»Jerg, wach auf!« Ihre Stimme zerriss die Stille.
Ihr Mann murmelte schlaftrunken vor sich hin und wehrte ihre Hand unwillig ab.
»Es brennt.«
Diese Worte, der Alptraum eines jeden Christenmenschen, weckten Jerg auf der Stelle. Er fuhr auf, saß aufrecht, bevor sie weitersprechen konnte, und sprang aus dem Bett.
»Raus hier! Nimm die Kinder! Ich schau nach den Tieren.«
Hedwig schlug die Hand vor den Mund. Der Stall brannte. Sonst hätte sie kein Licht gesehen.
Während der Rauch sich schwer auf ihre Atemwege legte, griff sie mit fliegenden Händen nach ihrem Kleinsten, setzte ihre Beine auf den Boden und tappte zum Bett der Älteren.
»Marie, Heinrich, Hans, wacht auf! Schnell!« Sie rüttelte die Großen wach, zerrte sie unsanft hoch, schubste sie einen nach dem andern zur Tür, riss sie auf und zuckte zurück. Die Stiege brannte lichterloh. Die Flammen fuhren bis zur Decke empor und prasselten, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Die kleine Marie griff nach ihrer Hand, während sie noch immer untätig auf dem Treppenabsatz stand und entsetzt auf das lodernde Feuer starrte.
»Lauft!«, schrie Jerg. »Und zieht euch die Zipfel eurer Nachtgewänder vors Gesicht.« Mitten durch die Flammen stürmte er die Treppe hinunter.
Die Tiere, dachte Hedwig. Ihr ganzer Besitz. Die Lähmung fiel von ihr ab, als die drei Kinder zu husten begannen. »Du nimmst deinen Bruder!«
Heinrich, ihr Ältester, nickte ihr entschlossen zu und griff nach dem Arm von Hans, seine Augen so blau im Schein der Flammen. Sie selbst hielt Maries Hand in ihrem eisernen Griff, drückte Jacobs Köpfchen an sich und machte sich an den Abstieg. Schritt für Schritt, Stufe für Stufe. Flammen, die mit höllenheißen Händen nach ihr griffen, Rauch, der ihr die Sicht vernebelte und den Atem nahm. Der Feuerwind fasste unter Maries Zöpfe und wehte sie hoch. Der Rauch schmeckte nach Tod. Am liebsten hätte Hedwig sich auf eine Treppenstufe gesetzt und aufgegeben.
Aber nein! Sie musste die Kinder in Sicherheit bringen.
Marie neben ihr weinte verzweifelt, hustete sich die Seele aus dem Leib. Hedwig zog sie weiter abwärts, drückte den Kleinen an ihre Brust, darauf achtend, dass die Buben ihr folgten. Wie stolz sie auf Heinrich war, der seinen Bruder verbissen hinter sich herzerrte.
Dann stolperten sie über die Schwelle, rangen nach Luft, so frisch wie Quellwasser, drückten sich aneinander und schauten zu, wie ihr kleiner Hof hoch über dem Neckartal zum Raub der Flammen wurde.
In einem wilden Tanz loderten sie aus den Fenstern und verschlangen gierig ihr Hab und Gut. Die Kinder sahen aus wie knapp der Hölle entronnen. Rußverschmierte Gesichter, aus denen sie blaue Augen anstarrten.
Hedwig blickte sich unruhig um. Wo blieb Jerg?
Der Stall brannte lichterloh. Die Strohballen standen in Flammen und jagten eine Herde winziger Funken aus den Fenstern, die in der Dunkelheit verglommen. Ein Balken krachte laut zu Boden. Was würde aus ihnen werden, wenn Jerg nicht zurückkehrte?
Armenhaus, dachte sie dumpf. Sie würden im Katharinenspital in Esslingen enden und für eine Schale Suppe anstehen müssen.
Doch dann stürzte eine schwarze Gestalt aus dem Stall, das Gesicht rußverschmiert, die Haare angesengt. Jerg. Flammen fraßen sich durch seinen leinenen Hemdsärmel. Um sie zu ersticken, warf er sich zu Boden und wälzte sich auf dem lehmigen Vorplatz.
»Ich konnte nichts mehr tun.« Seine Stimme war heiser.
Hedwig verstand.
Die Brandstifter hatten an mindestens zwei Stellen gleichzeitig Feuer gelegt. Die Tiere, ihr Haus, ihr Stall. Nur ein paar Katzen hatten sich retten können und starrten ausdruckslos auf das Flammenmeer. Marie zog eins der struppigen Biester auf ihre Schultern.
»Zu spät«, sagte Hedwig.
Aber Jerg wollte nicht auf sie hören, sondern rannte mit den Buben zur Pumpe, um verbissen Eimer für Eimer zu füllen. Das Wasser landete im Feuer und verdampfte. Noch weigerte er sich zu begreifen, dass sie verloren hatten.
Sie waren mit nichts als dem nackten Leben davongekommen. Der Brand war ein Denkzettel für alle Bauern in den Filialen der Reichsstadt, die sich nicht erpressen lassen wollten.
»Du hättest reden sollen«, sagte Hedwig leise. Schließlich hatten sie die Runen an der Stallwand früh genug gesehen, mit denen die Verbrecher ihren Hof dem Untergang geweiht hatten.
»Wir haben mehr als das Haus zu verlieren«, sagte Jerg langsam.
Jetzt erst fiel Hedwig der Schwiegervater ein, der hilflos in seiner Kammer im Bett lag. Sie hatten ihn einfach vergessen.
2
Der Morgen graute über Esslingen. Erleichtert strich Tessa Wagner ihrem Jüngsten ein paar Haarsträhnen aus der Stirn. Das Fieber war gesunken. Bis Mitternacht hatte sie über den Büchern gesessen, die sie ihrem Verwalter Heinrich Pregatzer nicht allein überlassen wollte. Auf dem Weg ins Bett jedoch hatte sie festgestellt, dass ihr zwanzig Monate alter Joachim fiebernd in seinem Bettchen lag und vor sich hin phantasierte. Gestern Nachmittag hatte er zu husten begonnen. Da hatte sie noch nicht geahnt, dass es so schlimm werden würde.
Tessa hatte den Rest der Nacht an seinem Bett gesessen, ihm Aufgüsse von Thymian und Spitzwegerich eingeflößt und gegen das Fieber Wickel mit Essigwasser um seine dünnen Beinchen geschlungen. Stundenlang hatte der kleine Blondschopf gequengelt. Es war ein harter Kampf gewesen, aber er hatte sich gelohnt. Endlich atmete er ruhig.
Tessa zog ihm die Decke über die Brust und betrachtete sorgenvoll sein Gesicht mit den roten Fieberwangen. Joachim, den die Familie liebevoll Joschi nannte, war so viel zarter als seine Brüder, der fünfzehnjährige Andreas und der vierzehnjährige Cyrian, der hauptsächlich mit seinen Streichen glänzte. Ihre Ziehtochter Leontine war die Einzige in dieser überreich mit Söhnen gesegneten Familie, die keinen Unsinn anstellte. Hinzu kam noch Tessas neue Schwangerschaft, in deren Verlauf die Übelkeit nicht nachlassen wollte, obwohl sich ihr Bauch schon deutlich wölbte.
Manchmal wuchs ihr alles über den Kopf. Das Handelskontor, das sie gemeinsam mit ihrem Verwalter Heinrich Pregatzer betrieb, ihre Familie, ihr großes Haus und dazu noch ihre Stellung in der Stadt Esslingen, in der die einflussreichen Kreise erbittert darüber stritten, ob sie sich der Reformation anschließen sollten oder nicht. All das brauchte Kraft. Es wurde Zeit, dass ihr Mann Corentin zurückkehrte, der im Dienst des Habsburger Obervogts Dietrich Späth stand und zuletzt drei Monate am Stück fort gewesen war. Viel zu lange hatte sie ohne ihn auskommen müssen.
Tessa rieb sich die brennenden Augen und sehnte sich nach ihrer weichen Decke. Vielleicht konnte sie ja noch ein Stündchen Schlaf herausschlagen, bevor der Tag anbrach, an dem sie wie immer von morgens bis abends zwischen Kinderzimmer und Kontor hin- und herhetzen würde.
Noch einmal legte sie prüfend die Hand auf Joschis feuchtheiße Stirn. Er atmete ruhig. Sicher würde er sich in den Morgenstunden gut erholen.
Da hörte sie federleichte Schritte im Gang, die zielbewusst an ihrer Kammertür vorbeistrebten. Tessa runzelte verwundert die Stirn und fragte sich, warum Leontine, die seit mindestens zehn Jahren nicht mehr schlafgewandelt war, mitten in der Nacht barfuß ins Erdgeschoss tappte. Vor Sonnenaufgang aufzustehen kam für den kleinen Morgenmuffel sonst überhaupt nicht in Frage.
Plötzlich klopfte jemand mit voller Wucht gegen die massive Eingangstür aus Eichenholz.
Tessa stemmte sich hoch und verließ den Raum, um ihrer Tochter die Treppe hinabzufolgen. Ungebetenen nächtlichen Besuchern war nicht erst seit Herzog Ulrichs Angriff auf Esslingen im Jahr 1519 nicht zu trauen. Sie hoffte inständig, nicht irgendwelchen gefährlichen Eindringlingen entgegentreten zu müssen. »Leontine?«
Als Tessa unten ankam, hatte ihre Tochter die mächtige Haustür soeben aufgerissen. Sie war barfuß, trug nur einen Schal über ihrem leinenen Nachtgewand. Ihre welligen dunkelbraunen Haare flossen ihr über den Rücken.
Tessa öffnete schon den Mund, um sie für ihre unziemliche Kleidung zu tadeln, als ihr Blick auf die Besucher fiel. »Mein Gott!« Sie schlug die Hand vor den Mund.
Die sechsköpfige Familie Häberle drückte sich verlegen durch die Tür und schaute sich im holzgetäfelten Gang des reichen Bürgerhauses um, als sei sie im Himmel gelandet.
»Feuer«, sagte die Bäuerin Hedwig.
Die Familie bewirtschaftete einen kleinen Hof im Esslinger Filial Liebersbronn, dessen Grund sie von Tessa gepachtet hatte. Alle sechs boten ein Bild der Verzweiflung. Das kleinste Kind saß mit verlorenem Blick auf Hedwigs Hüfte und lutschte am Daumen. In ihren Kleidern hing der Geruch nach kaltem Rauch.
»Mordbrenner«, sagte Hedwig heiser. »Wir konnten nichts als unser Leben retten und wissen nicht, wohin wir gehen sollen.«
»Es ist alles verloren«, fügte ihr Mann Jerg hinzu, ein Kerl wie ein Baum, den Tessa immer als völlig unerschütterlich erlebt hatte. »Haus, Hof und Tiere.«
»Und der Großvater …«, flüsterte der älteste Junge.
»Er ist im Haus verbrannt«, sagte Hedwig tonlos.
»Kommt einfach rein.«
Es war Tessas Christenpflicht, die Ankömmlinge nicht vor der Tür stehen zu lassen. Gemeinsam mit Leontine, die die kleine Marie an die Hand nahm, geleitete sie die Familie in die Küche. Dort heizte ihre Köchin Martha gerade den Ofen an und schlug die Hände über dem Kopf zusammen, als sie sah, was da auf sie zukam.
Zusammen tischten sie auf, was die Vorratskammer hergab, Brot, Käse, Butter, Schinken, Wurst, Gsälz aus ihren Gärten und verdünnten Wein, den die Gäste durstig hinunterstürzten. Den Kindern gingen beim Anblick des reichlich gedeckten Tisches die Augen über.
»Greift zu«, lud Tessa sie ein.
Während die Kinder im Essen schwelgten, schwiegen ihre Eltern bedrückt und zitterten vor Kälte in ihren dünnen Nachtgewändern. Leontine lief nach oben, um eine Reihe Decken und Tücher aus den Schränken zu holen, in die sich die Gäste dankbar einwickelten. In solchen Momenten erinnerte sie Tessa schmerzlich an ihre leibliche Mutter Theophila.
Martha heizte weiter an und brachte das Feuer im Ofen mit knackenden Holzscheiten zum Prasseln, sodass sich Jerg und Hedwig schließlich doch noch entspannten und zögernd zugriffen.
Tessa nahm Hedwig ihren Kleinsten ab und steckte ihm einen Kanten Brot zu, auf dem er selig herumkaute. Als Leontine sich neben sie auf die Küchenbank schob, warf Tessa ihr einen nachdenklichen Blick zu.
»Woher wusstest du, dass sie kommen würden?«
»Frag nicht.«
In den letzten Wochen hatte sie eine Mauer des Schweigens rund um sich errichtet, die Tessa nicht durchdringen konnte. Wenn sie es recht bedachte, hatte es begonnen, als Leontine ihre Arbeit in der Apotheke aufgegeben hatte. Oder hing es mit dem Kaplan Seiler zusammen, den Tessa des Hauses verwiesen hatte, weil er ihr als Beichtvater zu unerbittlich erschienen war?
»Ich dachte, das hätten wir hinter uns.« Wehmütig strich sie Leontine über die seidenweichen Haare. Wenn es darum ging, ihre rätselhaften Fähigkeiten zu verschleiern, war Tessa unzählige Male zu ihrer Komplizin geworden. Wie oft hatte sie sich vor sie gestellt, wenn sie Naturwesen sah, die es nicht geben konnte. Tessa erinnerte sich noch gut an den kleinen Wassergeist im Rossneckar und die Elfen in den Blütenkelchen, auf deren Existenz Leontine beharrte, bis Tessa ihr klarmachte, dass man solche Wesen vielleicht heimlich sehen, aber niemals darüber reden durfte.
»Du hättest es mir erzählen müssen.«
»Es hat mich selbst überrascht.« Leontine war so hübsch mit ihren dunklen Augen, dem Lockengeriesel, dem ovalen Gesicht und der elfenbeinzarten Haut.
Ich muss mich um eine passende Eheabrede kümmern, dachte Tessa bedrückt. Wenn möglich, nicht unter ihrem Stand.
Entschlossen wischte sie ihre Sorgen beiseite, übergab Hedwig ihren Jüngsten und sorgte für Nachschub auf dem Frühstückstisch. Noch mehr Brot und heißer Wein waren gefragt. Die Bauernkinder jubelten. Tessa hingegen japste wie ein gestrandeter Walfisch und fühlte sich unendlich erschöpft.
Mit dem anbrechenden Tag erwachte der Hausstand nach und nach. Die Mägde drückten sich gähnend durch die Tür, musterten die Bauernfamilie entgeistert und ließen sich von Martha an die Arbeit scheuchen. Ihnen folgten die Lehrjungen aus dem Kontor und schließlich Tessas ältere Söhne, deren Unterricht in der Lateinschule schon früh begann.
Cyrian warf den Gästen einen neugierigen Blick zu. Andreas, ihr Ältester, griff abwesend nach einem Kanten Brot, um gleich wieder seine Nase in sein Buch zu stecken.
»Von der Freiheit eines Christenmenschen«, entzifferte Tessa auf der Titelseite. Jetzt hielt dieser Martin Luther, dem es gelungen war, Esslingen komplett zu entzweien, also schon Einzug an ihrem Frühstückstisch.
»Wenigstens grüßen könntest du«, zischte sie.
Andreas nickte gleichmütig in Jergs Richtung.
Tessa runzelte die Stirn. Als Eltern hatten Corentin und sie versucht, ihren Kindern ein Mindestmaß an Höflichkeit gegenüber den ärmeren Ständen beizubringen. Standesdünkel konnten sie sich bei Corentins Herkunft beim besten Willen nicht erlauben.
So schnell sich die Küche gefüllt hatte, leerte sie sich auch wieder, als die Dienstboten an die Arbeit gingen und die Jungen in Richtung Schule verschwanden. Leontine übernahm taktvoll die drei älteren Kinder und ließ Tessa mit Hedwig und Jerg allein, die beklommen schwiegen, als würden sie die Tragweite ihres Unglücks erst nach und nach begreifen.
»Ihr müsst den Rat benachrichtigen«, riet Tessa.
Martha mischte sich ein. »Die Großkopfeten sollen den Corentin beauftragen.« Sie trank einen Schluck dampfend heißen Wein.
Tessa nickte widerwillig. Ihr Mann würde die Bande der Brandstifter unerbittlich jagen und ihrer gerechten Strafe zuführen. »Es wird Zeit, dass er zurückkommt«, sagte sie. Seine Heimkehr war ihr sehnlichster Wunsch, auch wenn es alles andere als einfach mit ihm war.
3
Anfang März streckte der Winter noch einmal seine klammen Finger nach Esslingen aus und weigerte sich entschieden, klein beizugeben. Nachdem Corentin Wagner und Lenz Schwarzhans das Tor am Hornwerk und das Wolfstor durchritten hatten, schlugen sie den Weg durch die Küferstraße und über den Fischmarkt ein.
Nach Hause, dachte Corentin befremdet. Die Mauern schlossen sich erstickend um seine Brust und verursachten ihm Atembeklemmungen.
Jahrelang hatte Corentin um das Esslinger Bürgerrecht gekämpft, das ihm die Stadtoberen als ehemaligem Scharfrichter von Hall nicht zugestehen wollten. Erst beim Angriff Herzog Ulrichs auf die Stadt im Jahr 1519 hatte sich gezeigt, dass er der Reichsstadt treu ergeben war. Mit seinen Bewaffneten hatte er den Schwäbischen Bund entschlossen unterstützt. Nach Ulrichs Vertreibung war Corentin in den Dienst Dietrich Späths, des Habsburger Obervogts von Urach, getreten und hatte im Bauernkrieg ein Fähnlein des Schwäbischen Bundes befehligt, was ihm den Rang eines Hauptmanns eingebracht hatte. Seiner Heldentaten wegen waren die Stadtbürger Corentin daraufhin mit widerwilligem Respekt begegnet. Freundschaft brachten sie ihm jedoch auch nach all den Jahren nicht entgegen.
Eine fromme Matrone bekreuzigte sich sogar, als er sie mit einem Kopfnicken begrüßte. Eiskalte Regentropfen fielen. Sie gefroren und verwandelten den Boden nach und nach in eine spiegelnde Eisfläche.
»Ob Tessas Hausstand schon wach ist?« Corentin ließ den Wallach im Schritt gehen, den er nach dem Tod seines Rappen Junge zu seinem Reitpferd erkoren hatte. In Ermangelung eines Namens hatte er ihn nach seinem Äußeren benannt, Fuchs.
Acht Hufe klackten gemächlich auf dem überfrorenen Kopfsteinpflaster.
»Du meinst wohl deinen Hausstand«, entgegnete Lenz kopfschüttelnd.
Corentin fühlte sich ertappt, setzte sich schweigend vor Lenz’ Braunen und querte über die Agnesbrücke den Kanal, auf dem Eisschollen trieben.
Am Rossmarkt angekommen, ritten sie in den Vorhof des Wagner’schen Anwesens ein und saßen ab. Ein Knecht nahm ihre Pferde am Zügel und führte sie zum Stall.
Als Corentin sich umwandte, stand Tessa schon auf der Schwelle des lang gestreckten Hauses und putzte sich ihre mehlbestäubten Hände erwartungsvoll an ihrer weißen Schürze ab.
Wie lange sind wir zusammen? Sechzehn Jahre, dachte er. So zerbrechlich ist diese Liebe, so kostbar. Ein unverdientes Geschenk.
Glitzernd von überfrorener Nässe, erschien ihm der Platz, auf dem er stand, plötzlich aus dünnem Eis, in das sie jederzeit einbrechen konnten.
Mit drei großen Schritten war er bei ihr und zog sie, ihres wachsenden Bauches wegen ungelenk, an sich. Tessa stellte sich auf die Zehenspitzen, legte ihm die Arme um den Hals und küsste ihn unvergleichlich süß auf den Mund. In den gemeinsam verbrachten Jahren war sie immer schöner geworden. Noch immer empfand Corentin reine Begierde, wenn er sie nur von Weitem sah. Ihr klopfendes Herz, die hellbraunen Ringellocken, die sich aus ihrer Haube stehlen wollten. Corentin berührte ihre Stirn mit seinen Lippen.
Tessa entspannte sich in seinen Armen. »Endlich bist du da.«
»Ts, ts«, machte Lenz spöttisch hinter ihnen.
Widerwillig gab Corentin Tessa frei.
»Ihr könnt es gleich hier im Hof treiben, Till«, sagte Lenz augenzwinkernd. »Ich schaue auch weg.«
Tessa stemmte ihre Hände in die Hüften. »Dein Benehmen hat durch schlechte Gesellschaft Schaden genommen.«
»Da war sowieso Hopfen und Malz verloren«, sagte Lenz und grinste.
Tessa hakte sich bei beiden Männern unter und zog sie über die Schwelle ins Haus, wo Corentin sofort der Brandgeruch auffiel.
»Was ist los?«, fragte er.
»Feuer. Aber nicht bei uns.«
Die Männer folgten Tessa in die Küche, wo sich Corentin beim Eintreten wie immer den Kopf am Türrahmen stieß. »Hoppla.« Lenz runzelte irritiert die Stirn.
In dem dämmrigen, rußgeschwärzten Raum drängten sich die Menschen. Martha stand am Herd, bereitete das Mittagsmahl vor und scheuchte ihre Mägde herum. Der Topf auf dem Herd blubberte laut. Rindfleischsuppe.
Corentins Magen knurrte. Sie waren vom Heerlager erheblich schlechteres Essen gewohnt, als bei Tessa jemals auf den Tisch kommen würde. Doch unter den würzigen Küchendünsten verstärkte sich der beißende Rauchgeruch.
Hedwig und Jerg saßen auf der Bank und starrten mit gefalteten Händen vor sich hin. Corentin kannte die beiden als Pächter von Tessas Grundstück in Liebersbronn.
Brandopfer, dachte er. Beunruhigt fragte er sich, was aus ihrem Hab und Gut geworden war.
Während Tessa ihre Arme bis zum Ellenbogen in einer Schüssel Hefeteig vergrub, hielt Lenz Abstand und goss sich an der Anrichte einen Becher Wein ein. »Wo ist Cyrian?« Wenn er sie besuchte, fragte Lenz immer zuerst nach seinem Patensohn.
Corentin hatte keine Ahnung. Er sah seine älteren Söhne nur alle sechs Monate, weil er den Großteil seiner Zeit Botendienste für Dietrich Späth verrichtete. Manchmal gelang es ihm, bei seinen seltenen Besuchen ein neues Kind zu zeugen, das ihm ebenso fremd war wie der kleine Junge, der neben dem Ofen auf dem Schoß seiner Amme saß. Er hatte rote Fieberwangen und quengelte leise. Corentin musste einen Moment lang nachdenken, bis ihm sein Name einfiel. Joachim. Ungeschickt strich er ihm über das weiche Haar, was das Kind in Tränen ausbrechen und furchtsam seine Arme nach seiner Mutter ausstrecken ließ.
»Mama!«
»Aber das ist dein Vater, Joschi.« Tessa zog den Kleinen auf ihre Hüfte. Sie wirkte plötzlich befangen. »Setz dich doch, Corentin. Und du auch, Lenz.«
Im Heerlager waren die Dinge nicht so kompliziert. Corentin wünschte sich inständig in diese raue Männerwelt zurück. Dann aber wandte er sich den Pächtern zu und fühlte sich in seinem Element. Brandstiftung gehörte ebenso wie Kampf und Krieg zu den Abgründen des Lebens, mit denen er sich auskannte. Immerhin hatte er es im Jahr 1519 mit Herzog Ulrich und seinen Schweizer Söldnern aufgenommen.
Er setzte sich rittlings auf einen Stuhl. »Was ist passiert?«
Jerg, den Corentin als verlässlichen Mann kannte, schien sich seine Worte zurechtzulegen. Tränen standen in seinen Augen.
Hedwig wischte sich einen Rußfleck von der Nase und öffnete ihren Mund. »Der Jerg hat –«
Bevor sie den Schwall Vorwürfe loswerden konnte, der ihr zweifellos auf der Zunge lag, sprang die Tür auf. Im Rahmen stand Corentins älteste Tochter, die ein Kleinkind auf dem Arm trug. Ein Mädchen hing an ihrer anderen Hand, schaute misstrauisch in den Raum und lutschte an seinem Daumen. Hinter ihrem Rücken lugten zwei Buben hervor. Alle vier waren längst nicht so rußbeschmiert wie ihre Eltern. Wahrscheinlich hatte Leontine sie soeben in den Badezuber gesteckt.
»Vater.«
»Leontine.« Unwillkürlich fragte sich Corentin, wann aus seiner ältesten Tochter eine Frau geworden war, eine so bildhübsche noch dazu. Er dachte an den Brief, der in seinem Wams steckte. Das Schreiben würde ihr Leben von Grund auf verändern.
Entschlossen setzte Leontine die Kinder bei ihren Eltern ab, zog einen Stuhl neben Corentins und verflocht ihre Finger mit den seinen. Nach einem viel zu langen Moment löste er sich und legte ihre Hand vorsichtig zurück auf ihr Knie. Auch wenn er sie noch so liebte, war ihm immer bewusst, was er ihr schuldig war. Niemals würde sie von ihm erfahren, dass er ihren leiblichen Vater hingerichtet hatte.
Lenz, der auf der Ofenbank neben der Amme saß, konnte nicht widerstehen, Leontine augenzwinkernd zu necken. »Mein süßes Hexenbalg.«
Sie blickte irritiert auf. Die Zeiten, in denen sie über solche Späße gelacht hatte, schienen endgültig vorbei zu sein. Überhaupt wirkte sie viel zu ernst für ihre jungen Jahre. Corentin würde sich Lenz später vorknöpfen müssen. Zunächst aber sollten ihm die Pächter den Brand genauer schildern.
»Kommt alle mal her!« Tessa putzte sich die Hände an ihrer Schürze ab, winkte die Kinder zu sich und lud sie ein, gemeinsam mit dem kleinen Joschi aus ihrem Hefeteig Rosinenwecken zu formen. Die Mägde deckten den Tisch und trugen die Suppe auf, während Jerg mit stockender Stimme berichtete.
Es war, wie Corentin befürchtet hatte. Mordbrenner trieben in Esslingen und Umgebung ihr Unwesen und pressten den Bauern und Weingärtnern ihre kargen Ersparnisse ab. Wenn diese nicht parierten, brannten sie ihnen den Hof nieder, lichterloh.
»Im Remstal haben sie schon im Weinberg gewütet«, fügte Hedwig, die sich nicht den Mund verbieten ließ, hinzu.
»Tatsächlich?« Lenz war unmittelbar betroffen. Seine Familie bewirtschaftete in Großheppach ein Weingut.
»Gerade eben hinterm Katzenbühl«, schränkte Jerg ein.
»Dann werden sie auch vor dem Schenkenberg nicht haltmachen«, sagte Corentin.
»Da waren Gaunerzinken, aber Jerg hat sie abgewischt«, sagte Hedwig missbilligend.
»Wir konnten uns nicht erpressen lassen«, wehrte sich Jerg.
»Du trägst die Schuld, wenn wir an den Bettelstab kommen«, keifte seine Frau.
»Solange es uns gibt, wird das nicht der Fall sein.« Tessa ließ sich neben Corentin auf einen Stuhl fallen. Der Duft der Rosinenbrötchen, die inzwischen im Ofen gelandet waren, überlagerte den Rauchgeruch.
»Vater haben wir auch vergessen«, fuhr Hedwig fort. »Jetzt ist er tot.«
Jerg beugte sich ungeschickt über den Tisch. »Du, Corentin. Ich meine, Ihr, Hauptmann Wagner.« Er errötete unter der Rußschicht in seinem Gesicht.
»Du kannst beim Du bleiben«, sagte Corentin.
»Könntest du nicht auf die Suche nach den Brandstiftern gehen?«
Corentin nickte bedächtig. »Natürlich.«
»Dafür brauchst du aber einen Auftrag vom Rat«, meinte Lenz.
»Den werd ich mir schon holen«, sagte Corentin gelassen.
Dann wandte sich die Familie mit ihren Gästen dem Essen zu. Nachdem die Häberles ihre Kinder gründlich abgefüttert hatten, zogen sie sich zurück. Tessa hatte ihnen eine Kammer im Dachgeschoss, heißes Wasser und einen Badezuber herrichten lassen. Wahrscheinlich wähnten sie sich im Himmel.
»Was wird nun aus ihnen?«, fragte Leontine, während sie einen Stapel Teller abtrug.
»Sie können so lange im Dienstbotenquartier bleiben, bis ihr Haus wieder bewohnbar ist«, sagte Tessa.
»Und ihr Vieh und Saatgut, wer ersetzt ihnen das?«
Corentin fragte sich, wann seine Tochter so vernünftig geworden war. Wann hatte sie zu lachen verlernt?
»Ich sorge schon für sie«, antwortete Tessa fest.
»Mehr als dieses eine Mal können wir uns nicht als Armenpfleger betätigen«, wandte Corentin ein. »Ich will euch umgehend in der Stube sehen.«
Da er sich sonst kaum in Familienangelegenheiten einmischte, entlockte ihm der verdutzte Ausdruck im Gesicht der beiden Frauen ein Schmunzeln. Die Überraschung würde auf seiner Seite sein.
»Warte, ich komme gleich mit.« Tessa band sich die Schürze ab und folgte ihm hocherhobenen Hauptes.
Der Begriff Stube wurde dem holzvertäfelten Saal nicht gerecht, der sich herrschaftlich über die gesamte Länge des Hauses erstreckte. Der Raum beherbergte eine geschnitzte Tafel für zwanzig Gäste sowie eine Anrichte, auf der wertvolle venezianische Gläser standen. Das Bild an der Wand, das den Besuch der Heiligen Drei Könige darstellte, stammte aus Florenz und war überaus kostbar. Tessa hatte es im letzten Jahr in Augsburg erworben, als sie mit der Familie Fugger über eine Zusammenarbeit beraten hatte.
Seit einigen Jahren stand das Handelshaus Wagner besser da als je zuvor. Corentin musste sich mühsam ins Gedächtnis rufen, dass der Besitz auf seinen Namen eingetragen war, ebenso wie das Gut der Familie Hofstätter bei Heilbronn nach endlosen rechtlichen Querelen an ihn gefallen war.
In ihrem Kontor tätigte Tessa gemeinsam mit ihrem Verwalter und dem Gewürzhändler Mosche die Geschäftsabschlüsse, die den Betrieb nach dem Tod ihres Vaters weit vorangebracht hatten. Sie kümmerte sich um ihre wachsende Familie und bewies einen sicheren Instinkt, wann und wo sich für Safran, Zimt, Nelken und Pfeffer die besten Preise erzielen ließen.
Jetzt jedoch drückte ihr Gesicht Anspannung aus. Dunkle Ringe lagen unter ihren Augen.
Wie müde sie aussieht, dachte Corentin.
Leontine betrat den Raum und wischte sich die Hände an ihrer Schürze ab.
Corentin füllte drei Pokale mit Wein. »Auf euer beider Wohl.« Er prostete ihnen zu und trank einen großen Schluck. Es war ein dunkelroter Burgunder, der beste, den sie sich für besondere Gelegenheiten aufhoben.
Verwundert nippten sie an ihren Gläsern.
»Aber warum …?«, fragte Tessa misstrauisch. »Gibt es einen Grund zu feiern?«
»Wartet.« Corentin zog den Brief aus seinem Wams und legte ihn auf den Tisch. Das Schriftstück war mit dem württembergischen Wappen gesiegelt, das, säuberlich in rotes Wachs gedrückt, neben den drei Geweihstangen die Reichssturmfahne, die Barben Mömpelgards und die Teck’schen Rauten zeigte.
»Auch wenn Herzog Ulrich, Gott sei’s gedankt, den Titel nicht mehr führen darf, ist seine Gemahlin Sabina noch immer berechtigt, das Wappen zu nutzen«, sagte er. »Er ist an dich adressiert, Leontine.« Er schob den Brief in ihre Richtung.
»An mich?« Sie griff mit spitzen Fingern nach dem Corpus Delicti, drückte es an ihr Mieder und warf ihren Eltern einen Blick zu, der Corentin auf rätselhafte Weise schmerzte.
»Na los!«, ermutigte er sie.
Leontine brach das Siegel, um zu lesen, während sich Tessa auf die Zehenspitzen stellte und vergeblich versuchte, ihr über die Schulter zu lugen. Leontine war einen halben Kopf größer als sie.
Corentin sah nur, dass die Seite von Buchstaben in einer entschlossenen Handschrift bedeckt war. Um einen handgeschriebenen Text zu entziffern, reichten die Lesekenntnisse nicht aus, die er in den Jahren seines Aufstiegs mühsam erworben hatte.
Während sich Leontine in den Text vertiefte, überzog sich ihr Gesicht zunächst mit Röte und wurde dann blass. Als sie fertig war, ließ sie den Brief sinken und starrte schweigend vor sich hin.
»Was steht drin?«, fragte Tessa begierig. Geduld war noch nie ihre Stärke gewesen.
Leontine sagte nichts.
»Herzogin Sabina …«, erläuterte Corentin, »… lädt Leontine auf Schloss Urach ein, um sie gemeinsam mit ihrer Tochter Anna zu erziehen. Sie hat mir den Brief gestern ausgehändigt. Und, Kleine …«, er wandte sich seiner Ziehtochter zu, »… es war allein ihre eigene Idee.«
Corentins Dienstherr Dietrich Späth hatte Sabina 1516 aus dem Gefängnis ihrer Ehe mit Herzog Ulrich befreit und zu ihren Brüdern an den bayerischen Hof gebracht. Seit mehreren Jahren weilte die Herzogin allerdings schon wieder in Urach.
»Was für eine wundervolle Möglichkeit«, sagte Tessa langsam.
»Ich will das nicht.«
»Aber Leo. Das ist die Lösung all unserer Probleme.«
»Ist es nicht«, stieß Leontine zornig hervor. »Ich passe nicht zu diesen Leuten.«
»Doch, das tust du«, sagte Tessa mit ungewohnter Schärfe in der Stimme. »Als Tochter des adlig geborenen Jona von Absberg steht dir ein solches Leben zu. Stell dir mal vor. Du wirst die Gefährtin der Prinzessin von Württemberg. Solch ein Angebot schlägt man nicht in den Wind. Außerdem kenne ich die Herzogin. Sie ist eine hochwohlgeborene Dame mit Herzenswärme und Anstand, die sich um dich und deine Bildung kümmern wird.«
»Ein Ehemann, der mich trotz aller Makel nimmt, springt sicher auch dabei heraus«, entgegnete Leontine so voller Bitterkeit, dass Corentin sie überrascht anstarrte.
»Darum geht es doch gar nicht«, sagte er.
»Aber Leo«, sagte Tessa. »Wie auch immer die Sache mit deinem Erbe ausgeht, du bist ein Freifräulein von Absberg. Du gehörst einem höheren Stand an. In unsere Familie passt du jedenfalls nicht.«
»Vielen Dank, dass du mich daran erinnerst.« Leontine drehte sich auf dem Absatz um, stürzte aus dem Raum und knallte die Tür hinter sich zu.
Tessa schlug die Hand vor den Mund. »Mein Gott, was habe ich nur gesagt?« Als sie sich Corentin zuwandte, standen Tränen in ihren Augen.
»Lauf ihr nach«, entgegnete er düster.
Tessa setzte sich in Bewegung, so schnell sie es mit ihrem Umfang konnte.
4
Feuer hatte Cyrian Wagner schon immer fasziniert. Am besten, wenn es dazu ordentlich knallte und krachte. Er kniete im Gras neben dem Kanal, jeder Grashalm kalt und knisternd von Eis. Etwa fünf Ellen maß die Lunte aus Hanf, die zu dem kleinen Haufen Schießpulver führte, den er sich gestern Abend aus Tessas Gewürzlager geholt hatte. Entwendet, konnte man auch sagen. Es geschieht ihr recht, wenn sie ihre Bestände nicht sicherer verwahrt, dachte er. Er war über die Maßen stolz auf seine Zündschnur, die er fachgerecht mit Pferdemist eingerieben hatte.
Ein Schwanenpaar schwamm zwischen den Eisschollen umher und beobachtete misstrauisch sein Tun. Cyrian griff nach dem Feuereisen, das er von daheim mitgebracht hatte. Als er es mit einer gekonnten Bewegung auf den Stein niedersausen ließ, entstand ein klarer, hoher Ton. Gleich, das wusste er, würden die ersten Funken fliegen wie Glühwürmchen in einer Sommernacht.
Freude erfasste ihn. Er hatte sich lange auf dieses Experiment vorbereitet und dafür extra diesen gottverlassenen Ort aufgesucht.
»Haben wir dich«, sagte eine Stimme in seinem Rücken. Eine andere spendete kichernd Beifall.
Cyrian wandte sich um. Auf dem Weg stand Ambrosius Marchthaler mit seinen Spießgesellen Hans und Jerg Mannsberger sowie der kleine Friedrich Scheuflin, der sein Rattengesicht hinter Jergs Rücken hervorstreckte und fies grinste.
Cyrian erhob sich bedächtig und registrierte, dass er alle Mitglieder von Ambrosius’ Bande um einen Kopf überragte. Einen Vorteil musste es ja haben, von Corentin Wagner abzustammen. »Was wollt ihr?«
»Was wir wollen?« Ambrosius steckte seine Daumen unter sein besticktes Wams von bester Qualität. Weil sein Vater der reichste Stoffhändler der Stadt war, litt er immer wieder unter Anfällen von Prunksucht, die seine schwatzhafte Mutter noch förderte. »Schauen, was du so treibst. Wo du doch in der Schule heute nicht gerade die Leuchte warst.«
»Eher ein Armleuchter.« Friedrich, der seine mickrige Gestalt durch besondere Dreistigkeit wettmachen musste, konnte sich vor Lachen kaum auf den Beinen halten. »Das ersssste Gebooot lauft, nein ähh, lautet …«, machte er Cyrians Leseversuche nach.
Hitze schoss in Cyrians Gesicht. Heute hatte er wieder den Rohrstock geschmeckt, weil er sich einfach nicht merken konnte, wie das mit dem Lesen funktionierte. Seine rechte Hand war noch immer geschwollen.
»Na und?«, sagte er trotzig. »Dafür kann ich besser rechnen als ihr alle zusammen.« Die Welt der Zahlen war ihm vertraut; in ihrem Kosmos aus logischen Zusammenhängen fühlte er sich erheblich wohler als in der realen Welt.
»Was hast du denn da?« Ambrosius trat an das Schießpulver heran und betrachtete es stirnrunzelnd.
»Das geht dich überhaupt nichts an.«
Ambrosius hockte sich neben dem Schießpulverhaufen auf den Boden, steckte seinen Zeigefinger hinein und roch an einer Prise. »Sapperlott«, sagte er. »Wenn ich das dem Schulmeister erzähle. An solchen Dingen merkt man, was du bist …« Er machte eine kleine Pause und fügte dann das einzige Wort hinzu, das er sich besser hätte sparen sollen. »Henkersbrut.«
Cyrian sah rot, sprang auf Ambrosius zu und versenkte seine Faust in seinem Gesicht. Der Knochen in Ambrosius’ Nase knackte.
»Halt!« Eine Hand riss Cyrian zurück.
Er fuhr mit geballten Fäusten herum und blickte seinem älteren Bruder Andreas in die Augen, der in Begleitung seiner beiden Freunde auf dem Weg stand. Cyrian hatte nicht geahnt, dass sich in Andreas’ schmalen Schultern so viel Kraft verbarg.
Alle drei waren in würdevolle schwarze Talare gekleidet, wie es sich für angehende Studenten der Tübinger Universität gehörte. Sie betrachteten Cyrian unglaublich blasiert und fühlten sich mit Sicherheit über alle Arten von Gassenraufereien erhaben.
Andreas schürzte hochmütig die Lippen. »Musst du dich immer prügeln? Du bringst unsere Familie noch in Misskredit.«
Cyrian schwieg eigensinnig.
»Isch blute«, stöhnte Ambrosius.
Aus dem Augenwinkel beobachtete Cyrian voller Genugtuung, wie das Blut aus Ambrosius’ Nase auf sein Wams tropfte. Seine Kumpane scharwenzelten um ihn herum und versuchten, das sprudelnde Nass mit ihren Ärmeln aufzufangen. Schadenfroh malte er sich aus, was Ambrosius’ Mutter wohl zu der Sauerei sagen würde.
»Daf wirft du mir büfen!«, rief Ambrosius.
»Das sehen wir dann noch, Marchthaler«, erwiderte Andreas gelassen, bevor er sich Cyrian zuwandte, der schon begonnen hatte, seine Feuerutensilien einzusammeln. Den Schießpulverhaufen kehrte er geistesgegenwärtig unter ein paar Blätter. »Komm mit nach Hause!«
Kopfschüttelnd machten sich die drei angehenden Studenten auf den Weg zurück in die Stadt und nahmen Cyrian in ihre Mitte. Er trottete zwischen den Jungen, die alle über ein Jahr älter und mindestens doppelt so klug waren, dahin und fühlte sich wie ein Missetäter. Und dennoch. Er überragte sie und hätte es im Faustkampf locker mit zweien von ihnen gleichzeitig aufgenommen.
Nachdem sich die beiden anderen unter den Doppeltürmen von St. Dionys von Andreas verabschiedet hatten, folgte Cyrian seinem Bruder zum Rossmarkt.
»Vater ist heute nach Hause gekommen«, sagte Andreas, als sie am Tor standen.
Cyrian unterdrückte einen Fluch. Wenn sich seine Schandtat herumsprechen würde, hatte er von Corentin keine Nachsicht zu erwarten.
Andreas musterte ihn zweifelnd aus seinen grauen Augen. »Was hat der Marchthaler denn angestellt, dass du ihn so verdroschen hast? Nicht dass er es nicht verdient hätte.«
»Er hat mich Henkersbrut genannt«, gab Cyrian mürrisch zurück.
Andreas nickte. »Aber das ist doch normal. Mach dir nichts draus.«
Ausnahmsweise fühlten sie sich durch ihre Herkunft als Schicksalsgefährten.
»Nur kein Aufsehen erregen. Und Vater besser nicht daran erinnern, dass es uns gibt.« Andreas grinste Cyrian verschwörerisch an.
Gemeinsam betraten sie das Haus, schlichen sich in den ersten Stock, betraten ihr Zimmer und ließen sich erleichtert auf ihre Betten fallen. Abendessen würden sie sich holen, wenn die Luft rein war.
5
»Wann ist Leontine dir entglitten?«
Corentin lag mit verschränkten Armen auf dem riesigen Himmelbett, das Tessa seiner langen Beine wegen extra beim Schreiner in Auftrag gegeben hatte. Diese Nacht gehörte ihnen allein. Den kleinen Joachim hatten sie vorläufig bei seiner Amme einquartiert.
Tessa lockerte ihr Mieder, das sich über ihrem wachsenden Bauch kaum noch schließen ließ, und schlüpfte aus ihrem Rock. Darunter trug sie nur ihr Leinenhemd. Nachdenklich drückte sie einen Lappen in der Schale mit dem warmen, lavendelparfümierten Wasser aus, das ihr die Mägde eben gebracht hatten, und begann, sich zu waschen. Während Corentins Augen mit sichtlichem Genuss auf ihr ruhten, trocknete sie sich mit einem Tuch ab. »Sie ist schon eine Weile so verschlossen.«
Ihr Versuch, Leontine zum Einlenken zu bewegen, war vor deren verschlossener Zimmertür gescheitert. »Von wem hat sie nur diese unglaubliche Sturheit?«
»Wie konntest du zu ihr sagen, sie passe nicht in unsere Familie?«
»Ich weiß auch nicht«, gestand Tessa. »All die Jahre seit Theophilas Tod habe ich ihr gegeben, was immer ich konnte, aber es hat nicht gereicht.« Sie gähnte leise. Die schlaflose letzte Nacht und der Tag mit seinen Herausforderungen steckten ihr in den Knochen. Dazu kam noch diese vermaledeite Schwangerschaft, die ihr schon zur Halbzeit geschwollene Knöchel bescherte.
Erschöpft ließ sie sich auf den Bettrand fallen und lehnte sich an Corentin, der anfing, ihren Nacken zu massieren. Als seine Daumen sich in ihre verkrampften Muskeln bohrten, gab sie ein wohliges Stöhnen von sich. Damit sollte er nur weitermachen, möglichst den Rücken hinunter bis zu der Stelle über dem Kreuzbein, die sich immer so verkrampfte.
»Du mutest dir zu viel zu.«
»Aber was ich gesagt habe, stimmt doch«, sagte Tessa beharrlich. »Vom Stand her steht Leontine meilenweit über uns. Und mehr noch. Wenn sie sich weigert, Herzogin Sabinas Angebot in Betracht zu ziehen, müssen wir uns bald um eine passende Eheschließung für sie bemühen.«
»Das dürfte schwierig werden.« Corentin hielt inne und umfasste Tessas Brüste von hinten. »Wenn du schwanger bist …«, murmelte er in ihren Nacken hinein, »schwillt alles an dir wie ein reifender Apfel.«
Tessa lachte leise. Ihr Herz klopfte erwartungsvoll. Manchmal erschrak sie vor der Begierde, die sie noch immer mit Corentin verband. »Im neunten Monat hast du mich, glaub ich, noch nie gesehen. Dann wälze ich mich walfischgleich durchs Land. Vielleicht ja diesmal …« Vielleicht würde er ja länger bleiben als die zwei Wochen, die er sich sonst immer genehmigte.
Seit fünfzehn Jahren kämpften sie nun schon um Leontines Erbanspruch, den ihr der Halbbruder ihres Vaters, der Raubritter Hans Thomas von Absberg, streitig machte. Begonnen hatte es im Jahr 1514. Da hatten sie Leontines Mutter Theophila im Fränkischen bei ihren Versuchen unterstützt, die Ansprüche ihrer Tochter durchzusetzen. Mehrere Besuche auf Burg Absberg hatten ihnen ein Bild ihres grausamen Gegenspielers vermittelt, mit dem auf keinen Fall zu spaßen war. Theophila war im folgenden Sommer am Fieber gestorben. Corentin und Tessa, die damals mit Andreas schwanger gewesen war, hatten Leontine an Kindes statt angenommen und waren nach Esslingen zurückgekehrt.
Einige Jahre später hatten sie den Rechtsstreit vor das Reichskammergericht gebracht, das in Esslingen tagte. Doch die ehrenwerten Richter zitterten vor Furcht, weil sich der Raubritter als Entführer unschuldiger Reisender betätigte, die er vorzugsweise in Einzelteilen zurückschickte. Hinzu kam, dass er ein Spießgeselle des abgesetzten Herzogs Ulrich von Württemberg war, mit dem man sich sicherheitshalber nicht anlegen sollte. 1523 war dem Schwäbischen Bund angesichts der rücksichtslosen Raubzüge des Absbergers der Kragen geplatzt. Die Truppen waren zu seiner Burg geritten und hatten ihm seine Heimstatt über dem Kopf hinweg angezündet.
An Leontines ungewisser Situation hatte auch dieses rigorose Vorgehen nichts geändert. Im Gegenteil. Hans Thomas von Absberg verweigerte ihr sogar die Einkünfte von einigen Erbhöfen und Fischereirechten, die ihr durch das Erbe ihres Vaters gesichert zustanden.
»Sie angemessen zu verheiraten wird nicht einfach werden«, sagte Corentin. »Entweder ihr Bräutigam steht so hoch über ihr, dass ihm der Raubritter nichts anhaben kann …«
»Hochadel, meinst du?« Tessa legte sich neben ihn auf die Seite und schlang ihren Arm um seine Brust. Corentin war ein Baum von einem Mann, groß, breitschultrig, mit festen Muskeln. Er bot Halt, das hoffte sie jedenfalls.
»Oder er ist von so niedriger Geburt, dass ihr ererbter Adelstitel nicht mehr von Belang ist«, vollendete er. »Ein ehrenwerter Handwerker oder wohlhabender Weinhändler tut es auch. Hauptsache, sie ist glücklich.«
»Das hieße klein beigeben«, sagte Tessa, »was mir natürlich überhaupt nicht schmeckt. Wozu haben wir dann so lange gekämpft?«
Corentin sog scharf den Atem ein, als Tessa ihre Hand über seinen Bauch abwärtsgleiten ließ. Bevor sie sich uneingeschränkt den angenehmeren Dingen des Lebens zuwenden konnten, musste sie ein leidiges Thema ansprechen. »Wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, wer ihre Mutter war. Theophila war in Esslingen nicht mehr sicher, weil sie das zweite Gesicht besaß. Sie hat den Tod vorausgesehen, zuletzt ihren eigenen. Heute Morgen …«, Tessas Herz krampfte sich bei der Erinnerung an ihre Begegnung im kalten Hausflur zusammen, »… hat Leontine die Ankunft der Familie Häberle erahnt und stand im Gang, bevor die Leute anklopften. Es war nicht das erste Mal.«
»Verdammt«, sagte Corentin.
Just in diesem Augenblick pochte es zaghaft an der Tür, anders als bei Jergs und Hedwigs Poltern vor Sonnenaufgang.
Tessa verdrehte die Augen. Zweisamkeit würde ihnen heute so schnell nicht mehr vergönnt sein.
»Herrin?«, fragte ein verschüchtertes Stimmchen.
»Du musst dich nicht fürchten hereinzukommen, Stella. Nur Mut.« Ihre jüngste Magd schob sich zaghaft durch die Tür. Stella war nicht die Hellste und hatte ständig Angst, Fehler zu machen.
»Unten steht die Marchthalerin im Gang und ist ganz aufgebracht. Martha meinte, ich soll Euch rufen.«
»Tessa!« Margaretes schrille Stimme schallte bis zu ihnen hinauf.
Corentin verschränkte seine Arme vor der Brust. »Ignorier die Nervensäge einfach.«
»Das geht leider nicht.« Margarete war die Frau von Tessas bestem Freund Ägidius Marchthaler, den sie nicht vergrätzen wollte.
»Schon gut. Ich komme.« Seufzend rollte sie sich aus dem Bett, streifte ihr Hauskleid über und schloss die notwendigen Haken und Ösen.
Eitel kommt der Sache nahe, dachte Tessa, während sie die Treppe hinabstieg. Wahrscheinlich musste Margarete als Gattin des reichen Stoffhändlers und frischgebackenen Ratsherrn Ägidius Marchthaler eine Schaube tragen, die an den Ärmelrändern mit Pelz besetzt war und ein rotes Seidenkleid hervorschimmern ließ. Durch ihre pompöse Kleiderwahl betonte sie ihre religiöse Überzeugung als Ehefrau eines Vertreters der papistischen Fraktion im Rat, der sich auf die Seite des Stadtpfarrers Sattler und des Speyrer Domkapitels geschlagen hatte. Die Protestanten betonten ihre Bescheidenheit durch einfache Kleidung in tiefem Schwarz.
Tessa war sich nicht sicher, was ihre eigene Einstellung dem lutherischen Glauben gegenüber betraf. Ihre Marienfrömmigkeit hätte sie ungern aufgegeben, den Zwang, durch protzige Kleidung ihre Stellung herauszustreichen, hingegen schon.
Sie zögerte ihre Ankunft im Erdgeschoss absichtlich hinaus, indem sie die letzten Stufen extra langsam nahm.
Margarete stand im Gang wie ein angriffslustiger Drache. Ihre rötliche Gesichtsfarbe spiegelte ihre Gemütsverfassung ebenso wie der wogende Busen.
Tessa riss sich zusammen. »Grüß dich Gott, Margarete. Was führt dich so spät noch in unser Haus?«
Statt einer Antwort sah ihre langjährige Freundin sie nur vorwurfsvoll an.
Nichts Gutes ahnend, bat Tessa sie in die Stube und ließ Süßwein und die Rosinenbrötchen vom Vormittag auftragen, die Margarete schnöde verschmähte. Den Wein schüttete sie allerdings auf ex in sich hinein. Es klirrte unschön, als sie Tessas venezianisches Glas auf dem Tisch abstellte.
»Du hattest dich ja wohl nicht schon zurückgezogen?«, fragte sie pikiert. »Es dämmert ja kaum.«
»Hmm, doch.«
Tessa spürte, wie sie flammend errötete.
Corentin betrat den Raum, goss sich ein Glas Burgunder ein und zog Margaretes ungeteilte Aufmerksamkeit auf sich.
»Was ist los?«, fragte er.
Margarete überging ihn. Im Gegensatz zu ihrem Ehemann schien sie Corentins niedrige Abkunft niemals zu vergessen. »Es geht um Ambrosius«, berichtete sie an Tessa gewandt. »Cyrian hat ihm heute am Rossneckar die Nase gebrochen.«
Tessa seufzte und nippte an ihrem Glas Süßwein. Als Margaretes einziges Kind war Ambrosius ihr Augapfel, gleichgültig, was der Junge anstellte. Nichtsdestotrotz konnte Cyrian ein schlimmer Raufbold sein.
Sie fing Corentins ermutigenden Blick auf. Er würde sie reden lassen und nur dann eingreifen, wenn es sich nicht vermeiden ließ.
»Was sagt denn dein Mann dazu?«, fragte sie. Auf Ägidius Marchthalers vernünftiges Urteil konnte man sich verlassen.
»Der meint, dass Ambrosius Cyrian schon provoziert haben wird. Aber dann bricht man einem anderen Jungen doch nicht gleich die Nase.« Margarete seufzte. »Wir werden einen Wundarzt aufsuchen müssen.«
»Das könnte Corentin erledigen«, meinte Tessa.
»Niemals«, entgegnete Margarete entrüstet, während sich der Genannte ein Grinsen verkniff.
Corentin war ein Meister im Einrichten gebrochener Gliedmaßen. Seine bei zahlreichen Hinrichtungen erworbenen Anatomiekenntnisse hatte er auf dem Schlachtfeld perfektioniert. Keinesfalls jedoch würde Margarete akzeptieren, dass ein ehemaliger Scharfrichter Hand an ihren kostbaren Sohn legte.
»Jungen prügeln sich halt«, sagte Corentin. »Sie regeln auf diese Weise, wer der Stärkere ist.«
»Mag sein«, sagte Margarete ausweichend.
»Vielleicht könnte Cyrian ja morgen zu euch kommen und sich bei Ambrosius entschuldigen«, schlug Tessa vor.
»Ja, sicher«, sagte Margarete langsam. »Aber dann ist da noch das Schießpulver …«
»Welches Schießpulver?«, fragte Corentin alarmiert.
Ein Lächeln schlich sich auf Margaretes Lippen. »Das Schießpulver, das euer Sohn aus deinem Warenlager entwendet hat und am Kanal explodieren lassen wollte.« Sie drehte sich auf dem Absatz um und rauschte aus dem Raum.
Schweigend starrte Corentin ihr hinterher. »Wo ist der Lederriemen?«, fragte er dann.
»Ich weiß nicht«, log sie. »Du willst ihn doch wohl nicht verhauen? Die Jungen haben sich schon zurückgezogen.«
»Doch«, sagte Corentin.
Verzweifelt rang Tessa die Hände. »Aber Corentin, nein.«
Ihr zweitältester Sohn schaffte es, überall anzuecken. Er war verschlossen, brütete gern vor sich hin und tat sich mit dem Lesen so schwer, dass er oft genug von seinem Schulmeister Hiebe kassierte. Alles in allem ähnelte er seinem Vater mehr, als ihnen lieb sein konnte.
»Er hat dich bestohlen, Tessa«, sagte Corentin. »Der Tracht Prügel entgeht er nicht. Sag dem Jungen, dass ich ihn morgen sprechen will. Unsere Familie darf sich keine Ungesetzlichkeiten erlauben.«
»Aber Corentin. Du bist kein Unehrlicher mehr.« Ein Gefühl von Hilflosigkeit stieg in Tessa auf.
»Bist du dir da sicher? Hast du nicht bemerkt, wie deine Freundin mich angestarrt hat?« Corentins Gesicht wirkte wie versteinert.
Tessa ließ die Hände sinken. Es kam immer wieder vor, dass er sich vor ihr verschloss und die Nacht allein im Wirtshaus verbrachte, wo ihn nicht einmal Lenz stören durfte. Bei solchen Gelegenheiten hüllte sich Corentin in seine Dämonen wie in einen Mantel aus Schatten. Für heute hatte Tessa ihn verloren. Sie schluckte an ihrer bitteren Enttäuschung.
An der Tür wandte er sich noch einmal um. »Der Zustand der Unehrlichkeit hört niemals auf, Tessa, nicht einmal, wenn man sich ein Leben lang um Rechtschaffenheit bemüht. Man bleibt darin hängen wie in heißem Pech. Stell dir vor … Dadurch, dass du dich mit mir abgibst, steckst du mit drin. Mitgefangen, mitgehangen.«
Er durchschritt die Tür, ließ sie hinter sich ins Schloss fallen und verschwand in der Dunkelheit.
6
In dieser Nacht träumte Leontine von Absberg zum ersten Mal seit langer Zeit wieder vom Feuervogel. Voller Stolz entfaltete er seine Schwingen aus roten, goldenen und pfirsichfarbenen Federn, als wollte er sich in die Gewölbe der Morgenröte erheben. Sie stand ihm gegenüber, erbebte unter dem Blick seiner Augen und staunte über sein leuchtend blaues Herz. Dann jedoch loderte er in einem Flammenregen auf und zerfiel auf dem Scheiterhaufen seiner Träume zu Asche.
Leontine erwachte mit klopfendem Herzen und tauben Fingerspitzen, als die Nacht sich schon gen Morgen neigte. Das Zimmer war ausgekühlt, die Kerze auf ihrem Untersetzer aus Messing zu einem Wachsklumpen zusammengefallen.
Sie blinzelte in die Finsternis, die den blauen Schein der Dämmerung angenommen hatte. Wie lange hatte sie sich nach dem Feuervogel gesehnt, der all ihre Ängste mit sich nahm, wenn er lichterloh verbrannte?
Der kleine schwarz-weiße Kater neben ihr räkelte sich und drückte seinen warmen Rücken an ihre Seite.
Er trug den Namen »Wind«, der seiner Lebhaftigkeit angemessen war. Im letzten Herbst hatte Leontine einen zugebundenen Sack im Katzenneckar treiben sehen und war ihm am Ufer entlang gefolgt, bis er sich in den Ästen einer Weide verfangen hatte und sie ihn mit Hilfe eines Stocks aus dem bräunlichen Dreckwasser hatte ziehen können. Mit fliegenden Fingern hatte sie die Knoten gelöst und die Kätzchen aus ihrem Gefängnis befreit. Für nahezu alle kam jede Hilfe zu spät. Sie lagen still und ineinander verkrallt am Ufer, als hätten sie im letzten Moment Trost beieinander gesucht. Wind jedoch hatte sie aus seinen hellgrünen Augen angesehen und sich auf der Stelle einen Platz in ihrem Herzen erobert.
»Mein Bester«, sagte sie liebevoll.
An Schlaf war nicht mehr zu denken. Entschlossen schob Leontine den Kater zur Seite, setzte sich aufrecht an das Kopfteil des Himmelbetts und versuchte, sich die goldene Verheißung des Feuervogels ins Gedächtnis zu rufen. Wenn ihr das gelang, musste sie sich nicht mit Herzogin Sabinas völlig absurdem Angebot herumschlagen. Da sprang der Kater mit einem Satz aus dem Bett und verwandelte sich in ein fauchendes Ungeheuer mit gesträubtem Pelz und ausgefahrenen Krallen.
»Was ist los, Wind?« Schon bevor sie den Blick hob, erfasste sie eine böse Vorahnung.
Der Schatten klebte wie ein See aus Dunkelheit hinter der Kommode. Erschrocken zog sie sich ihre Decke bis zum Kinn.
Besuch aus dem Jenseits versetzte sie immer in eine Art Schockstarre. Was wäre, wenn sie den Geist einfach ignorierte, die Augen zukniff und so tat, als würde sie weiterschlafen? So hatte sie es gehalten, nachdem die Menschen hinter ihrem Rücken zu tuscheln begonnen und einige bei ihrem Anblick die Finger gegen den bösen Blick gekreuzt hatten. Nichtbeachtung reichte hier allerdings nicht aus, denn der Geist hub an zu reden, was bisher noch niemals vorgekommen war.
»Du kannscht ned immer vor dir selbscht davonlaufe, Schneckle«, sagte er leise in ihrem Kopf. »Das nutzt niemandem ebbes, am wenigschten dir selbsch.«
Großvater Häberle, dachte Leontine verwundert. Großvater Häberle, dessen Leben das Feuer gefordert hatte.
Er schwebte hinter der Kommode hervor und waberte auf sie zu wie ein eisiger Winterwind. Leontine erstarrte, als er einen Finger nach ihr ausstreckte und sie am Arm berührte. »Sag ihne, dass ich ihne nix nachtrag, ich bitt dich schön.«
»Gehe hin in Frieden«, flüsterte sie und wünschte Großvater Häberle von Herzen alles Gute.
Der Schatten löste sich in Richtung des Fensters auf und verschwand, als hätte er nur auf diese Worte gewartet. Von früheren Erscheinungen dieser Art wusste Leontine, dass Geister problemlos durch Wände gehen konnten. Er hatte nicht bedrohlich gewirkt, sondern ein seltsam tröstliches Glücksgefühl ausgestrahlt, als würde er seinen Tod als eine Art Befreiung verstehen.
Erschrocken bemerkte Leontine die Brandblase, die die Berührung seines Fingers auf ihrem nackten Arm hinterlassen hatte. Sie pustete darauf.
Erst nach und nach erfasste sie, was diese Begegnung zu bedeuten hatte. Gegen einen leibhaftigen Geist in ihrem Schlafzimmer nahm sich ihr morgendlicher Anfall von Hellsichtigkeit beinahe harmlos aus. Eine kleine Vorahnung konnte man getrost vergessen. Das hier nicht. Es war nicht vorbei. Sie sah Gespenster und sprach sogar mit ihnen. Ihre Andersartigkeit hatte sich nicht gelegt, auch wenn ihre Ziehmutter Tessa sich das noch so wünschte. Leontine stand auf der Schwelle zwischen den Welten, mit einem Fuß im Diesseits und dem anderen im Jenseits.
Ich bin zum Fürchten, dachte sie mit einem Anflug schrägen Humors. Wie sollte sie sich am Hofe der Herzogin behaupten, ohne dass sich die hochwohlgeborenen Menschen dort vor Angst in ihre prinzlichen Kniehosen machten?
Missliche Situationen verlangten nach einer Lösung. Die stand so plötzlich vor ihr, dass ihr kurz schwindlig wurde. Sie würde in das Haus ihrer leiblichen Mutter gehen.
Entschlossen stellte Leontine ihre Füße auf den Holzboden, tappte durch den Raum und suchte nach ihren Ersatzbeinlingen und ihrer Mütze, denn es war kalt im Quellental. Sie zog ihren warmen Wollrock und ihren pelzgefütterten Mantel an und stopfte zwei Hauskleider sowie ihre dicken Ersatzstrümpfe in einen Beutel. Als sie bereit war, warf sie noch einen Blick zurück in den Raum, in dem sie gestickt, gebetet und vergeblich gehofft hatte, dass sie normal werden würde.
Nein, dachte sie dann. Damit ist es vorbei. Feinden muss man in die Augen blicken, sagt Vater immer.
Sie stand schon an der Tür, als der Kater ihr bittend um die Beine strich.
»Also gut. Dich nehm ich mit.« Entschlossen steckte Leontine ihn unter ihren Umhang, wo er genügend Wärme für zwei abgab. Dann öffnete sie verstohlen die Tür und schlich auf den Gang hinaus.
Selbst für ihre alte Köchin Martha, die ihre Gicht mit den Hühnern aus dem Bett trieb, war es noch zu früh. Leontine tat ein paar Schritte in Richtung der Treppe, als ihr Fuß schmerzhaft gegen etwas Knochiges stieß, das unflätig fluchte.
»Cyrian?«
Ihr Bruder saß quer zu den Stufen auf dem Boden, die Arme um seine angezogenen Beine geschlungen. Seine Haare rochen nach Rauch.
»Was tust du denn hier?«, fragte Leontine.
»Das könnte ich dich ebenso fragen.«
Sie wusste, dass Cyrian manchmal nachts durch die Straßen streifte und irgendwelche Dinge anstellte. Verpfeifen kam nicht in Frage, auch nicht, wenn man ihn bei verbotenen Aktivitäten erwischte. So wenig die Geschwister sonst miteinander zu schaffen hatten, so eng hielten sie im Notfall zusammen.
Cyrian zögerte. »Ich hab ein bisschen Schießpulver explodieren lassen«, sagte er. »Und du?«
»Ich gehe ins Quellental ins Haus meiner leiblichen Mutter Theophila.«
Cyrians blaue Augen weiteten sich überrascht. »Davon weiß Tessa sicher nichts.«
»Erzähl ihr das morgen.« Auf keinen Fall wollte Leontine ihrer Ziehmutter durch ihr Verschwinden Angst einjagen. »Aber sie soll mich bitte in Ruhe lassen. Ich muss dringend nachdenken.« Sonst werde ich noch verrückt und ende wie die sabbernden Blöden, die sie in einem gesonderten Raum des Spitals aufbewahren, fügte sie für sich hinzu. Oder auf dem Scheiterhaufen, mit Sicherheit aber in der ewigen Verdammnis.
Cyrian rang sich ein schiefes Grinsen ab. »Das mach ich, nachdem Vater mich verprügelt hat.«
»Die Marchthalerin«, schloss Leontine. Sie hatte Margarete gestern Abend im Gang herumkeifen hören.
»Nicht nur«, gab er zurück.
Leontines ältester Bruder Andreas hatte im Verlauf ihrer Kindheit kaum Prügel kassiert, weil er sich, schlau, wie er war, aus den meisten Schwierigkeiten herauswinden konnte. Sie selbst war verschont geblieben. Cyrian aber hatte die Lederpeitsche, die zusammengerollt in Mutters Kommode lauerte, bei nahezu jedem von Corentins seltenen Aufenthalten zu schmecken bekommen.
»Du immer mit deinen Heldentaten.« Sie wuschelte ihm zum Abschied durch seinen dunklen Schopf, schob sich an ihm vorbei die Treppe hinunter und trat auf den Vorplatz hinaus. Das Tor fiel hinter ihr ins Schloss, als sei das ein Abschied für immer.
Der Kater bewegte sich unruhig in ihren Armen, während Leontine verstohlen durch die Straßen in Richtung des Frauentors huschte, wo laut Cyrian eine offene Pforte in der Stadtmauer auf sie wartete. Zu ihrer Rechten erhob sich der mächtige Bau des Spitals. Links lag die Dominikanerkirche.
Ein Mann trat aus den tiefen Schatten. Leontines Herz setzte einen Schlag lang aus. Es war Nikolaus Seiler, der als Kaplan im Dienst des Stadtpfarrers Balthasar Sattler stand.
»Vater Nikolaus.« Erschrocken fragte sie sich, was er so früh morgens außerhalb des Zehnthofs zu suchen hatte.
Seiler hatte sich der Familie Wagner vor einigen Monaten als Beichtvater angedient und war, nachdem er ihnen allen mehrmals die Beichte abgenommen hatte, von Tessa des Hauses verwiesen worden. Er sei ihr zu fanatisch, hatte sie verlauten lassen. Leontine jedoch hatte ihm gleich während ihrer ersten Beichte von ihrer Sehergabe erzählt.
Er musterte sie aus Augen so blass wie der Frost. »Die Hexentochter. Was bist du doch für ein bezauberndes Mädchen.«
Leontine stand da wie erstarrt. Seilers Finger waren eiskalt, als er sie über ihre Wange gleiten ließ.
»Leontine von Absberg«, fuhr er fort. »Der Bastard eines leichtfertigen Sängers von adligem Geblüt. Aber ich weiß es besser, weil ich in der Dämonologie wohlbewandert bin. Du bist ein Kind des Bösen, gezeugt beim Tanz um das Feuer bei einem dieser unsäglichen Feste.« Er bekreuzigte sich. »Und führe mich nicht in Versuchung … Ist dir bewusst, dass du mich jede Nacht im Traum heimsuchst? Aber sicher weißt du das, Homunkulus, der du bist. Sag, mit welchem Tier reitest du zum Hexensabbat? Wann hast du dich dem Teufel verschrieben?«
Leontine wurde schwarz vor Augen, denn insgeheim fürchtete sie nichts mehr, als dass ihre Gabe sie direkt in die Hölle führte. »Wie kommt Ihr dazu, mir solche Dinge zu unterstellen?« Seiler umgab ein leichter Branntweingeruch, der ihr unangehm in die Nase stieg.
»Ihr seid ja betrunken«, stieß sie angewidert hervor. Geistesgegenwärtig sprang sie einen Schritt zur Seite, als er sich neben ihr an der Chorwand abstützte. »Ihr bringt mich in Verlegenheit«, sagte sie heiser. »Besser, Ihr geht und schlaft Euren Rausch aus.«
Doch Seiler fuhr fort, jedes Wort ein Dolch, der sich in Leontines Seele bohrte. »Ach, Mädchen. Früher oder später wird man auch in der Reichsstadt Esslingen den Ketzern auf den Leim gehen und die evangelische Predigt einführen. Aber bei Hexen und Teufelsanbetern kennen auch die Protestanten keine Gnade.«
Nach diesen Worten legte sich eine so tiefe Stille über den Platz, dass Leontine den Frost in den Bäumen knacken hörte.
»Lass mich deine Seele retten«, fügte Seiler lockend hinzu. »Sonst entgehst du deiner Strafe nicht.«
Mit einem Schlag erwachte sie aus ihrer Erstarrung und tauchte, den strampelnden Kater fest an sich gepresst, unter Seilers Arm hindurch. Sie rannte. Ihre Füße trugen sie Stufe für Stufe die große Freitreppe zur Frauenkirche hinauf. Seilers Worte jedoch flogen wie Krähen hinter ihr her, die ihre Krallen in ihre Kopfhaut schlugen.
»Du bist des Teufels, Mädchen! Brennen sollst du! Brennen im fünften Kreis der Hölle!«
7
Die Gasse führte steil den Hang hinauf. Leontine durchschritt das zugewachsene Törchen, dessen Pforte in den Angeln knirschte, und blieb erst stehen, als sie die Weingärtnerhäuser weit oben in der Beutau erreicht hatte.