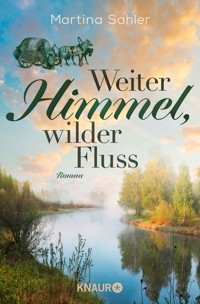14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der große Roman über die Gründung von Sankt Petersburg Zar Peter setzt im Mai 1703 an der Newa den ersten Spatenstich. Er will eine Stadt nach westlichem Vorbild bauen: Sankt Petersburg. Ein monumentales Vorhaben, das Aufstiegschancen und Abenteuer verheißt. Aus allen Himmelsrichtungen reisen die Menschen an: Graf Fjodor mit seiner intriganten Frau und ihrer Tochter, die sich nach dem Wunsch der Eltern mit dem Zaren verloben soll. Ein italienischer Architekt, der seine Geliebte in Florenz zurücklässt und von der Vergangenheit eingeholt wird. Der deutsche Arzt Dr. Albrecht mit seinen Töchtern. Während die Jüngere mit einem holländischen Tischlergesellen abenteuerlustig durch die Sumpflandschaft streift, verliert die Ältere ihr Herz an einen Mann, der zum Mörder wird. Langsam wächst eine Stadt heran … Der Roman einer Stadt, eine lebendige Geschichtsstunde über Aufbruch und Abenteuer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
»Hier entsteht eine Stadt!« Zar Peter bestimmt eine unscheinbare Insel im Newadelta, um Sankt Petersburg zu gründen. Eine gigantische historische Leistung, die Wagemutige aus ganz Europa anzieht. Graf Fjodor mit seiner intriganten Frau und ihrer Tochter, die sich nach dem Wunsch der Eltern mit dem Zaren verloben soll. Einen italienischen Architekten, der seine Geliebte in Florenz zurücklässt und von der Vergangenheit eingeholt wird. Den deutschen Arzt Dr. Albrecht mit seinen Töchtern. Während die Jüngere mit einem holländischen Tischlergesellen abenteuerlustig durch die Sumpflandschaft streift, verliert die Ältere ihr Herz an einen Mann, der zum Mörder wird. Immer beobachtet von dem Gottesnarr Kostja, dem nichts entgeht: keine Intrige, kein Liebesschwur, keine Meucheltat. Währenddessen werden die Fundamente der Stadt von schwedischen Kriegsgefangenen und russischen Leibeigenen aus dem Boden gestampft. Im Kampf gegen die Naturgewalten wächst Stein für Stein eine Stadt heran, die Russlands Fenster zum Westen werden soll.
Die Autorin
Martina Sahler
Die Stadt des Zaren
Der große Sankt-Petersburg-Roman
List
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweise zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1611-6
© 2017 © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Textauszug aus: Alexander Puschkin, Der eherne Reiter. Petersburger Erzählungen. Aus dem Russischen von Rolf-Dietrich Keil. © der deutschen Übersetzung Insel Verlag Frankfurt am Main 2003. Alle Rechte bei und vorbehalten durch Insel Verlag, Berlin
E-Book: L42 AG, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Er stand am weltumspülten Strand In tiefem Sinnen, unverwandt Ins Ferne schauend. Bleiern zogen Die Fluten durch das niedre Land; Ein Kahn trieb einsam auf den Wogen, Und hier und da im Ufermoor Stach eine Hütte grau hervor, die karge Wohnstatt eines Finnen, und Wald, in den sich nie verlor Ein Sonnenstrahl durch Nebelinnen, rauschte ringsum. Stolz dachte er: Von hier aus drohen wir dem Schweden. Hier werde eine Stadt am Meer, zu Schutz und Trutz vor Feind und Fehden. Hier hatte die Natur im Sinn Ein Fenster nach Europa hin, ich brech’ es in des Reiches Feste;
Personen im Jahr 1703
(Historische Personen sind mit einem * gekennzeichnet)
Der Zar, seine Familie, seine Freunde:
Zar Peter Alexejewitsch*, 30, der von einer Stadt am Meer träumt.
Fürst Alexander »Alexaschka« Menschikow*, sein bester Freund und Berater.
Jewdokija Lopuchina*, 33, Peters Ehefrau, die er ins Kloster verbannt hat.
Zarewitsch Alexej*, 13, Peters Sohn und Thronfolger.
Martha Skawronskaja*, 19, Peters Geliebte.
Patrick Gordon*, schottischer Söldnergeneral und Peters militärischer Hauptberater.
François Lefort*, Schweizer Glücksritter in Nemezkaja Sloboda, guter Freund Peters und später Admiral seiner Kriegsflotte.
Boris Scheremetew*, Feldmarschall der russischen Armee.
Anna Mons*, 30, Peters erste Mätresse in der Ausländervorstadt von Moskau.
Darja Arsenjewa*, Menschikows Geliebte und spätere Ehefrau.
Domenico Trezzini*, Schweizer Architekt, Bauherr in St. Petersburg.
Dr. Laurentius Blumentrost*, Wissenschaftler und Leibarzt des Zaren.
Die deutsche Arztfamilie:
Dr. Richard Albrecht, 42, deutscher Arzt, ursprünglich aus dem hannoverschen Coppenbrügge, wohnt seit sechs Jahren mit seiner Familie in der Moskauer Ausländervorstadt, als er die Einladung nach St. Petersburg bekommt.
Frieda Albrecht, 39, seine Frau.
Helena Albrecht, 18, ihre älteste Tochter.
Paula Albrecht, 14, die Ärztin werden möchte.
Gustav Albrecht, 10, der Sohn, der genau wie Zar Peter für die Schifffahrt brennt.
Die Tischler aus Amsterdam:
Theodorus van der Linden, 60, Tischlermeister aus Amsterdam in St. Petersburg.
Willem van der Linden, 14, Lehrjunge bei seinem Vater.
Schwedische Kriegsgefangene:
Erik Widström, 21, schwedischer Kriegsgefangener, der mithilft, die Stadt aus dem Boden zu stampfen.
Siri Nordin, 19, Eriks Verlobte in Uppsala.
Arvid Nordin, 19, Eriks bester Freund und Zwillingsbruder von Siri.
Die russische Grafenfamilie:
Graf Fjodor Bogdanowitsch, 36, General in der Leibgarde Zar Peters.
Gräfin Viktoria, 35, seine Gattin.
Komtess Arina, 17, die Tochter des Grafenpaares, die nach dem Willen der Mutter Zar Peter erobern soll.
Russische Leibeigene, die zur Grafenfamilie gehören und mit nach St. Petersburg reisen:
Zoja, 25, eine Russin mit Feuer im Blut.
Ewelina, 23, Zojas beste Freundin.
Jemeljan, 25, Zojas Geliebter.
Michail, 27, ein Mann, der seine Ehefrau ins Grab geprügelt hat.
Die Italiener in St. Petersburg:
Matteo di Gregorio, 28, Architekt aus Florenz und Lebemann.
Francesco di Gregorio, 24, der jüngere Bruder.
Chiara Martini, 23, Schneiderin aus Florenz, Matteos Geliebte.
Camillo, Chiaras väterlicher Beschützer.
Und Kostja, der zwergwüchsige Gottesnarr, dessen Alter keiner kennt und der stets darum kämpft, die Wahrheit ans Licht zu bringen.
Prolog
An der Newamündung, 16. Mai 1703
Seit Sonnenaufgang kreiste der Adler über Ingermanland. Er schwebte über den Sümpfen, den Birkenwäldern und dem Wasser der Newa.
Vielleicht wollte er auskundschaften, was sich die Menschen dabei dachten, dieses unwirtliche Gebiet zwischen dem Ladogasee und dem Finnischen Meerbusen zu betreten.
Vielleicht wollte er auskundschaften, ob sie sich anschickten, die Herrschaft über die Natur an sich zu reißen.
Zar Peter stand dicht am Flussufer, wo eine Fregatte und Ruderboote auf ihn und seine Gefolgschaft warteten. Den Blick hielt er nach oben gerichtet.
Das Morgenlicht schluckte alle Farben und gab der Landschaft einen silbernen Anstrich. Die Nebel, die früh über der Newa wallten, lösten sich auf. Ein frischer Wind von der Ostsee trieb den Schleier über Land und Moor hinweg, in die Birken und Föhren drüben auf finnischer Erde, wo sie zerfaserten.
Vor dem Himmelsblau hoben sich die Schwingen des Greifvogels klar umrissen ab. Vermutlich lauerte er auf einen der Feldhasen, die auf der Insel gegenüber herumsprangen und mit aufgerichteten Ohren lauschten.
Nun, sollte er sich eine letzte Fleischmahlzeit greifen, dachte der Zar. Die Hasen würden flüchten, sobald die Soldaten auf dem Eiland mit Hämmern und Kränen, Stein und Holz eine Festung errichteten. Ein Kirchturm sollte aufragen und Seefahrern aus allen Ländern der Welt signalisieren: Hier haben die Russen ihr Tor zum Westen.
Die Luft schmeckte noch nicht nach der Weichheit des Sommers, sie war wie Kristall, kühl und klar. Zar Peter nahm einen tiefen Atemzug. Stolz und Vorfreude erfüllten ihn.
Nach einer jahrhundertelangen Fehde um diesen uralten Wasserweg zur Ostsee und der Kriegserklärung des Zaren im August 1700 an den Schwedenkönig hatten die Nordmänner die russische Kriegsmacht in diesem Frühjahr unterschätzt, als sich die Regimenter des Zaren aufmachten, die baltischen Provinzen Ingermanland und Karelien an der Grenze zu Finnland zu erobern. Nicht irgendein Land, das anderen gehörte, sondern das Erbe ihrer Väter. Fürst Alexander Newski hatte das Gebiet vor fast fünfhundert Jahren von den Schweden errungen.
Ingermanland zog sich als schmaler Streifen an der Südküste des Finnischen Meerbusens von der Newa bis zur Festungsstadt Narwa. Karelien war ein viel größeres, von Wäldern und Seen bedecktes Landstück mit felsiger Küste zwischen der Ostseebucht und dem Ladogasee.
In den vergangenen Monaten hatte der Zar sein Heer aufgestockt und die Kirchenglocken zahlreicher Städte und Klöster einschmelzen lassen, um daraus Kanonen, Mörser und Haubitzen zu gießen. Dank dieser Aufrüstung hatten sie zunächst Nöteborg erobert und der strategisch wichtigen Zitadelle den deutschen Namen Schlüsselburg gegeben. Was für ein Triumph!
In Moskau ließen sie sich für diesen Kriegserfolg feiern, aber mehr noch als seine Landsleute bejubelten den Zaren die Ausländer in der Moskauer Vorstadt. Ihm zu Ehren schmückten sie Triumphbögen, legten die Gassen mit Teppichen aus und warfen aus den Fenstern Lorbeer- und Blumenkränze auf ihn und seine tapferen Krieger.
Zum nächsten Ziel hatten sie die Schanze von Nyen erklärt, die genau wie Schlüsselburg den Ausfluss der Newa aus dem Ladogasee beherrschte. Die Schweden kapitulierten nach achttägiger Belagerung und stundenlangem Beschuss. Vor zwei Tagen war Feldmarschall Scheremetew siegreich in die Festung eingezogen. Die feindlichen Kämpfer, die sie dabei gefangengenommen hatten, würden ihren Teil dazu beitragen, dass im Newadelta die größte und schönste Stadt entstand, die die Welt je gesehen hatte: die neue russische Hauptstadt. Mit Fug und Recht war er, Peter Alexejewitsch Romanow, zum Meister der Newa aufgestiegen.
Nach der Einnahme der Nyenschanz hatten sie darüber beratschlagt, ob sie diese Zitadelle ausbauen sollten. Doch sie war klein und marode und lag weit von der Ostsee entfernt. Die Haseninsel, von der Newa umrahmt, bot sich als der bessere Ort für eine Verteidigungsanlage an.
Zar Peter würde keine Zeit verlieren, genau hier den Grundstein für eine Stadt zu legen, in der die russische Seemacht erstarken konnte.
Der Krieg gegen die Schweden dauerte an, aber die Eroberung der schwedischen Festungen, die wie ein Ring das offene Meer versperrt hatten, öffnete ihnen den Zugang zur Ostsee – bis vor wenigen Tagen nur ein schwedischer Binnensee. Den Schweden gehörte alles: von Riga in Liefland über Reval in Estland bis zu den Weiten von Finnland, das an Ingermanland grenzte.
Nun würden die Russen das eroberte Newadelta sichern und nutzbar machen. Natürlich wusste Peter, welchen Kraftakt dies bedeutete, aber er zweifelte nicht am Erfolg seiner Pläne.
»Sankt Pieterburch? Hast du dir das sorgsam überlegt?«
Peter wandte sich Fürst Alexander Menschikow zu. Wie alle anderen Männer musste auch sein bester Freund den Kopf in den Nacken legen, um ihn anzuschauen. Der Zar überragte sie alle.
Menschikows grüner Samtmantel im europäischen Stil betonte seine Schultern, die Kniehose und die weißen Strümpfe die schlanke Gestalt. Purpurne Adern von zu viel Wodka durchzogen sein Gesicht mit dem flachsblonden Schnurrbart. Das spöttische Lächeln, bei dem er nur einen Mundwinkel hob, hatte er sich aus seiner Jugend bewahrt. Es blitzte in seinen Augen, als er seinen Weggefährten angrinste.
Peter verpasste ihm einen Schlag auf die Schulter. »Wann habe ich mir jemals etwas nicht sorgsam überlegt?« Sein Lachen klang unbeschwert und erinnerte an eine Jugend, in der sich das Leben und das Regieren wie ein verrücktes Abenteuer angefühlt hatten.
»Willst du tatsächlich wissen, wie oft in deinem Leben du aus einer Laune heraus Entscheidungen getroffen hast? Das könnte eine längere Geschichte werden. Mach dich darauf gefasst, dass sich unsere Abfahrt zur Haseninsel um Stunden verzögert«, gab Menschikow zurück.
Nur wenige Menschen wagten es, in diesem Ton mit dem Zaren zu reden. Aber Peter Alexejewitsch schätzte einen Freund wie Menschikow, der kein Blatt vor den Mund nahm. Sicher, er war ein Gauner und stets auf seinen Vorteil bedacht, aber er erwies sich auch immer wieder als einer der Fleißigsten und der Klügsten. Ihn aus der Gefolgschaft zu werfen wäre ein Leichtes, ihn hinzurichten ebenso. Aber welche Männer blieben ihm dann? Talentlose, unfähige Halunken. Darüber hinaus würde Menschikow jederzeit für den Zaren seinen Kopf riskieren. Wog allein diese Eigenschaft nicht jede Form von Habsucht auf?
»Gib dir keine Mühe, mich zu erzürnen, mein Freund. Ich weiß, dass es vielleicht die größte Tat meines Lebens sein wird, Sankt Pieterburch zu erschaffen. Ein schönes blühendes Kind unter Europas Greisen, herausragend durch seine Pracht und die herrlichsten Anlagen.«
»Den Ruf der Stadt willst du in die Geschichte einschreiben, indem du ihr deinen Namen gibst? Warum dann auf Niederländisch? Verleugnest du dein russisches Vaterland?« Menschikow verschränkte die Arme vor der Brust und lächelte den Zaren von der Seite an.
Der Regent runzelte die Stirn. »Es soll mir recht sein, wenn die Leute glauben, dass die Stadt nach mir benannt wird. Obwohl es nicht der Wahrheit entspricht.«
Schutzpatron der Stadt sollte, genau wie für Rom, der Apostel Petrus werden. Ihm wurde sie geweiht, in seinem Namen erschufen sie die Metropole.
»Pieterburch wird für die Ewigkeit gebaut werden«, fuhr der Zar fort. »Und ja, an die Niederlande darf unsere Stadt durchaus erinnern, von mir aus an Amsterdam. Es gibt schlechtere Vorbilder als die Holländer, die allein durch ihren Fortschrittsglauben ihr Land zur Blüte gebracht haben. Wir haben es selbst erlebt, mein Lieber. In Pieterburch wirst du als erster Generalgouverneur ein Auge darauf haben, dass sich die Architekten und Bauherren an die exakten Pläne halten. Sie sollen mit Sinn und Verstand Straßen anlegen und Gemäuer hochziehen. Ich will eine Ordnung, verstehst du?«
Menschikows Miene wirkte auf einmal ungewohnt ernst. »Ich frage mich nur, wie du das in diesem Sumpfgebiet schaffen willst. Quellwasser haben wir noch nicht entdeckt, das Wetter ist launisch, es gibt keine Verbindung zu bewohnten Landstrichen. Und wir müssen uns nach der Beschaffenheit des Bodens richten. Morast und Schlick werden uns an vielen Stellen einen Strich durch die Pläne machen.«
Die Newa machte hier eine Schleife nach Norden und floss dann nach Westen ins Meer. Auf der letzten Strecke teilte sie sich in vier Mündungsarme mit zahlreichen Querverbindungen, so dass sich die geplante Stadt aus einem Dutzend Inseln zusammensetzen würde. Die Haseninsel bildete den Mittelpunkt und Kern der Landschaft.
»Jammere nicht, das steht dir nicht«, widersprach der Zar. »Wir werden Herr über dieses Land werden. Wir werden Kanäle graben wie die Holländer in Amsterdam, und wir werden den Boden festigen, wo immer es nötig ist.«
Menschikow nickte ein paar Mal sinnend. »Wir werden gewaltige Anstrengungen unternehmen müssen. Wir und Tausende unserer Landsmänner.«
»Ich weiß, mein Freund, ich weiß.« Peter hob den Arm, um seiner Gefolgschaft, die sich hinter den beiden mächtigsten Männern des Landes versammelte, das Zeichen zum Aufbruch zu geben. »Unser Lohn wird eine Stadt sein, die dem Westen zugewandt ist. Eine Metropole, die in einer Buntheit von Gesichtern, Sprachen, Gewändern und Kulturen erstrahlen wird.«
Menschikow wiegte den Kopf und murmelte vor sich hin: »Vielleicht die erdachteste Stadt der Welt.«
Säbel klirrten, Stiefel stampften, als zweihundert Männer zum Ufer aufbrachen. Die Fregatte wartete auf den Zaren, auf Menschikow und eine Handvoll enger Vertrauter. Die Soldaten der Leibgarde verteilten sich auf die Ruderboote.
Aufrecht stellte sich der Zar an den Bug des Schiffes, schaute der Haseninsel entgegen, während die Ankerwinde ächzte und die Fregatte an Fahrt aufnahm. Der Wind mischte den Duft nach frischem Gras und Baumgrün mit dem Modergeruch der Uferpflanzen.
Peter richtete sich zu voller Größe auf, hielt sich mit beiden Händen an der Reling.
Wie hatte er diesen Tag herbeigesehnt, an dem sie das Fundament für eine russische Weltmacht erschaffen würden. Eine trutzige Stadt am Meer, zum Schutz vor den Schweden und gegen wen auch immer, der ihnen dieses Gebiet streitig machen wollte. Eine Stadt, die talentierte europäische Architekten, Bauherren und Schiffbauer mit offenen Armen empfangen würde, damit sie zum Wohlstand aller beitragen konnten.
Mochte manchen diese am Westen orientierte Politik wie ein launischer Einfall des Zaren erscheinen, so stellte sie doch nur den Versuch dar, im Wandel der Zeiten Schritt zu halten. Es gab viel aufzuholen für Russland.
Die Ausländer würden ihre Lehrmeister sein: Wie baute man edle Steinhäuser im modernen Stil? Wie legte man Parks und Gärten an? Wen sollte man mit der Aufstellung der Armee und der Flotte, dem Schiffbau und der Waffenherstellung beauftragen? Wie heilte man Kranke und stellte wirksame Arzneien her? Wie schneiderte man deutsche Kleidung, wie setzte man Uhrwerke zusammen?
Peter wusste sehr wohl, dass es nicht all seinen Untertanen schmeckte, wenn er die Ausländer so sichtbar umwarb. Wenn er mit Menschikow darüber diskutierte, pflegte er zu erläutern: »Ich habe zweierlei Untertanen. Zum einen verständige und wohlgesinnte, die einsehen, dass ich die Fremden zum Nutzen aller zu uns hole und mich um ihr Wohlergehen kümmere, damit sie gern bei uns bleiben. Auf der anderen Seite die Ewiggestrigen, die Boshaften, die meine guten Absichten nicht anerkennen. Alles Neue verachten sie aus Dummheit, und wenn sie können, verhindern sie es. Sie hängen an den verflossenen Zeiten, in denen die Sonne mehr gewärmt habe. Dabei vergessen sie, wie es bei uns ausgesehen hat, ehe ich mich in anderen Ländern umgesehen und die Fremden in unser Land gezogen habe.«
In Peters Visionen stiegen bereits die Villen und Paläste empor, die Straßenzüge und vor allem die Werft, die zum Wahrzeichen seiner Stadt werden sollte.
Wer hätte noch vor einem Jahrzehnt eine Kopeke darauf gesetzt, dass Russland zur Seemacht aufsteigen würde? Zwar fehlte es in den heimischen Wäldern an widerstandsfähigem Schiffbauholz, aber dafür gab es Eisen, Kupfer, Hanf und Segeltuch im Überfluss. Peter würde alles heranschaffen lassen, was sie zur Ausrüstung benötigten.
Sein erstes Boot hatte er vor zehn Jahren auf dem Gut seines Großvaters entdeckt, einen englischen Kahn, den der Schiffbauer Karsten Brand für ihn reparierte.
Wie anmutig er über die Wellen geglitten war, wie schnittig er den Wind einfing! Was für ein Wunderwerk! Das Schlagen des Segeltuchs, das Knarren der Bretter, das Klatschen des Wassers gegen den Bug, der brausende Wind in den Ohren – noch in diesen Tagen erinnerte sich Peter an jedes Detail.
Damals hatte seine jugendliche Schwärmerei vom Segeln großen Auftrieb bekommen.
Damals hatte er begonnen, von einem russischen Hafen an der Ostsee zu träumen.
Der einzige maritime Zugang des riesigen Reichs befand sich zu jener Zeit am Weißen Meer bei Archangelsk. Eingeschlossen durch die Schweden im Norden, Polen im Westen und die Türkei im Süden, war Peter in ein riesiges Land mit miserablen Grenzverhältnissen hineingeboren worden.
In Archangelsk hatte Peter erlebt, wie sich, sobald im Frühjahr das Eis brach, ganz Europa traf. Engländer, Holländer und Dänen reisten an, um mit Pelzen, Häuten, Hanf, Talg, Getreide und Pottasche zu handeln. Was für ein lebendiger, blühender Ort! Ein solches Zentrum wollte Peter an der Ostsee bauen, einen eisfreien Hafen, der zum Aufstieg Russlands zu einer der führenden Mächte beitragen sollte.
An diesem Tag im Mai, vom kreisenden Adler beobachtet, würde er beginnen, seine Vision zu verwirklichen.
Die Fahrt über die bleiernen Newafluten dauerte nur wenige Minuten. Der Zar sprang zuerst von Bord und setzte den Fuß auf die Insel, die die Keimzelle seiner Stadt werden sollte. Seine Leibgarde folgte.
Die Hasen, die zur Begrüßung in Richtung der kleinen Flotte gestarrt hatten, stoben in alle Richtungen davon.
Peter stemmte die Arme in die Seiten und betrachtete das Eiland von Nord nach Süd, von Ost nach West. Der Boden verlief flach und fest bis hinab zum Ufer. Im Geiste sah er die Mauern des Verteidungswalls, die russische Flagge wehte auf dem höchsten Wachturm. Und über allem ragte die Kirchturmspitze des Gotteshauses, das zu Ehren der Apostel Petrus und Paulus entstehen sollte und das der Anlage ihren Namen geben würde: die Peter-und-Paul-Festung.
Mit langen Schritten begann er, die Insel abzuschreiten. Brummend und stampfend folgten ihm die Männer. Die letzten zogen Kanonen hinter sich her, deren Räder über das unebene Landstück rumpelten.
Mancher aus seiner Garde mochte ihn für irrsinnig halten, aber was andere über ihn dachten, hatte den Zaren noch nie geschert. Mit eiserner Hand würde er sein traditionsverkrustetes Reich in die Zukunft führen. Es teilhaben lassen an der Entwicklung, die Europa nahm. Einen Meisterplan gab es nicht, doch seine Willensstärke suchte ihresgleichen im Land.
Vielleicht ein halbes Dutzend Männer besaß Geisteskraft genug, um seinen Vorstellungen zu folgen. Mehr nicht. Aber Widerstände galt es zu überwinden. Vielleicht würde es Jahrzehnte dauern, bis der letzte Altgläubige verbissen eingestand, dass der Zar seine Entscheidungen nur zum Besten des Vaterlandes traf.
Die Wolken verdichteten sich, der Wind frischte auf, während der Zar den Weg um die Insel fortsetzte. An einigen Stellen blieb er stehen, verharrte sinnend und schaute über die vom Wasser durchzogene Landschaft. Er würde vor Ort bleiben müssen, um die Befestigung und Bebauung zu überwachen.
Sein Blick glitt nach Osten über den Flussarm, wo zwischen weiß leuchtenden Birkenstämmen vereinzelte graue Holzhütten standen, karge Wohnstätten, von ihren finnischen Bewohnern verlassen. Dort würde er sich sein eigenes Haus bauen lassen, keinen Palast, bestimmt keinen Palast, eine bescheidene Arbeitsstätte, in der er seine Vertrauten empfangen und mit den Europäern über seinen Plänen brüten konnte.
»Sehe ich Skepsis in deiner Miene?« Menschikow hatte sich wieder aus den Reihen gelöst.
Peter lachte auf. »Gewiss nicht«, erwiderte er. »Selten fühlte ich mich entschlossener als am heutigen Tag. Folgt mir!«
In der Inselmitte hob er die Hand und wandte sich an Graf Fjodor Bogdanowitsch, der auf Geheiß des Zaren einen Spaten mitführte. Buckelnd drückte sich der Graf nach vorn, um dem Herrscher das Werkzeug zu überreichen.
Mit unbewegter Miene nahm Peter die Schaufel entgegen. Das Blut rauschte in seinen Ohren, eine Böe wehte ihm die Haare übers Gesicht. Er strich die Strähnen fort, bevor er den ersten Spatenstich setzte.
Menschikow applaudierte laut und anhaltend, bis die anderen Männer einstimmten, zögernd und weniger berauscht.
Mühelos schaufelte Peter eine Grube in den Boden. Ein Priester trat hervor, hinter ihm vier Männer in Uniform, die eine steinerne Kiste trugen. Darin befand sich ein goldenes Kästchen, das Teile der Reliquien des heiligen Andreas barg. Nach orthodoxem Glauben hatte der Apostel den Russen einst das Wort Gottes gebracht.
Mit andächtigen Mienen senkten die Männer die Kiste in das Erdloch, während der Priester Gebete murmelte und Weihwasser sprenkelte, dessen Duft sich mit dem Geruch von Brackwasser mischte.
Zwei weitere Soldaten bedeckten die Grube mit einer steinernen Platte. Menschikow nahm sich das Recht, die Inschrift laut gegen den Wind sprechend vorzutragen, so dass es bis zu den hinteren Männern vordrang: »Im Jahre 1703 seit der Fleischwerdung unseres Herrn Jesus Christus, am 16. Mai, wurde die Herrscherstadt Sankt Pieterburch von dem Großen Herrn, dem Zaren und Großfürsten Peter Alexejewitsch, Autokrator von ganz Russland, gegründet.«
Peter bückte sich und legte zwei längliche Rasenstücke in Kreuzform auf die Platte. »Hier soll eine Stadt entstehen!«, rief er mit feierlich getragener Stimme. Ein Lächeln erhellte seine Züge, während die Männer in Jubel ausbrachen.
Sie würden hinter ihm stehen, sie würden wie er mit allen Kräften gegen die Natur ankämpfen. Obwohl sie seine Vision einer Stadt nicht teilten, vertrauten sie ihm, ihrem Zaren, den sie von Kindesbeinen an kannten. In der Moskauer Vorstadt hatten sie gemeinsam Schlachten nachgespielt und Kriegsstrategien ersonnen, von jugendlichem Übermut getrieben. Für seine Leibgarde hatte Peter die Besten seiner Kameraden ausgewählt. Auf ihre Treue konnte er sich verlassen – und auf ihre Überzeugung, dass sie in Zar Peter einen klugen Vordenker und Fürsten hatten.
Peter wies auf zwei Birken und ordnete an, sie zu fällen. Vier Männer führten sogleich seinen Befehl aus. Die Axtschläge donnerten über die Insel, übertönten das Plätschern der Wellen und das Rauschen in den Baumwipfeln. Ein Schwarm Spatzen stob schimpfend in den Himmel, über die Newa hinweg bis zum anderen Ufer.
Die Soldaten legten dem Zaren die beiden Birken zu Füßen. Mit einem Hanfseil band er die kräftigsten Äste aneinander. Ein paar Männer richteten die Bäume auf, so dass sie ein Tor bildeten. Die weißen Stämme versenkten sie in rasch ausgehobenen Erdlöchern und befestigten sie mit Grasnarben. Ehrfurchtsvoll schauten alle hoch zu diesem symbolischen Tor, das über den Reliquien und dem Gedenkstein aufragte.
Der Zar beschirmte die Augen mit der Hand gegen die Sonnenstrahlen, die durch die Wolken brachen. Der Adler zog nun genau über der Haseninsel seine Runden. Spiralengleich glitt das Tier tiefer und tiefer, bis Peter den gebogenen Schnabel und die glänzenden Pupillen sehen konnte. Hinter ihm schwoll das Murmeln seiner Männer an, manche riefen »Oh!« und »Seht nur!«.
Einen Wimpernschlag später schwang sich das Tier aus den Lüften herab und ließ sich auf dem Birkentor nieder. Am Rasseln hinter sich erkannte Peter, dass sich seine Männer bekreuzigten. Er selbst ließ keinen Blick von dem Greifvogel, der auf dem Ast thronte.
Himmlische Zuwendung? Ein kaiserlicher Adler als Vorbote kommender Größe? Vielleicht. Auf jeden Fall verlieh der Greifvogel dieser historischen Stunde der Grundsteinlegung von Sankt Pieterburch zusätzliche Würde. Peter jedoch hing zu sehr den Naturwissenschaften an, um an ein göttliches Zeichen zu glauben. Genau wie Alexander Menschikow.
»Ein Wunder, ein Wunder!«, hörte Peter den Grafen Bogdanowitsch hinter ihm raunen. Als er sich umdrehte, sah er, dass sich der Graf anschickte, auf die Knie zu fallen.
Menschikow hinderte ihn daran, indem er ihn rüde am Ärmel packte. »Seid nicht einfältig, Graf Bogdanowitsch. Vermutlich lebt das Tier schon länger auf der Insel, und die Schweden haben es gezähmt.«
Die Menge hinter Peter verstummte, während er den Arm dem Adler entgegenhob. Das Tier spreizte die Flügel und ließ sich darauf hinab. Salutschüsse peitschten über die Newa, während Peter mit dem Vogel zu seinem Schiff zurückschritt.
Ob seine Männer aus Vernunft an ihn glaubten oder weil der Himmel seinen Segen gegeben zu haben schien, bekümmerte den Zaren nicht. Er brauchte sie, egal, was sie dachten.
Das Reich war groß, die Widerstände gewaltig, und bis die ersten Schiffe in den neuen Hafen einliefen, Regierungspaläste emporwuchsen und Bürger über die Prachtstraßen flanierten, würden Jahre ins Land ziehen, in denen der Boden im Ingermanland mit dem Blut und dem Schweiß der Arbeiter getränkt werden würde.
Nein, Peter gestattete sich keine Illusionen darüber, dass dieser Etappensieg gegen die Schweden und die Grundsteinlegung der neuen Hauptstadt das Ende des russischen Kampfes um Anerkennung in der europäischen Welt bedeuten würde.
Er war erst der Anfang.
Buch 1
Aufbruch
Juli 1703 – März 1704
Kapitel 1
Nemezkaja Sloboda, Ausländervorstadt bei Moskau, Juli 1703
Frieda Albrecht stellte den Weidenkorb mit dem in Papier gewickelten Huhn, dem Kohl und den Kartoffeln an den Wegrand und wischte sich mit dem Unterarm über die Stirn.
Seit Tagen brannte die Sonne auf die Dächer, Gärten und Felder der Ausländervorstadt. Wer es sich leisten konnte, verschanzte sich zur Mittagszeit in seinem Haus, schloss Fenster und Türen, um die Zimmer kühler zu halten.
Frieda hätte es sich leisten können, aber ihre Umtriebigkeit ließ es nicht zu, dass sie sich mittags zur Ruhe setzte. Irgendetwas gab es immer zu tun.
Am liebsten würde sie von Sonnenaufgang bis zur Nacht an der Seite ihres Mannes arbeiten, der als Arzt über die Grenzen der Vorstadt hinaus Anerkennung genoss. Aber zu oft beschlich sie das Gefühl, ihm im Weg zu sein.
Das Einkaufen und Kochen für ihre fünfköpfige Familie übernahm sie selbst.
In der Ausländervorstadt gab es drei Märkte für Gemüse und Fleisch, Brot und Gewürze: einen gegenüber der Holländischen Reformationskirche und zwei kleinere in der Nähe der Lutherischen Kirchen. Die Türme dieser Gotteshäuser zeigten Reisenden schon aus weiter Entfernung an, dass sie sich einem Ort näherten, in dem keine Russen lebten.
Grüne Gärten, Blumenbeete und Büsche säumten mehrgeschossige Häuser mit Schräg- und Spitzdächern. Es gab Terrassen, Springbrunnen, und in den Orangerien wuchsen aus Westeuropa gelieferte Tulpen, Rosen und sogar Weintrauben.
Hier lebten Menschen unterschiedlicher Nationalität und unterschiedlichen Glaubens miteinander. Protestanten, Lutheraner, Calvinisten, Katholiken wohnten bunt gemischt. Es gab keine Aufteilung nach Nationen, Religion oder Berufen. Die Häuser der Deutschen standen neben denen der Schweden, Holländer, Engländer, Schotten, Dänen, Franzosen, Schweizer. Allerdings war die deutsche Sprache am geläufigsten. Diejenigen, die hier seit mehreren Generationen lebten, nannten die anderen die Altdeutschen.
Was ihnen an der russischen Lebensart gefiel, hatten sie in der Vorstadt übernommen: Die Häuser waren mit Gärten umgeben, in denen neben den eher unüblichen Blumenbeeten die in Russland beliebten Johannisbeer- und Himbeersträucher wuchsen. Außer Pferdeställen und Remisen gab es die für die Aufbewahrung von Lebensmitteln bewährten Eiskeller, daneben Brunnen, Heuschuppen, Sommerküchen und Badehäuser.
Für den Hausputz gönnte sich Frieda eine Hilfe, die Witwe Ella, die damit den Unterhalt für sich und ihre beiden Kinder verdiente. Eine Hausangestellte zu haben untermauerte den Rang der Familie Albrecht im Ort. Hochdekorierte Militärs, Kaufleute, Diplomaten, Handwerksmeister, Ärzte und Apotheker verfügten gemeinhin über Personal, wollte man sich nicht der Armut verdächtig machen. Frieda legte wenig Wert auf derartige Spitzfindigkeiten. Sie schätzte die bunte Vielfalt der Sloboda-Gemeinschaft.
Sie krempelte die Blusenärmel bis zur Schulter hoch und schüttelte die Arme, um sich Luft zuzufächeln. In ihren Achseln klebte der feuchte Stoff. Sie trug nur ein einfaches Leinenkleid, dennoch staute sich die Hitze darunter.
Vielleicht würde sie am späten Nachmittag mit ihren beiden Töchtern ein Bad in der Jausa nehmen, an deren Ufer sich Nemezkaja Sloboda befand. Eine knappe Meile nordöstlich auf der anderen Seite des Flusses erhoben sich die bunten Zwiebeltürme der Basilius-Kathedrale über den Dächern Moskaus.
Regelmäßig fuhren Boote zwischen den beiden Häfen hin und her, aber die Deutschen zog es selten in die russische Hauptstadt. Sie hatten in ihrem Dorf alles, was sie brauchten. Hier konnten sie ihren althergebrachten Lebensstil pflegen, gingen ihren Verpflichtungen nach. Es war ein geflügeltes Wort der Russen, ordentlich wie ein Deutscher zu sein.
Dass die Einheimischen sie mieden, nahmen sie mit Gelassenheit. Für die Russen waren sie Ketzer und Ungläubige, aber von dem Wissen der Ärzte und der Architekten profitierten vor allem die Höhergebildeten gern.
Friedas Mann Richard galt als einer der fähigsten Mediziner, wie generell die deutsche Medizin einen herausragenden Ruf genoss. Wer seine Abneigung gegen die Europäer überwand und ihn aufsuchte, der schwärmte von dem deutschen Arzt, der sein Wissen nicht in mündlichen Überlieferungen von den Großvätern angesammelt, sondern an einer Universität im Westen – in Leyden – studiert hatte.
Schon seit einem Jahrhundert luden die russischen Herrscher Ärzte aus Europa zu sich ein, aber das Misstrauen gegenüber den Ungläubigen saß tief. Die Bauern vertrauten lieber den Kräuterkundigen, dem Barbier auf dem Moskauer Läusemarkt oder den Knocheneinrenkern, die sich ihr Wissen über Beinbrüche, Verrenkungen und Zerrungen selbst beigebracht hatten. Im Übrigen galten Krankheiten für viele Russen schlicht als Strafe Gottes: Wem Gott eine Krankheit oder ein Leiden geschickt hat, genese durch die Gnade Gottes, durch Tränen, Gebet und Fasten, durch Almosen an die Armen und aufrichtige Reue, durch Dank und Fürbitte und Barmherzigkeit und ungeheuchelte Liebe zu jedermann. So hatte es Frieda in einem altrussischen Hausbuch gelesen.
Welch ein Irrsinn, dass es immer noch russische Bauern gab, die ausgerechnet die ausländischen Fachleute der Hexerei bezichtigten, wenn sie mit ihrem Universitätswissen die Kranken heilten. Andererseits aber schickten die besser gebildeten Russen ihre begabten Söhne nach England, Holland und Deutschland, um sie in der medizinischen Wissenschaft ausbilden zu lassen.
Frieda atmete ein paar Mal tief ein. Nur noch wenige Schritte bis zum Arzthaus, aber heute war einer dieser Tage, an denen ihr das Wetter besonders zusetzte. Sie lockerte die Schnüre der Bluse am Dekolleté und wollte nach dem Korb greifen, um das letzte Stück zurückzulegen, als eine junge Frau auf sie zusprang.
»Geht es Euch nicht gut?« Finger drückten sich in ihren Arm, hellblaue Augen mit Wimpern wie Spinnenbeine musterten ihr Gesicht.
Frieda zwang sich zu einem Lächeln. »Danke, Anna, es ist schon gut. Die Hitze, weißt du?«
»Soll ich den Korb für Euch tragen?« Anna beugte sich bereits hinab, um den Henkel zu fassen.
»Lass nur, alles in Ordnung.«
Weil Anna keine Anstalten machte, die Hand wegzunehmen, schüttelte Frieda sie ab und richtete sich zu voller Größe auf, die Wirtsfrau um einen halben Kopf überragend.
In solchen Situationen war Frieda froh darüber, ungewöhnlich hochgewachsen zu sein, dabei schlank und von graziler Gestalt. Nur ihre Füße besaßen Ausmaße, die den Schuhmacher bei der Anprobe stets vielsagend schnalzen ließen. Aber gut, wer schaute schon zuerst auf die Füße eines Menschen?
Die Anteilnahme warf einerseits ein gutes Licht auf Anna. Andererseits fühlte sich Frieda wie eine Greisin behandelt. Seit wann brauchte eine wie sie Hilfe beim Körbetragen? Die Fürsorge anderer ließ Frieda nicht zu, nicht von ihren Kindern oder ihrem Mann und schon gar nicht von anderen Dörflern, die sich wichtigmachen wollten. Das Leben hatte sie gelehrt, dass sie am besten damit fuhr, wenn sie die Zügel selbst in der Hand hielt. Der verbittert wirkenden Anna, deren jugendliches Blond die Kerben um ihren Mund und die Falten zwischen ihren Brauen nicht wettzumachen vermochte, fühlte sich Frieda an Kraft und Lebensfreude weit überlegen.
Im Ort tuschelte man darüber, dass der Zar Anna einst zu seiner Geliebten erwählt hatte. Vielleicht war sie es immer noch? Darüber konnte man nur spekulieren, seit Peter Alexejewitsch sich nur noch selten in dem Holzpalast aufhielt, den er in der Nähe von Sloboda besaß.
Vor zehn Jahren hatte es den Zaren fast täglich zu den Europäern gezogen. Frieda erinnerte sich gern daran. Hier hatte er sich mit Patrick Gordon angefreundet, einem adligen Gutsbesitzer aus Schottland, mit dem er Whisky und Rum aus den Kolonien getrunken und den er später als seinen militärischen Hauptberater mit in den Krieg gegen die Schweden genommen hatte.
Hier hatte er die Bekanntschaft des Schweizers François Lefort gemacht, der Admiral seiner Kriegsflotte werden sollte. Und hier verliebte er sich in Anna, Tochter des Weinhändlers Johann Mons, obwohl er bereits mit siebzehn Jahren auf Drängen seiner Mutter die drei Jahre ältere Jewdokija Lopuchina geheiratet hatte.
Im Februar 1690 gebar seine Ehefrau einen Sohn – Alexej. Frieda kannte die Gerüchte darüber, dass sich der Zarewitsch lieber bei seiner Mutter im Kreml aufhielt, statt seinen Vater in die Schlachten zu begleiten und Kriegsstrategien zu erlernen.
Die westliche Lebensweise begeisterte den Zaren, wie Frieda wusste. Während Anna ihn offenbar als Gesprächspartnerin und mit europäischer Freizügigkeit beeindruckte, weckten Lefort und Gordon mit Erzählungen über die Kultur, die Handwerke und die Wissenschaften die Wissbegier des Zaren und seinen Wunsch, Russland zu einer europäischen Macht aufzubauen.
Frieda war bestens unterrichtet über all diese Angelegenheiten, die den Zaren betrafen. Nicht nur, weil er bei Blessuren und Bauchgrimmen ihrem Mann blind vertraut und sich deswegen oft in ihrem Hause aufgehalten hatte, sondern weil sie insgeheim eine Schwäche für ihn hegte.
Mehr noch als von seiner majestätischen Erscheinung fühlte sich Frieda von seinem unstillbaren Wissensdurst, seinem Fortschrittsglauben und seinem Scharfsinn angezogen. Ein Mann, der jeden mit seiner Schlagfertigkeit, seiner Gescheitheit und seinen Kenntnissen in die Knie zwang. Auch ein jähzorniger und rigoroser Herrscher, gewiss, aber wann hatte man je gehört, dass die Empfindsamen und Nachsichtigen die Welt bewegten?
»Lauf nur ins Wirtshaus, Anna. Nach der Mittagshitze werden euch die Dörfler die Türen einrennen und mit den Humpen poltern.«
Anna nickte. »Lasst Euch gerne einmal wieder in der Schenke sehen. Für Euch und den Doktor ist immer ein Plätzchen reserviert. Und zwei Becher von unserem besten Hauswein.« Sie eilte davon, und Frieda setzte ihren Weg fort.
Obwohl sich Anna ihr gegenüber stets gefällig gab, mochte sie sie nicht besonders. Ihrer Freundlichkeit schien etwas Herablassendes anzuhaften, und darüber hinaus vermutete Frieda, dass es zu ihrer Schande ein Funken Eifersucht sein könnte, weil Anna den Zaren in ihrer jahrelangen Liaison so privat erlebt haben musste wie nur wenige andere Frauen.
Während sie, den Korb am Arm baumelnd, die Werkstatt des Schmieds umrundete und auf das zweistöckige Holzhaus am Rande des Dorfes zuging, in dem sie mit ihrer Familie lebte, spürte sie Scham in sich aufsteigen.
Wie undankbar von ihr, von einem anderen Mann zu träumen, obwohl ihr der beste Gatte der Welt zur Seite stand und drei wunderbar geratene Kinder. Sie sollte einfach zufrieden sein, dass es das Schicksal gut mit ihr gemeint hatte, aber Gefühle ließen sich zu Friedas Bedauern nicht abstellen, nur bändigen.
Sie seufzte, als sie endlich den Vorgarten erreichte. Drei Apfelbäume reckten ihre Zweige bis hoch zum Dach. Die sauer duftenden grünen Früchte hingen an den Ästen, kaum so groß wie Walnüsse. Frieda freute sich darauf, in wenigen Wochen ernten zu können und die Familie mit Most und Apfelkuchen zu verwöhnen. Sie entriegelte das Tor am Lattenzaun.
Von links schoss Gustav heran. »Mutter, Mutter! Der Postmann – am Hafen! Er hat einen Brief für uns dabei! Du rätst niemals, von wem er ist!«
»Na, dann verrate es mir lieber gleich.« Frieda wuschelte dem Zehnjährigen durch die karottenroten Haare, die drahtig in alle Richtungen abstanden. Seine Hose glänzte feucht bis zu den Oberschenkeln. Am liebsten spielte ihr Jüngster am Ufer der Jausa, wo er an einem verwitterten Ruderboot werkelte.
»Vom Zaren persönlich!« Gustavs Stimme überschlug sich.
»Ach, Gustavchen, da wird dich der Postmann veralbert haben. Warum sollte der Zar uns schreiben?«
»Wenn ich es dir doch sage, Mutter! Ich habe den Brief und das Siegel mit eigenen Augen gesehen!« Seine Schultern sackten nach vorn, er senkte den Kopf. »Ich habe den Postmann gedrängt, aber er wollte ihn mir nicht aushändigen.«
Frieda lachte auf. »Ärgere dich nicht. Es wird keine halbe Stunde dauern, bis er bei uns ist. Dann können wir ihn alle lesen.« Sie wollte ihren Sohn, der ihr lang und schlaksig bis an die Schultern reichte, ins Haus hineinschieben, aber Gustav wand sich unter ihrem Arm hindurch.
»Ich hole Paula und Helena. Sie wollen bestimmt erfahren, was der Zar uns schreibt.«
Frieda nickte. »Mach das.« Gustav war ihr sehr ähnlich. Mit hellwachem Köpfchen jagte er durch die Welt, rastlos wie sie selbst.
Sie trat in den dunklen Flur, schloss rasch die Tür hinter sich. Frieda liebte ihr Zuhause. Sie kannte einige Häuser von Russen und wusste, wie sehr sich deren Stil und Geschmack von ihrem eigenen unterschied.
Spiegel und geschmiedete Leuchter schmückten die Wände, in der Wohnstube dominierte ein Landschaftsgemälde mit den Wäldern und Wiesen aus ihrer früheren Heimat. Von all ihren Kindern hingen Porträts über dem gemauerten Kamin in der Stube. In der Küche bewahrte sie in einem geschnitzten Schrank Glas und Kristall auf, aber zu ihrem wertvollsten Familienbesitz gehörte eine Wanduhr sowie ein in einer Vitrine ausgestelltes Album mit Postkarten europäischer Städte.
Sie lugte in die Wohnstube. Richard ruhte auf dem Diwan, lang ausgestreckt, den Mund leicht geöffnet. Sein Schnarchen erfüllte den Raum. Ein warmes Gefühl durchströmte sie, während ihr Blick an seinem Bauchansatz hängenblieb und höherglitt zu den Bartstoppeln. Das schmale Gesicht mit den tiefliegenden Augen, die buschigen Brauen, die Stirn, an der das Haupthaar zurückwich. Ein schöner Mann? Eher nicht. Aber sie liebte ihn so, wie er da lag, die Knöchel über das Ende des Sofas hängend, die Arme auf der Brust gefaltet.
Sie liebte es, wie er Gustav voller Stolz musterte, wenn der Junge ihm eine Skizze für sein Segelboot präsentierte. Wie er Paula auf die Stirn küsste, wenn er sie in ein Buch vertieft antraf. Wie er Helena an den Fingerspitzen fasste, um sie zu betrachten, wenn sie sich herausgeputzt hatte.
Sie liebte es, dass er an ihr, seiner Frau, in den Nächten Halt fand, wenn ihn Alpträume quälten, er könnte all dies – seine Familie, seine Arztpraxis, sein Zuhause in der Moskauer Vorstadt – verlieren.
Dort, wo er lebte und liebte, schlug Richard tiefe Wurzeln. Kein Abenteurer, kein Schönseher, keiner, der die Welt erobern wollte. Ein bodenständiger Mann, aufrichtig, treu und eine Koryphäe in seinem Fach.
Was wog dagegen schon eine schwärmerische Schwäche für den Zaren? Träume konnte niemand verbieten, aber wenn Frieda vor die Wahl gestellt würde, der Zar oder ihr Mann Richard, dann wüsste sie, für wen sie sich entscheiden würde.
Leise schloss sie die Stubentür, um ihn nicht zu wecken. Er legte sich gern zur Mittagsruhe, bevor später, wenn die Sonne tiefer sank, die Patienten vor dem Arztzimmer Schlange standen. Der Behandlungsraum lag im rückwärtigen Teil des Hauses.
Frieda betrat die Küche, um die mitgebrachten Lebensmittel zu verstauen. Das Huhn würde sie gleich heute rupfen und in Gemüsebrühe über der offenen Feuerstelle köcheln. In der Abendkühle könnten sie sich die Suppe mit dem frischen Brot schmecken lassen.
Welche verrückten Ideen Gustav mal wieder durch den Kopf schossen, dachte Frieda, während sie ihre Einkäufe aus dem Korb in den Regalen verteilte und das Huhn auf dem Hacktisch ablegte. Wahrscheinlich hatte der Postmeister ihn zum Narren gehalten, und Gustav würde vor Enttäuschung aufstampfen, wenn sie den tatsächlichen Absender erfuhren. Vielleicht ein Brief ihrer Mutter aus Hannover, vielleicht eine Nachricht von einem dankbaren Patienten aus dem Kreml.
Wenige Minuten später herrschte im Flur ein solches Stimmengewirr und Trampeln, dass Richard aufwachte. Kurz darauf stand die Familie vollzählig in der Küche.
Gustav ließ sich gleich an dem Tisch nieder und wollte sich ein Stück vom Brot nehmen. Frieda musste ihm auf die Finger klopfen.
Helena trug noch die Waschschürze, die Hände aufgequollen vom Wasser – der einzige Makel an ihrer ältesten Tochter.
»Wo ist der Wäschekorb?« Frieda schaute sie an.
Helenas Stirn färbte sich rosa. »Oh, wie dumm, den habe ich unten am Ufer vergessen. Ich hole ihn später, sobald wir wissen, was der Zar uns schreibt, ja?«
Frieda stieß die Luft aus. Im Allgemeinen gab es an Helenas Pflichtbewusstsein nichts auszusetzen. Die Schule in Sloboda hatte sie jedenfalls regelmäßig besucht, wenn auch ohne Begeisterung. Nur ihre Sprunghaftigkeit zerrte an Friedas Nerven. Ein Brief des Zaren versprach Abwechslung in ihrem Alltag in der Vorstadt. Da konnte ein Korb mit der gesamten Wäsche der Familie und den Bettlaken schon mal in Vergessenheit geraten.
Mit ihren frischen Wangen und dem taudicken Zopf, den zweifarbigen Augen, dem zu einem Lächeln geschwungenen Mund und ihrer allseits bekannten Vorliebe für Kleiderstoffe in Himmelblau war Helena mit ihren achtzehn Jahren eine junge Frau, nach der sich jeder umdrehte. Sie wusste genau, wie verführerisch sie auf die Kerle wirkte, wenn sie von Herzen lachte – was sie gerne und oft tat. Als fröhlicher und eigensinniger Mittelpunkt unter den jungen Leuten in Sloboda würde sie vermutlich schon bald aus all ihren Verehrern denjenigen wählen, der ihr näherkommen durfte. Aber würde sie dann auch zwischen Schwärmerei und Liebe unterscheiden können? Und würde sie sich ihres Wertes bewusst sein?
Helena erschien ihr noch zu launenhaft für die folgenschwere Entscheidung, mit welchem Mann sie in den Stand der Ehe treten sollte.
Mit dem Sohn des Apothekers vielleicht oder dem besonnenen Johannes, dem Ältesten des Hutmachers. Aber stur wie ein Maulesel, würde sie sich kaum nach dem richten wollen, was die Eltern vorgaben.
Wenn Frieda mit Richard stritt, dann hauptsächlich wegen Helena. Richard traute seiner Ältesten wesentlich mehr zu.
Den schlimmsten Streit hatten sie vor zwei Jahren ausgefochten, während in ihrem Haus ein schwedischer Kriegsgefangener zur Genesung lag. Deutsche Bauern hatten den Mann halbtot vor den Toren der Stadt gefunden und ihn zu Dr. Albrecht geschleppt. Helena hatte täglich bei seiner Pflege geholfen, ihm die Stirn abgetupft und ihn mit Suppe gefüttert. Frieda war in helle Aufregung geraten, weil sie vermutete, dass ihre Tochter das Herz an den Falschen verlor. Mit sechzehn Jahren!
Steen war nach zwei Wochen trotz einer intensiven Kur mit Wasser und Wein und stetig erneuerten Senfumschlägen an seiner Lungenentzündung gestorben. Nächtelang hatte Helena geweint, so dass Frieda schon befürchtete, sie würde niemals über diese Schwärmerei hinwegkommen.
Aber sie hatte sich geirrt.
Nach diesem ersten Schmerz wuchs die Lebensgier in Helena, ihr Bedürfnis, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Noch war ihr Ruf in der Vorstadt der einer geselligen, lebensfrohen jungen Frau, doch die Grenze zur Vergnügungssucht war fließend und Helena zu unbekümmert, um vorauszusehen, wohin sie ihre Launen führen konnten.
»Was ist das hier für ein Brimborium?« Richards Stimme klang noch belegt von dem Nickerchen. Er räusperte sich und wischte sich mit den Handballen über die Augen. Auf seiner Wangenhaut hatte das Kissen ein Muster hinterlassen.
Frieda trat neben ihn, streichelte die Schlaffalten glatt und küsste ihn auf den Mund. »Hast du dich gut ausgeruht, Lieber? Verzeih den Lärm. Gustav glaubt, dass ein Brief vom Zaren kommt.« Sie schmunzelte. »Du kennst ihn ja.«
Gustav sprang auf. »Ich habe mir das nicht ausgedacht! Es stimmt wirklich!«
»Was sollte denn der Zar von uns wollen? Der hat genug mit seinen Eroberungen an der Ostsee zu tun. Da wird er sich kaum an die Arztfamilie aus der Moskauer Vorstadt erinnern und uns einen warmen Gruß schicken«, meldete sich Paula zu Wort. Sie schenkte sich aus einem Krug ein Glas Wasser ein und trank es in kleinen Zügen, während sie entspannt gegen den Tisch lehnte. Vermutlich hatte Gustav sie in der Pfarrbibliothek gefunden, wo sie sich am liebsten aufhielt, wenn sie das Haus verließ.
Obwohl Frieda kaum etwas wichtiger fand als Bildung und Verstand, bekümmerte es sie, dass sich ihre jüngere Tochter am liebsten im Haus verkroch und die Nase in Bücher steckte, die sie sich aus den Regalen der Eltern entlieh. Sosehr sie Paula dafür schätzte, dass sie ihren Kopf nicht nur gebrauchte, um die Haare darauf zu süßen Locken zu drehen, so wenig wollte sie eine Stubenhockerin als Tochter. Eine, die über medizinischen Skizzen und Texten hockte, statt am Flussufer oder in den Gassen des Dorfes mit den anderen Halbwüchsigen herumzutollen. Es gab viele Jugendliche in Sloboda, aber Paula mit ihren vierzehn Jahren schien weder zu ihnen noch zu den jungen Erwachsenen zu gehören.
Frieda wünschte, die Lebenslust und die Wissbegier ihrer beiden Töchter wären gleichmäßiger verteilt. Was die eine zu viel besaß, hatte die andere zu wenig. Aber wann im Leben konnte man es sich schon aussuchen?
Wenn Paula sich an der frischen Luft aufhielt, dann nur in Begleitung ihres Hundes Fidel, der in einem Bretterverschlag hinter dem Haus lebte. Paula hatte ihn vor einem Jahr halbverhungert zu ihnen gebracht und ihn mit Fleischbrocken, die sie sich vom Munde absparte, aufgepäppelt. Fidel dankte es ihr mit tiefer Ergebenheit.
Paula ging den Dingen gern auf den Grund und ließ sich den Verstand nicht von Wunschdenken und Sehnsüchten vernebeln. Aber in diesem Fall lag sie vermutlich falsch. Frieda hielt es für möglich, dass sich der Zar an den deutschen Arzt aus Sloboda erinnerte.
Richard und sie waren bereits verheiratet gewesen und lebten mit den Kindern im hannoverschen Coppenbrügge, als ihr Mann den damals vierundzwanzigjährigen Zaren durch Zufall bei einem befreundeten Zimmermann kennenlernte. Peter Alexejewitsch Romanow war zu dieser Zeit inkognito mit seiner großen Gesandtschaft durch Europa gereist, um sich selbst ein Bild von der westlichen Wissenschaft und Technik zu verschaffen.
Richards Schilderungen seiner medizinischen Studien begeisterten den Zaren. Aufs herzlichste lud er ihn nach Russland ein, doch Richard zögerte zunächst. Am Ende bewirkte Friedas Abenteuerlust mehr noch als alle guten Argumente des Zaren. Sie wurde nicht müde, Richard Tag und Nacht davon zu überzeugen, dass sie die Enge der Heimatstadt verlassen und die Welt sehen mussten.
Geplant hatte der Zar vermutlich, dass sich die Familie im Schatten des Kremls niederließ, aber Richard bevorzugte die behagliche Ausländervorstadt – und in dieser Angelegenheit setzte er sich gegenüber seiner Frau durch. Zu Recht, wie sich herausstellte, als sie in den ersten Wochen die offene Abneigung der Russen mit voller Wucht traf.
Zum Zeichen seiner Gastfreundschaft schenkte ihnen der Zar Ballen von Samt und Zobelfelle, Kostbarkeiten, aus denen Frieda in der dunklen Jahreszeit Wintermäntel und Festkleidung für die Familie schneiderte, die sie sich in der deutschen Heimat nie im Leben hätten leisten können. Richards Gehalt war üppig bemessen, ein Vielfaches dessen, was ihnen in Hannover zur Verfügung gestanden hatte.
Gustav war damals vier, Paula acht, Helena zwölf Jahre alt, und sie folgten den Eltern wie Entenküken auf dem langen beschwerlichen Weg in das fremde Land. Eine Reise ins Unbekannte, aber die Aussicht auf finanzielle Sorglosigkeit für sich und die Kinder war verlockend. Und war es nicht eine Ehre, in den Diensten eines der mächtigsten Männer der Welt zu stehen und von ihm umworben zu werden? Die Entscheidung, nach Russland überzusiedeln, hatten sie letzten Endes nie bereut.
»Da kommt er!« Helena reckte den Hals, um aus dem Fenster schauen zu können.
Der Postmann gehörte zu den wenigen, die Zar Peters Anordnung, die Bärte abzuschneiden, mit Vergnügen nachgekommen waren. So lenkte nichts von seinen gefälligen Gesichtszügen mit den breiten Wangenknochen und den kohlschwarzen Augen ab. Kein Wunder, dass sich Helena beeilte, um diejenige zu sein, die den Brief von ihm entgegennahm, dachte Frieda und seufzte.
Sie starrten aus dem Fenster, beobachteten, wie Helena mädchenhaft die Hüften wiegte und den Kopf neigte, während sie den Brief von dem Boten entgegennahm. Noch während sie einen Blick auf das Siegel warf, schlug sie sich die Hand vor den Mund. Dann flitzte sie wenig grazil ins Haus zurück.
»Das Schreiben ist tatsächlich von Zar Peter!«, sprudelte sie hervor und reichte mit zitternden Fingern den Umschlag ihrem Vater.
Alle drängelten sich um Richard, während er das Schreiben knisternd entfaltete. In der Stille, während sie lasen, hörte man die Bretter der Außenwände knacken. Von draußen drang das Bellen des Hundes zu ihnen, der sich nach Paula und seiner Mittagsmahlzeit sehnte.
Das Schweigen dauerte an, als sich Richard auf den nächsten Stuhl plumpsen ließ. Er stützte die Ellbogen auf den Tisch und fuhr sich mit beiden Händen durch das Gesicht.
Der Zar, gewandt in mehreren Fremdsprachen, schrieb in Deutsch.
Eine stürmische Vorfreude stieg in Frieda auf, Erwartung und Ungläubigkeit zugleich. Sie las von den neu eroberten Gebieten oben an der Ostsee und von seiner Stadt, in die er Handwerker und Wissenschaftler aus ganz Europa einladen wollte, damit sie sich am Werden von St. Petersburg beteiligten. Und wie dringend fähige Mediziner gebraucht wurden. »Er will, dass wir zu ihm an die Newa reisen«, stellte sie schließlich mit tonloser Stimme fest, die nichts von ihrem inneren Aufruhr verriet.
Richard nickte, das Gesicht weiterhin in den Händen geborgen, als durchdränge ihn trotz des Nickerchens eine tiefe Müdigkeit.
Gustav hüpfte wie ein Frosch vom Fenster zur Feuerstelle und wieder zurück. »Ja, ja, ja! Wir reisen zu Zar Peter!« Gustav vergötterte den Regenten. Nicht nur weil er mit ihm die Leidenschaft für die Seefahrt teilte. »Wirst du sein Leibarzt werden?«
Richard stieß ein gequältes Lachen aus. »Unfug. Den hat er sich längst gewählt, und nach allem, was man hört, leistet Blumentrost beste Arbeit. Wusstet ihr, dass er über Skorbut promoviert hat?«
Frieda beobachtete ihren Mann und den Aufruhr in ihm. Als könnte er in diesen Minuten jemanden für das Werk seines berühmten Kollegen begeistern!
»Ein bemerkenswerter Mann, dieser Blumentrost. Er stellt sogar seine eigenen Medikamente her! Kein Wunder, wenn ihm der Zar persönlich die Apothekergärten anlegt. Und wie es aussieht, wächst dem Glücklichen in seinem Sohn ein Nachfolger heran, dem das medizinische Talent praktisch in die Wiege gelegt wurde, und …« Richard unterbrach sich selbst, weil seine Familie unruhig wurde. Sicher nicht über die Verdienste von Blumentrost.
Frieda sah ihn von der Seite an. Setzte ihm die Bitte des Zaren zu? Oder wollte er den Gedanken daran verscheuchen, dass er selbst es zu einem angesehenen Wissenschaftler wie Laurentius Blumentrost hätte bringen können? Doch ihm waren immer die Menschen wichtiger gewesen, die ihn unter Schmerzen um Hilfe baten. Und seine Familie.
»Nein, er will dort an der Ostsee eine Hafenstadt anlegen. Für all die Europäer, die daran mitarbeiten, braucht er Ärzte«, stellte Richard fest. Sein Gesicht wirkte fahl. Auf seiner Stirn standen Falten.
Frieda wusste, wie sehr der Zar der deutschen Ärzteschaft zugetan war. Unter Peters vielfältigen Interessen nahm die Chirurgie einen besonderen Platz ein. Er ließ keine Gelegenheit aus, beim Sezieren von Leichen anwesend zu sein, um sich ein Bild vom Inneren des Menschen zu verschaffen. Es ging das Gerücht, er hätte schon selbst zur Knochensäge gegriffen, um einem Verletzten das Leben zu retten. Stets trage er, so hieß es, zwei Bestecke mit sich: das eine mit mathematischen Werkzeugen wie Zirkel und Maßstab zur Untersuchung von Schiffen; das andere mit chirurgischen Instrumenten wie einem Paar Lanzetten, einem Schnepper zum Aderlass, einem Seziermesser, einer Zange zum Zahnausreißen, einer Schere, einer Sonde, einem Katheter. Seine Vorliebe für die Wundarzneikunst gipfelte darin, dass man es ihm auf seinen Befehl rechtzeitig mitteilen musste, zu welcher Zeit und wo, sei es im Hospital oder in der Privatpraxis, eine ungewöhnliche Operation stattfinden sollte.
In den Behandlungsräumen von Dr. Richard Albrecht war ihm diesbezüglich wenig geboten worden. Friedas Mann besaß zwar Grundkenntnisse in der Chirurgie, aber sein Studium in Leyden hatte ihm vor allem gezeigt, dass seine Stärke in der Zuwendung zu den Kranken lag, nicht im Operieren und Sezieren. Richard vermochte wie kein Zweiter an der Augenfarbe, dem Zungenbelag und dem Geruch des Urins auf Krankheiten zu schließen. Dadurch hatte er sich die Hochachtung des Zaren errungen.
»Nun, dann reist du hin, und wenn die Stadt fertig ist, kommst du zurück«, schlug Helena vor.
Paula zog eine Grimasse. »Wie stellst du dir vor, dass eine Stadt entsteht? Glaubst du, der Zar schnipst mit den Fingern, und zwei Monate später stehen Paläste und Häuser zum Einzug bereit?«
»Du weißt es natürlich mal wieder ganz genau«, gab Helena mit einem Zwinkern zurück.
»Auf jeden Fall besser als du«, erwiderte Paula. »Wenn wir da hinreisen sollen, dann nicht für einen Sommer, sondern für alle Zeit. Meinst du immer noch, dass Vater das übernehmen soll?«
Helena öffnete den Mund für eine Erwiderung, aber Frieda kam ihr zuvor: »Paula hat recht. Der Zar will uns für immer an die Newa holen.«
»Ich frage mich, wie er sich das denkt«, murmelte Richard. »Wir haben uns hier ein Leben aufgebaut. Wir haben ein schönes Haus, Freunde, hier werde ich gebraucht. Ich werde ihm antworten, er soll sich nach anderen Ärzten umsehen. Sicher gibt es Kollegen, die sich darum reißen, im Dunst des Herrschers Großes zu leisten.«
Frieda ließ sich auf dem Stuhl neben ihrem Mann nieder, umklammerte mit beiden Händen seinen Arm. »Liebster, denk nicht nur an uns. Denk an die Kinder. Ich vertraue dem Zaren, er wird eine Weltmetropole erschaffen! Sollten wir nicht daran teilhaben und unseren Kindern eine Zukunft außerhalb der Dorfgrenzen geben?«
»Wenn seine Stadt fertig ist, haben wir immer noch Zeit genug, um dorthin umzusiedeln«, grummelte Richard.
Frieda sog die Luft ein. Sie kannte ihren Mann gut genug. Er wollte keine Veränderung mehr. Das Verlassen ihrer deutschen Heimat hatte ihm mehr zugesetzt als allen anderen Mitgliedern der Familie. Sie erinnerte sich an die ersten Nächte in Russland, in denen sich Richard hin und her gewälzt hatte, von Alpträumen gequält. Sicherheit und Beständigkeit waren für ihn die Säulen seines Lebensglücks. Frieda mit ihrem Wagemut und ihrer Lust an allem Neuen stieß an ihre Grenzen, wenn sie ihren Mann mit ihrem Schwung mitziehen wollte.
Auch in zehn Jahren würde er abwiegeln und letzten Endes ablehnen, Sloboda zu verlassen.
In zehn Jahren wären die Kinder erwachsen und hätten eigene Familien, hier in Sloboda, wo die Grenzen eng waren, während oben an der Ostsee das europäische Leben pulsierte! »In zehn Jahren werden wir zu alt für einen solchen Schritt sein, Richard. Noch sind wir jung genug, um einen Neuanfang zu wagen.«
Richard rieb sich mit der flachen Hand über die Stirn. Gustav trat auf ihn zu. »Vater, bitte, lass uns umziehen. Ich möchte Schiffbauer werden. Wie könnte ich das an der Jausa?«
»Wirst du nicht Schiffbauer, dann wirst du eben Zimmermann. Die werden stets gebraucht«, widersprach sein Vater.
Gustav senkte den Kopf. Paula legte den Arm um ihren jüngeren Bruder. »Und ich möchte studieren.«
Alle im Raum lachten herzlich auf.
Paulas Wangen färbten sich klatschmohnrot. Sie ballte die Hände. »Ich weiß, dass das hier für mich nicht möglich ist! Aber ich habe gehört, dass der Zar von europäischen Universitäten schwärmt. In seiner Stadt wird er vielleicht Institute einrichten, in denen Frauen lernen dürfen.«
Frieda musterte ihre Tochter voller Bewunderung. Sie wünschte ihr, dass sie ihren Traum in die Wirklichkeit umsetzen könnte. Aber ein Studium schien außerhalb des Möglichen zu liegen, und Mitleid schlich sich in ihren Blick.
In Richards Miene lag Stolz auf seine ehrgeizige Tochter, aber seine Angst vor dem Verlust der Heimat wog schwerer. »Paula, mach dir nichts vor«, erwiderte er. »Du kannst hier in Sloboda dem Pastor den Haushalt führen. In den Abendstunden wird er dir sicher gestatten, in seiner Bibliothek zu lesen.«
Paula verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich will mehr, Vater.«
»Und wer soll sich um deinen Hund kümmern?« Richard kniff ein Auge zu. »Meinst du etwa, wir könnten Fidel mitnehmen?«
Paula verlor alle Farbe aus dem Gesicht. »Nicht?«
»Bestimmt nicht«, bestätigte Richard. »Kind, freu dich an dem, was du hast, statt nach den Sternen zu greifen.«
Empörung stieg in Frieda hoch wie eine Stichflamme. Was für eine gemeine Behauptung, und dies nur, weil er Verbündete gegen den Umzug suchte! Paula hing mit all ihrer Liebe an diesem Hund.
Helena näherte sich ihrem Vater von hinten und schlang die Arme um ihn. Sie küsste ihn auf die Wange. »Ich will nicht umsiedeln, Vater. Gerade gestern hat mir Thies Haardenhof eine Rose geschenkt. Ich habe lange darauf gehofft und kann es kaum erwarten, ihn einmal allein zu treffen. Wir wollen nur am Fluss spazieren gehen, aber ich bin sicher, dass er um meine Hand anhalten wird. Ist das nicht fabelhaft?«
Frieda stockte der Atem. Von allen Taugenichtsen in Sloboda galt der Sohn des Schuhmachers als der schlimmste. Er ließ den lieben langen Tag den Herrgott einen guten Mann sein, schaute jedem Rock hinterher und betrank sich ab Mittag bei Anna in der Schenke. Dummerweise hatte das Schicksal ihn mit einer seltenen Attraktivität ausgestattet und einem Charme, dem sich kaum eine entziehen konnte. Im Dorf nannten sie ihn nur den schönen Thies. Die Mädchen rissen sich um seine Aufmerksamkeit.
Richard stieß langsam die Luft aus. Er wusste genau wie sie, dass diese beginnende Liebelei allein Grund genug wäre fortzuziehen, so weit die Füße sie tragen würden.
»Ich verbiete dir, dich mit ihm zu treffen«, erklärte Frieda frostig. »Ein Nichtsnutz, ein Tagedieb, ein Schürzenjäger ist er! Und du willst dich an ihn verschwenden?« Sie musterte ihre Tochter entgeistert.
»Ihr kennt ihn nicht so gut wie ich!«, rief Helena.
»Das möge Gott verhüten, dass du ihn besser kennenlernst als alle anderen«, entgegnete Frieda.
»Was du bloß an diesem Idioten findest«, murmelte Paula.
»Ein Langweiler«, stimmte Gustav ungefragt zu.
Im Nu entflammte in der Küche eine heftige Diskussion über die Vorzüge und Nachteile des schönen Thies, bis Richard ein Machtwort sprach. »Schluss jetzt! Wir …«
Ein Klopfen an der Tür ließ sie alle innehalten. Richard fingerte seine goldene Uhr an der Kette aus der Westentasche und senkte das Kinn auf die Brust, während er die Zeit ablas. »Mit solchem Firlefanz haben wir die Zeit verquasselt! Da kommen schon die Patienten!«
»Gehst du öffnen?« Frieda nickte Helena zu, die sofort losstürmte, um die Besucher einzulassen.
»Du musst mit ihr reden«, flüsterte Richard seiner Frau zu.
Frieda biss sich auf die Unterlippe. »Wenn sie bloß auf mich hören würde.«
In dem Moment erklang es von der Diele: »Du glaubst es nicht, Arina! Der Zar persönlich hat uns geschrieben!«
Ein Lächeln der Erleichterung stahl sich auf Friedas Gesicht.
Helena liebte es, andere Leute mit Neuigkeiten zu beeindrucken, und wenn diese dann auch noch von einer Lichtgestalt wie dem Zaren persönlich kamen, gab es kein Halten mehr für sie. Sie beurteilte die Ereignisse in ihrem Leben zuallererst immer mit ihrem Herzen, und das war wahrlich kein verlässlicher Ratgeber. Beständigkeit war ein Fremdwort in Helenas Gefühlswelt.
Frieda fragte sich manches Mal, wohin Helenas wechselnde Stimmungen sie führen mochten. Bestimmt nicht vor den Traualtar mit dem schönen Thies! Das würde Frieda bis zu ihrem letzten Atemzug zu verhindern wissen.
Aber vielleicht entpuppte sich gerade die Sprunghaftigkeit ihrer ältesten Tochter in diesem speziellen Fall, da es um die Reise an die Newa ging, als Vorteil.
»Was! Wie aufregend!«, antwortete eine junge Frau.
»Das freut mich für euch«, ertönte da eine näselnde Stimme, die Frieda gut kannte.
Gräfin Viktoria Bogdanowitsch rauschte mindestens zweimal im Monat heran, weil sie sich um die siebzehnjährige Komtess Arina sorgte, ein stockdünnes Mädchen mit fast durchscheinender Haut und einem Gesicht, in dem man das Jochbein wie unter Pergament erkennen konnte. Sie schien vor gefüllten Schüsseln zu verhungern.
Anfangs hatte Richard sie noch zur Ader gelassen, aber unter dieser Anwendung nahm ihre Schwäche dermaßen zu, dass sie sich bald kaum noch auf den Beinen halten konnte. Inzwischen konnte er nicht mehr tun, als appetitanregende Kräuter beim Apotheker für sie mischen zu lassen, aus denen sie sich Tee bereitete. Ob sie ihn tatsächlich trank, konnte er nicht kontrollieren. Er vermutete, dass sie es nicht tat, denn im Gegensatz zu ihrer Mutter klagte sie ihm gegenüber nie über ihre Zartheit. Dürr wie ein Ginsterzweig, schien sie vollkommen mit ihrem Körper zufrieden zu sein und kokettierte genau wie Helena mit den Kavalieren.
Bei den zahlreichen Besuchen hatten sich die beiden jungen Frauen angefreundet, unterhielten sich in einem Kauderwelsch aus Deutsch und Russisch. Frieda achtete darauf, dass ihre Kinder die Sprache der neuen Heimat beherrschten. Die meisten Russen jedoch sträubten sich, ein ausländisches Wort zu lernen. Außer Zar Peter.
»Meine Liebe!« Frieda trat mit einem gesellschaftlichen Anlässen vorbehaltenen dünnen Lächeln auf die Gräfin zu. Mit der reich bestickten Kopfbedeckung, dem hoch taillierten Kleid aus gelbem Damast und den lang herabfallenden schmalen Ärmeln war Gräfin Bogdanowitsch der Inbegriff einer eleganten Russin. Sie tauschten Wangenküsse.
Richard hatte sich gleich nach dem Türklopfen in sein Behandlungszimmer verdrückt. Er mochte mit der Gräfin kein privates Wort wechseln. Es reichte ihm schon, dass sie ihn mit ihrem Töchterchen belästigte. Dieser fehlte es an nichts, außer an einer Mutter, die mehr in ihr sah als ein hübsches Lärvchen, das sie gewinnbringend an den Mann zu bringen gedachte und das deswegen drall und kerngesund in die Gesellschaft eingeführt werden sollte.