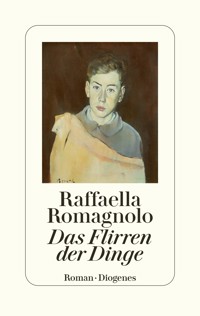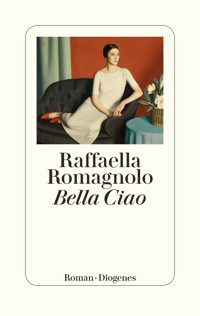21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die zehnjährige Francesca kümmert sich hingebungsvoll um eine Katze, aber mit Menschen spricht sie nicht. Ihre Lehrerin Gilla vermutet hinter dem Schweigen ein Geheimnis. Niemand weiß, was das Kind unter Mussolini und im Krieg erlebt hat. Erst seit Kurzem ist Frieden in Europa, Frieden im piemontesischen Borgo di Dentro. Gilla hofft auf einen Neuanfang für ihren Schützling. Mit den einfachen Mitteln einer Lehrerin versucht sie, Francescas Welt wieder ins Lot zu bringen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Raffaella Romagnolo
Die Sterne ordnen
Roman
Aus dem Italienischen von Maja Pflug
Diogenes
Für die, die unterrichtenFür meine BanknachbarinFür die Schule insgesamt, die mich gerettet hat
SCHULJAHR 1945–46Aufbruch
Die Lehrerin
Die Lehrerin ist zweiundzwanzig Jahre alt und heißt nach einer verstorbenen Tante Virgilia, einer Frau von himmlischer Güte und legendärer Hässlichkeit. Der Name wurde gewählt, damit die Neugeborene schon am Taufbecken lernt, dass man im Leben nicht alles haben kann.
Virgilia also. Obwohl nicht einmal Mutter und Vater sie so nennen. Auch Michele nicht (an Michele will sie nicht denken). Und auch der Direktor der Grundschule von Borgo di Dentro nicht, der doch ihren richtigen Namen kennt. Auch er nennt sie Gilla, wie alle. Signorina Gilla.
»Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind«, sagt er und lässt sie Platz nehmen.
Gilla nickt wortlos. Es ist an ihm zu sprechen, er hat sie einbestellt.
»Ich komme sofort auf den Punkt«, fährt der Mann fort. Er hat eine Adlernase, der eng anliegende Priesterrock glänzt wie Gefieder.
Sie, jedenfalls ein Teil von ihr, hält Borgo di Dentro heute, am 23. Juli 1945, nicht mehr aus, das Dachgeschoss im Vico Luna 13, wo sie wohnt, die in der Sommerhitze glühende Altstadt, die hohen, baufälligen Mietshäuser, die feuchten, dunklen Sträßchen, die ans Mittelalter erinnernden Seidenspinnerinnen, Wahrsagerinnen, Arbeiter, Wäscherinnen, Hufschmiede, Nutten, Taschenräuber und Hühnerdiebe. Gassen, in denen die junge Frau sich vorsichtig bewegt, mit gesenktem Blick, um bestimmte Orte zu meiden, schmerzhaft wie die Stationen der Via crucis. Den »Königspalast«. Die Schusterwerkstatt an der Piazza Fontana. Sie macht nur die allernötigsten Wege. Um den blutigen Hinterhalten des Gedächtnisses zu entgehen.
Und auch den neuen Teil der Stadt erträgt sie nicht mehr, die aristokratischen Häuser mit Schieferdächern und schmiedeeisernen Balkönchen, die Apotheke, in der es nichts gibt, die melancholische Konditorei, das Modegeschäft, das kürzlich wieder eröffnet hat, den verstaubten Kurzwarenladen. Sie hasst die leeren oder nur mit ein bisschen Ramsch bestückten Schaufenster. Den Bäcker, der nur dunkles Brot hat, wenige Laibe. Die Schlange vor dem Ernährungsamt, wo man die Lebensmittelkarten abholt.
»Ich habe sehr schmeichelhafte Informationen über Sie erhalten. Ihr Aufopferungsgeist …«
Das Büro des Pfarrers und Direktors ist eine triste Kammer. An der kahlen Wand hinter dem Mann das Kruzifix und ein Kalender, stehengeblieben im Monat April 1942, dem »XX. Jahr der faschistischen Ära«. In einer Ecke ein Haufen unbrauchbarer Möbel.
»Ich weiß, dass Sie sich ausgezeichnet haben …«
Sie hat Mühe, nicht den Faden zu verlieren. Am liebsten würde sie den alten Kalender vom Nagel reißen und ihn zerfetzen. Die Vergangenheit ist vorbei! Aber es ist nicht nur der Kalender, es ist der Ort, der ihr Unbehagen bereitet. Nicht das Büro: das ganze Gebäude. Als sei sie in einem verseuchten Haus. Deswegen ist sie unruhig. Unter den Sohlen spürt sie Strohhalme, Sägespäne. Ein Nachtlager? Von Tieren? Menschen?
»Die Prüfungen, die Sie überstanden haben …«, fährt er fort.
Warum hat sie eingewilligt, den Mann zu treffen, wenn ein Teil von ihr schon die Koffer gepackt hat? Gilla gehört nicht nach Borgo di Dentro: Sie gehört nach Genua, ist einen Schritt von der Piazza Colombo entfernt geboren, zwischen Via Galata und Via San Vincenzo aufgewachsen, dort ist sie zur Schule gegangen, dort hat sie das Lehrerinnendiplom gemacht, dort hat sie Sturmangriffe von viermotorigen Avro Lancasters voller riesiger, explosiver Eier überlebt. »Haben Sie schon mal den Krater einer Zehn-Tonnen-Bombe gesehen?«, fragt sie.
Der Direktor betrachtet sie schweigend. Falls ihn die Unterbrechung wundert, zeigt er es nicht. Er hebt die zusammengelegten Hände vors Gesicht. Die klauenartigen Finger trommeln und erzeugen dabei ein feines Geräusch. »Unsere kleine Gemeinschaft hat bereitwillig viele Ihrer Mitbürger aufgenommen, als sie auf der Flucht waren«, sagt er dann.
Ein Punkt für ihn, denkt Gilla. Pass auf, würde Michele sagen. Die Priester machen dir Schuldgefühle, sie laden dir die Verantwortung für Sachen auf, für die du nichts kannst, sie manipulieren dich, ziehen dich auf ihre Seite. (An Michele will sie nicht denken. Zu viel Sehnsucht, zu viel Schmerz.)
Bleibt die Tatsache, dass sie nicht an diesen Ort gehört. Und ist damit nicht der Augenblick gekommen, sich auf den Heimweg zu machen wie alle anderen Evakuierten? Was hält sie hier fest? Ihre Eltern haben Borgo di Dentro und das Dachgeschoss im Vico Luna 13 schon vor Monaten verlassen. Die Wohnung in Genua steht noch, die Uhrmacherwerkstatt ihres Vaters ebenfalls. Sie schreiben ihr Postkarten aus der Welt von früher. Der Hafen, die Strandpromenade von Sestri.
Papa hat das Geschäft wieder eröffnet. Wir waren zum Baden am Meer. Wir warten auf Dich.
Manchmal werden sie auch deutlicher.
Der Krieg ist zu Ende, worauf wartest Du noch?
»Und außerdem sind die Nöte, die die Bewohner von Genua ertragen mussten, in gewisser Weise vergleichbar mit denen, die unsere kleine Gemeinschaft betroffen haben«, fängt der Direktor wieder an. »Aber das wissen Sie ja selbst. Und gerade die Bindung, die Sie aufzubauen verstanden haben …«
Die Kammer ist feucht, Gilla schlingt die Arme um den Körper, sie fröstelt.
»… im Grunde geht es nur darum, die Aufgabe zu Ende zu bringen, Signorina Gilla. Auch die Kinder von Borgo di Dentro …«
»Haben das verdient?«, ergänzt sie abrupt. Worte wie Geschosse, die sie nicht zurückhalten konnte. Der Mann zieht ein Blatt unter der ledernen Schreibunterlage hervor, die schwarz ist wie der Tisch, das Kreuz und die Soutane, legt es vor sich und schiebt es ihr mit zwei Fingern hin. Darauf steht:
BORGO DI DENTRO
GRUNDSCHULE
SCHULJAHR 1945–1946
ANTRAG AUF INDIENSTSTELLUNG
Ihr ist, als hörte sie das Geräusch einer Falle, die zuschnappt. Sie möchte aufspringen und ihm, ihm und allen anderen, ins Gesicht schreien: »Der Krieg ist zu Ende!« Doch sie bleibt sitzen und schweigt, lässt ihren Blick schweifen. Die Verwüstung. Die Verwüstung und die ganze Arbeit, die noch zu tun bleibt. Also nimmt sie ruppig das Blatt, füllt es aus und unterschreibt. Allein, mit zusammengepressten Lippen geht sie dann wieder in den glühend heißen Sommer hinaus. Gilla, Gilla, so ist der Beruf der Pfaffen, sagt Michele in ihrem Kopf, und seine Augen lachen.
Das kleine Mädchen
Ende August 1945. Eine trächtige Katze schlüpft durch den Schilfrohrzaun und betritt das Gelände des Waisenhauses. Sie ist zu jung, um zu wissen, dass dort, wo jetzt Weinbergpfähle und Flussröhricht stehen, einmal ein hoher Gitterzaun war. Stangen, Stäbe, Ziernägel, dekorativ gedrehte Leisten und oben Lanzenspitzen, beschlagnahmt von Seiner Exzellenz Cavalier Benito Mussolini. Eisengitter, zu Haubitzen geworden, und Haubitzen, weggefegt wie Blätter vom Wind.
Die Katze läuft rasch, mit wachsamen Sinnen. Grauer Rücken, weißer Bauch. So mager, dass die Schwellung durch den Nachwuchs gar nicht zu ihr zu gehören scheint, sondern in der hochstehenden Sonne wie ein Fremdkörper wirkt, eine glänzende Beule.
Sie meidet den schmalen Weg, erreicht eine Ecke, schleicht unter den großen Fenstern der Schlafsäle eng an der Mauer entlang. Blitzschnell saust sie am Hinterausgang vorbei, den die Nonnen benutzen, um in den Gemüsegarten zu gelangen. Sie wirft keinen Blick in die Zimmerflucht, wo es nach Seife und Schweiß riecht, schon gar nicht heute. Rasch eilt sie weiter mit der Last, die unter ihr baumelt und beinahe die Betonfliesen streift. Noch mehr Fenster, und Türen, die zu Hortensienbeeten hinausgehen, zu den verblühten Rosen, zur majestätischen Zeder, unter der die Mädchen in der heißesten Zeit Schutz suchen dürfen nach dem Stickunterricht und vor dem Nachmittagsgebet.
Hier bleibt die Katze stehen. Sie prüft die Lage, ignoriert Grashüpfer, kleine Würmer. Die Luft riecht nach reifen Feigen, Blütenstaub und Menschen. Dann läuft sie weiter, umrundet das Gebäude, erreicht die Rückseite, den verlassenen Teil, der jetzt im Schatten liegt, zu viel sogar für die Hortensien, die ihn doch lieben, an die Tomaten gar nicht zu denken. Es ist eine ebene Fläche, wo nur Gänseblümchen, Löwenzahn und Brennnesseln gedeihen. Die Katze zögert, beobachtet, schnuppert. In einer Ecke weggeworfener Hausrat, altes Zeug, das niemand mehr benutzt. Sie nähert sich einer rostigen Tonne, klettert kühn auf zwei zerfetzte Reifen, mustert die Stacheln eines Brombeerstrauchs. Eine kleine Brettertüre, abgeschlossen, unten von der Feuchtigkeit zerfressen. Sie schnuppert daran. Abgründe des Nichts, Geruch nach Dunkelheit und Leere. Sie macht sich ganz flach und kriecht untendurch in den Kellerraum.
Das kleine Mädchen hockt im Windschatten, deshalb riecht die Katze es nicht, als sie vorsichtig die Stufen hinunterläuft. Es ist eher ein Verschlag als ein Keller, eng, übel riechend, Wände aus Backstein und vereinzelt Kippfenster, durch die Rechtecke aus grauem Licht hereinfallen. In einem Winkel findet sie einen zerlöcherten, mehrfach geflickten Sack, rau und doch weich, genau richtig. Sie kauert sich nieder. In Wellen überlaufen die ersten Wehen das Fell. Sie schließt halb die Augen. Atmet tief. Blut. Kein Laut.
Unterdessen dreht das kleine Mädchen den Schlüssel und öffnet die Tür. Eine Wolke von Kälte, Feuchtigkeit, Schimmel. Sie braucht ein paar Sekunden, bis ihre Augen sich an das Halbdunkel gewöhnen und sie den Mut findet hineinzugehen.
Die Katze hat keine Möglichkeit zu fliehen, weder vor den Wehen noch vor dem kleinen Mädchen, das näher kommt. Sie bemerkt gerade noch, dass die Kleine sich auf die Fersen hockt. Der Geruch ihrer Fußzehen, die aus den Sandalen hervorschauen, wäre es wert, genauer untersucht zu werden. Aber nicht jetzt.
Das Fell des ersten Katzenbabys ist hell und glitschig. Es leuchtet im Dunkeln. Die Kleine würde Mutter und Kind gern berühren, doch sie traut sich nicht. Das Junge hängt sich sofort an eine Zitze. Die Pfötchen sind fleischfarbene Krallen. Noch nie hat die Kleine etwas Zärtlicheres, Grausameres, Verblüffenderes gesehen.
Im Lauf einer Stunde kommen das zweite, das dritte und das vierte Junge zur Welt. Dasselbe Grau, dasselbe Weiß wie die Mutter. Die Kleine geht zurück zur Tür und schließt von innen ab. Klack, schnappt das Schloss zu. »Das ist unser Geheimnis«, sagt sie.
Die Katze lässt sich am Hals kraulen. Am nächsten Morgen kriecht sie unter der Brettertüre durch ins Freie, um auf Futterjagd zu gehen. Zwanzig Tage lang pendelt sie zwischen drinnen und draußen, dann verschwindet sie. Das kleine Mädchen fürchtet, dass sie gefangen worden ist. Katzenfleisch schmeckt so ähnlich wie das von Kaninchen, bloß ein bisschen süßer. Nur das vierte Junge überlebt.
Das mechanische Planetarium
Ende August 1945. Während das kleine Mädchen der trächtigen Katze in den Verschlag folgt, trifft der Direktor in der Schule die sieben Lehrer und dreizehn Lehrerinnen, die sich bereit erklärt haben, im Schuljahr 1945–46 ihren Dienst anzutreten.
»Achtzehn Monate Besatzung, und das ist das Ergebnis!«, beginnt er. Das Grüppchen erwartet eine große Rede, doch er beschränkt sich darauf, voranzugehen. Die ganze Runde, Klassenzimmer für Klassenzimmer, Abstellraum für Abstellraum, Toiletten und Souterrain. Vor der großen Putzaktion sollen sich alle im Klaren sein über die verschmierten Wände, die verdreckten Ecken, den Gestank, die rücksichtslos aufeinandergetürmten Bänke, die herausgerissenen Dielen, die in irgendeinem Ofen gelandeten Fußschemel. »Kennt jemand einen hilfsbereiten Schreiner?«
Gilla wird blass. Der erbärmliche Zustand der Turnhalle im Untergeschoss nimmt ihr den Atem. Die Kletterwand. Zeichen am Holz, die wie Schreie wirken. Stricke? Ketten? Als sie an den Sprossen vorbeigeht, wendet sie das Gesicht ab. Erst auf dem Rückweg nach oben kann sie aufatmen.
»Alles ist weg«, predigt der Direktor unterdessen, »alles!« Papier, Tinte, Abakusse, Schreibfedern, Lineale, Winkelmesser, Zirkel, die Schachteln mit den Gewichten, die Holzmodelle des Kubus, der Kugel, der Pyramide. »Was wollten die Deutschen nur mit unseren Abc-Fibeln? Die Nazis haben hier ihr Militärhospital eingerichtet, das wissen Sie, oder? Aber was sollten die Verwundeten, die Krankenpfleger, die Offiziere mit unseren Sachen anfangen?« Die topografischen Karten sind völlig verschmiert. Die Landkarten ebenso. Benutzbar sind höchstens zwei oder drei. Für zwanzig Klassen.
Untröstlich zieht die Prozession weiter, die Lehrer und Lehrerinnen senken bei den Klagen des Direktors den Kopf. Gilla beschließt die Reihe, ihr Blick wandert über die Verwüstung. Scherben, gesplittertes Glas, ein Bücherriemen, schmutzige Binden, ein Spitzer. Doch da, an ein an zwei Stellen eingerissenes Drahtgitter gelehnt, glitzert etwas. Neugierig beugt Gilla sich hinunter und entdeckt, dass es sich um ein mechanisches Planetarium handelt, ein raffiniertes Modell des Sonnensystems aus Metall und Pappmaschee, die Kurbel für die Bewegung der Drehachse, die mit Temperafarben bemalten Planeten, der Sockel mit den goldverzierten Sternzeichen. Sie verengt die Augen zu Schlitzen, während die Stimme des Direktors sich entfernt. Ist das schön, denkt sie. Wenn es bloß nicht so angeschlagen wäre, die Ärmchen verbogen, nutzlos. Rasch läuft sie an den anderen vorbei nach vorne. »Darf ich das mitnehmen?«, fragt sie.
Zurück in der Dachwohnung im Vico Luna stellt sie es auf den Küchentisch. Die Sterne ordnen. Sie blättert in dem naturwissenschaftlichen Buch des Lehrerbildungsinstituts, bis sie die Doppelseite findet, die dem Universum gewidmet ist. Merkur und Mars scheinen in Ordnung zu sein. Venus fehlt. Die Ärmchen von Uranus und Pluto ähneln unnatürlich verrenkten Gliedmaßen. Bei Pluto fehlt auch die Stütze, und Gilla folgert daraus, dass das Modell vor der Entdeckung des kleinsten Planeten des Sonnensystems gebaut wurde. Saturn ist da, aber er hat seine Ringe verloren. Das Ärmchen des Jupiters ist an zwei Stellen geknickt, sodass die metallische Bahn des größten Planeten die der anderen behindert. Der Mond ist wer weiß wohin gerollt. Die Erde ist in zwei Teile gespalten.
Zum Spaß die Umlaufbahn des Jupiters verbiegen, denkt sie. Nacheinander die Ringe des Saturns abstreifen. Und gleichzeitig im Keller Finger und Zehen zertrümmern, Knochen brechen, Brustwarzen quetschen.
Sie hält die Gedanken im Zaum, indem sie den Mechanismus studiert, sich das Innere vorstellt. Sie liebt es, sich in Getriebe zu versenken. Das hat sie vom Vater, dem Uhrmacher, gelernt. Auch sie hat überaus geschickte Hände. Ein Lichtblick. Doch die Vergangenheit umweht sie überall.
Erster Schultag
1
Der September zieht sich hin, in den Geschäften gibt es immer noch fast nichts zu kaufen, immer noch gelten die Lebensmittelkarten. Der Unterricht hätte am 1. Oktober beginnen sollen, das wäre die Regel, aber das Ministerium verschiebt den Start um zwei Wochen. Das erste Schuljahr ohne Krieg kommt mühsam in Gang.
Gilla verlässt das Haus nur, um etwas zu essen zu kaufen. Sie studiert die neuen ministerialen Lehrpläne für die Grundschule des befreiten Italiens und macht sich Notizen in ihr Heft, während sie ein Stück Brot knabbert oder eine halbe Tasse Milch hinunterkippt. Sie deckt den Tisch nicht wie früher, als sie das Dachgeschoss noch mit den Eltern teilte, nie isst sie richtig zu Mittag oder zu Abend. Die meiste Zeit verbringt sie allein, ihre einzige Gesellschaft sind die Stimmen in ihrem Kopf, die Stimmen derjenigen, die sie verloren hat oder die weit weg sind, oder Stimmen aus dem Radio, aber nicht so oft, weil sie vor allem Musik hört. Selten trifft sie ihre Freundin Rosa Maria, die nach dem Krieg außerhalb eine Stelle als Weberin in einer Fabrik gefunden hat und fast nie zu Hause ist. In jedem Fall sind es kurze Begegnungen, eine flüchtige halbe Stunde, in der vor allem Rosa Maria spricht, doch Gilla ist es recht, denn sie fühlt, dass sie keine langen, intimen Gespräche aushalten könnte. Sie hat auch keine Lust, in den Zug zu steigen, nach Genua zu fahren und den Tag mit ihrer Familie zu verbringen. Nur abends, wenn sie am Modell des Sonnensystems arbeitet, wird ihr leicht ums Herz, doch schon bald drängt eine unüberwindliche Müdigkeit sie ins Bett, und in der Nacht hat sie beängstigende Träume. Ein Souterrain voller Kinder, dann voller Verwundeter, Michele, der ihr mit einer Spritze in der Hand entgegenkommt, und sie wacht auf. Berge von Schutt, Staub, Gestank, gellende Stimmen unter den Trümmerhaufen, und sie wacht auf. Ein Wald, dunkel wie in der Nacht, obwohl es Tag ist, sie hinkt bergauf, weiß, dass sie spät dran ist, schaut auf die Uhr an ihrem Handgelenk, es ist eine Männeruhr, sie steht, sie gehört Michele. »Wirf sie weg, Gilla«, sagt ihr Vater, und sie wacht auf, und es fällt ihr schwer, wieder einzuschlafen.
Als sie am Morgen des ersten Schultags steif vor Kälte aufsteht, ist es noch dunkel. Der Herbst schreitet ohne Erbarmen voran. Sie denkt nicht an die rötliche Maserung der Rebstöcke, an die Explosion von Gelb und Orange der Kakis in den Höfen, an den fleischigen Geruch von umgegrabener Erde und auch nicht an den süßen, intensiven Duft nach Rauch und gerösteten Kastanien. Solche Sachen nimmt sie nicht mehr wahr, als hätte sie die Fähigkeit dazu verloren. Die Energie. Es kostet sie schon so viel Kraft, die quälenden Bilder zu bekämpfen, die sie nachts heimsuchen.
Aber jetzt los! Morgenrock, Ofen, die Scheite anfachen. Die Toilette im Treppenhaus. Das Wasser anwärmen. Sich Gesicht, Hals, Ohren und Achseln waschen. Frühstück mit der übrigen Milch vom Vorabend, den Blick fest auf das kleine Modell des Sonnensystems gerichtet, das gut die Hälfte des Tisches einnimmt. Rundherum Beilagscheiben, Schrauben, Klebstoff, eine Rolle Draht. Eine Riesenunordnung, aber was macht das schon, wenn sie hier allein lebt? Sie ist niemandem Rechenschaft schuldig. Der letzte Schluck Milch. Nicht innehalten, nicht zögern. Die Tasse abspülen. Den Behälter des Eisens mit Glut füllen, auf der freien Seite des Tisches die Bluse bügeln, dann das graue Kostüm ausbürsten, die Schuhe polieren. Die Tasche packen mit dem, was sie in den letzten Tagen in der Gegend auftreiben konnte. Sieben Bleistifte, ein Bündel Löschpapier, eine fast volle Schachtel Kreiden, fünf Hefte von der Fürsorge, mit schwarzem Einband und rotem Farbschnitt.
Auftreiben: Sie hat den Eindruck, nichts anderes getan zu haben, seit sie vor beinahe drei Jahren in Borgo di Dentro angekommen ist, mit den Eltern evakuiert. Reis, Butter, Käse, Tütchen mit echtem Kaffee. Sie versteckte die paar Lebensmittel im Korb ihres Fahrrads unter einem Stapel Bücher. Wenn die Wehrmachtssoldaten beschlossen, sie zu kontrollieren, dachten sie, Gilla wäre auf dem Schwarzmarkt tätig. Sie lachten, beschlagnahmten die Sachen und schauten nicht zwischen den Seiten nach. An chiffrierte Botschaften dachten sie nicht. Dummköpfe! Zum Heulen, das gute Essen herzugeben, das die in den Bergen rund um den Ort versteckten Partisanen so dringend gebraucht hätten. Aber auch zum Lachen, dass die Soldaten so blöd waren. Manchmal reichte es schon, ein Knie zu entblößen. Solche Idioten. Einen Knopf aufzumachen, zuzulassen, dass sich der Rock hob. Aber schade um Reis und Butter, die nicht leicht aufzutreiben waren. Es fehlte an allem.
Wie jetzt, denkt Gilla. Sie schnauft hörbar und stellt die Tasche neben die Schuhe. Legt noch vier Taschentücher und einen Apfel dazu. Wer nie in einer Grundschulklasse war, kann sich nicht vorstellen, welche Wunder ein Apfel im rechten Augenblick wirken kann. Sie hört die Glocken. Eilig knöpft sie den Mantel zu und greift nach der Tasche. Blick zum Spiegelbild in der Vitrine. Hochgesteckte Haare, ernstes Gesicht. Sie erkennt sich nicht wieder. Logisch, denkt sie.
Sie kommt zu früh. Geht in das der 5D zugewiesene Klassenzimmer, stellt die Tasche auf das Podest neben das Pult und hängt ihren Mantel an einen Nagel in der Wand dahinter, leer bis auf das Kruzifix. Keine Landkarte, kein Bild des Königs.
Sie sieht sich um. Auch die anderen Wände sind kahl. Durch die großen Fenster überschwemmt das frühe Licht nicht vergipste Risse, mit der Messerspitze eingeritzte Zeichen, schwer zu deutende Flecken. Wein? Oder Schlimmeres? Wer hier frisch gestrichen hat, war nicht besonders sorgfältig. Oder die Mittel waren unzulänglich. Sie fasst an die Heizkörper. Kalt. Sie überprüft, ob die Tafel sauber ist, die Kreiden und der Schwamm ordentlich bereitliegen. Es ist wichtig, die Pannen vorherzusehen, die Überraschungen gering zu halten.
Sie geht zwischen den Bänken hindurch. Zwölf unförmige Dinger aus glänzendem Holz, schwarze Ablagen zum Aufklappen. Schwierig, sich hinzusetzen, kompliziert, sich zu bewegen, sich nach hinten oder zur Seite zu drehen, aufzustehen. Käfig-Bänke, Bänke wie Rettungsboote auf stürmischen Ozeanen. Sie zählt die Sitzplätze und vergleicht sie mit den dreiundzwanzig Namen im Register. Jede Bank hat zwei Plätze, ein Platz ist übrig. Jemand wird auf hoher See allein bleiben. Wachsen bedeutet schließlich auch, sich selbst zu genügen. Jede Ablage hat in der Mitte ein Loch. In jedem Loch ein Tintenfass. Mit Tinte. Gut, denkt die Lehrerin Gilla. Jedes mögliche Hindernis vorhersehen. Estote parati, seid bereit.
Auch wenn es nicht stimmt, betrachtet sie diesen als ihren ersten Tag als Lehrerin. Unterrichten heißt nicht erklären, diktieren, korrigieren, Nasen putzen, Verletzungen verarzten, Chöre dirigieren, Knoten entwirren, ausschimpfen, bestrafen. Unterrichten heißt, all das jeden Tag tun, denkt die Lehrerin Gilla. Die in den ersten Kriegsjahren in Genua gemachte Erfahrung zählt sie nicht mit, weil es ihrer Ansicht nach keine richtige Schule war. Improvisierter Unterricht, wackelige Stundenpläne, mehr ausgefallene als reguläre Schultage. Angstverzerrte Gesichter, geweitete Augen wegen der nächtlichen Bombenangriffe, Kleine wie Große zum Umfallen müde. Jungen und Mädchen, die von einem Tag zum andern spurlos verschwanden. Andere, die schmächtig und erschrocken erschienen, um Prüfungen abzulegen, die nur noch eine Formalität darstellten. Ausreichend. Bestanden. Die Schülerin zeigt … Auch wenn die Schülerin, hungrig und ohne die geringste Ahnung, bloß zeigte, dass sie anwesend war.
Jetzt dagegen beginnt die richtige Schule, denkt die Lehrerin Gilla. Dreiundzwanzig kleine Mädchen, die sie nicht kennt. Sie kehrt zum Pult zurück. Ihre Schritte hallen im leeren Raum. Sie zieht ihr Heft aus der Tasche. Überfliegt die Notizen. Sechs, die die Klasse wiederholen. Drei kommen aus der Altstadt, essen in der Schule zu Mittag, bekommen nachmittags im Hort einen Imbiss, Frühstück und Abendessen weiß man nicht. Vier wohnen in der Neustadt. Die, vermutet die Lehrerin Gilla, haben makellose Hefte, ordentliche Bücher, eine elegante Schrift und Zöpfe mit Schleifen. Zwölf stammen aus der Peripherie, also vom Land. Drei sind Halbwaisen von Mutterseite, sechs von Vaterseite. Zwei sind brustkrank. Über vier konnte der Direktor keine Auskunft geben. Müsste sie wetten, wer in der Bank allein bleibt, würde die Lehrerin Gilla auf ein Mädchen vom Land tippen.
Das Pult hat zwei Schubladen. Sie öffnet die erste. Leer. Sie legt die Kreiden, die Hefte und den Apfel hinein. Die Minuten eilen dahin, das Herz beschleunigt: Der erste Tag ist ein großer Schrecken. Sie stellt sich die in einer Reihe stehenden Schülerinnen vor. Schwarzer Schulkittel, weißer Kragen, blaue Schleife. Ein unbekanntes, unvorhersehbares Heer, und das Schuljahr, das heute beginnt, das erste seit Kriegsende, kommt auf sie zu wie ein rasender Zug. Erstes Trimester, Weihnachten, zweites Trimester, Ostern, drittes Trimester, Sommer, Prüfungen, schriftlich, mündlich, Beurteilungen, Grundschulabschlusszeugnisse. Das Übermaß dessen, was alles getan werden muss, nimmt ihr den Atem. Es muss gut gemacht werden. Italienisch, Arithmetik, Geschichte, Erdkunde, Schönschrift, Singen, Religion. Zuschneiden, Nähen, Sticken und Stopfen. Laufen, Geräteturnen, Freiübungen. Sie massiert ihre Augenlider, dann schaut sie in die zweite Schublade. Darin liegt ein zwei Spannen langer Rohrstock, der Griff abgenutzt, die Spitze dünn und biegsam. Sie schiebt sie wieder zu. Zieht erneut ihren Mantel an, nimmt die Tasche und macht sich auf zum Eingang, um die dreiundzwanzig kleinen Mädchen in Empfang zu nehmen, die der 5D zugeteilt sind.
Erster Schultag
2
Die Kleine ist zehn Jahre alt, und ihr Name ist ein nicht unerheblicher Teil des Problems. Am Morgen des ersten Schultags trägt sie einen zweireihig geknöpften eisengrauen Mantel, der zwei Nummern zu groß ist. Die rechte Tasche ist ausgebeult und feucht umrandet. Sie zieht ein Taschentuch heraus, geht in die Hocke und breitet es aus.
»Schau, was ich dir mitgebracht habe«, sagt sie. Der Keller dämpft die Geräusche, als spräche man in ein Kissen. »Na komm schon, schau mal nach.«
Licht? Spärlich. Staubig. Es fällt durch ein Fensterchen herein, dessen Scheibe unglaublicherweise noch ganz ist und schmutzig.
»Bist du gar nicht neugierig?«
Das Kätzchen, das als einziges überlebt hat, ist kaum älter als sechs Wochen. Es lugt hinter einer löchrigen Zinkwanne hervor. Mit zuckendem Schwanz kommt es näher. Es würde ohne Weiteres in die Manteltasche passen, anstelle des Taschentuchs, oder in die ausgestreckte Hand, wo jetzt ein Klümpchen Weißbrot prangt, das aussieht wie ein kleiner Schwamm.
»Das ist für dich«, sagt die Kleine. Sie nimmt ein Bröckchen und hält es dem Kätzchen hin. Einen Namen hat es nicht. Die Kleine will ihm keinen geben. Namen sind ihrer Meinung nach eine sehr komplizierte Angelegenheit.
»Los, friss, heute hab ich es eilig.« Der Mantelsaum schleift über den Boden aus gestampfter Erde. Das Kätzchen schnuppert und zieht sich wieder zurück.
»Was sind das für Mätzchen?«
Die Dunkelheit erschreckt sie nicht mehr so wie beim ersten Mal, und auch der dumpfe Geruch nach Schimmel nicht. Sie hat sich daran gewöhnt. Und nicht nur daran. Auch an die täglichen Andachten, mindestens drei, an Strafen und nächtliche Geräusche.
»Du MUSST fressen«, drängt die Kleine.
Sie spürt die Feuchtigkeit auf ihrer Handfläche. Das Taschentuch ist nasser, als sie dachte. Sie beschließt, es vor dem Abend heimlich zu waschen und zwischen dem Bettrost und der Matratze auszubreiten, dann ist es am nächsten Morgen trocken und gebügelt, und niemand merkt etwas. Sie lächelt ein wenig. Der abenteuerliche Teil der Geschichte missfällt ihr nicht.
»Fressen oder gefressen werden!«, mahnt sie.
Das Kätzchen fixiert sie, zwei Lichtkügelchen im Halbdunkel.
Es hat sie eine Menge Entschlossenheit gekostet, sich diesen Riesenhappen zu besorgen. Man beobachtet sie ständig. So kommt es ihr jedenfalls vor. Unglaublich, dass sie es trotzdem geschafft hat. Sie hat gefrühstückt wie jeden Morgen, mit Blick auf den Teller und im Mund einen Bissen des üblichen Weißbrötchens (ihr alleiniges Privileg, die anderen achten nicht mehr darauf). Einen schönen, großen Bissen. Kauen, kauen, kauen. Dann noch ein Bissen. Weiterkauen. Nicht runterschlucken. Warten. Wieder ein Bissen. Kauen, kauen. Eine Ewigkeit. Bis eine der Kleinsten ein Glas umgestoßen und die Nonne aufgeschrien hat. Alle haben sich nach dem Lärm umgewandt, das hat sie ausgenutzt, um den Brotbrei in ihr Taschentuch zu spucken.
»Carpe diem! Das ist Latein und bedeutet ›Nutze den Augenblick‹.«
Natürlich hat sie jetzt Hunger. Unmöglich, sich an den Hunger zu gewöhnen. Sie beißt ein Stückchen von dem schwammigen Brot ab und schluckt es. Was übrig bleibt, scheint ihr immer noch ausreichend für so ein kleines Kätzchen. »Jetzt mach endlich.«
Das Tier reagiert nicht. Eine Wanze mit bräunlichem Schild stößt gegen die Zinkwanne, macht ein schrilles Geräusch, das Kätzchen beobachtet sie gebannt.
»Puer, Knabe. Puella, Mädchen. Ich hab es nicht vergessen. Ich übe im Kopf.«
Die Wanze landet auf dem Metallrand und verstummt.
»Amo, amas, amavi, amatum, amare.«
Die Kleine legt das Taschentuch mit dem Brotbrei auf den Boden und setzt sich, den Rücken an die Mauer gelehnt, die Knie angezogen. Die Wanze beginnt wieder zu tanzen.
»Das Ave Maria Gratia Plena kann ich auswendig. Wenn du willst, sag ich es dir auf.«
Das Kätzchen verliert das Insekt aus den Augen. Es setzt sich auf die Hinterpfoten, legt den Schwanz um sich, leckt sich die Brust. Drei-, viermal fährt es langsam und voll Eifer mit der Zunge übers Fell, dann wird es abgelenkt und klettert am Ärmel des Mantels hoch, die Krallen wie Widerhaken.
»Aua!«
Es steigt auf die Schulter und krallt sich in den Haaren fest, die zu einer geflochtenen Schnecke aufgesteckt sind.
»Du spinnst wohl!«
Es spaziert den anderen Arm hinunter und läuft zu einer Tonscherbe mit zwei Finger hoch Wasser.
»Hast du Durst?«
Acqua ohne c, denkt die Kleine. Aqua aquae, Substantiv der ersten Deklination. Sie lehnt den Hinterkopf an die Mauer und schließt die Augen. In der gewohnten Reihenfolge geht sie die Erinnerungen durch, Zimmer für Zimmer. Das erste: eigelbe Tapete, pfirsichfarbene Vorhänge, Schrank aus Wurzelholz, Messinggriffe, Kommode mit vier Schubladen und geflammter Marmorplatte. Auf der Platte Granatohrringe im cremefarbenen Stoffschächtelchen, Schildpattkamm, Bürste, Violetta di Parma. Dann das zweite, ihres: Tagesdecke mit Fransen, Fenster zur Gasse, Schreibtisch, Lampe mit bordeauxrotem Schirm, Pinocchio, Herz, Die Tiger von Mompracem, die alte Puppe, der ein Auge fehlt. Dann das dritte: geblümte Tischdecke, gesäumt mit Lochstickerei, die Hohlräume so groß wie die Spitze ihres Zeigefingers, wie gemacht, um ihn hineinzubohren. Bücher mit Rücken in allen Schattierungen von Grün und Braun. Reliefzeichnungen. Porzellanservice, Espressotässchen, Untertassen, Zuckerdose, der Deckel mit einem Griff in Form von …?
Sie hebt den Kopf, öffnet die Augen. Sie ist unsicher. In Form von einer Eichel? Oder waren es zwei aneinandergelehnte Eicheln? Waren es überhaupt Eicheln? Es gelingt ihr nicht mehr, die Zuckerdose vor sich zu sehen. Unwillkürlich schluchzt sie. Der traurige Teil der Geschichte. Das Kätzchen dreht sich um und sieht sie an. Sie streckt sich zu der Tonscherbe hin und schöpft etwas Wasser in die hohle Hand. Es trinkt, spritzt ringsum alles nass.
»Morgen bringe ich dir frisches mit«, sagt sie, während das Wasser durch ihre Finger rinnt. Genau so, denkt sie, machen es die Dinge, wenn sie verschwinden, wenn sie sich entscheiden, sie zu verlassen, obwohl sie alle Anstrengungen unternimmt, um sie in Erinnerung zu behalten: Tropfen für Tropfen. An diesem Vormittag der Deckel der Porzellanzuckerdose.
»Genug jetzt mit dem Wasser, du musst fressen«, sagt sie und zupft wieder ein Bröckchen vom Brot ab. Das Kätzchen stupst es mit der Schnauze an. Mit der freien Hand streichelt sie ihm die seidenweichen Ohren. »So ist’s fein.«
Das Zuschnappen des kleinen Kiefers, das leise Schmatzen. Dann läuten die Glocken.
»Ich muss jetzt los.«
Die Kleine legt den Rest des Brots neben das Wasserschüsselchen, steckt das Taschentuch ein und steht auf.
»Es ist nichts dabei, wenn ich in die Schule gehe. Es ist nicht gefährlich. Glaube ich.«
(Sie, nur sie. Die anderen bleiben im Waisenhaus.)
Sie kommt an einem Haufen Hausrat vorbei, bedeckt von jahrzehntealtem Staub, weicht einer Schubkarre aus, an der das Rad fehlt, huscht die Wand entlang bis zu der Treppe, die zur Tür führt, dreht sich prüfend um. Das Kätzchen scheint unentschieden, ob es fressen oder einer Taubenfeder hinterherjagen soll.
»Morgen komme ich wieder. Ich lass dich nicht allein.«
Sie schlüpft hinaus, schließt mit dem Schlüssel ab, den sie um den Hals trägt. Vor dem Eingang häuft sie das Zeug auf, das ihn tarnen soll: zuerst ein Brett, um den von der Feuchtigkeit morschen unteren Teil der Tür abzudichten, dann zwei aufgeschlitzte Reifen, eine verrostete Tonne, die Ranke eines Brombeerstrauchs. Sie sticht sich.
Die Kleine kann es nicht wissen, aber die Glocke hat längst geläutet, während sie an der Hand der Nonne geht. »Achte genau auf den Weg. Siehst du die Linde da? Siehst du die Piazza?«, sagt die Frau. »Präg’s dir ein. Morgen gehst du allein hin.« Das Schulgebäude ist nur zwei Schritte vom Waisenhaus entfernt, und sie, sagt die Frau, ist »eine Signorinetta«.
Sie heißt Giuliana – Suor Giuliana –, aber ihr wahrer Name ist Giacinta. Das hat die Kleine entdeckt, als sie zufällig ein Gespräch zwischen Giuliana/Giacinta und der Mutter Oberin mithörte. Seitdem fragt sie sich, was daran falsch ist, Giacinta zu heißen. Und ob auch die anderen Nonnen gezwungen waren, ihren Namen abzulegen.
Suor Giuliana geht schleppend, denn sie ist alt, wenn auch nicht so alt, wie die Kleine denkt. Für sie haben das fortgeschrittene Alter, die asketische Magerkeit, die papierne Haut und der von der Guimpe umschlossene welke Hals etwas Uraltes und Tröstliches, wie der Schatten eines tausendjährigen Baums. Ein Eindruck von Milde, dank dem Suor Giuliana ihr von Anfang an keine Angst gemacht hat wie die anderen. Suor Lucia, die einen in den Arm kneift. Suor Francesca, die nach Knoblauch stinkt und herumschreit. Suor Caterina, die wegen nichts zu weinen anfängt, und mehr als alle anderen Madre Ferrari, die Oberin mit ihrem mörderischen Schweigen. Der Ranzen stößt derweil gegen ihre knochigen Schulterblätter. Die Kleine denkt, dass sie die Riemen enger schnallen muss. Der Ranzen ist noch so ein Privileg, genau wie zur Schule zu gehen.
»Von Montag bis Samstag«, sagt Suor Giuliana. Ganz klar ist der Kleinen dieses Privileg nicht, da sie keine Ahnung hat, wie eine echte Schule eigentlich aussieht, also von innen, oder wie sie funktioniert, und so malt sie es sich aus: Übungen im Hof mit Reifen und Keulen. Im Chor singen. Maramao perché sei morto, Il pinguino innamorato, Giovinezza. Sachen, die man ihr erzählt hat.
Die richtige Treppe ist die rechts, darüber steht »Mädchenabteilung«, und der Eingang oben ist weit offen. Das Maul des Riesenhais von Pinocchio. Der Flur – der gluckernde Bauch des Seeungeheuers – kommt ihr unendlich lang und unendlich hoch vor, erstaunlich: der Fußboden aus farbigen sechseckigen Kacheln, die Reihe geschlossener Türen, die strengen Schilder darüber, die Geräusche, die sich bei jedem Schritt unentwirrbar vermischen. Schreie, Flüstern, Gelächter, Gejammer, trockene Schläge. Sie möchte sich gern an die Mauer lehnen, zwischen den an Kleiderhaken aufgehängten Jacken verschwinden, doch Suor Giuliana hinkt weiter den Gang entlang und strebt direkt auf die düstere Kammer des Direktors zu. Er ist ein Priester, und das hat die Kleine nun wirklich nicht erwartet.
Während die Erwachsenen sich etwas abseits unterhalten, mustert sie die kahlen Wände, sieht die Spuren von Schränken, Bücherregalen, Bildern, die wer weiß wo abgeblieben sind. Hinter dem großen, dunklen Tisch hängen ein schwarzes Kruzifix und ein Wandbord, das neu zu sein scheint, das Holz poliert, und darauf mehrere ausgestopfte Vögel, jeder mit einem Etikett und dem wissenschaftlichen Namen. Drei davon kann sie sich merken, bevor sich die Erwachsenen wieder ihr zuwenden; Falco tinnunculus, Coloeus monedula, Sylvia atricapilla.
»Gefallen sie dir?«, fragt der Direktor plötzlich. Eine schrille Stimme, fast ein Trillern. »Sie sind meine Leidenschaft. Hast du auch eine Leidenschaft?« Die Kleine antwortet nicht. Sie weiß nicht, ob die Vögel ihr gefallen oder sie anekeln. »Setz dich.« Er schiebt einen Stuhl an den Tisch. Dann schreibt er etwas auf ein kariertes Blatt und schiebt es ihr zusammen mit dem Federhalter hin.
Die Kleine erstarrt. Der Mann hinter ihr macht sie befangen. Ihre Hände beginnen zu schwitzen. Sie zieht die Schultern hoch und betrachtet das Blatt. Eine Addition mit Kommazahlen und eine Multiplikation mit zweistelligen Zahlen. Sie löst die Aufgaben rasch, will es hinter sich bringen, will heraus aus diesem unerwarteten, lästigen Engpass, den sie an diesem Vormittag offenbar passieren muss.
»Nun Geometrie. Schreib: Aufgabe. Absatz. Berechne.«
Sie hat den Eindruck, dass der grimmige Blick des Direktors ihre Finger in Brand steckt. Sie säubert die Feder mit Löschpapier, legt sie kurz ab, trocknet ihre Hände am Revers des Mantels und schreibt dann weiter.
»Also: Berechne die Fläche eines quadratischen Felds, dessen Seiten 42 Meter messen. Los, mach schon.«
Sie atmet tief durch, zählt die Karos auf dem Blatt, kaut an ihrer Unterlippe und zeichnet ein exaktes Quadrat. Neben eine der Seiten schreibt sie 42 m, beginnt eine neue Zeile und schreibt in die Mitte Vorgehensweise, in die nächste Zeile setzt sie die Aufgabe 42×42, darunter schreibt sie Ergebnis und darunter 1764 Quadratmeter.
Suor Giuliana sieht den Direktor an, als wollte sie sagen: »Hab ich’s Ihnen nicht gesagt?«
Auch beim Diktat, bestehend aus sechzehn Wörtern, zwei Kommas und einem Fragezeichen, macht die Kleine keine Fehler. Die Schrift ist ordentlich und angenehm.
Der Direktor sieht die Nonne an, dann sie. Er schreibt zwei Zeilen auf ein Blatt, faltet es zusammen und reicht es ihr. »Das gibst du Maestra Gilla, deiner Lehrerin«, sagt er. Suor Giuliana ermutigt sie mit Blicken. Der Direktor lässt eine Schuldienerin rufen, die sie in die Klasse begleiten soll.
Der Zettel des Direktors in ihrer Hand hat etwas Lebendiges, Unangenehmes, als hielte sie ein Insekt an den Flügeln. Die Kleine würde gern wissen, was darauf geschrieben steht, bevor sie ihn Maestra Gilla aushändigt, traut sich aber nicht, nachzuschauen. Also hält sie ihn etwas von sich weg, während sie hinter der Schuldienerin hergeht.
»Mach schon«, knurrt die Frau, als sie die Treppe zum ersten Stock in Angriff nehmen. Sie ist kantig, die Figur, der Schritt, der Ton. Sie heißt Antonia.
»Ich hab keine Zeit für Nachzüglerinnen!« Und dann noch: »Gleich am ersten Tag zu spät zu kommen!«
Der Flur gleicht aufs Haar dem im Erdgeschoss, sechseckige Kacheln, hohe Fenster zu der großen Piazza, die sie an der Hand von Suor Giuliana überquert hat, die gleiche Reihe von Türen mit Schildern darüber, die gleichen unverständlichen Geräusche. Die Schuldienerin Antonia strebt mit kämpferischem Eifer voran, mit hysterischen Trippelschritten und rasselndem Schlüsselbund, den sie am Gürtel trägt.
»3A. 3B. 3C. 3D. Merk’s dir! Leute, die sich verlaufen, können wir hier nicht gebrauchen!«, sagt sie, ohne sich umzudrehen. Am Ende des Korridors biegt sie scharf rechts ab, die Schlüssel klirren unwiderruflich, und es ist, als befehle sie rechts-marsch-marsch!
Noch mehr Türen.
»4A! 4B!«
Jetzt gehen die Fenster zur Straße hin, und die Kleine sieht die Umrisse des Waisenhauses.
»4C! 4D! Aufgepasst! Hier sind die Fünften!«
Sie sieht die langen schwarzen Äste der Zeder, wie Arme ausgestreckt.
»5A! 5B!«
Sie sieht den Eingang zum Hof. Dort, irgendwo im Dunkeln, stellt sie sich die Katze vor.
»5C!«
Die Traurigkeit ist ein Spinnennetz, das sie erst umschmeichelt und dann gefangen nimmt. Unterdessen hat die Schuldienerin Antonia die geschlossene Tür der 5D erreicht. »Komm her!«, schreit sie flüsternd.
Mit gesenktem Kopf stellt sich die Kleine neben sie. Die Frau zeigt auf die Kleiderhaken. »Beeil dich! Ich hab nicht den ganzen Vormittag!« Während die Kleine den Mantel ablegt und die blaue Schleife wie eine zerdrückte Blume baumelt, klopft die Frau, wartet nicht auf Antwort, öffnet die Tür, schiebt die Kleine hinein und schließt sie sofort wieder, mit einem dumpfen Schlag.
Dreiundzwanzig Augenpaare sind auf sie gerichtet. Das ist der schlimmste Moment. Der Zettel des Direktors beginnt zwischen ihren Fingern zu zittern.
Dreiundzwanzig Augenpaare plus das der Lehrerin, Maestra Gilla, die das Blatt an sich nimmt und schweigend liest. An ihrer rechten Wange zuckt ein Muskel, das sehen alle. Alle. Sechsundvierzig weibliche Augen.
»Setz dich dorthin«, sagt die Lehrerin und deutet auf den einzigen leeren Platz. Eine Bank in der ersten Reihe, der freie Platz ist neben dem Fenster. Die Klassenkameradin steht auf, damit sie durchkann. Sie stellt den Ranzen auf den Boden, rutscht hinein, merkt, dass sie etwas falsch gemacht hat, für den Ranzen gibt es eine Halterung, daher steht sie wieder auf, verstaut den Ranzen, schlüpft zurück auf die Bank und sieht aus dem Augenwinkel, dass die Kameradin zwei Hefte vor sich hat und den Federhalter in der Hand hält. Also steht sie erneut auf, um aus dem Ranzen die Sachen zu holen, die sie braucht. Gemurmel. Gekicher. Die Kleine wird feuerrot, und auf einmal ist das der schlimmste Moment.
»Ruhe!«, mahnt Maestra Gilla. Sie tut so, als merke sie nichts von dem ganzen Hin und Her, und fährt mit ihrer Erklärung an der Tafel fort. Bruchrechnen.
Die Kleine schlägt die erste Seite ihres karierten Hefts auf. Sie schreibt alles mit, was die Lehrerin diktiert, obwohl es unnötig ist, die Bruchzahlen kennt sie schon. Auch kann sie 3/4 in eine Dezimalzahl verwandeln. 0,75. Und sie weiß, dass 4/58/10 entspricht, was wiederum 0,8 entspricht. Nach dem Bruchrechnen braucht sie das linierte Heft. Ein Diktat. Danach ein Aufsatz mit dem Titel Mein Willkommensgruß für den Herbst.
»Ihr habt eine Stunde Zeit«, sagt die Lehrerin.
Die Kleine entspannt sich allmählich. Das Thema gefällt ihr. Sie füllt vier dicht beschriebene Seiten. Ohne Flecken. Sie schreibt, im Herbst verfärben sich die Blätter und werden goldgelb, manche auch rubinrot. Die Esskastanien schmecken süß wie Honig. Da sie ein Gedicht des berühmten Dichters Giosuè Carducci auswendig kann, das ihr passend erscheint, beschließt sie, es zu benutzen. Sie schreibt: »… über unwirtlichen Hügeln steigt der Nebel im leichten Regen, und auf den Straßen riecht man das Gären der Bottiche und den herben Duft der Weine«.
Die Lehrerin geht währenddessen zwischen den Bänken durch. Sie gibt Hinweise, verteilt Bleistifte und Hefte von der Fürsorge. Bei ihr bleibt sie nicht stehen.
Unter den Aufsatz schreibt die Kleine »Ende«, dann schaut sie aus dem Fenster. Sie erkennt, welche Form das Schulgebäude hat. Es gibt einen mittleren Trakt (der längere Flur, den sie im Erdgeschoss mit Suor Giuliana und im ersten Stock mit der Schuldienerin Antonia entlanggegangen ist) und zwei hufeisenförmig angeordnete Seitenflügel. Am Ende eines dieser Flügel befindet sich die 5D und ihre Bank. Die Fenster auf der gegenüberliegenden Seite zu zählen ist, als blicke man in einen Spiegel. Unten der weite Hof mit zwei gleichen Treppenaufgängen, die an Wettläufe auf den Stufen und an Ballspiele denken lassen.
Beim Pausenläuten entdeckt sie, dass man aufstehen darf, wenn man will, man kann sich zu zweit zusammentun und Hände klatschen und dabei »Ich heiße Lola / und komm aus Thule, / zum Italienischlernen / geh ich zur Schule« singen oder einen Kreis bilden und »Ringelringelreihen« singen oder auf die Toilette gehen oder auch einfach an seinem Platz sitzen bleiben, um zuzuschauen, was die anderen machen. Sie sieht, wie Maestra Gilla eine Klassenkameradin ans Pult ruft und ihr einen Apfel schenkt. Sie sieht, wie ihre Banknachbarin die Tischplatte aufklappt und ein Tütchen und ein kleines Päckchen herausholt, das eine halbe gekochte Kartoffel enthält. Die Kleine hat nicht den Mut nachzuschauen, ob in ihrem Ranzen etwas zu essen ist.
Nachdem die Banknachbarin die kalte Kartoffel ungeschält verschlungen hat, greift sie in das Tütchen und stopft sich eine Handvoll Kürbiskerne in den Mund. Ihr bietet sie keine an. Sie ist ziemlich hässlich. Schiefe Zähne, stumpfe Augen, hängende Schultern. Sie macht Rechtschreibfehler, und von Bruchrechnen hat sie keinen blassen Schimmer. Ihr Ausdruck ist nicht intelligent, und sie riecht ein bisschen nach Zwiebel, aber nicht mehr als die Mädchen, mit denen die Kleine nachts den Schlafsaal teilt. Und sie selbst riecht ja auch nach Zwiebel, glaubt sie.
Während des restlichen Vormittags wird nicht im Chor gesungen, und man geht auch nicht in den Hof, um Übungen mit Reifen und Keulen zu machen. Stattdessen malt man ein Bild mit frei wählbarem Sujet, aber ebenfalls zum Thema Herbst. Sie malt drei Kastanien mit Schale. Eine offen, eine zu, eine halb aufgeplatzt. Ihre Nachbarin malt einen Ofen. Dann folgen vier Geometrieaufgaben, und zum Schluss betet man das Engel Gottes. Sie kennt es. Die Nachbarin deklamiert mit heller Stimme, sie bewegt nur die Lippen im Rhythmus.
Bevor sie sie verabschiedet, bittet die Lehrerin alle, »in Schönschrift« ihren Vor- und Nachnamen auf das Deckblatt des karierten Hefts zu schreiben. Eine nach der anderen sollen sie das Heft zum Pult bringen. Am Nachmittag, sagt die Lehrerin, wird sie die gemachten Übungen korrigieren.
Ihre Banknachbarin schreibt: »Piombo Maria Luisa«. Sie schreibt nichts. Als sie an der Reihe ist, tritt sie aus der Bank und legt ihr Heft oben auf den Stoß.
»Dein Name?«, fragt die Lehrerin.
Die Kleine schüttelt den Kopf.
Wieder Gekicher.
»Ruhe!« Die Lehrerin blättert das Heft durch und sieht, dass alle Übungen gemacht sind. Sanft ermahnt sie sie: »Du musst deinen Namen auf das Deckblatt schreiben, woher soll ich sonst wissen, dass es dein Heft ist?« Sie lächelt.
Der Ausdruck der Kleinen dagegen ist angespannt, dunkle Iris, Ringe unter den Augen. Maestra Gilla kommt es vor, als stünde ein wildes Tier vor ihr.
»Diesmal lass ich es dir durchgehen, weil es der erste Tag ist. Aber in meiner Klasse mache ich keine Ausnahmen. Und damit du es weißt, Privilegien hasse ich.« Dann zieht sie den Zettel des Direktors aus der Tasche, liest ihn noch einmal, steckt ihn wieder ein, taucht den Federhalter in die Tinte und schreibt auf das Deckblatt des Hefts:
Francesca Pellegrini
Die Augen der Kleinen durchzuckt ein Leuchten.
Privilegien
Die Kleine genießt viele Privilegien.
Ein Weißmehlbrötchen zum Frühstück, zum Mittag- und zum Abendessen.
Am Sonntag etwas Süßes aus der Konditorei. Gewöhnlich wählt sie einen Rosinenzopf oder ein Gebäck aus Zucker, Eiweiß und Mandelmehl mit kandierter Kirsche.
Huhn oder Kaninchen zweimal pro Woche.
Hustensaft (nur im Winter).
Lederschuhe in ihrer Größe (ein Paar).
In die Schule gehen.
Den Ranzen mit den Büchern, den Heften, zwei Federn und Löschpapier. Den Tintenvorrat. Den Zirkel in einem mit lila Seide ausgeschlagenen Etui.
Sich im Waisenhaus und im Hof fast überall frei bewegen zu dürfen. Verboten sind nur die Privaträume der Nonnen und die Speisekammer.
Befreiung von der Teilnahme an Beerdigungen, Prozessionen, Festen und Zeremonien, während die anderen in Uniform und nach Größe geordnet in Sechserreihen dabeistehen müssen.
Statt des grauen Kittels ihre eigenen Kleider zu tragen. Schade, dass einige ihr nicht mehr passen. Deshalb trägt sie den Mantel, der zwei Nummern zu groß ist.
Nicht alle Privilegien sind ihr sofort zugestanden worden. Am Anfang war es hart.
Erster Schultag
3
Den ganzen Vormittag über verliert Gilla die Nachzüglerin nicht aus den Augen. Sie bemerkt, dass die Kleine aufmerksam zuhört, ordentlich schreibt, fleißig die gestellten Aufgaben löst. Dass sie in der Pause nichts isst und mit niemandem spricht. Dass sie am Ende des Unterrichts ihre Sachen im Ranzen verstaut, beim Kommando in Ruhe auf den Korridor hinausgeht, ihren Mantel zuknöpft, ihre Banknachbarin an der Hand nimmt und schweigend in der Zweierreihe wartet.
Gilla stellt sich neben die Schlange und richtet es so ein, dass sie knapp hinter ihr steht. Beim Läuten der Glocke durchläuft die Gruppe ein Zucken. Sie sieht, wie die Kleine losgeht, ohne zu drängen oder die anderen zu schubsen, die Treppe hinuntersteigt, ohne zu rennen, und die Hand ihrer Gefährtin erst loslässt, nachdem sie durch die Tür der Mädchenabteilung gegangen sind. Sie sieht, wie die beiden sich mit einem Kopfnicken verabschieden.
Gilla bleibt auf der Schwelle stehen, während die Mädchen und Kolleginnen nach Hause strömen. Sie erkennt die Kleine im Gewimmel der Piazza, der Ranzen hüpft auf ihrem Rücken, die straff geflochtene Schnecke im Nacken. Eine alte Nonne flüstert ihr etwas ins Ohr. Das ist der Moment, denkt Gilla. Sie kneift die Augen zusammen, sieht, wie die Kleine nickt und die Schnecke auf und ab wippt.
Ist das möglich?, ruft sie innerlich aus und zieht zum zweiten Mal den Zettel des Direktors aus der Tasche.
Francesca Pellegrini, 10 Jahre.
Seit Januar im Waisenhaus Sant’Anna.
Sehr gut in Orthografie, Schönschrift, Arithmetik, Geometrie.
Spricht nicht.
Was bedeutet »spricht nicht«? Gilla hebt den Blick, Nonne und Kind sind verschwunden.
1938–1939
Genua, 14. Mai 1938
Gilla ist vierzehn Jahre alt. Aufgeregt im Gedanken an den Tag, der sie erwartet, ist sie schon beim Erwachen quirlig wie Quecksilber. Sie erledigt alles in Windeseile, Toilette und Frühstück, und ist dann viel zu bald ausgehbereit. Also schließt sie sich gestiefelt und gespornt in ihrem Zimmer ein, um sich im großen Spiegel zu betrachten.
Sie prüft, ob der Knoten der schwarzen Krawatte richtig gebunden ist (was für ein toller Kontrast zu dem leuchtenden Weiß der Pikeebluse!). Sie rückt die ebenfalls schwarze Mütze zurecht, damit sie weich auf den zu Locken gedrehten kastanienbraunen Haaren sitzt. Sie lächelt zufrieden. In Uniform gefällt sie sich sehr. Sie spitzt die Lippen zu einem stummen Kuss. Dann begutachtet sie ihren Busen. Die Rundungen unter dem Stoff geben ihrer Figur etwas Anmutiges, findet sie. Sie prüft die Knie, wie sie zwischen dem Saum des Faltenrocks und dem Bündchen der weißen Kniestrümpfe herausschauen. Kerzengerade! In ihren Riemchenschuhen stellt sie sich auf die Zehenspitzen und macht eine Dreivierteldrehung, um die Wirkung von hinten zu betrachten.
»Gilla, beeil dich, es ist Zeit!« Die Stimme der Mutter hinter der Türe.
Sie stürmt hinaus, unterwegs zur Schule, aber ohne Bücher und Hefte, denn heute findet kein Unterricht statt, und man geht direkt zum Appell. In den Tagen davor haben sie im Hof immer wieder die Lieder geprobt, den Schritt, den Gruß mit gestrecktem Arm, Hunderte synchron zum Himmel gereckte, strahlend weiße Pfeile. Zum Himmel, der heute blendend hell leuchtet.
Der Regierungschef, Seine Exzellenz Cavalier Benito Mussolini, kehrt zwölf Jahre nach seinem ersten Besuch in die Stadt zurück, doch daran denkt Gilla nicht, während sie mit den Klassenkameradinnen die Via XX Settembre hinuntergeht, geschmückt mit langen Schwalbenschwanzbannern, auf denen »Duce« steht und »A noi«, im Hintergrund die fröhlichen Willkommenssirenen vom Hafen und eine freudig jauchzende Trompete. Jetzt ist der Sommer da, denkt Gilla. Der Faltenrock. Die Zöpfe einer Kameradin, einfach bildhübsch. Das lustige Getrappel auf den alten Pflastersteinen. Wie Tanzschritte. Sorglos lacht und scherzt sie mit den anderen, die Lehrer sind ja weit weg. Sie lacht und scherzt auch auf der Piazza della Vittoria, in dem Sektor, der ihnen von der Stadtverwaltung zugewiesen wurde. Ein neuer, moderner, glänzender Platz. Marmor und elegante Blumenbeete, wo vorher ungepflegter Rasen war. Sie lacht bei der Reihe von Statuen, die zu dieser Gelegenheit aufgestellt wurden, beim Wehen der Fahnen im Wind. Sie lacht, weil sie vierzehn Jahre alt ist. Sie lacht, aber vor Staunen, angesichts der imposanten Bühne in Form eines Bugs. Ein meterhoher künstlicher Schiffsrumpf, bereit, in See zu stechen, unter dem die Menge einem Meer gleich anschwillt und harmonisch wogt, elektrisierend. Und irgendwann übertönt die Musik alles, selbst die Sirenen, selbst die Siegersalve der Artillerie, auch das Gelächter. Hunderte von Blockflöten, Pikkoloflöten, Klarinetten, Oboen, Fagotte, Trompeten, Posaunen, Flügelhörner, alle Blaskapellen der Stadt. Dann Stille. Unfassbare Stille. Auf dem Bühnenbug spricht ein Mann in Uniform. Metallische Stimme aus den Lautsprechern. Aufschrei. Du-ce, Du-ce, Du-ce. Und in diesem Augenblick, am Höhepunkt der Begeisterung, tritt Benito Mussolini an die Reling des Bugs. Auch er in Uniform, mit Handschuhen und Orden an der Brust. Noch mehr Beifall. Gilla spürt, wie die Wärme der nahen Körper sie einlullt, fortträgt, hochhebt. Sie schreit, wenn die anderen schreien, seufzt, wenn die anderen seufzen. Sie bemüht sich aber auch aufzupassen. Sie weiß, dass das morgen in der Schule thematisiert wird. Doch die Worte Benito Mussolinis verwehen im Wind. Frankreich. Engländer. Reich. Hinauf, hinauf, wie Vögel im Aufwind. Sanktionen. Achse. Flotte. Werften. Frieden für alle. Fern, immer ferner, in einem Flügelschwirren. Bewaffneter Friede.
Es kostet Gilla große Anstrengung, den Faden nicht zu verlieren, und sie schweift ab. Sie erwidert das Zwicken einer Kameradin, kichert mit einer anderen, während sie einem achtzehnjährigen Avantgardisten zublinzelt, der sie unverwandt anschaut. Sie hat so viel Spaß, dass es ihr vorkommt, als dauerte die lange Rede, von der sie so gut wie nichts versteht, nur einen Augenblick, und schon löst sich die Versammlung auf, das Fest ist zu Ende, und es wird Zeit, nach Hause zu gehen.