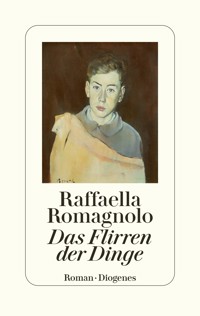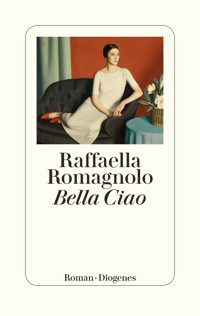20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Tapir
- Sprache: Deutsch
›Cedrus libani‹, so heißt der Baum, der seit Jahrtausenden die Geschichte der Menschheit begleitet. Schon die Phönizier verehrten ihn, wie sollten sie auch nicht? Ein Baum, der so alt werden kann, hat viel zu erzählen. Und so erkundet Raffaella Romagnolo nicht nur das Wesen dieses besonderen Baums, sie zeigt auch in vier Episoden, wie die kleinsten Momente Leben verändern können und was der Halt bedeutet, den die Wurzeln der Libanonzeder versprechen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 111
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Raffaella Romagnolo
Die Libanonzeder
Aus dem Italienischen von Peter Klöss
Diogenes Tapir
Für Richard Powers, der den Weg wies.
Vor Milliarden von Jahren lernte eine einzige selbstreplizierende Zelle zufällig, wie man einen unwirtlichen Ball aus giftigen Gasen und vulkanischer Schlacke in diesen lebendigen Garten hier verwandelt. Und damit wurde alles möglich, alles, was ihr hofft und fürchtet und liebt.
Patricia Westerford
Am Anfang
Am Anfang öffnet sich der Zapfen mit den holzigen Blütenblättern wie eine welkende Rose. Schuppe um Schuppe löst sich aus der spiralförmigen Struktur, bis der Samen offen und nackt daliegt. Eine durchscheinende Membran umhüllt ihn wie Seidenpapier.
Tage, Nächte vergehen. Herbst-Tagundnachtgleiche. Ein Windstoß erfasst ihn. Die Membran ist ein runder Flügel mit dünnen Adern wie Spinnfäden. Der Samen ist die dunkle Verdickung am inneren Rand des Flügels, von dem er sich tragen lässt, fort vom Mutterbaum.
Der Schoß, der ihn hervorgebracht hat – eine majestätische Libanonzeder –, erscheint jetzt als eine Struktur mit klaren Konturen und definierten Farben: ein von Harz glänzender Stamm, kräftige, ebenfalls spiralförmig angeordnete Äste, die wie Arme ausgestreckt sind, das Blaugrün der Krone, das Wachsgrün der neuen Zapfen und das Braun der alten, das Dottergelb der männlichen Blüten, die randvoll mit Pollen gefüllt sind.
Der runde Flügel segelt ein Stück, dann beginnt er zu trudeln. Ringsum noch mehr Bäume, flechtenübersäte Felsen und Rhododendren. Jetzt führt der Samen den Reigen an. Er wirbelt umher, beschreibt eine Spirale (wieder eine Spirale), dreht sich immer schneller im Kreis, zielstrebig auf den Boden zu. Der Aufprall ist hart. Die Kraft der schraubenförmigen Bewegung ist so groß, dass sie die Oberfläche durchbohrt und den Samen samt seiner geflügelten Schleppe ans Ziel zieht: tief in einen Haufen Erde, der Stunden zuvor von den wühlenden Klauen eines Wildschweins aufgeworfen wurde.
In der Dunkelheit gleicht der Samen einem kleinen Stein. Wie tot liegt er da, bewegungslos und selbstgenügsam, während um ihn herum das Leben in Gestalt von Mikroorganismen pulsiert, Bakterien, Schimmel- und andere Pilze in den fantastischsten Farben, die unermüdlich organisches Material in Wasser und Kohlendioxid umwandeln. Vor ihrer Gefräßigkeit schützt ihn seine harte Schale.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Nachts fällt die Temperatur unter den Gefrierpunkt. Am Morgen knistert der gefrorene Boden. Wintersonnenwende. Die Sonne steht tief, ihre Strahlen dringen nicht durch die graue Wolkendecke. Es schneit, und der Schnee taut nicht weg. Ein, zwei Monate. Dann steigt die Temperatur wieder an. Der Schnee bildet harte, glitzernde Flecken.
Das Unterholz ist von einem staubigen Braun. Aus Krokuszwiebeln platzen violette Blüten und Blätter, die wie aufgestellte Lanzen aussehen. Reinweiße Inseln aus Schneeglöckchen. Der Samen ist jetzt kalt und dehydriert, die äußere Hülle verschrumpelt.
Im Frühling, zur Tagundnachtgleiche, steht die Sonne wieder hoch über dem Horizont. Eines Nachmittags regnet es. Nicht sonderlich stark. Ein Nieselregen, der die Schlucklöcher im Karst schwarz färbt, die Quarzitkristalle freilegt und die Erdschicht, die den Samen bedeckt, kaum merklich beschwert. Der Wald gibt metallische Geräusche von sich, die Nadeln sind hart wie Dornen. Die Erde verströmt einen modrigen Geruch. In die winzigen unterirdischen Gänge kommt Leben. Wirbellose der Gattung Lumbricus machen sich über die duftende Weichheit her und zerkauen mikroskopisch kleine Klumpen. Ab und zu wagen sie sich nach draußen und lösen in ihrem unterirdischen Reich kleine Erdrutsche aus, die unendlich kleine Abgründe aufreißen. Irgendwann dringt ein vollkommen runder Tropfen in einen dieser Schlünde ein, rinnt einen Spalt entlang, erreicht unversehrt das Versteck des Samens und löst damit eine Explosion aus. Aber im Innern.
Mit der Kraft von tausend Atmosphären nimmt der Samen das Wasser in sich auf, als wollte er einen Urdurst stillen. Dessen Moleküle reagieren mit den Proteinreserven des Embryos. Aminosäuren, Peptide, Maltose, Glukose und sogar Hormone, sogenannte Gibberelline, werden gebildet und veranlassen die Zellen, sich zu strecken, zu wachsen und zu vermehren. Stunden, Tage geht das so, dann platzt der Samen auf.
Eine Keimwurzel durchbricht die Samenhülle und wagt sich vor in die Dunkelheit gen Erdmitte, wo sie sich auf der Suche nach Wasser und Nährstoffen verzweigt. In entgegengesetzter Richtung steigt eine winzige Ausstülpung empor, die Plantula, so ihr lateinischer Name. Sie weiß, wo oben und unten ist, wo innen und außen. In sich trägt sie die Kotyledonen, Keimblätter voller Nährstoffe, und eine himmelwärts strebende Gipfelknospe. Sie überwindet die Schwerkraft und den Widerstand des Bodens. Die Samenhülle – oder was davon übrig ist – schützt sie wie ein zerfaserter Schild.
Wenn der Keimling die Welt erblickt, bricht schon der Tag an. Ein Sturm aus Gasen und Farben. Die blaue, violette und rote Strahlung des elektromagnetischen Spektrums der Sonne flutet die Chloroplasten in den Keimblättern. Zweite Explosion. Das Kohlendioxid in der Atmosphäre verbindet sich mit dem Wasser, das die Keimwurzel nach oben gepresst hat. Das Ergebnis sind Glukosemoleküle, dann Glukoseverbindungen, Traubenzucker und Stärke, aus denen sich Stamm, Rinde, Äste und weitere Blätter bilden, zu Tausenden, zu Millionen. Überschüssig – das Abfallprodukt – sind Sauerstoffmoleküle, Leben.
Die Zedern des Herrn
Tiefe Nacht. In dem Raum, den sie mit den anderen Frauen und den Kindern teilt, erhebt Hotti sich von ihrem Strohsack. Das Mondlicht fällt auf aneinandergedrängte Körper, in Schlaf versunkene Gesichter, Steinguttöpfe und an Nägel gehängte Überkleider. Barfuß in ihrer Tunika schleicht das Mädchen durch den Vorraum zu dem einzigen andern Raum des Hauses. Hier bleibt sie stehen. Sie muss vorsichtig sein, warten, bis ihre Augen sich ans Halbdunkel gewöhnt haben.
Atemzüge füllen den Schlafraum, den ihr Vater mit Kalk getüncht und ihre Mutter mit raffinierten blauen Mustern verziert hat. Viele Jahre sind vergangen seit dem Sommer, als er ein junger Mann und sie hochschwanger war. Die üppige Dekoration aus verschlungenem Weinlaub ist mittlerweile verblasst. Deshalb hat ihre Mutter ihr beigebracht, wie man die Blättchen des Färberwaids pflückt, einweicht, trocknet und zu Pulver zerstampft, damit Hotti weiß, wie man den fauligen Gärgestank in schillernde Farbe verwandelt. Und deshalb wäre es jetzt an ihr, die Zeichnungen aufzufrischen und vielleicht neue hinzuzufügen. Ihre Mutter hat nicht mehr die Energie für das, was sie damals mit der Tatkraft einer Fünfzehnjährigen mühelos bewältigt hat: zweiunddreißig blau-violette Ranken malen und ein Mädchen austragen, das sich gegen die Heerscharen von Viren, Bakterien, Parasiten und Fieber zur Wehr setzen kann, die sich auf jedes neue Lebewesen stürzen.
Hotti vertreibt den Gedanken wie eine lästige Fliege. Sie ist jetzt genauso alt wie ihre Mutter damals, als sie mit ihr schwanger war und die Wände verziert hat. Die Zeit rast wie das Trommeln an einem Festtag. Jetzt wäre es an ihr zu gebären: Ihre Brüste sind prall, ihre Hüften haben die richtige Breite, und bei jeder Mondumdrehung fließt das Blut. Ihre Schwestern haben es schon hinter sich.
Sobald sie ausreichend sieht, überquert sie die Schwelle des zweiten Raums. Die gestampfte Erde unter den Füßen ist kalt. Die Leiber scharren und murmeln. Zwischen Säcken mit Getreide und Krügen mit Öl schlafen ihr Vater, ihre Schwäger und Brüder. Die Waffen bei sich. Leben ist Krieg. Hotti stellt sich vor, sie wäre eine Löwin. Sie erreicht die Liege des ältesten Bruders, beugt sich hinunter und lauscht auf seinen Atem. Schlafend ist er keine Gefahr. Jetzt ist sie eine Schlange. Sie lässt ihre Hand unter die Liege gleiten, findet das Versteck, zieht den Dolch mit Scheide und Gürtel aus Leder hervor und bleibt wie erstarrt in der Mitte des Raums stehen. Sie dreht den Kopf und kneift die Augen zusammen. Beobachtet, wittert, sie ist ein Nachtvogel. Sie erkennt die Gerüche, einen nach dem anderen, aber sie lässt sich nicht von den Gefühlen aufhalten, die in ihr aufsteigen. Sie bindet sich das Messer um die Taille. Geht zwischen den Schlafenden hindurch. Sie ist draußen.
Die Luft ist kühl, der Mond rund. Die Vollmondnacht ist ein Risiko. Die Kuppel des Backofens schimmert blassgrau. Die Schafsrücken im Pferch sehen wie Kalksteinblöcke aus. Die Gasse vor dem Haus ist hell erleuchtet. Ein großes Risiko, aber auch eine Notwendigkeit. Wie soll sie sich sonst orientieren? Rasch geht sie los. Ihre aus Ginsterfasern gewebte Tunika wippt im Takt mit ihren tiefschwarzen Locken. Sie sieht aus wie ein ätherisches Wesen, dem Wald entflohen. Irgendwo schreit ein Schakal. Sie beginnt zu rennen. Sie erreicht den Rand des Dorfes und folgt einem Sträßchen, das auf eine Lichtung führt. Ein Hund antwortet, weit weg. Steine bohren sich in ihre Füße, hohes Gras zerkratzt ihre Knöchel. Das Mädchen steuert auf einen Flecken Grün zu, und als sie ihn erreicht, ist das Dorf hinter ihr nur noch eine düstere Ahnung. Sie überlegt, ob sie sich umdrehen und zurückschauen soll. Sie tut es nicht.
Eine Geschichte fällt ihr ein, die ihr Geliebter ihr erzählt hat. Meir heißt er, immer taucht er aus heiterem Himmel auf, der Spaßvogel, und lenkt sie von der Arbeit ab. Beim Wäschewaschen am Bach spritzt er ihr Wasser in die Augen. Beim Brombeerpflücken sticht er sie mit unsichtbaren Stacheln. Wenn sie die Kaninchenfalle überprüft, neckt er sie, indem er die Schlinge verheddert.
Freudig begrüßt Hotti ihn jedes Mal. Er ist die Liebe ihres Lebens. Jetzt, da er sich ihr in Form einer Geschichte offenbart, hält sie inne. In dieser Richtung werden sie nicht nach ihr suchen. Niemand wird sie für so verrückt halten, dass sie sich in die Berge wagt. Außerdem hat sie tags zuvor falsche Fährten gelegt, die in die Ebene führen. Ein Stofffetzen an einem niedrigen Ast. Ihre Kette mit dem Lapislazuli-Anhänger gut sichtbar auf der Straße. Schade, dass sie ihr einziges Schmuckstück opfern musste, aber das ist es wert. Sie werden denken, man habe sie entführt. Das kommt vor. Die Mutter wird weinen. Sie werden sich damit abfinden. Hotti gehört nicht mehr zu ihnen, sie gehört zu Meir.
Und jetzt ist Meir in Form einer Geschichte zu ihr gekommen. Das Mädchen legt den Dolch neben sich und setzt sich im Schneidersitz, mit dem Rücken zum Dorf. Sie starrt ins Dunkel und ruft sich sein Gesicht in Erinnerung, die vollen Locken, seinen Körper, seine Hände, seinen Mund. Mit kalten Fingerspitzen berührt sie ihre Lippen, malt sich einen Kuss und lauscht auf das, was in der Erinnerung verwahrt ist, wie der Wein im Schlauch.
Es war einmal eine Frau, die lebte in einem Dorf von Sündern.
(Meirs Stimme – wie könnte sie sie vergessen? – ist süß wie Honigtau.)
Gott zürnte und beschloss, das Dorf in einem Sturm aus Feuer und Schwefel zu zerstören. Er rief die Frau, die ohne Sünde war, und sagte zu ihr: »Dich verschone ich. Also lauf. Nur umdrehen darfst du dich nicht.«
(Die Tunika ist dünn, sie schützt kaum vor der Feuchtigkeit der Nacht, aber Hotti spürt es nicht. Sie liebt dieses Spiel, im Geist die Worte zu rekonstruieren, die sie mit Meir gewechselt hat. Eine Wärme strahlt dann von ihrer Brust in den ganzen Körper aus.)
Die Frau floh wie befohlen, vermochte aber der Versuchung, sich umzudrehen und zu schauen, was Gott mit ihrem Dorf anstellte, nicht zu widerstehen.
(In dem Spiel fragt das Mädchen: »Und was tat Gott?«)
Gott bestrafte sie. Die Flammen blendeten sie. Der heiße Wind saugte sie ein. Ihr Blut wurde zu Stein. Ihr Fleisch zu Salz.
Großartige und schreckliche Geschichten kennt Meir. Tagelang redeten sie darüber. Heimliche Sätze, eilige Gespräche in der kurzen Zeit, die einem Mann und einer Frau bleibt, um ein paar Worte zu wechseln, ohne dass es einen Skandal gibt. Ihr war, als würde ihr Kopf aufplatzen wie eine überreife Melone, die Samen darin bereit zu sprießen. Jetzt zum Beispiel stellt sie sich vor, der Sternenhimmel würde sich in einen großen Flammenregen verwandeln. Baumhohe Flammen, glühendes Gestein, Rauch, verbranntes Fleisch. Vielleicht hat die Frau aus der Geschichte auf der Flucht durch die gleiche Dunkelheit, die Hotti jetzt wie ein kaltes Bad umgibt, hinter sich einen Schein wahrgenommen und sich deshalb umgedreht. Nicht weil sie nicht gehorchen wollte, nur um besser zu sehen. Das war doch verständlich, oder? Wer nur einen Gott hat, für den gibt es kein Entkommen, denkt Hotti.
Das hatte zu Streit zwischen ihnen geführt. Das Mädchen befürchtet, dass es auch in Zukunft, wenn sie endlich bei Meir ist, so sein wird. Aber sie ist bereit, ihr Schoß ist es. Sie will keinen anderen darin haben. Deshalb ist sie fortgelaufen. Auch wenn es Dinge gibt, die Meir nur schwer begreifen kann, die tausend Gottheiten zum Beispiel, die sie kennt. Aber Hotti ist zuversichtlich. Eine nach der anderen will sie ihm erklären, ihm unzählige Namen, Spitznamen und Verwandtschaften in die zarte Ohrmuschel flüstern, sie ihm in den Mund hauchen, wenn sie sich umarmen. Auch Hottis Geschichten sind blutrünstig und schön. Gnadenlose Unsterbliche, Gestalten mit heimtückischen, unwiderstehlichen Kräften, von unendlicher Güte oder unerhörter Grausamkeit, wandelbare Mischwesen, mal männlich, mal