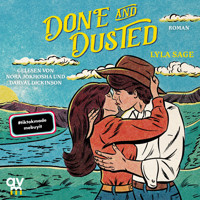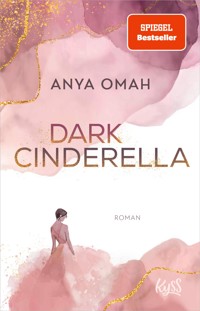16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vom langen Schatten der Vergangenheit. Ein glanzvolles literarisches Debüt über eine Frau, die sich in den Schatten eines Mannes begibt und sich nach seinem Tod nicht wiederfindet. Falk Margraf ist berühmt, er ist der rebellische Spross einer alten Bayreuther Großbürgerfamilie, der Wagner gegen die Rockmusik eingetauscht hat, vor allem aber hat er das Lied geschrieben, das das Lebensgefühl einer aufsässigen Generation traf und gleichzeitig prägte. Wen wundert es, dass die aus einfachen Verhältnissen stammende junge Sängerin Alex es Anfang der Achtziger für den Glücksfall ihres Lebens hielt, ihn getroffen und ihm offensichtlich ziemlich gut gefallen zu haben. Und wenn auch Falks machtbewusste Schwester Isolde, nach deren Seminar es zu dem Treffen kam, gerade ihren Elevinnen geraten hatte, lieber Intendantinnen zu werden statt Sängerinnen – Alex entschließt sich, den mühsamen Weg der eigenen Karriere gegen ein erheblich unanstrengenderes Leben mit Falk einzutauschen.Siebzehn Jahre später ist sie klüger: Sieben Jahre ist Falk da schon tot und sie sitzt mit zwei unehelichen Kindern und einem handfesten Trauma vereinsamt und ohne wirkliches Ziel in Berlin, Isolde Margraf gibt ihr die Schuld an Falks Tod und schneidet sie, und nur die Mutter Falks, das erratische Oberhaupt des inzwischen stark dezimierten Margraf-Clans, hält noch den Kontakt zu ihr; schließlich ist Alex' Tochter Wanda ihre einzige Enkelin. Katharina Döbler gelingt in ihrem Debütroman Die Stille nach dem Gesang ein kleines Mirakel: Sie erzählt in einem raffiniert gebauten Roman nicht nur das Leben einer Frau, die sich in den Schatten eines Mannes begeben hat, aus dem sie nicht herausfindet, sondern zeichnet auch das Portrait einer ganzen Generation, die unangepasst und rebellisch startete, sich aber in unendlich vielen pragmatischen Kompromissen verlor, und vom Niedergang dessen, was einst unter dem Namen Bildungsbürgertum den kulturellen Ersatzadel Deutschlands darstellte. Die Stille nach dem Gesang wurde vom Deutschen Literaturfonds in Darmstadt gefördert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
» Buch lesen
» Das Buch
» Die Autorin
» Impressum
»When you think the night has seen your mindThat inside you’re twisted and unkindLet me stand to show that you are blindPlease put down your hands’Cause I see youI’ll be your mirror«
The Velvet Underground
»Gleichwohl geht der Prozeß der Emanzipation des Weibes nur unter ekstatischen Zuckungen vor sich.«
Richard Wagner, ein paar Stunden vor seinem Tod
»Alles erwogen, hätte ich meine Jugend nicht ausgehalten ohne Wagnersche Musik. Denn ich war verurteilt zu Deutschen. Wenn man von einem unerträglichen Druck loskommen will, so hat man Haschisch nötig. Wohlan, ich hatte Wagner nötig.«
[Menü]
Falk frühstückt
Er trat aus dem Hotel und ging über die Straße, die im Schatten lag. Der Himmel war ganz blau, die Luft gerade so kalt, dass es erfrischend war. Es war noch früh. An der ersten Straßenecke traf ihn jäh das Sonnenlicht, und er knöpfte seinen Mantel auf. Zwei Straßen weiter streifte ihn der Geruch von frischem Brot. Er war froh, dass er noch lange zu gehen hatte. Die Sonne wärmte seine linke Seite, er konnte fühlen, dass er nach Süden ging. Dann bog er um die Ecke und der Glanz blendete ihn von vorn, und einen kurzen Augenblick vergaß er, wo er war: Es hätte auch eine andere Stadt sein können, Madrid oder Wien oder Baden-Baden. Er überlegte im Gehen, welches die hässlichste Stadt war, in der er sich je befunden hatte. Er dachte gerade an Kassel, als er an seiner früheren Wohnung vorbeilief, ohne nach oben zu schauen. Es war nur eine Erinnerung, die ihn anflog und sich ein paar Schritte weiter schon aufgelöst hatte.
Der Weg war ihm vertraut. Jedes Mal ein bisschen anders, aber vertraut, wie ein Freund, der graue Haare bekommen oder eine neue Frau an seiner Seite hat und derselbe Freund bleibt. Er mochte das Hotel, in dem er alle paar Wochen für ein paar Tage wohnte. Es war verbaut, winkelig und sehr geblümt. Und es hatte keine Klimaanlage, was er schätzte. Die Fenster schlossen nicht einmal richtig, es gab immer einen leichten Luftzug im Zimmer, und das in einer der besseren Gegenden der Stadt, gleich um die Ecke vom Kurfürstendamm.
Er ging schnell, die Hände in den Manteltaschen, aber kalt war ihm nicht, er hatte den Schal nicht gebunden, den Mantel nicht wieder zugeknöpft, der wasserdichte Stoff wehte um seine Beine. Er hatte viel vor in den nächsten Tagen. Und zwischendurch wollte er noch zum Friseur, seinem türkischen Lieblingsfriseur, der noch rasierte. Vielleicht. Morgen früh. Und dann die Liste abhaken, die er immer im Kopf hatte, wenn er zurückkam. Zur Bank, zur Agentur, Mama besuchen, Einkäufe, Termine abarbeiten, die Bernhard für ihn festgemacht hatte. Vier Tage. Aber vor allem: Alex. Dann würde er wieder weg sein.
Er war auf dem Weg zu seiner Schwester, die ihn wie immer als Erste erwartete und ihre Entourage zu diesem Zweck aus dem Haus schickte. Das Frühstück mit Isolde war der Anfang jedes seiner Besuche in der Stadt, in der er so lange gelebt hatte, und egal wie lange er blieb, ob er allein war oder nicht, ob sie sich später bei Mama wiedertrafen: Der erste Morgen in Berlin gehörte Isolde. Man hätte auch sagen können: An seinem ersten Morgen in Berlin gehörte er Isolde. Aber er war nie auf den Gedanken gekommen, es so zu betrachten.
Die Straße beschrieb einen Bogen und die Sonnenwärme kam jetzt von rechts. In seinem Kopf kämpften zwei kleine Melodien miteinander, und er blieb einen Augenblick stehen, um zu hören, welche von beiden am Ende übrig bleiben würde.
Dann spürte er links hinter seinem Gesichtsfeld eine plötzliche Unruhe. Jemand schrie, und er merkte, dass er selbst gemeint war. Er drehte sich um zu jemandem, der einen Fahrradhelm trug, ein halb gekipptes Rad zwischen den Beinen. Er hörte nicht hin, was der Mann schrie, sondern versuchte seine beiden Melodien wiederzufinden. Der Mann hatte Bartstoppeln und an seinen Lippen zogen sich Spuckefäden, wenn er den Mund aufriss. Langsam drangen die Worte zu ihm durch. Meinste wirbrauchnochmehr hirntote innerstatistikodawat … glaubste dubistn … panza … wennste dichumbring willstmusste nichandre vakehrsteilnehmafür … missbrauchn.
Er fand erstaunlich, wie der schreiende Mann die Pausen in seinem Redefluss setzte. Entschuldigung, sagte er und lächelte und hob seinen Blick von den Lippen zu den Augen des Fremden. Die waren zu seiner Überraschung fast schwarz, er hatte blau oder grau erwartet. Er lächelte weiter in die jähe Stummheit hinein. Ich war in Gedanken, sagte er, tut mir wirklich leid.
Er hatte nicht gemerkt, dass er direkt hinter der Ecke auf dem Radweg stehen geblieben war. Der andere atmete stumm und heftig. Dann holte er noch einmal tief Luft, es klang wie ein Seufzen, hob sein Fahrrad auf und kletterte umständlich hinauf. Penna, sagte er im Losfahren, ganz leise.
Er erzählte es Isolde. Sie hatten sich seit vielen Wochen nicht gesehen, er war so lange nicht mehr hier gewesen, und sie hatten sich auch an keinem der anderen Orte getroffen, wo sie sich sonst verabredeten: im Haus bei Tarragona, bei Clara, und natürlich zu Hause, bei Mama. Das war ungewöhnlich.
Isolde trug ein Tuch ums Haar, als sie die Tür öffnete. Brudermein, sagte sie, und Schwestermein antwortete er, wie immer, wenn niemand dabei war, es hatte mit einem Märchen zu tun, das er ihr vorgelesen hatte, als sie noch Kinder waren. Sie umarmten sich und Falk spürte ihren üppigen Busen und dachte zum hundertsten Mal, dass Isolde eine gute Mutter geworden wäre. Nie hätte er ihr das gesagt.
Die Friede geht gleich, sagte Isolde, und Falk verstand den Hinweis, nichts Familiäres zu besprechen, solange sie noch im Hause war. Isolde hielt ihre Affären oder Liebesbeziehungen oder Ausbeutungsverhältnisse streng getrennt von der Familie und hatte ihre Frauen nie zu den Zusammenkünften bei Mama mitgebracht. Falk fand die Disziplin, mit der sie Arbeit, Familie und Liebesleben sortierte, immer noch erstaunlich und bewunderte sie sogar dafür. Er hätte das nie gekonnt.
Holst uns noch a paar Semmeln, Friedl Süße, sagte Isolde über die Schulter und Friede antwortete von weit hinten aus dem Flur, gleich, und stürzte alsbald an ihnen vorbei, ein kleines Wesen mit fliegenden Schals und Haaren und einem runden Kindergesicht. Falk war sich nicht sicher, ob er sie schon einmal gesehen hatte, er hatte sie noch nie begrüßt, das erwartete sie auch nicht und Isolde schon gar nicht.
Sie ist sehr begabt, die Friede, sagte Isolde.
Friede musste es noch gehört haben, bevor sie zur Tür hinaushuschte. Isolde erwähnte nicht, worin diese Begabung lag, aber Falk verstand, dass sie mit Friede zufrieden war.
Er setzte sich an den Tisch, an den Platz, wo er immer saß, und Isolde hantierte mit dem Espresso. Es war genau wie letztes Mal. Wie es in Madrid war, wollte Isolde wissen. Ob es noch einmal Ärger bei der Musik für diesen französischen Kitschfilm gegeben hätte. Ob es jetzt endlich ausgestanden sei. Es waren keine ernst gemeinten Fragen und keine bedeutenden Antworten, der Kaffee wurde fertig und Friede wehte wieder herein mit einer Tüte Brötchen, neigte den Kopf gegen Isoldes Schulter und ließ sich aufs Haar küssen, sagte bis später und verschwand wie ein Luftzug. So, sagte Isolde, und sah ihn über ihre Tasse hinweg gründlich an.
Sie war viel jünger als er, aber irgendwann in seinem Leben hatte er angefangen, sie als Autorität zu betrachten. Er hatte sich nie die Zeit genommen, darüber nachzudenken, warum das so war. Er dachte nie über dergleichen nach: In seinem Leben nahmen Menschen und Dinge eben ihre Plätze ein. Selten hatte er das Gefühl, dass er da eingreifen müsste. Seine Erfahrung war, dass die meisten Dinge und Menschen von selbst wieder verschwanden, wenn er ihnen keine Beachtung schenkte. Alles regelte sich von selbst und manches regelte Isolde für ihn, stellvertretend für die Familie: So wie es Mama früher getan hatte und sein älterer Bruder Veit.
»Ich muss nachher gleich zu Alexandra«, sagte er.
Isolde lachte. »Du Armer.«
»Wieso? Wegen Alex? Sie tut mir doch nichts.«
Isolde tropfte ein wenig Honig in ihre ausgehöhlte Brötchenhälfte. »Nein, das tut sie bestimmt nicht«, sagte sie langsam, »sie tut ja nie irgendwas.«
»Sie will ein Kind«, sagte er.
»Was? Ihr habts euch doch schon fast ein Vierteljahr nimmer gesehn.« Sie betrachtete nachdenklich das Brötchen, mit halb offenem Mund. Mit ihrem Tuch um den Kopf hatte sie etwas von einer Hexe; das unschuldige Ding in ihrer Hand würde sie unerbittlich töten und verspeisen.
»Die Alexandra«, Isolde seufzte und sah ihren Bruder kummervoll an, bevor sie zubiss.
Falk strich feine Leberwurst auf eine Kümmelstange, ein doppelter Genuss, den er in Spanien entbehren musste.
»Dafür bist du zu alt«, sagte Isolde, als sie eine Weile gekaut hatte. Er hob jäh den Blick von seiner Wurst, deren Farbe ihm außerordentlich gefiel, und zeigte sein Erstaunen mit allen Teilen seiner Person, bis in die Falten seines Hemdes hinein.
»Wieso ich?«
»Nicht von dir?«
»Doch, ich glaub schon, von wem denn sonst, aber …«, er brachte die Leberwurst sorgfältig entlang der Brötchenkante aus, »wie alt ich bin, ist doch egal.«
Isolde zog die Augenbrauen hoch und brummte, weil sie den Mund wieder voller Honig hatte.
»Ich meine, es ist mir nicht egal, aber dem Kind kann es doch egal sein. Und Alex, ich meine, wenn sie unbedingt will …«
Isolde pfefferte ihr Brötchen auf den Teller.
»Weißt du, was das heißt? Verantwortung! Familie gründen …! Mit der Alexandra! Mit Alexandra Zelinski eine Familie gründen. Du als Familienvater! Häuslich werden, mit dem Kinderwagen im Park rumlaufen! Du! Mit Alexandra. Familie Margraf.« Isolde sprach jetzt lupenreines Hochdeutsch, ihr sonniger südlicher Akzent war verschwunden.
»Falk! Sie ist doch weggegangen.« Ihre Hand knallte auf den Tisch. »Sie hat dich verlassen.« Die Hand knallte noch einmal. »Und du fütterst sie immer noch durch.« Knall. »In deiner Wohnung.«
Falk betrachtete sie erstaunt.
»Ich wusste gar nicht, dass du sie so wenig magst. Ich weiß, dass du nicht viel von ihr hältst, aber du hast noch nie viel von meinen Freundinnen gehalten, oder?«
»Falk«, sagte Isolde langsam und sorgfältig, »sie ist ein langweiliges, hübsches Nichts.« Er schwieg. »Du langweilst dich mit ihr. Sie ist unbegabt und hat sich an dich gehängt. Und …«
Falk lächelte sie an. »Gleich haust du wieder auf den Tisch.« Sie ließ ihre fuchtelnde Hand sinken. Dann hob sie sie wieder und strich ihm über den Kopf. Im Sitzen war sie fast so groß wie er.
»Du musst zum Friseur«, sagte sie.
»Ich weiß. Morgen.«
»Mach das nicht. Das wird dir nur leidtun.«
Es war klar, dass sie nicht den Friseur meinte. Er nahm seine Kümmelstange wieder zur Hand und verteilte noch mehr Leberwurst darauf.
»Ich glaub nicht«, sagte er.
Er biss, kaute, schluckte.
»Ich stell mir das nicht so vor«, er formulierte langsam, und merkte, dass er das, was er sagte, zum ersten Mal wirklich dachte. So war das oft, wenn er mit Isolde redete. »Ich denke nicht an Familie gründen, es ist einfach so, Alexandra will ein Kind, soll sie es nicht haben? Ich habe Geld genug, sie wird ein Kindermädchen bekommen, alle Hilfe, die sie nötig hat. Und sie hat etwas zu tun. Und, sieh mal«, er schaute auf und legte seine Kümmelstange auf den Teller zurück, »wir haben alle keine Kinder, na gut, es gibt den kleinen Halbchinesen da in Amerika, aber Veit ist tot, der Junge spricht nicht mal deutsch, er kennt uns alle kaum und nennt einen anderen Mann Vater. Er ist kein Margraf.«
Isolde hatte sich das Tuch vom Kopf gewickelt und begann nun, ihr Haar mit dem Tuch zu einem festen Seil zu drehen, ihr Gesicht bedeutete ihm, dass sie sehr genau zuhörte. Zustimmung sah er darin nicht.
Aber sie sagte nichts.
»Mama wäre glücklich über Enkelkinder«, sagte er schließlich.
»Dass ausgerechnet du damit kommst«, Isolde begann ihre künftige Frisur auf ihrem Kopf umzustapeln, sie konnte das blind, die Haarnadeln holte sie aus der Tasche ihrer Kostümjacke, ohne auch nur hinzusehen, Bewegungen, die ihm so vertraut waren, dass er genauso wenig hinsah wie sie.
»Ein Margraf! Damit Mama ihren Stammhalter hat! Es kann doch sein, dass der Hanno da in Australien oder Neuseeland, oder wo er auch hingeflohen ist, dass er da einen ganzen Stall voller Kinder hat, weißt du’s?
Vielleicht gibt’s einen Haufen kleine hochbegabte Margrafs da unten, nur wir wissen’s nicht?
Ich mein, wenn du die Mama glücklich machen willst, dann krieg doch bitte raus, was der Hanno macht, flieg hin und zähl nach, wie viele Kinder er hat.«
Falk mochte es nicht, wenn Isolde so redete, obwohl er natürlich wusste, dass sie recht hatte, irgendwie.
Aber wenn sie dieses gebirglerisch Massive, das sie aus ihrer Schulzeit im Alpeninternat und von ihren österreichischen Professoren aufgesogen hatte, nach außen kehrte, wurde er bockig. Er wusste, dass sie das absichtlich tat, dieses älpische Wüten.
»Die Alexandra ist doch keine Frau für dich. Du brauchst eine, mit der du …«, sie dachte nach, und er hatte kurz den Eindruck, dass sie überlegte, was sich Falk von einer Frau wünschen könnte, das er nicht mit ihr, mit seiner Schwester hatte, »… mehr anfangen kannst.«
»Wer sagt denn, dass ich nichts mit ihr anfangen kann?«
Isolde rammte die vorletzte Nadel in ihren Haarturm und hielt noch eine zwischen den Lippen. Deshalb klang ihre letzte Bemerkung ziemlich gequetscht.
»Außer im Bett, meine ich.«
»Reden wir von etwas anderem«, brachte er heraus, sie hatte recht, sicher, einerseits. Er sah sie vor sich, Alex, wie sie auf der Terrasse halb saß und halb lag und nichts tat, als alle paar Minuten ihre Glieder ein wenig zu bewegen, einen Arm hinter den Kopf winkeln und den anderen Arm drehen, sodass die zarte Innenseite nach oben zeigte, zur Sonne. Alex, die an der Tür stand und irgendetwas sagte und eine kleine Locke bewegte sich mit dem Atem vor ihrem Mund, Alex, die über etwas lachte, das er gesagt hatte und dabei die Augen aufriss, Alex, die durch Perez’ Bar ging und eine Welle von treuen Kopfbewegungen hinter sich herzog. Alex, die sagte, ich weiß nicht, was meinst du und ihn später wissen ließ, was er meinen sollte. Alex, die sich zurücklehnte und den Kopf zur Seite drehte und sich das lange üppige Haar mit den Handrücken von der Schulter hob, als sei es zu schwer. Alex, der dann doch immer alles recht war. Oder egal war.
Isolde vollendete ihre Frisur nachdrücklich hinter dem linken Ohr.
»Willst no an?«, fragte sie versöhnlich und nickte mit dem Kopf in Richtung Espressomaschine.
»Ja gerne, Schwestermein«, antwortete er. Sie würde, das wusste er, jetzt nicht mehr über Alex und das Kind sprechen. Ihre Frisur war, wie fast immer, aufsehenerregend hoch, ein vielfarbiger Turm aus Stoff und Haar, und der verschob sich um keinen Millimeter, als sie den Kopf hinunterbeugte und die Milch ganz unten aus dem Kühlschrank fischte.
»Was macht die Karriere im Apparat?«, fragte er leichthin. Sie antwortete erst, als der Milchschaum zu ihrer Zufriedenheit zu geraten begann.
»Nicht steil, aber stetig.«
Sie drehte sich um, und er hatte dasselbe Gefühl, das er früher gehabt hatte, bevor sie anfing zu singen: Anspannung und die Vorfreude auf den ersten Ton. Mit ihrem schwarzweißen Kostüm und dem unglaublichen Haaraufbau sah sie aus, als hätte ein Kostümbildner sie eingekleidet, als zeitgenössische Brangäne, etwas in der Art.
»Ich bin als Kultursenatorin im Gespräch«, sagte sie, setzte den einen Fuß ein wenig vor, zog den Kopf ein paar entscheidende Millimeter aus den Halswirbeln nach oben wie ein großer Vogel.
»Ich wünsche dir Glück.«
Er sagte das ganz förmlich und er war aufrichtig. Er bedauerte sehr, dass sie nicht mehr sang, das wusste sie. Es gab zwei Themen, über die sie nur mit größter Vorsicht und am liebsten gar nicht mehr sprachen: Das eine war, dass sie ihre Freundinnen aus dem unbezahlten Ausbeutungsverhältnis ihrer Liebe in das einer bezahlten Assistentin zu übernehmen pflegte, beide befristet und nur dann, wenn die Trennung »ohne Szenen« verlief, wie Isolde es nannte. Und darüber, dass Isolde ihrer Managementkarriere wegen nicht nur ihren Beruf als Sängerin aufgegeben hatte, sondern sogar einer Partei beigetreten war. Falk war diese Partei suspekt, einfach weil es eine Partei war, mochte sie auch noch so umwelt- und menschenfreundlich sein. Er hätte jetzt sagen können: Da hat sich’s ja jetzt ausgezahlt. Aber er sagte es nicht. Isolde hätte geantwortet, es können ja nicht alle ein Leben lang den Trotzkopf spielen, manche müssen eben auch die Welt in Ordnung halten. Sie hatten solche Gespräche schon oft gehabt, und er musste ihr am Ende recht geben. Auch darin, dass er gerne ein Trotzkopf war und sich um die Ordnung der Welt keine Gedanken machen wollte. Ihn interessierte mehr die Unordnung, denn er betrachtete sich als Künstler.
Er sagte nochmals feierlich: »Alles Glück dieser Erde.« Und irgendetwas in ihm sagte auch, dass er von einer Schwester, die Kultursenatorin war, nur profitieren konnte. Es tat ihm aber wirklich leid, dass sie nicht mehr sang, ihre Stimme war schwer und ein wenig metallisch in den Höhen, in tiefen Lagen wie Sirup, wie Honig, wie altes Gold, sie füllte jeden großen Raum mit Selbstverständlichkeit und auf der Bühne sah selbst ihre Frisur ganz normal aus.
»Wenn’s nach dir gegangen wär, hätt ich eine Punkband gegründet«, sagte Isolde und zog Fuß und Kopf wieder zurück.
Und wurde mit einem Glattziehen der unsichtbaren Falten ihrer Jacke wieder ganz die pragmatische Kulturpolitikerin.
»Das wäre eine Verschwendung gewesen, ich geb’s zu. Du brauchst kein Publikum, Schwestermein, du brauchst ein Volk.«
Sie lachten.
Unausgesprochen stand im Raum der Satz, der die fünf Margraf-Kinder durch eine arbeitsreiche Kindheit getrieben hatte: Du hast Talent und es ist deine Pflicht, etwas daraus zu machen.
Friede kam nach genau eineinhalb Stunden zurück. Sie klingelte diskret. Erst dann steckte sie ihren Schlüssel ins Schloss. Falk war klar, dass sie für genau diesen Zeitpunkt zurückbeordert war. Sein Besuch bei Isolde war beendet.
»Wir sehn uns dann zum Essen bei Mama«, sagte er im Aufstehen. Das sagte er immer, wenn er ging.
»Nicht zum Essen heut«, Isolde griff seinen Arm und rief über den Flur: »Friedl Süße, mein Herz, geh doch schon mal rüber und fang mit der Post an, ich komm gleich.« Von Friede kam kein Laut.
»Mama hat ihren Anwalt da«, sprach sie leiser weiter, »den alten Doktor Blind und seinen neuen Adlatus, ein ziemlich geriebenes Bürschchen, wenn du mich fragst, aber elegant, egal, jedenfalls Mama will, dass wir auch kommen, es geht um irgendwelche Wichtigkeiten, Geld und Familienehre …« Sie sprach immer noch laut genug, mit ihrer vollen Stimme fast direkt in sein Ohr. Es tat weh.
Sie lauschte kurz hinaus, schien die lautlose Friede im Flur huschen zu hören, redete nicht weiter.
»Wann?«, fragte er gefügig. Er hasste solche Dinge, mit denen Mama viel Zeit verbrachte und die Isolde als Wichtigkeiten bezeichnete. Aber er war genug Margraf, noch dazu der einzige lebende männliche Margraf, um seinen Widerwillen zu überwinden. Natürlich war da noch Hanno, der jüngere Bruder, von dem in den letzten fünfzehn Jahren keine Todesnachricht gekommen war. Und auch sonst keine Nachricht, soviel er wusste.
»Komm um halb fünf.«
Es passte ihm nicht. Er wollte am Nachmittag bei Alex sein, wenn er von seinem Agenten käme, wenn er auf dem neusten Stand wäre und den Zeitplan für die nächsten Tage in der Stadt aufgestellt hätte. Er war Künstler, aber er hatte sein System.
Er wollte sie sehen, Alex, ihr Haar fallen sehen, ihren langen Hals, er wollte wissen, wie sie jetzt war, nach den fast zwei Monaten, in denen er sie nicht um sich gehabt hatte. Dass Alex ein Leben für sich allein führen sollte, war ganz jenseits seiner Vorstellung. Er hatte nie das Gefühl gehabt, dass sie irgendetwas tat, von dem er nichts wusste.
Sie hätte Heimweh, hatte sie in Madrid oft gesagt, sie wolle, dass er mit ihr nach Berlin zurückginge, und dass sie ein Kind hätten. Aber sie hatten sich doch eingerichtet dort. Und dann war sie plötzlich allein gegangen. Nach Hause. Sie hatte wirklich nach Hause gesagt. Das war seltsam, weil sie nur ein paar Jahre hier in Berlin gelebt hatte. Aber er hatte ihr das nicht übel genommen. Sie hatten sich am Telefon nicht gestritten, wenn sie sich bei ihm gemeldet hatte. Sie hatten über praktische Dinge gesprochen, über die Wohnung, über Geld, über Termine.
Bevor er abgeflogen war, hatte er sie noch einmal unter seiner alten Telefonnummer angerufen. Er hatte nur gesagt, dass er heute am Nachmittag käme. Sie wartete vielleicht schon auf ihn. Sie hatte immer auf ihn gewartet, auf Flughäfen und Bahnhöfen, und zu Hause sowieso. Wenn er aus seinem Studio kam, war sie da, einfach da. Mit einem Buch, mit einem Kaffee, mit dem Telefon, mit Nagellack, mit einer Zigarette. So würde sie auch heute da sein.
»Ich hoffe, das dauert nicht endlos.«
»Ein bisschen wird’s schon dauern. Aber was soll’s, du hast doch immer Zeit für die Mama, wenn du hier bist.«
»Aber erst am Abend, ich bitte dich. Ich habe den ganzen Tag zu tun.«
Isolde bedachte ihn mit einem begütigenden Blick, der ihn ärgerte. Er fuhr sich mit den Fingern um den Hals, wie oft, wenn er sich beruhigen wollte, und fand eine Insel unrasierter Haare. Darunter schlug Puls. Er zog die Hand zurück, als hätte ihn etwas gebissen.
»Es ist wegen der Alex, stimmt’s?«
Ja, sie kannte ihn. Schwestermein.
»Lass gut sein. Ich komme um halb fünf.«
»Die Alexandra, die läuft dir nicht weg.«
»Ich weiß«, sagte er.
Als er auf die Straße trat, hatte er plötzlich Isoldes Stimme im Ohr, wie sie sich singend spiralförmig nach unten wand, er sah sie vor sich, als er um die Ecke bog, eine Gestalt inmitten von Tönen, die sie umgaben wie ein Licht. Sie war wunderbar, wenn sie sang. Als er an der Bäckerei vorbeikam, dort, wo Friede vorher seine Kümmelstangen gekauft hatte, beschwor die Hexe Ulrica in seinem Kopf gerade den König des Abgrunds mit Isoldes Stimme.
[Menü]
Sonntag
Der Vorhang hatte sich im Klappfenster verfangen. Er wehte auf die Straße hinaus und schlug von außen gegen die Scheibe. Obwohl das Gewebe so fein war, klang es wie ein Klopfen. Der weiße Stoff bäumte sich auf und sackte wieder zusammen, zitterte in der Höhe und fiel, wölbte und entspannte sich. Sie beobachtete diese unerwartete Lebendigkeit vor ihren Augen, als gäbe es nichts Interessanteres, als gäbe es nichts anderes zu tun. Es gab wirklich nichts Interessanteres.
Es war Sonntag. Es schneite, in der Mittagsdämmerung schwebten die Flocken als Lichtpunkte vor dem Fenster. Es waren solche, die nicht liegen bleiben, viel zu dünn und durchsichtig, um irgendetwas zu bedecken, nicht einmal den halb weggetauten Matsch der letzten Tage, nicht den Müll, der auf den Pfützen schwamm, oder den spitzen Streukies, der in den Rillen der Schuhe stecken blieb und auf dem Steinboden im Hauseingang kreischte. Es war einer der längsten und dreckigsten Winter, den sie je in dieser an dreckigen Wintern nicht armen Stadt erlebt hatte, vier Monate Dunkelheit, ein kaltes Warten darauf, dass das Leben irgendwann wieder weitergehen würde mit Blättern an den Bäumen, mit Licht und Wärme.
Es war an diesem Tag noch gar nicht richtig hell geworden und würde halb dunkel bleiben bis zur Nacht. Die Gegenstände im Zimmer warfen keine Schatten, die Menschen auch nicht, alle Umrisse wie verwischt, die beiden Kinder hätten auch Zwerge sein können, vor allem der kleine Rafi mit seinem großen Kopf, und sie selbst Schneewittchen, oder eher die Böse Königin. Aber es war alles so normal, Mutter und zwei Kinder, die an einem Wintertag einem verschmutzten Vorhang beim Flattern zuschauten.
Kuck, Rafi, sagte Wanda in feierlichem Ton zu ihrem kleinen Bruder, das da ist ein Gespenst.
Rafi drehte seinen großen Kopf von dem zappelnden Vorhang weg, hin zu Wanda und schaute zu ihr auf. Er tat das sehr langsam, wie er alles tat, nickte und drehte sich dann gehorsam wieder zum Fenster.
Alexandra sah kein Gespenst, so sehr sie sich auch anstrengte. Das Einzige, was ihre erwachsene Fantasie hergab, war eine Fahne, eine weiße Fahne der Ergebenheit, die idiotisch über einem Berliner Bürgersteig wehte. Oder ein Segel, das nicht richtig am Wind lag, sie war nur einmal Segeln gewesen, es war schön gewesen und wahnsinnig lange her.
Gib, sagte Rafi und streckte die linke Hand nach dem Vorhang aus, mit der rechten hielt er sich an Wandas Hosennaht fest.
Das kannst du nicht haben, Wanda sprach jetzt mit ihrer Märchenstimme, so redete sie meistens, wenn sie ihrem kleinen Bruder Geschichten erzählte. Das ist ein wildes Gespenst, es braucht Freiheit. Es muss fliegen, wohin es will, über die Dächer davon und bis in den Himmel, hui, hui …
Rafi zog die Schultern an die Ohren und verzog das Gesicht, gleich würde er weinen.
Wir können es nicht ins Haus holen, weil Gespenster machen nachts immer Krach, fuhr Wanda fort, und dann können wir nicht schlafen.
Rafi beruhigte sich sofort wieder, er glaubte Wanda alles.
Kinder, es ist nur ein Vorhang.
Alexandra begann, die verschmutzte, wehende Stoffbahn ins Zimmer zu ziehen.
Kuck, es wehrt sich, flüsterte Wanda.
Es gibt keine Gespenster, sagte Alexandra jetzt mit Nachdruck.
Rafi fing jetzt wirklich an zu weinen.
Doch, Gespenster gibt es do-och, Wanda wieder, mit der Entschiedenheit ihrer sechs Jahre, Mama lügt jetzt, weil sie denkt, dass wir Angst haben. Haben wir aber nicht.
Sie hob den Kopf und richtete ihre weit auseinander stehenden Augen direkt und erbarmungslos wie Scheinwerfer auf Alexandras Gesicht.
Niemand sonst sah sie je so an. Hatte sie je so angesehen, auch Wandas Vater nicht.
Sie verteidigte sich nicht. Sie hätte zugeben können, dass sie gelogen hatte, ja, es gibt Gespenster, natürlich gibt es die, und ja, sie kommen und erschrecken einen, besonders nachts, aber wie Vorhänge sehen sie nicht aus. Sie sind wie ganz normale Menschen, die sie ja einmal gewesen sind, sie reden auch so, vielleicht etwas unverblümter, sie sind nur blasser und ihre Gesichter sind unscharf. Man kann mit ihnen sogar reden, aber es nützt nichts, sie etwas zu fragen, weil sie keine Antworten geben. Sie sagen sowieso nie etwas, das man nicht schon weiß. Manchmal lachen sie, aber nur leise. Sie sind vollkommen unempfindlich und man kann ihnen nicht wehtun, selbst wenn man das wollte. Man will aber nicht. Man will, dass sie bleiben, und am leichtesten verscheucht man sie, indem man so tut, als seien sie nicht da.
Aber wozu hätte sie den Kindern das sagen sollen, sie hätten nur Angst bekommen. Wanda hatte recht. Sie log lieber.
Sie holte die Leiter und nahm den Vorhang ab. Sie hasste es, auf Leitern zu stehen, auf einem so winzigen Scheibchen Holz hoch über dem Boden. Die Kinder hielten unten fest, während sie mit Klammern und Schienen kämpfte, es war beruhigend, dass die beiden da unten waren, auch wenn es nichts nützen würde, wenn die Leiter wirklich anfing zu wackeln, sich zu neigen, wenn sie kippte, die Kinder konnten sie dann nicht halten. Trotzdem war es beruhigend, wie sie da standen, Zwerge im Zwielicht, und als sie mit dem Vorhang unterm Arm wieder festen Boden unter den Füßen hatte, hätte sie sie gerne umarmt.
Aber sie schnappten sich den Vorhang und spielten Gespenst, Rafis entzücktes Kreischen klang wie der Streukies unter den Sohlen.
Wie so oft stellte sie sich vor, Wanda alles zu erzählen, wie würde sich das anhören, dein Vater war Musiker, Wanda. Aber das wusste Wanda schon. Er war berühmt, jedenfalls ein bisschen. Das wusste sie auch schon. Er war der Mann, den ich liebte, und er liebte mich. Das klang schon falsch. So unerträglich falsch, dass es von den Zähnen bis zu den Ohren wehtat.
Immer wieder fing sie an, sich eine Geschichte zurechtzulegen, aber es gab so vieles, das sie selbst nicht wusste, die Ungereimtheiten, die Lücken, so vieles, das sie selbst nicht verstand und auch nicht wissen wollte. Aber irgendwann würde sie Wanda sagen müssen: So ist es gewesen, Wanda. So war dein Vater.
Sie müssen sich Ihrer Geschichte stellen, hatte Bengtsson gesagt, der Psychiater, er sagte gerne solche vorhersehbaren Dinge, er war ein sanftes Rindvieh mit feuchten braunen Augen, ein Ochse, um genau zu sein, der auf ihre Weiblichkeit nicht im Geringsten reagierte, aber vielleicht war ja gerade das der Grund, warum sie zu ihm ging. Dass er ihr die kleinen gelben Pillen verschrieb, war ein weiterer Grund, der bessere wahrscheinlich. Und er beruhigte sie. Er verstand, dass sie in einem Ausnahmezustand lebte und Beruhigung nötig hatte, sonst verstand das niemand: Nach sieben Jahren, dachten alle, neuen Männern und zwei Kindern war doch wirklich alles vorbei.
Und eigentlich wusste sie selbst nicht einmal, was für einer Geschichte sie sich denn stellen sollte. Und was hieß das überhaupt, sich stellen, sie war ja keine Verbrecherin, sie hatte nichts getan und nichts zu gestehen, vor welchem Richter denn, und die reine Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit, das war sowieso unmöglich.
Was hast du die ganze Zeit gemacht? Das war keine Frage, das war ein Vorwurf, den sie nicht entkräften konnte, weil sie es einfach nicht mehr wusste, sich nicht erinnerte, und was nützte es auch, es war alles eben so gekommen und dafür konnte man ihr nicht die Schuld geben.
Was sie brauchte, war eine Geschichte, die sie Wanda erzählen konnte, vielleicht nicht gleich, später, wenn das Kind alt genug wäre, wenn es nicht mehr so unschuldig, wenn es ihr selbst ähnlicher wäre.
Ihre Tochter hat ein Recht darauf, hatte Bengtsson gesagt, es ist auch ihre Geschichte.
Aber das stimmte nicht, es war nicht Wandas Geschichte, es war die Geschichte ihrer Eltern, die Geschichte von Alexandra Zelinski und Falk Margraf, die irgendwann aufgehört hatte, ein gute Geschichte zu sein, und sozusagen tragisch geendet hatte, oder wie man das nun nennen wollte, Falk hätte das Wort tragisch bestimmt unangemessen gefunden, er hätte wahrscheinlich gelacht und ein anderes, ein besseres gefunden.
Der Schnee fiel immer noch so dünn. Sie wandte sich vom Fenster ab und hörte sofort auf zu denken, das konnte sie, es funktionierte immer, und sie vergaß, bis zum nächsten Mal, was sie gedacht hatte.
[Menü]
Montag
Am nächsten Nachmittag ging sie mit den Kindern in den Park mit dem Schlitten, zum einzigen Hügel der Gegend. Die Bäume standen schwarz gegen den Himmel, von hier unten hatten sie damals auf die Bomber geschossen, Flak, vom Hochbunker, der inzwischen eine Ruine war. Auf dem aufgetürmten Schutt von zerstörten Häusern konnte man jetzt Schlitten fahren, über alles war der Park gewachsen. Das Leben geht weiter, hätte Bengtsson gesagt. Und: Alles hat auch sein Gutes, man muss das Positive in den Dingen sehen. Der Schnee fiel dünn, wie seit Tagen, wie in ihrer Erinnerung. Sie rodelten halb auf gefrorenen Grashalmen und halb auf dreckigem Weiß. Es war sehr kalt.
Wenn jemand sie beobachtet hätte, hätte er eine glückliche Familie bei Winterfreuden gesehen, Winterfreuden auf Ruinen, aber die sah man ja nicht mehr, und dass der Vater fehlte, wäre ja normal gewesen an einem Werktag.
Die Kinder waren süß in ihren bunten Mützen und sie hatten wirklich Spaß mit ihrem Schlitten, bis ihre Hände und Füße kalt wurden. Wanda wollte sofort ein Fußbad und heißen Kakao, sie zappelte vor Kälte und hatte die Hände im Handschuh zu Fäusten gerollt, sodass die Fingerlinge leer hinunterhingen. Rafi nickte, ihr kleiner Sekundant, die furchtbar feinen Schneeflocken zergingen auf den grünen Rentieren seiner Mütze. Am Reißverschluss des Anoraks baumelte ein winziger Tropfen, der ihre Aufmerksamkeit unerbittlich einfing.
Es war ganz still, wie es manchmal ist, wenn es schneit, der feine Schnee, derselbe wie damals auf dem Friedhof.
Auch da hatte es dünn und durchsichtig geschneit, aber der Boden war noch weich gewesen, es hatte noch keinen richtigen Frost gegeben, Anfang November.
Auf dem mit feinem Kies bestreuten Weg schwankte der Sarg auf dem Karren, neigte sich mit jeder Drehung der hohen Räder ein wenig nach links und stand dann wieder gerade. Sie hätte es angenehm gefunden, so geschaukelt zu werden.
Sie ging hinterher. Auf dem Sarg lag eine Schicht perlender Feuchtigkeit, die an der linken Ecke, direkt vor ihren Augen, zu einem Tropfen zusammenlief. Sie wartete auf den Moment, in dem der Tropfen fallen würde. Die Schuhe der alten Frau neben ihr knarrten bei jedem Schritt. Der Tropfen war irgendwann weg. Der Schnee zerging auf dem Kies. Es war ein langer Weg. Der Tropfen kam wieder.
Sie hatte im Krankenhaus Medikamente bekommen, kleine gelbe Pillen, die alles unterhalb des Halses zu einer festen weißen Fläche machten, es fühlte sich an, als steckte sie in einer Steinplatte, nicht unangenehm, nur ungewohnt. Mama neben ihr marschierte genau in der Mitte des Weges und hielt eisern ihren Arm. Sehr fest. Es war natürlich nicht ihre Mutter, sondern seine. Es war ja auch nicht ihre Beerdigung, aber niemand ging zu seiner eigenen Beerdigung, sie hätte beinah gelacht, weil es komisch war.
Ihre Füße liefen in der Spur, die das linke Rad des Karrens in den Weg gezogen hatte. Mamas Schuhe knarrten rhythmisch und ohne Pause. Man sagte, dass Schuhe knarrten, wenn sie nicht bezahlt wären, als ob Mama je in ihrem Leben irgendetwas nicht bezahlt hätte, das war unvorstellbar, Mama war immer untadelig und ihre Schuhe Maßanfertigungen, wie alle ihre Schuhe, mit exakt vier Komma acht Zentimetern Absatz. Mama weinte nicht. Sie gingen langsam, viel zu langsam für diese Kälte, auf Mamas anderer Seite ging Isolde, zwei Köpfe höher fast mit ihrer hohen steifen Frisur, wie eine Pharaonin, sie hätte einen Stab tragen sollen und einen Knebelbart. Alexandra dachte lauter Dinge, die sie nicht hätte denken sollen, unpassende Dinge. Sie dachte viel und fühlte nichts. Abschiednehmen. Sie sollte Abschied nehmen, stattdessen dachte sie an das Revers von Falks Lieblingsjackett, das immer nach innen knickte, und dass sie ihm jetzt einen Anzug angezogen hatten. Sie hätten ihm das verwaschene blaue T-Shirt lassen sollen und das Jackett mit dem geknickten Revers, oder die Kleider, mit denen er zuletzt vor ihrer Tür gestanden hatte.
Aber es war sowieso alles falsch, es war einfach unglaublich, alles war vorbei, alles, und sie taten alle, als sei das normal. Hinter ihnen knirschten die Schritte der Freunde, der Leute, die an ihrem Tisch gesessen hatten, schleiften durch Kies und Feuchtigkeit, unter den tropfenden Bäumen mit ein paar letzten Blättern, unter Gemurmel, das man ganz leise hörte, ein Gemurmel, das ihr bestimmt nicht wohlgesonnen war. Ihre Füße in den dünnen Stiefeletten waren eiskalt. Sie hatte keine Schuhe für einen deutschen Winter. Sie war hier falsch, ganz falsch, falsch alles andere, falsche Freunde, die falsche Mutter. Aber Mama wenigstens hielt sie fest.
Sie spürte den Druck an ihrem rechten Unterarm, als hätten sich Adlerklauen hineingegraben, Mamas Hände mit den langen beweglichen Fingern, wie Falks Hände, wie Krallen in Lederhandschuhen. Sie konnte sich nicht losreißen, in Beerdigungszügen waren jähe Bewegungen zu auffallend, wollte es auch nicht, ohne Mama wäre sie völlig aus der Rolle gefallen.
In Wirklichkeit war es Wanda, die an ihrem Arm zerrte und vor Kälte zu weinen begann und vor Wut auf Alexandra, die nichts tat, nur einfach herumstand, während ihr kalt war. Rafi hüpfte auf der Stelle. Sie hatte die beiden für ein paar Sekunden einfach vergessen.
Kommt, wir gehen ins Warme, und sie umarmte ihre Kinder schnell und fest, wie ihre Oma sie immer umarmt hatte, und dann fuhren sie noch einmal den Berg hinunter, die Kinder genossen es nicht mehr, aber sie, sie genoss es sehr, sie lebte, auch wenn sie fror, sieben Winter hatte sie ihm voraus, ihrem Toten, ihrem Dahingegangenen, wie der Leichenredner gesagt hatte, der ein professioneller Humanist gewesen war.
Und jetzt, in einem Leben ohne ihn, brachte sie ihre Kinder ins Warme, kochte Kakao, setzte sie in ein heißes Bad. Es war ein Triumph, Leben, Weitermachen, auch wenn man dabei allein war. Die beiden schliefen bald ein, sogar Wanda, die sich meistens weigerte, zusammen mit dem Kleinen ins Bett zu gehen.
Wandas Lider schimmerten bläulich im Schlaf. Das hatte nichts zu bedeuten, hatte der Arzt gesagt, kein Anzeichen für eine Krankheit, aber sie konnte es trotzdem nicht lassen, legte immer wieder den Kopf auf Wandas Brust, wenn sie schlief, und hörte ihrem kindlichen Herzschlag zu, schnell und gleichmäßig. Auf dem Kopfkissen mischte sich ihr eigenes dickes Haar mit Wandas feinem Kinderhaar, fein wie Falks Haar. Aber alles war gut.
Sie müssen jetzt an Ihr Kind denken, hatte Bengtsson damals gesagt, kurz bevor sie sie gehen ließen aus der Krisenstation. Sie hatten die Schwangerschaftshormone in ihrem Blut gefunden und es ihr dann gesagt. Es war wie in einer Seifenoper.
Dr. Bengtsson, Psychiater und Therapeut mit aufrichtigem Ochsenblick: Sie-müssen-jetzt-an-Ihr-Kind-denken, er sagte es auf wie Frauenarzt Dr. Moebius aus der gleichnamigen Fernsehserie, gütiger Blick, Schnitt, Nahaufnahme auf das Gesicht der Patientin, in dem es sichtlich zu arbeiten beginnt, Schnitt, und das nächste Mal, wenn man die Patientin sieht, geht sie heiteren Schrittes zur Tür hinaus und sagt zum Abschied noch zu Frauenarzt Dr. Moebius: Sie haben mir wieder Mut gemacht, Herr Doktor, ich danke Ihnen.
So hatte er sich das vielleicht vorgestellt, Bengtsson, als er zu ihr sagte: Sie müssen jetzt an Ihr Kind denken, es braucht Sie, und je besser Sie sich fühlen, desto besser wird es ihm gehen.
Sie hatte also an ihr Kind gedacht und sich gut gefühlt. Das Gutfühlen war mit diesem Steinplatten-Medikament nicht allzu schwer, sie war niemals verzweifelt und auch nicht wirklich unglücklich. Sie konnte sich nur lange nicht daran gewöhnen, dass sie auf einmal allein war und ein Kind bekam und noch dazu kein Geld hatte.
Sie wurde Mutter und Witwe, man wächst in seine Rollen hinein. Die Reihenfolge war ja andersherum gewesen, Witwe und Mutter, wie absurd. Obwohl Witwe: Juristisch gesehen war sie das nicht, verheiratet waren sie nicht gewesen, geerbt hatte sie nichts. Sie war nur zurückgeblieben wie ein Haustier, sein Haustier, die gelehrige und zahme Alexandra, trächtiges Haustier dann, nunmehr herrenlos, später Muttertier. Sie hatte nichts, nur das Kind, an das sie denken und dessentwegen sie sich gut fühlen sollte.
Aber dann kam Wanda zur Welt und schrie, ihr Herz schlug stetig, sie war gesund, sie wuchs, sie lachte, Wanda, deren Haar dünn und weich auf dem Kissen lag, Wanda, die im Schlaf ganz leise seufzte, Wanda, die am Morgen mit einem einzigen Lidschlag die Welt in Drehung versetzte, Wanda, die rote Kleider liebte. Wanda schwitzte im Schlaf, im Haaransatz bildeten sich kleine Löckchen vor Feuchtigkeit. Das Nachthemd war bis zu den Achseln hinaufgerutscht. Wanda würde da sein, wenn sie nicht mehr da war. Es blieb immer jemand übrig. Jemand, der triumphierte. Rafi schnarchte zart wie eine Katze. Auch er würde da sein, aber vielleicht würde er sich gar nicht an sie erinnern.
Sie wanderte durch die Wohnung und löschte die Lichter.
Das kleine Vorderzimmer war dunkel, wie immer, außer wenn Rafael, Rafis Vater, angereist kam, um seinen Sohn zu besuchen oder ihn abzuholen. Sie hatte schon lange vor, ein Zimmer für Rafi daraus zu machen, nahm sich immer vor, damit anzufangen, wie sie sich vornahm, Wanda alles zu sagen. Aber das Zimmer war voller unsichtbarer Dinge, verborgen in Kisten und Schränken, Dinge, die ihr und Falk gehört hatten, und einer Blechkiste, die ihre war, aber seit seinem Tod hatte sie nie wieder hineingesehen: Es waren alte Briefe darin, und wahrscheinlich lauter Zettel, Postkarten, Programmhefte, Fotos, Hotelprospekte, Schiffsfahrpläne, Heirats- und Geburtsanzeigen, all das Zeug, das man aufhebt, nur um es nicht wegzuwerfen, zu keinem anderen Zweck.
Aber Wanda hatte irgendwie ein Recht auf all das, laut Bengtsson, jedes Kind hätte das Recht auf seinen Vater, auch wenn es ein toter Vater war, egal.
Und so lagen die Papierfetzen ihres früheren Lebens hier herum, auch wenn es vergessen und nicht mehr wichtig war, denn dass sie Witwe war und all das, was hieß das schon, als ob die Welt nicht voller Witwen wäre, und sie war ja nicht einmal eine echte.
In den übrigen Kisten waren wahrscheinlich nur verdorbene Kleider, Tischwäsche und alte Noten, nach denen sie nicht mehr singen würde. Eine dicke Papprolle gab es, in der wahrscheinlich irgendwelche Kunstdrucke steckten. Sie würde das alles auspacken und wegwerfen, vielleicht morgen schon, nur die Kiste behalten, nur das Wichtigste aus der Kiste, für Wanda.
[Menü]
Dienstag
Sie brachte die Kinder zur Schule und zum Kindergarten. Sie setzte sich an ihren Schreibtisch und überprüfte die Überweisungen für Rafi, das Geld kam herein, alles war in Ordnung. Danach war sie entschlossen, in das kleine Vorderzimmer zu gehen und die Blechkiste zu öffnen. Sich ihrer Geschichte zu stellen. Auf dem Weg dorthin trat sie auf einen unter dem Teppich versteckten Legostein. Sie trug ihn ins Kinderzimmer und warf ihn zu den anderen. Sie hob ein Puppenkleid auf und legte es in die Schublade. Sie stellte den Roller in die Ecke. Sie fand angebissene Kekse und einen halben Apfel, schon ganz braun, in Rafis Bett. Es war still im ganzen Haus. Sie warf Handpuppen in die Truhe. Der Deckel fiel krachend zu. Danach war es noch stiller als vorher.
Sie hatte sich früher ihr Leben nie als etwas Stilles ausgemalt. Es war irgendwie immer voller Stimmen gewesen, Singstimmen, Sprechstimmen, Vogelstimmen. Musik, Fragen und Antworten, die Schreie der Paranoiker und Schwerbehinderten im Stift von Helfenbach, Wind und Glocken und ferne Geräusche von Leuten, die irgendetwas taten. Im Stiftsgarten hatte man das Kreischen von Sägen gehört, Hühnergackern, die Axt des Gärtners. Sie hatte damals schon gewusst, dass sie einmal in der Großstadt leben würde, wenn sie groß wäre, aber nie geglaubt, dass eine Großstadt so still sein würde. Vor ihrem Fenster gab es andere Fenster, wenn man hinaussah, sah man gleich wieder woanders hinein, man sah Menschen sich bewegen, man sah sie reden, aber man hörte nichts. Und zwischen Fenster und Fenster nur ein stummer einziger Baum, von dem der Schnee langsam verschwand.
Es war jetzt mehr als sieben Jahre her. Wenn es im Leben so etwas wie eine Symmetrie gab, Zyklen, irgendwas, eine Ordnung der vergehenden Zeit, dann musste sich etwas ändern.
Am Nachmittag auf dem Rückweg vom Kindergarten waren vom Winter nur noch Matsch und Pfützen übrig. Rafi trat ins Wasser, dass es ihr an die Knöchel spritzte. Sie ging schnell und zog ihn hinter sich her, bis sie außer Sicht waren, bis die munteren Mütter, engagierten Väter und aufgeweckten Kinder ihnen nicht mehr nachschauten, die Erzieherin, die Rafi nachdrücklich ermuntert hatte, seine Mütze selbst vom Haken zu nehmen und sich aufzusetzen. Er tat nichts dergleichen, das tat er nie. Er stand stumm und schaute zu Boden, und dann nahm sie es in die Hand, sie war schließlich seine Mutter, zog sie ihm das Ding auf den Kopf, die süßen gestrickten Rentiere zerknautscht und verkehrt herum, unter dem missbilligenden Blick dieser Veronika oder Monika, sie vergaß den Namen jedesmal. Beim nächsten Elternabend würde es wieder heißen, Rafael ist in der Entwicklung zurück und man muss besonders viel Geduld mit ihm haben, und alle würden sie ansehen, aber keiner würde etwas sagen.
Die Erde unter den Straßenbäumen sah schimmlig aus.
Rafi trat noch einmal ins Wasser, mit aller Kraft, sodass ihre Strümpfe nass wurden bis zu den Knien. Sie riss ihn am Arm, zerrte ihn aus der Pfütze. Er taumelte hinter ihr her, und als sie zu ihm hinunterschaute, blickte er auf und schloss dann ganz schnell die Augen.
Zu Hause zog sie die nassen Strümpfe aus, ihre Fußnägel waren hässlich, ungepflegt, aber wer sah schon ihre Füße, mitten im Winter, außer den Kindern? Und außer Monin, der nicht da war, der ja fast nie da war, und solange sie keinen Unfall hätte und sie ihr im Krankenhaus die Strümpfe ausziehen müssten, sähe keiner ihre Füße. Ihre Oma hatte immer gesagt: Zieh frische Sachen an, du müsstest dich ja schämen sonst vor den Ärzten.
Aber sie hatte sich schon so viel geschämt, abgesplitterter Nagellack war wirklich kein Grund, außerdem neigte sie nicht zu Unfällen, ihr war nie etwas geschehen, nicht als sie auf der Bühne mit dem Kopf nach unten geschaukelt hatte, nicht beim Balancieren auf der Balustrade hoch über Madrid. Sie hatte auch Falk überlebt, ihr passierte nichts, es passierte anderen. Deshalb hatte sie kein Testament gemacht, obwohl Monin ihr ausführlich erklärt hatte, was sie schreiben sollte, worauf zu achten wäre und so weiter, Monin ihr Anwalt und Liebhaber, Monin, der Wanda zu ihrem Erbe verhelfen sollte.