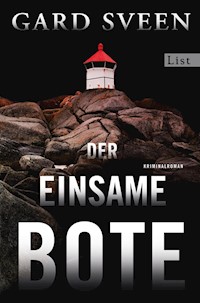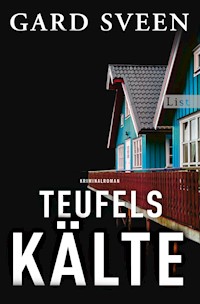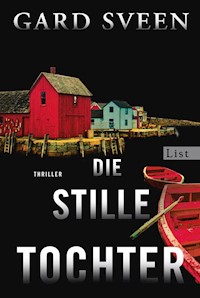
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wer ist Freund und wer ist Feind? Oslo, 1982: An einem eiskalten Dezembertag verschwindet die ehemalige DDR-Bürgerin und KGB-Agentin Christel Heinze. Hat ihre große Liebe Arvid Storholt, ein berühmt berüchtigter Doppelagent, damit zu tun? War es wirklich wahre Liebe oder nur eine Gelegenheit zum Verrat? Oslo, 2016: In einem See werden die Überreste einer Frauenleiche gefunden. Kurz darauf wird Arvid Storholt ermordet. Tommy Bergmann, selbstzerstörerischer Ex-Polizist, ermittelt für den norwegischen Geheimdienst. Gibt es eine Verbindung zwischen der toten Unbekannten und dem ermordeten Sowjetagenten? Tommy Bergmann stößt auf einen alten Skandal, der auch ihm selbst gefährlich werden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Die stille Tochter
Der Autor
GARD SVEEN, geboren 1969, ist Staatswissenschaftler und arbeitet als Seniorberater im norwegischen Verteidigungsministerium. Sein Debüt Der letzte Pilger wurde mit dem Rivertonpreis 2013 und dem Glass Key Award 2014 als bester Krimi Skandinaviens ausgezeichnet. Er stand damit wochenlang auf der Spiegel-Bestsellerliste. Gard Sveen lebt in Ytre Enebakk, einem kleinen Ort in der Nähe von Oslo.
Das Buch
Ein hochspannender Krimi zu Zeiten des Kalten Krieges: Im November 1973 reist die 17-jährige Schwimmerin Christel Heinze aus Ostberlin mit ihrer Mannschaft zu einem Wettkampf nach Oslo. Nach minutiöser Planung wagt sie die Flucht vom Hallenbad zur nächstgelegenen U-Bahnstation. Der Stasi-Beauftragte dieses Auslandswettkampfes ist ihr dicht auf den Fersen, doch sie entkommt. Über die westdeutsche Botschaft wird sie in die Freiheit nach Deutschland geschickt. Für ihr Studium kehrt Christel einige Jahre später nach Oslo zurück. Innerhalb weniger Jahre wird sie unfreiwillig zur KGB-Agentin und verschwindet schließlich irgendwann spurlos. Was ist geschehen? Erst im Jahr 2016 stößt Tommy Bergmann auf eine mögliche Spur. Da er vom Polizeidienst suspendiert wurde, hat er nichts zu verlieren und keine Angst davor, sich mit den Mächtigen anzulegen. Doch die wollen ihre Geheimnisse nicht preisgeben …
Gard Sveen
Die stille Tochter
Thriller
Kriminalroman
Aus dem Norwegischen von Günther Frauenlob
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
ISBN: 978-3-8437-2034-2© 2019 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinThis translation has been published with the financial support of NORLA.Alle Rechte vorbehaltenSchutzumschlaggestaltung: Cornelia Niere, MünchenUmschlagabbildungen: © GettyImages/ Bob LussierE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.com
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Teil 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Teil 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Prolog
Oktober 2016Nes, Akershus
Arvid Storholt stand oben im Dachzimmer, als es unten klingelte. Mit einem Mal fühlte er sich krank, als würde er Fieber bekommen. Wer klingelte denn jetzt? So weit ab vom Schuss, wie er wohnte?
Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr und dachte, dass er sich ihrer längst hätte entledigen sollen. Sie erinnerte ihn an Dinge, an die er sich eigentlich nicht mehr erinnern wollte.
Unten an der Tür klingelte es ein weiteres Mal.
Er beugte sich zu dem Teleskop vor, das er im Dachzimmer aufgestellt hatte, und studierte den dunklen Himmel über der hügeligen Landschaft am westlichen Ufer der Glomma.
»Alexia, kannst du aufmachen?«, rief er.
»So spät nicht mehr«, sagte sie. Dem Klang nach stand sie direkt unter der Treppe.
Storholt ging zum Treppenhaus und schrie fast nach unten: »Du musst keine Angst haben. Das ist bestimmt nur der Nachbar.«
Mit dem Nachbarn meinte er den Bauern auf dem Hof, oder besser Gut, das fast einen Kilometer entfernt lag. Arvid Storholt hatte dieses sogenannte Gesindehaus vor fünfzehn Jahren im Netz gefunden und ungesehen gekauft. Es kam tatsächlich vor, dass der Bauer vorbeikam, manchmal sogar zu den merkwürdigsten Zeiten, als gehörte das Haus noch immer ihm. Er hatte es seinerzeit für seine Tochter renoviert, die sich aber hatte scheiden lassen und nach Oslo gezogen war.
»Okay«, sagte Alexia widerwillig.
Sie hatte sich in Norwegen nie richtig eingelebt und spürte noch immer, wie die Leute im Supermarkt sie anstarrten.
Manchmal kamen alte Kommunisten zu ihm und sagten, dass sie es gut fänden, was er getan hatte. Dass er dem Imperialismus die Stirn geboten habe … Die meisten behandelten ihn aber wie einen Zurückgebliebenen. In zwei Wochen wollten sie zurück in ihr Haus in Glyfada bei Athen und dort bis Anfang April bleiben. Er wollte nur noch den letzten Rest des norwegischen Herbstes genießen. Außerdem hatte er Kinder und Enkel hier, die ihn trotz der Erniedrigung, die sie durch ihn erfahren hatten, gernhatten.
Storholt sah noch einmal durch das Teleskop, aber der Himmel hatte sich in der letzten halben Stunde mehr und mehr zugezogen. Dann drückte er es etwas nach unten und verfolgte ein paar Autos auf dem Weg in Richtung Kongsvinger. Scheinwerfer huschten über die Hauptstraße, unterbrochen durch die lange Reihe der Bäume, die am anderen Ufer der Glomma standen.
War er auf der Suche nach der Vergangenheit? Nach einem Helikopter, der ohne Licht über die Glomma flog und das Feuer auf das Fenster eröffnete, hinter dem er stand? Begnadigt nach acht Jahren. Er war wirklich verflucht billig davongekommen. Nachdem er die Strafe abgesessen hatte, war es ihm gelungen, in Griechenland, Russland und zuletzt auch in Norwegen das reinste Geschäftsimperium aufzubauen.
Eine Minute verging, vielleicht auch mehr. Unten im Erdgeschoss war es seltsam leise.
Er hätte sich kein so großes Haus kaufen sollen, dachte er, lieber zu jeder Zeit den kompletten Überblick haben. Sein Führungsoffizier, Sascha, hätte das Haus nicht gemocht. Wegen der fehlenden Fluchtmöglichkeiten. Storholt hatte sich aber nicht einmal die Mühe gemacht, oben im ersten Stock eine Feuerleiter zu montieren.
»Alexia?«
Keine Antwort von unten.
Mit einem Anflug von schlechtem Gewissen wurde ihm bewusst, dass er Alexia zu öffnen gebeten hatte, weil er selbst Angst hatte.
Was für ein Scheiß!, dachte er gleich darauf, ließ das Teleskop stehen und ging mit raschen Schritten zur Treppe und nach unten.
»Alexia? Verdammt! Jetzt gib doch Antwort.«
Als er am Fuß der Treppe stand, sah er, warum sie nicht geantwortet hatte.
Sie lag im Flur, das Gesicht ihm zugewandt, blendend weiß, als hätte sie schon jetzt alles Blut verloren.
Er versuchte einen Schritt auf sie zuzugehen, aber seine Beine wollten ihm nicht gehorchen.
»Weißt du noch, was Sascha immer gesagt hat?«, hörte Storholt irgendwo von links. »Einem Mann, der sein Land freiwillig verrät, kann man nicht trauen.«
Storholt schüttelte langsam den Kopf, doch es gelang ihm nicht, sich umzudrehen. Er blieb wie angewurzelt auf dem afghanischen Teppich vor der Treppe stehen. Seine Hand tastete nach dem Handlauf.
Er riss den Blick von seiner Frau los und sah zu den Schuhen am Ende des Teppichs hinüber.
Dann erblickte er das Messer, es war so klein, dass man es im Ärmel der Jacke verstecken konnte.
Erst jetzt erkannte Storholt das Gesicht.
»Du?«, rutschte es ihm heraus.
»Sascha ist bald tot, Arvid.«
»Tot?«, wiederholte Storholt, als hätte er diesen Gedanken selbst noch nie gehabt.
»Er hat mich gebeten, dir noch einen letzten Besuch abzustatten.«
Teil 1
Vier Monate zuvorJuni 2016Enebakk
1
Piotr Woźniak umklammerte die Ruder fest mit seinen Händen und dachte, dass er in ein paar Minuten am Storholmen sein würde, wenn er einfach weiterruderte. Wenn er zu oft über die Schulter schaute, würde er aus dem Takt kommen. Er musste seinen Blick auf das Heck des Boots heften, nur dann fühlte sich die Strecke bis zur größten der beiden Inseln im See Mjær nicht so lang an. Es war warm, viel wärmer, als er es hier oben für möglich gehalten hatte. Ob es stimmte, was gesagt wurde? War das Fischfleisch bei dieser Wärme wirklich schlechter? Wenn er denn überhaupt etwas fing.
Er hielt die Angel mit dem Fuß fest, damit sie nicht ins Wasser rutschte, sollte ihm beim Schleppen wider Erwarten etwas an den Haken gehen.
Sein Vermieter, Petter Bruvik, dem der gut einen Kilometer nördlich gelegene Hof gehörte, schüttelte immer nur den Kopf über ihn. »Die Fische da unten kannst du nicht essen, auch wenn das Angeln da nichts kostet«, hatte er gleich gesagt, als Piotr im Mai zum ersten Mal zum Fischen gegangen war. »Solltest du es trotzdem tun, denk dran, dass Brachsen voller Gräten sind und Barsche allenfalls als Katzenfutter taugen. Und was Hechte machen, weißt du, oder?«
Piotr hatte nur den Kopf geschüttelt und gesagt, dass es ihm egal sei, was der Hecht mache, solange das Fischen nur nichts koste.
»Hechte fressen tote Menschen«, hatte der Bauer gesagt.
»Du machst Witze.«
»Warum, glaubst du, werden die so groß?«, hatte der Bauer gesagt. »Das sind Krokodile, Piotr. So etwas darfst du deinem Kind nicht vorsetzen. Und von dem Seeungeheuer in der Telemark hast du doch wohl schon gehört, oder? Das lebt auch in einem See.«
Piotr hatte nur gelacht. Er wusste, dass Norweger seltsam waren, aber Petter Bruvik übertrieb es wirklich mit seinen Ungeheuern.
Er hatte am nördlichen Ende des Sees, wo der Hof lag, schon eine halbe Stunde vergeblich gefischt und sich dann entschieden, der südlichen Strömung, die durch den See zog, zu folgen, um sein Glück vor dem Schilfgürtel am Südende zu versuchen, unweit des Ausflusses.
Nach ein paar Minuten war er an der Insel. Er legte an und blieb einen Moment beunruhigt sitzen. Eigentlich mochte er diese Seen nicht. Besonders diesen. Das Wasser war so schwarz, dass man nichts sehen konnte, und wenn es regnete, wurde es gleich braun und schlammig. Er zog das kleine Ruderboot an Land, legte die Angel auf den Boden und vertäute das Boot an einer Kiefer, die sich an der spärlichen Erdkruste der Felseninsel festklammerte.
Er wedelte eine aufdringliche Libelle weg und ließ seinen Blick über die stille Wasserfläche schweifen.
Wie tief mochte es hier sein? Vermutlich ziemlich flach, dachte er beruhigt und spürte, wie müde er war. Er hatte die ganze Woche bei einem örtlichen Schreiner gearbeitet und dem Bauer nach Arbeitsschluss dann noch in der Scheune geholfen. Und nachts hatte ihn seine knapp acht Monate alte Tochter wachgehalten.
Eine halbe Stunde blieb er dösend unter den Bäumen auf der Insel liegen.
Als die Hunde auf dem Hof auf der Ostseite des Sees anschlugen, schrak er auf. Der schwache Wind musste gedreht und die Laute mit sich gebracht haben. Eben war außer dem leisen Rauschen des Verkehrs auf der Westseite des Sees noch nichts zu hören gewesen.
Fische, die Tote fressen? Was für ein Blödsinn, dachte Piotr und schüttelte den Gedanken ab. Petter Bruvik war wirklich ein Idiot.
Piotr war noch immer warm, sodass er sich auszog und die Füße prüfend ins Wasser steckte. Vorsichtig trat er auf die Steine unter der Oberfläche, ehe der Grund unter ihm plötzlich verschwand und er in das kalte, schwarze Wasser eintauchte. Er tauchte unter. Als er die Augen öffnete, reichte sein Blick allenfalls einen Meter weit. Trotzdem tauchte er in fünfzehn Zügen von der Insel weg, ehe er nach Luft ringend wieder an die Oberfläche kam.
Als er nach unten blickte, sah er seine Füße nicht, so gering war die Sichttiefe in diesem von dunklem Wald und Feldern gesäumten See.
Er dachte, dass er sich jetzt genug abgekühlt hatte, und schwamm schnell zurück zur Insel. Die Angst vor dem Unbekannten, das aus der Tiefe auftauchen konnte, trieb ihn mit einem Mal an.
Er schwamm zur Südseite der Insel, entschied sich dann aber anders und schwamm zurück zur Nordseite, wo das Boot lag. Er war fast am Ufer, als etwas sein Bein berührte.
Er zuckte zusammen und hätte fast aufgeschrien. Bei dem Gedanken, was das gewesen sein konnte, bekam er Gänsehaut. Wollte ein Hecht ihm das Allerheiligste abbeißen, damit er nicht noch mehr Kinder bekam?
Dann stellte er fest, dass es vermutlich nur der Stängel einer Seerose gewesen war. Andererseits hatte er von Menschen gehört, die sich in Seerosenfeldern mit den Beinen in den Stängeln verheddert hatten, sodass sie nie wieder ans Ufer gekommen waren.
Sein Blick heftete sich auf eine Wurzel, die von der Insel bis unter das Wasser gewachsen war. Jedenfalls sah es so aus. Etwas weiter rechts, wo die Zweige hinter seinem Arm im Wasser verschwanden, war noch etwas anderes. Das scharfe Abendlicht ließ keinen Zweifel zu. Er versuchte, seinen Körper unter Kontrolle zu bekommen und so schnell wie möglich zurück auf die Insel zu gelangen, aber es war unmöglich.
Das Spiegelbild seines eigenen Gesichts auf der Wasserfläche vereinigte sich mit den Resten des Gesichts darunter. Für einen Moment glaubte er, eine lange Strähne am Schädel kleben zu sehen, dann wurde das Wasser ganz schwarz. Eine Wolke hatte sich vor die Sonne geschoben.
Eine Frau, dachte er.
Januar 1987Arrestzelle, Polizeipräsidium Oslo
2
Arvid Storholt wurde von dem Geräusch von Metall auf Metall geweckt. Er glaubte unmittelbar, es sei bereits Morgen, sein Körper war aber noch so benommen, dass er höchstens ein paar Stunden geschlafen haben konnte. Er griff zu der goldenen Schweizer Armbanduhr, die Sascha ihm zum vierzigsten Geburtstag geschenkt hatte und die noch viel teurer war als die, die er viele Jahre zuvor bekommen hatte. Er musste die Augen zusammenkneifen, um lesen zu können, was die beleuchteten Zeiger ihm mitzuteilen versuchten.
Viertel nach zwei. Es war noch mitten in der Nacht.
Er drehte sich um und wollte sich an Beate schmiegen, knallte mit dem Kopf aber gegen die Wand. Für einen Moment hatte er vergessen, was geschehen war, hatte alles für einen bösen Traum gehalten und sich zu Hause gewähnt. Als er dann aber den Schlüssel im Schloss der massiven Stahltür hörte, stieg das unbeschreibliche Unbehagen in ihm wieder auf.
Die Kinder mussten heute in die Schule.
Nein, mussten sie nicht. Am besten gingen sie nie mehr aus dem Haus. Wie würde ihr Leben von nun an aussehen? Er durfte keine Zeitung lesen, kein Radio hören und auch nicht fernsehen. Trotzdem wusste er, welche Hysterie außerhalb dieser Wände herrschen musste.
Im Laufe der nächsten Sekunden ging ihm noch einmal alles durch den Kopf, als wäre dort oben plötzlich mehr Platz. Wie lange hatte die erste Vernehmung gedauert? Fünf Stunden, sechs? Sieben, vielleicht acht? Er hatte jegliches Zeitgefühl verloren, dabei wusste er ganz genau, dass er erst seit sechsunddreißig Stunden in Untersuchungshaft saß. Er hatte sich entschieden, alles zu gestehen, ohne Anwalt, ganz im Gegensatz zu dem, was Sascha und Spitskjin ihm eingeschärft hatten. Er konnte nicht leugnen, dass er fünfundsechzig geheime Dokumente in seiner Aktentasche gehabt hatte, als er am Flughafen Fornebu verhaftet worden war. Aber was war mit den Treffen mit Sascha, und später mit Spitskjin in Oslo, Helsinki, Wien? Wie dumm konnte man sein? Und das Motiv? Was sollte er sagen, außer dass er an ein anderes Gesellschaftsmodell als den Kapitalismus glaubte? Alles hatte bei den vielen Solidaritätsbesuchen in Griechenland begonnen, als die Militärdiktatur auf ihrem Höhepunkt gewesen war, damals war er Kommunist geworden. Zu klar war ihm geworden, was für Regime die USA und der jämmerliche Marionettenstaat Norwegen unterstützten und welche Leiden der Kapitalismus und die fetten Direktoren der wichtigsten, weltumspannenden Gesellschaften den Menschen in der Dritten Welt zufügten. Und nicht nur da, sondern auch in Europa – in Spanien, Portugal und Griechenland. Er hatte deshalb freiwillig zugegeben, dass ihn die Russen 1971 in Athen rekrutiert hatten.
Als er wieder zu Hause gewesen war, hatte ihn der damalige Kulturattaché der sowjetischen Botschaft in Oslo, Alexander Iljawitsch Maximow, besucht. Sascha, wie er unter Freunden genannt wurde, hatte Storholts Potenzial erkannt und gesehen, dass der junge, in Politikwissenschaft promovierte Politiker eine große Zukunft vor sich haben konnte.
Tja, dachte Arvid Storholt. Er hatte es also wieder einmal nicht geschafft, den Mund zu halten. Aber noch war das keine Katastrophe. Er konnte noch immer einen Anwalt benennen und beim Termin vor dem Haftrichter alle gemachten Aussagen zurückziehen. Sascha und Spitskjin erwarteten von ihm, dass er alles leugnete und nichts gestand. Das einfache Modell. Er könnte angeben, zu seinem Geständnis gedrängt worden zu sein, dass die Beamten seine mentale Schieflage ausgenutzt hätten. Das wäre keine große Sache.
Die Zellentür wurde weit geöffnet. Arvid Storholt richtete sich auf und wurde im selben Augenblick von der Angst gepackt, die er auch bei seiner Festnahme gespürt hatte: Sascha wird mich umbringen. Nicht Spitskjin, vor dem hatte er aus unerklärlichen Gründen keine Angst. Aber Sascha würde ihm das Herz herausreißen und in den Rachen stopfen. Sascha hatte als Kind die deutsche Belagerung von Leningrad überlebt, hatte Zeitungspapier und Tapeten gegessen und von Müttern erzählt, die ihre Neugeborenen erwürgt hätten, damit die Familie etwas zu essen hatte. Er hatte es selbst gesehen, wie er auch gesehen hatte, wie ein Mann die Leber seiner Großmutter gebraten und wie ein ausgehungertes Tier heruntergeschlungen hatte. Würde ein solcher Mann einen Verräter wie ihn überleben lassen? Jemanden, der es nicht einmal geschafft hatte, seinen Mund zu halten?
Für einen Moment glaubte Arvid Storholt, dass tatsächlich Sascha in der Tür stand. Er hob die Hand, um das grelle Flurlicht abzuschirmen, das auf ihn fiel. Storholt hatte geglaubt, in Sicherheit zu sein, solange er in Untersuchungshaft saß. Dass ihn dort niemand erreichen könne. Am meisten Sorge machten ihm die Transporte. Dann konnte ein Scharfschütze ihn erschießen, wenn er nicht aus nächster Nähe erschossen wurde, so wie Jack Ruby damals Lee Harvey Oswald erschossen hatte. Kamen sie schon jetzt, um ihn wegzubringen?
Ein Mann trat in seine Zelle, gefolgt von zwei weiteren Männern in Zivil. Bei einem der beiden glaubte er Schulterklappen unter dem Mantel zu erkennen.
»Ziehen Sie sich an, Storholt.« Er erkannte die Stimme von Jan Amundsen wieder, der bei der Verhaftung in Fornebu dabei gewesen war.
»Eine einzige Chance wollen wir Ihnen noch geben. Vielleicht können wir Sie dann auf freien Fuß setzen.«
Juni 2016Enebakk
3
Tommy Bergmann fuhr auf den Parkplatz südlich des alten Grenzsteins zwischen den Bezirken Akershus und Østfold. Es war kurz vor halb elf am Abend, der letzte Mittwoch im Juni.
Der Kriminalchef des Polizeidistrikts Follo war im Urlaub, sodass Tommy und ein Kriminaltechniker von Polizeipräsident Fredrik Reuter persönlich an den äußersten Rand des Distrikts geschickt worden waren. Reuter und der damalige Staatsanwalt hatten Tommys Karriere vor zehn Jahren gerettet, doch damit stand er in ihrer Schuld und musste tun, was immer sie wollten. Eigentlich hatte auch er gerade Urlaub, aber daran war jetzt nichts zu ändern.
Tommy ergriff die unglaublich breite Hand des Mannes, der die Polizei verständigt hatte. Tommy hatte vor seinem Kommen Erkundigungen über ihn eingeholt. Petter Bruvik war Bauer und Immobilieninvestor.
»Unser kleiner slawischer Freund hier mietet das Brauhäuschen von mir«, sagte er und schlug dem Polen auf die Schulter. Dann holte Bruvik eine Snusdose aus der Hosentasche und schob sich eine Portion unter die Lippe.
»Sind Sie okay?«, fragte Tommy den Polen.
Der junge Mann zuckte mit den Schultern und gab leise murmelnd eine unverständliche Antwort.
»Der kommt schon klar«, sagte Petter Bruvik.
»Wir sollten rüberfahren, bevor es zu dunkel wird«, sagte er und führte Tommy zu dem Boot, das halb an Land gezogen worden war. Tommy dachte, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt war, um zu überprüfen, ob Außenbordmotoren hier überhaupt erlaubt waren. Er drehte sich nach Westen und sah, dass die Sonne längst hinter dem Höhenzug verschwunden war. Sie hatten bestenfalls noch eine Stunde, bis es dunkel war.
Tommy kletterte als Erster an Land, dann folgte der Kriminaltechniker und zuletzt Piotr Woźniak. Der junge Pole war beinahe noch blasser als der Körper im Wasser.
Tommy hatte in seinem Leben schon viel gesehen, musste aber anerkennen, dass der Anblick, der ihn am Ufer der kleinen Insel erwartete, speziell war. Von dem Menschen, der direkt unter der Wasseroberfläche lag, war kaum noch etwas vorhanden. Reste von Kleidung, ein Seil und irgendwelche Fetzen, bei denen es sich möglicherweise einmal um Haut gehandelt hatte. An einer Strähne am Schädel hatten ein paar seltsame Gewächse Fuß gefasst. Die langen, braunen, schleimigen Tentakel ließen es fast so aussehen, als hätte die tote Person lange Haare gehabt.
»Ich bin direkt daneben geschwommen«, sagte Piotr.
Tommy nickte und hockte sich hin. Ein kräftiges Seil schien um den Körper gewickelt zu sein. Die Kleiderreste ließen ihn an Winter denken, auf jeden Fall nicht an einen warmen Sommertag wie diesen.
»Ich bin mir sicher, dass es eine Frau ist«, sagte Piotr.
Darauf erwiderte Tommy nichts. Er drehte sich um und sah zum Boot hinüber.
Dann schob er seine Armbanduhr zurecht und sah nach, wie spät es war. Das Armband der alten Seiko-Uhr war zu locker, sodass sie häufig nur lose ums Handgelenk hing. Im letzten Sonnenlicht waren die dicken Narben zu erkennen, die quer über sein Handgelenk verliefen.
Als Tommy wieder aufsah, begegnete er den Augen des jungen Polen. Er sah Tommy mit einem Blick an, der Entsetzen, aber auch Mitgefühl ausdrückte.
Glotz mich nicht so an, dachte Tommy.
Nach einer halbstündigen Vorbereitung bekamen sie die Reste des Körpers aus dem Wasser gezogen.
Tommy wusste nicht, wie er beschreiben sollte, was vor ihnen lag. Es waren tatsächlich die sterblichen Überreste einer Frau, wie der Pole es vermutet hatte. Die Körpergröße und die Breite des Hüftknochens waren klare Indizien. Es sah so aus, als trüge sie die Reste eines Schafspelzmantels.
»Am Grund dieses Sees ist vermutlich sehr wenig Sauerstoff«, sagte der Kriminaltechniker. »Vielleicht gar keiner. Die Verwesung geht dann unglaublich langsam vor sich, die Sedimente sind wie ein Gefrierschrank. Sie liegt hier sicher schon seit vielen Jahren.«
»Nein, sie ist von der Strömung mitgerissen worden«, sagte Petter Bruvik, als es dunkel geworden war.
Tommy dachte, dass er die beiden Zivilisten längst vom Fundort hätte verweisen müssen, aber besonders der Bauer wirkte wacher als so mancher Polizist.
»Warum glauben Sie das?«, fragte Tommy.
»Zum einen glaube ich nicht, dass sie hier an dieser Insel abgelegt worden ist, das nehmen Sie doch auch nicht an. Dafür ist es hier viel zu offen. Schlimmstenfalls könnte man sogar von der Straße oder vom Hof da drüben gesehen werden, auch wenn beide weit weg sind. Zum anderen muss sie mit Steinen oder einem Bleigewicht beschwert gewesen sein, sonst wäre sie längst an die Oberfläche gekommen. Ich nehme an, dass sie irgendwo am Nordende des Sees versenkt worden ist. Ihre Kleider haben sich aufgelöst, das Tau hat sich gelockert und mit jedem Jahr, das vergangen ist, ist sie ein bisschen weiter in Richtung Seeausfluss getrieben.«
»Mag sein«, sagte Tommy. Der Mann war nicht dumm.
»Steine in den Taschen«, sagte der Kriminaltechniker. »Auf jeden Fall in denen, die noch übrig sind.« Er hatte sich vor den Überresten hingekniet, einen Atemschutz angelegt und hielt eine Taschenlampe in der linken Hand. Es war ein Wunder, dass er sich nicht erbrach, andererseits hatte er viel Erfahrung und gehörte wohl eher zu den Typen, die in einer solchen Situation auch noch ein Sandwich essen konnten.
»Ich kann Ihnen zeigen, wo ich sie versenkt hätte«, sagte Petter Bruvik.
Tommy fuhr mit Bruvik zurück an Land. Er saß im Bug und betrachtete die hell erleuchtete Insel mitten im See. Die Leiche der Frau musste bis zum nächsten Tag dort bleiben. Legten sie sie ins Boot, bestand die Gefahr, dass der Leichnam noch weiter Schaden nahm. Im schlimmsten Fall fiel das Skelett komplett auseinander.
Petter Bruvik fuhr mit Tommy über die am See entlang führende Straße nach Norden.
Ein paar Zigeunerwohnwagen standen auf einem Rastplatz. Vereinzelte Häuser und zwei Bauernhöfe waren das Einzige, was Tommy an der kurvigen Straße erkennen konnte.
Nach zwei engen Kurven sagte Petter Bruvik: »Das hier ist mein Hof.« Er zeigte nach links, aber Tommy konnte nichts erkennen. Bruvik bremste kurz darauf und fuhr von der Straße auf eine Wiese. In der Nähe war ein Hügel zu sehen, der Tommy an alte Wikingergräber erinnerte.
Links der Straße war der Hang mit Wald bewachsen, aber auf der Seite, auf der sie standen, waren in allen Richtungen Felder und Wiesen. Sie gingen wenige Minuten an einem Kornfeld entlang, bis sie zu ein paar Bäumen auf der anderen Seite des Feldes kamen. Kurz darauf waren sie am Seeufer.
Petter Bruvik ging bis nach unten ans Wasser.
Der See vor ihm badete in magischem Licht. Eine Mischung aus Tag und Nacht, wie man sie nur im Norden fand, sodass man sich fragen konnte, ob man wach war oder träumte, dachte Tommy. Nicht ein Laut war zu hören, sogar die Baumkronen über ihnen schwiegen.
»Ein ganz besonderer Ort«, sagte Petter Bruvik leise.
Tommy konnte ihm nur recht geben.
Das gegenüberliegende Seeufer schien steiler und ganz von Wald bewachsen zu sein.
Der See selbst war an dieser Stelle recht schmal, ein Sund umrahmt von Hügeln. Nirgendwo war Licht zu sehen.
»Wenn sie im Winter versenkt worden ist, hätte der Täter über das Eis in die Seemitte gehen und ein Loch bohren können. Das wäre im Laufe der Nacht dann wieder zugefroren.«
Sie standen eine Weile schweigend da.
Tommy dachte an den Schaffellmantel, den die Frau getragen hatte. So etwas war schon lange außer Mode. Zuletzt trug man das wohl in den Siebzigern oder frühen Achtzigern. Und waren diese Mäntel damals nicht auch sehr teuer gewesen?
Er glaubte sich daran zu erinnern, dass seine Mutter manchmal erwogen hatte, sich einen solchen Mantel zu kaufen, aber nie genug Geld dafür gehabt hatte.
»Ist hier am See viel Verkehr?«, fragte er.
»Jetzt ja. Früher war das aber weniger. An Tagen wie diesem verging gerne mal eine halbe Stunde zwischen den einzelnen Autos. Auf der großen Straße sind wir damals Fahrrad gefahren. Und wir konnten lange fahren, bis da mal ein Auto kam. Selbst im Sommer. Im Winter war es wie auf dem Mond. Komplett menschenleer.«
»Der perfekte Ort für Landstreicher«, sagte Tommy.
»Es gab damals schon ein paar seltsame Gestalten. Leute wie mein Mieter jetzt«, sagte Petter Bruvik.
Tommy schüttelte den Kopf. Er versuchte einen Schwarm Mücken zu vertreiben und trat einen Schritt zur Seite, mit geringem Erfolg.
»Was meinen Sie mit früher und mit den seltsamen Gestalten?«
»Na, die Siebziger oder Achtziger. Damals waren hier immer wieder Osteuropäer. Bulgaren, Tschechen, Polen, Russen. Ich weiß echt nicht, was die hier wollten, aber die hatten was Merkwürdiges an sich. Sie haben im See geangelt oder so getan, als würden sie das tun. Manchmal waren sie sogar im Winter hier. Mein Vater hat im Auftrag der Polizei die Autokennzeichen notiert. Osteuropäische Diplomatenfahrzeuge brauchten eine Sondergenehmigung, um mehr als dreißig Kilometer aus Oslo herauszufahren. Der See hier liegt direkt an der Grenze. Wir hielten das für ungefährlich, aber vermutlich haben die die Radarstation oben am Bindingsvann abgehört oder den Einflug der Militärmaschinen aus dem Flugfeld Rygge beobachtet. Solange sie das Getreide nicht kaputtmachten, war das für meinen Vater aber alles okay.«
Tommy schnitt eine Grimasse. Ein merkwürdiger Typ, dachte er.
»Einmal – ich war damals noch ein Kind – war ich mit einem Freund und einem der Hunde in einer kalten Frühlingsnacht draußen. Da haben wir mitten im Wald ein sowjetisches Auto gesehen, ich glaube jedenfalls, dass es aus der Sowjetunion war. Auf jeden Fall war es ein Wolga. Neben dem Auto stand ein Mann mit Mütze und rauchte. Die Glut seiner Zigarette sehe ich noch immer vor mir.« Bruvik zeigte zur anderen Seite der großen Straße hinüber, wo sich die Silhouette der Berge scharf im Mondlicht abzeichnete.
»In der Kurve da zweigt ein Waldweg nach links ab. Gar nicht weit von der Stelle, wo wir den Wagen geparkt haben.«
»Und was haben Sie gemacht, als Sie das Auto bemerkt haben?«
»Wir sind mit dem Hund so leise wie nur möglich wieder zurückgelaufen. Wir wollten ja nicht kaltgemacht werden. Ich dachte, wenn der Hund jetzt bellt, sind wir alle tot.«
»Wohin führt die Straße da?«, fragte Tommy und streckte den Arm nach Süden aus.
»Die Straße gabelt sich am Ende des Sees. In der einen Richtung kommt man bis nach Stockholm, folgt man der anderen, geht’s entweder zurück nach Oslo oder Richtung Südwesten nach Son oder Moss und von dort über die E6 nach Göteborg.«
»Wie weit ist es bis Moss?«, fragte Tommy. »Und Son?«
»Fünfundvierzig Minuten sind das sicher, nach Son etwas weniger«, sagte der Bauer mit einem Nicken. »Ja, diese Gegend ist wirklich perfekt für Landstreicher und Vagabunden, wenn Sie daran denken.«
Mit anderen Worten ein perfekter Ort, um jemanden zu töten, dachte Tommy. Oder um eine Leiche zu entsorgen.
Januar 1987Oslo
4
Jan Amundsen hatte ihm einen Schal um Kopf und Augen gewickelt, sodass er nicht sehen konnte, wohin sie fuhren. Die einzigen Sinnesorgane, die Arvid Storholt noch zur Verfügung standen, waren die Ohren, aber die halfen ihm nicht sonderlich, sich zu orientieren. Er hörte nur das Rollen der Reifen auf dem gefrorenen Boden.
Er hatte versucht, nachzuvollziehen, wohin sie fuhren, hatte dieses Unterfangen aber irgendwann aufgeben müssen. Nach rechts, nach links, das spielte doch alles keine Rolle mehr. Stattdessen hätte er zählen sollen, um die Zeit zu messen, aber auch das hatte vermutlich keinen Zweck. Dabei war er sich sicher, dass sie noch immer unten in der Stadt waren und nicht aufs Land oder gar auf eine Autobahn gefahren waren.
Er murmelte die Worte vor sich hin: Eine einzige Chance, auf freien Fuß gesetzt zu werden.
Er glaubte, zu wissen, was er dafür tun sollte, und das konnte er nicht tun.
Als der Wagen anhielt, hatte er das Gefühl, als wären sie die letzte Viertelstunde im Kreis gefahren.
Er wurde vom Auto weg geführt. Dem Geräusch nach zu urteilen, das seine Schuhe auf dem Schnee machten, musste es fünfzehn Grad minus sein, mindestens. Er stolperte über etwas, das er für eine Bordsteinkante hielt, bevor er durch eine Tür in einen warmen Raum geschoben wurde. Dann ging es über eine Treppe nach unten, einen Flur entlang und von dort noch weiter nach unten.
Zu guter Letzt wurde er auf einen Stuhl gedrückt, wo er – den Schal noch immer vor den Augen – sitzen blieb. Seine Schultern und beide Arme schmerzten. Er verstand nicht, warum sie ihm wie einem Mörder Handschellen angelegt hatten.
Nach ein paar Minuten hörte er, dass links vor ihm eine Tür geöffnet wurde.
Zwei Hände nahmen ihm mit schnellen Bewegungen den Schal ab.
Arvid Storholt sah in die blauen Augen von Jan Amundsen. Für einen Moment sah es so aus, als mäßen die beiden ihre Kräfte, ein wortloser Kampf, den einer der beiden gewinnen sollte. Oder nein, dachte Storholt, den sie beide möglicherweise verlieren würden.
Amundsen nickte dem Polizeibeamten neben sich zu. Es war im wahrsten Sinne des Wortes eine Befreiung, als dieser ihm die Handschellen abnahm.
Er wurde weiter in einen kleinen Kellerraum geführt, der ihn an die Szenerie eines Films erinnerte, den er einmal gesehen hatte. Mitten im Raum stand ein Schreibtisch, hinter dem ein Mann saß. Rechter Hand stand ein Paravent, wie man sie in Krankenhäusern nutzte, um in Mehrbettzimmern ein Minimum an Privatsphäre sicherzustellen. Auf dem einfachen Stahlrohrstuhl, der vor dem Schreibtisch stand, lagen eine Fingerklammer und vier Elektroden. Arvid Storholt folgte den dünnen Leitungen, die von den Sensoren über den Boden bis zum Paravent führten. Der Mann hinter dem Schreibtisch stand auf und begegnete seinem Blick.
Er trat ein paar Schritte vor und ergriff Storholts verschwitzte Hand.
Verdammt, dachte er. Wenn er auf irgendetwas nicht vorbereitet war, dann auf einen Lügendetektortest. Sascha hatte ihm erzählt, dass die CIA in den letzten Jahren immer häufiger darauf zurückgriff. Dabei erkannten diese Geräte in Wahrheit keine Lügen, sondern maßen lediglich Puls, Blutdruck und Schweißaktivität, um so das Stressniveau effektiv zu bestimmen. Was hatte Sascha sonst noch gesagt?
Ja, dass eine Person, die sich an zu viele Details erinnerte und eine zu umständliche Erklärung vorbrachte, immer log. Daran musste er denken. An verdammt vieles musste er denken.
»Das Ganze ist natürlich vollkommen freiwillig«, sagte der Mann ohne Namen. Storholt ließ seine Hand los und sah erst jetzt den goldenen Ring mit dem Pentagramm auf schwarzem Grund, den der Mann am Ringfinger trug. Der Walkürenring der Marineschule. Das Gesicht des Mannes hatte rote Flecken, sein Atem ging flach, als hätte er eine halbe Flasche Mundwasser geleert, um den Alkoholgeruch zu verbergen.
»So freiwillig, dass ich morgen früh nicht wieder ins Gefängnis muss?«
Der namenlose Mann rang sich ein Lächeln ab und gab Storholt zu verstehen, dass er auf dem Stuhl Platz nehmen sollte.
Ein junger Mann kam hinter dem Paravent zum Vorschein. Er entfernte die Sensoren, die auf dem Stuhl lagen, und machte mit der Hand eine einladende Geste, als handelte es sich wirklich nur um einen Friseurbesuch.
Arvid Storholt dachte, dass seine Passivität als Einwilligung gedeutet wurde, und der junge Mann – er war tatsächlich Amerikaner – bat ihn, den Pullover auszuziehen und sein Hemd zu öffnen.
Nach ein paar Minuten hatte der Amerikaner Storholts Brust rasiert, die Elektroden platziert und ihm einen Gürtel um die Hüfte gebunden.
Der Mann mit dem Ring setzte sich wieder hinter den Schreibtisch und schaltete eine kräftige Leselampe ein. Dann wurde die Deckenlampe ausgeschaltet. Jan Amundsen trat neben Storholt; er drehte den Schirm der Leselampe so, dass sie Storholt direkt ins Gesicht schien, sodass dieser nichts mehr sah.
»Sind Sie bereit?«, fragte Jan Amundsen irgendwo hinter der Lampe.
»So bereit wie Frankenstein«, sagte Storholt. »So sehe ich jetzt doch wohl aus, oder?«
Keiner im Raum reagierte auf seinen Witz. Storholt dachte, dass Humorlosigkeit ein Kriterium für die Rekrutierung zum Geheimdienst sein musste. Und ein niedriger Ruhepuls. Er selbst spürte es in seinen Ohren sausen, sein Puls hämmerte, als liefe er den letzten Kilometer des New-York-Marathons.
»Nehmen Sie sich Zeit«, sagte Jan Amundsen. »Wenn Sie bei etwas unsicher sind oder sich nicht mehr richtig erinnern, sagen Sie es einfach.«
Storholt nickte und schluckte ein paarmal. Es schien im ganzen Raum nichts zu trinken zu geben und er wollte keine Schwäche zeigen und um ein Glas Wasser bitten.
»Wir fangen dann an, wenn Ihr Puls wieder auf einem normalen Niveau ist«, sagte Jan Amundsen.
Storholt atmete tief durch und schloss die Augen. Er sah sich selbst in Fornebu, umgeben von Menschen, die an ihm vorbeieilten, spürte, wie sein Blick sich in Amundsens verhakte, wie Amundsen die Lippen bewegte und die Worte nur in Bruchstücken und mit Riesenverzögerung zu ihm vordrangen, gemischt mit den Aufrufen für den nächsten Flug nach Tromsø. »Abteilungsleiter Arvid Storholt? Kommen Sie bitte mit uns. Gegen Sie besteht Verdacht der Spionage für die Sowjetunion.« Das Gefühl, dass das alles nicht wahr sein konnte, war so überwältigend gewesen, dass er einen Schritt zur Seite hatte machen müssen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.
»Wir können genauso gut jetzt anfangen«, sagte Storholt. »Es ist Ihnen doch wohl klar, dass ich hier keinen Ruhepuls kriegen werde?«
»Es gibt keinen Grund, sich aufzuregen«, sagte Amundsen. »Wir erkennen natürlich an, dass die Situation für Sie nicht leicht ist.«
»Fangen Sie einfach an«, sagte Storholt.
»Sagt Ihnen der Name Christel Heinze etwas?«, fragte der Mann mit dem Walkürenring ohne jede Einleitung.
Arvid Storholt war vollkommen überrumpelt. Er hatte erwartet, dass sie mit ein paar einfachen Kontrollfragen begännen, oder mit irgendeiner Behauptung, aber sie schienen wenig Zeit zu haben. Sie hatten nur ein paar Stunden, bis er dem Haftrichter vorgeführt werden musste. Storholt fragte sich, wie er die Tatsache, dass sie unter Zeitdruck standen, zu seinem Vorteil nutzen konnte, aber sein Hirn wollte nicht mitarbeiten. Stattdessen spürte er, wie müde er war, wie grell die Lampe ihm ins Gesicht leuchtete und wie sehr er fror. Er starrte einen Augenblick nach unten und bemerkte, dass seine Brustwarzen steif geworden waren.
»Antworten Sie«, forderte der Mann. »Sagt Ihnen der Name Christel Heinze etwas?«
Storholt verspürte einen unbändigen Drang, sich die Klammer vom rechten Zeigefinger zu reißen, den Gürtel vom Leib und die vier Elektroden von der Brust, aber es gelang ihm, sich zusammenzureißen.
»Ja.«
»Margaret Meyer?«
»Nein.«
Er hätte seinen rechten Arm gegeben, um die Ausschläge des Polygraphen zu sehen, dabei tat er nur, was Sascha ihm gesagt hatte. Er antwortete mit betont ruhiger Stimme und versuchte, eine Art innere Ruhe aufzubauen. Wurde es zu schlimm, konnte er die Antwort ja auch verweigern.
»Bjørn?«, fragte der Mann mit dem Ring. »Sagt Ihnen der Name auch etwas? Oder Bjørnen – ›der Bär‹?«
Arvid Storholt spürte, dass es ihm, wie immer, wenn er nervös wurde, die Kehle zuschnürte. Dass er an den Handflächen schwitzte, begleitete ihn schon seit seiner Kindheit, aber er konnte jetzt ja nicht sagen, dass das normal sei.
»Der Bär?«, fragte nun auch Amundsen.
Storholt schüttelte den Kopf und versuchte, ein Lächeln zu unterdrücken. »Was soll damit gemeint sein?«
Es machte den Eindruck, als müssten weder der Amerikaner noch der Mann mit dem Walkürenring oder Amundsen auf den Zeiger schauen, der hinter dem Paravent ausschlug.
»Kommen wir zurück zu Christel Heinze, hat Maximow jemals über sie geredet?«
»Nein.«
»Sind Sie sicher?«
»Ja.«
»Wie haben Sie sich kennengelernt?«
»Wir waren beide Mitglieder der sozialdemokratischen Studentenvereinigung, Arbeiderpartiets Studentlag. Ich habe sie bei einem Sommerkurs unterrichtet. Das muss 1974 gewesen sein, glaube ich. Da sind wir uns das erste Mal begegnet.«
»Hatten Sie eine sexuelle Beziehung?«
»Was hat das mit der Sache zu tun?«
»Sie haben die Frage nicht beantwortet.«
»Warum soll ich sie beantworten?«
Jan Amundsen trat aus dem Dunkel und stellte sich vor die Leselampe.
»Antworten Sie einfach.«
»Nein, wir hatten keinen Sex. Wir waren kein Liebespaar.«
»Aber Sie waren in sie verliebt?«
»Nein.«
»Wissen Sie, wo sie sich zurzeit aufhält?«
»Nein.«
»Ist sie noch am Leben?«
»Das weiß ich nicht.«
»Haben Sie heute noch Kontakt zu ihr?«
Storholt antwortete nicht.
Amundsen blieb unmittelbar vor ihm stehen.
»Glauben Sie, dass sie als Agentin für uns gearbeitet hat?«, fragte der namenlose Mann hinter dem Schreibtisch.
Arvid Storholt gab sich alle Mühe, damit sein Mund ihm gehorchte.
Was sollte er antworten? Ja? Keine Ahnung?
»Worauf wollen Sie hinaus?«, fragte er schließlich.
»Haben Sie sie getötet, Storholt?«
»Mein Gott, nein!«
Es wurde still im Raum.
»Ich frage Sie noch einmal. Worauf wollen Sie hinaus?«
»Sie wissen, was wir wollen. Codename Bär«, sagte der namenlose Mann. »Medwedew. Ich bin mir sicher, dass Sie das wissen.«
Storholt schloss die Augen. Er hörte ein Sturmfeuerzeug klicken, er roch erst das Benzin und dann den Zigarettenrauch.
»Erzählen Sie mir vom Bären. Oder von Bjørn. Christel Heinze hatte ein Verhältnis mit einem Mann namens Bjørn«, sagte Jan Amundsen. »Hat sie jemals mit Ihnen über diesen Mann gesprochen?«
Storholt antwortete nicht. Er öffnete die Augen, blieb aber still sitzen und schüttelte den Kopf.
»Ist Bjørn der Bär? Storholt?«
Jan Amundsen hatte sich vor ihm hingekniet, die angezündete Zigarette in der rechten Hand, und sah Storholt mit aufgesetzt mitfühlender Miene an, als wollte er ihn trösten. Langsam entfernte er die vier Elektroden, die Storholt auf der Brust hatte. Storholt senkte den Blick und starrte auf die vier rasierten, hellrosa Felder. Dann nahm Amundsen ihm die Fingerklammer ab.
»Es hat keinen Zweck«, sagte Amundsen in den Raum hinein. Seine Stimme klang freundlich, als hätte er bereits erkannt, dass Arvid Storholt wie ein normaler Mensch angesprochen werden wollte. »Sie werden von diesem Zeugs nur nervös, oder?«
Storholt nickte heftig. Er knöpfte sich sein Hemd zu, fror aber noch immer.
»Hat Christel Heinze den Bären rekrutiert?«
»Nein«, antwortete Storholt unmittelbar. »Warum sollte sie das tun? Sie war ein Flüchtling. War vor ihrer Familie davongelaufen.«
Erst eine Sekunde später erkannte er, welch schwerwiegenden Fehler er gemacht hatte.
»Erzählen Sie uns von dem Bären, und wir tun alles, was in unserer Macht steht, um Ihnen zu helfen«, sagte Amundsen.
Oktober 2016
5
Ende Juni übernahm das Kriminalamt den Fall, und noch ehe es August war, waren die Ermittlungen so gut wie abgeschlossen – beides zu Tommy Bergmanns großem Missfallen. Wie üblich sah niemand einen Nutzen darin, Ressourcen auf einen derart alten Fall zu verwenden. Man schob das Problem in der Hoffnung, dass es mit der Zeit schon von selbst verschwinden werde, vor sich her. Andererseits musste sich auch Tommy im Laufe des Herbstes eingestehen, dass eine Mordermittlung mit einem unbekannten Opfer und einem unbekannten Täter ebenso verlockend war wie ein Kampf gegen Windmühlenflügel. Vier Frauen waren zwischen 1970 bis etwa Mitte der Achtzigerjahre verschwunden. Sie alle stimmten in gewissen Merkmalen mit der Toten überein. Alle vier waren Norwegerinnen, und sie waren bei ihrem Verschwinden zwischen neunzehn und dreißig Jahre alt gewesen. Kurz nach dem Fund der Leiche hatte alles dafür gesprochen, dass es sich bei der Toten um die im Winter 1975 verschwundene Trondheimer Medizinstudentin Anne Grete Torvaldsen handelte. Die Eltern waren sich sicher, dass es ihre Tochter war, und das Kriminalamt schien diese Theorie wohlwollend anzunehmen. Die junge Torvaldsen stammte tatsächlich von der Halbinsel Nesodden, was nur rund dreißig Kilometer entfernt war, und sie war während der Weihnachtsferien bei ihren Eltern verschwunden. Aber was Anne Grete Torvaldsen in Enebakk wollte und wer ihr mit Präzision und Kraft den Hals gebrochen hatte, wusste niemand zu sagen. Die Tatsache, dass der Körper der Toten vier bis fünf Zentimeter kleiner war als Anne Grete Torvaldsens angegebenes Körpermaß, kümmerte die Familie nicht. Tommy Bergmann war nicht gerade bekannt dafür, zurückhaltend zu sein, trotzdem hatte er sich an diesem Punkt noch nicht eingemischt. Es war nicht seine Aufgabe, Familie Torvaldsen zu sagen, dass sie allem Anschein nach die falsche Tote betrauerten. Doch was sollte eine zweiundzwanzigjährige Medizinstudentin angestellt haben, um von einem Profi getötet zu werden?
Als der Herbst kam, hatten die Rechtsmediziner ermittelt, dass das Alter der Toten zwischen achtzehn und dreißig lag, die DNA-Analyse ergab aber keinen Treffer. Die Zähne waren der Toten bis auf den letzten Rest ausgeschlagen worden, professionell und kaltblütig, sodass alles dafür sprach, dass die Frau von einem Auftragsmörder getötet worden war. Der Kriminalreporter der Zeitung Dagbladet, Frank Krokhol, bekam ein Interview mit der Mutter von Anne Grete Torvaldsen, in dem die ältere Frau voller Emotionalität betonte, dass die Tote ihre Tochter sei. Trotzdem war das alles nur eine vage Hoffnung. Da der Körper so lange unter Wasser gelegen hatte, war es schlichtweg unmöglich, mit Sicherheit festzustellen, ob es Torvaldsen war oder nicht.
Kein Mediziner der Welt war bereit, nur auf Basis von Vermutungen einen Totenschein auszustellen, sodass die sterblichen Überreste nie einen Namen bekamen. Die tote junge Frau aus dem See bei Enebakk galt deshalb offiziell nicht als Torvaldsens Tochter. Sonst aber schien sie niemand zu vermissen.
Die Unbekannte wurde schließlich Anfang September auf Kosten der Gemeinde Enebakk in einem neu angelegten Teil des örtlichen Friedhofs beigesetzt. Nur wenige Meter vom angrenzenden Golfplatz entfernt.
Fast vier Wochen nach der Beerdigung, es war Anfang Oktober, hatte Tommy Bergmann wie der Rest des Landes den Fall vergessen, wenn er auch noch immer eine Kopie der Fallakte bei sich zu Hause auf dem Schreibtisch liegen hatte.
Das Handy klingelte auf seinem Tisch und ein seltenes Mal freute Tommy sich über die Unterbrechung.
Sein Kopf dröhnte nach einem halbstündigen Sparringskampf am Morgen in der Boxhalle unter dem Sandakerzentrum. Ein junger, vielversprechender Marokkaner hatte einen Gegner gebraucht, sein üblicher Sparringspartner war krank, weshalb Tommy, der eigentlich nur für eine kurze Trainingseinheit gekommen war, spontan eingesprungen war. Eine dumme Entscheidung.
Er massierte sich den Nacken und versuchte zum x-ten Mal, einen Bericht über die anstehende Reorganisation des Polizeidistrikts zu lesen. Vielleicht sollte er wirklich etwas anderes tun, als die erneute Umstrukturierung des ohnehin schon am stärksten gebeutelten öffentlichen Ressorts verstehen zu wollen.
Die Stimme am Telefon erkannte er aus unerfindlichen Gründen gleich wieder. Tommy erinnerte sich an die Beerdigungszeremonie in der alten Holzkirche Mari in Ytre Enebakk.
Außer ihm waren nur die Pastorin, der Küster und die Eltern von Anne Grete Torvaldsen dort gewesen.
»Ich dachte nur, Sie sollten das wissen«, sagte die junge Pastorin.
»Was wissen?«, fragte Tommy und fischte die hellblaue Mappe aus dem Stapel der Dokumente, der rechts vor ihm lag. Eine Serie von Fotos des Schädels der Toten kamen zum Vorschein.
»Heute Morgen ist etwas Seltsames passiert«, sagte die Pastorin und hörte sich fast so an, als hätte sie Jesu Auferstehung beobachtet.
»Ja?«
»Ein Mitarbeiter des Friedhofs hat mich darauf aufmerksam gemacht.«
Tommy wartete. Pastoren brauchten immer eine Ewigkeit, bis sie zur Sache kamen, vielleicht eine Berufskrankheit, hervorgerufen durch zu viele Todesbotschaften. Er heftete seinen Blick auf den Bahnhof, das trostlose, riesige Einkaufszentrum jenseits der Gleise und die grauen, regenschweren Wolken.
»Auf dem Grab des Mädchens, Sie wissen schon welches, steht ein Grablicht …«
Tommy bemerkte, dass er die Stirn in Falten zog und sich aufrichtete.
»Was?«
»Ein Grablicht. Und ein Rosenstrauß mit einer Karte.«
»Was steht auf der Karte?«, fragte Tommy.
»Nichts.«
»Das waren bestimmt nur die Torvaldsens«, sagte Tommy. »Die Eltern.«
»Nein«, sagte die Pastorin. »Ich habe sie angerufen.«
»Fassen Sie nichts an«, sagte Tommy.
Als er den Friedhof erreichte, hatte es bereits kräftig zu regnen begonnen.
»Zur Hölle noch mal!«, sagte er laut, bevor er es bereute und seinen Blick über die Gräber schweifen ließ. Dies war kein Ort für Flüche, aber Gott wusste sicher, wie verflucht dieser Regen war, da mögliche Fuß- oder Fingerabdrücke jetzt verloren waren.
Das Grablicht brannte noch immer.
Die Pastorin wiederholte das Offensichtliche und Tommy spürte, dass der Schauer, der ihm über den Rücken lief, nichts mit dem kalten Regen zu tun hatte.
»Jemand war heute Nacht hier.«
Rosen, dachte Tommy. Ein großer Strauß Rosen, unten mit einem Band zusammengefasst. Oben am Strauß hing eine kleine Karte. Die Blumen waren sicher in Zellophan oder Papier eingepackt, dachte Tommy. Es wäre wesentlich leichter, wenn er wüsste, wo sie gekauft worden waren. Aber wer auch immer in der Nacht am Grab gewesen war, war sicher kein Amateur gewesen.
Er beugte sich vor, und der Regen fiel ihm in den Nacken und lief an seinem Rücken herunter. Er hob die durchnässten Blumen hoch.
»In der Mitte ist eine Nelke«, sagte die Pastorin.
Erst jetzt bemerkte Tommy, dass eine der roten Blumen keine Rose war.
»Nelken sind als Trauerblumen ziemlich normal, oder?«
Die Pastorin nickte.
»Bitte reden Sie mit niemandem darüber«, sagte Tommy. »Kein Wort über die Blumen, verstanden?«
Vorsichtig nahm er die kleine Karte, die sich im Regen bereits aufzulösen begann. Auf der Vorderseite war ein Foto von Blumen, die ihn an Margeriten erinnerten. Innen stand ganz richtig nichts. Auch die Rückseite war leer, keine Information, ob die Karte aus Norwegen oder dem Ausland stammte.
»Das sind keine Margeriten, oder?«, fragte er und hielt der Pastorin die Karte vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger hin.
»Doch.«
»Margeriten? Sind das denn auch Trauerblumen?«
»Nein.«
Er drückte die Blumen vorsichtig auseinander, damit sich das Band nicht löste, und zählte sie.
»Vierunddreißig rote Rosen«, sagte er leise vor sich hin. »Und eine Nelke.« Und eine verdammte Karte mit Margeriten.
Er suchte den Küster und schärfte ihm ein, nicht zu sagen, dass jemand am Grab der namenlosen Toten gewesen war. Dann rief er Familie Torvaldsen an und teilte ihnen mit, dass auch sie aus Rücksicht auf die Ermittlungen nichts sagen durften.
Er nahm das Grablicht, die Blumen und die Karte in einer großen Plastiktüte mit.
Unterwegs widerstand er dem Drang, in den Supermarkt und das Einkaufszentrum zu fahren und sich zu erkundigen, ob jemand tags zuvor ein Grablicht gekauft habe.
An der Tankstelle, an der sie auch Grablichter verkauften, trat er extra fest aufs Gaspedal. Es hatte keinen Zweck, anzuhalten und zu fragen, ob er sich die Videoaufzeichnung der letzten Tage anschauen dürfe. Zum einen war es nicht sein Fall, zum anderen war er sich sicher, dass derjenige, der das Grablicht und die Blumen gebracht hatte, nicht unerfahren war. Dass sie es nicht mit einem Amateur zu tun hatten, bestätigte sich, als Tommy das Grablicht im Präsidium auf Fingerabdrücke untersuchen ließ.
Sowohl das Glas als auch der Deckel waren blitzsauber und auch auf der Karte mit den Margeriten waren keine Abdrücke.
Der Mann – denn Tommy war überzeugt, dass es ein Mann war – hatte mitten in der Nacht mit einem Grablicht auf dem Friedhof gestanden und Handschuhe getragen, um keine Spuren zu hinterlassen.
Margeriten. Rosen. Und eine einzige Nelke.
Die Wahl der Blumen konnte kein Zufall sein. Eine mögliche Deutung lag auf der Hand: Liebe und Tod. Aber was hatte es mit der kleinen Karte auf sich?
Als Tommy nach Hause kam, googelte er »Margerite« im Internet, fand aber nichts, auf das er reagierte. Dann kam ihm der Name Tausendschön in den Kopf, aber er wusste nicht, ob das dieselbe Pflanze war, und verwarf den Gedanken gleich wieder.
Dann schaltete er Susannes Mac wieder aus und schlief fast unmittelbar auf ihrem viel zu teuren Designersofa ein.
Oktober 2016
6
Es war draußen bereits dunkel, als ihn die Frau weckte, die ihn vor zehn Jahren aus der Finsternis der Psychiatrischen Klinik Dikemark gezogen und zweimal pro Woche besucht hatte.
»Bist du eingeschlafen?«, fragte Susanne und streichelte ihm über die Haare. Aus Matheas Raum war das dumpfe Dröhnen von Musik zu hören. Vor langer Zeit einmal hatte er den Entschluss gefasst zu kämpfen, damit jemand für Mathea da war, sollte Susanne nicht überleben. Sie hatte überlebt, womit sein Auftrag hier auf Erden eigentlich zu Ende gewesen war. Eigentlich.
»Es ist Fredrik«, sagte Susanne und hielt ihm das Handy hin.
»Komm mal zu mir hoch«, sagte Reuter. »Zu mir nach Hause.« Dem Tonfall nach handelte es sich um einen Befehl und nicht um eine Einladung.
»Geht es um sie?«
»Um sie?«, fragte Reuter. »Wen meinst du?«
»Enebakk, die unbekannte Frau.«
Reuter schnaubte resigniert, als wäre Tommy fünf und nicht fünfzig Jahre alt.
Fredrik Reuter selbst öffnete ihm die Tür der Patriziervilla im Pareliusveien. Er sagte nichts, als er Tommy durch das Erdgeschoss des riesigen Hauses führte, das hoch über dem Oslofjord thronte. Schon Susanne gehörte in eine andere Liga als Tommy Bergmann, was ihre Herkunft und ihren Hintergrund anging, aber das war nichts im Vergleich zu seinem Chef, Fredrik Reuter. Während Susannes Großvater ein einfacher Büroangestellter gewesen war, der die Chance erkannt und genutzt hatte, im Kielwasser des Krieges von einem alten Nazi ein Haus auf Nesøya sehr günstig zu kaufen, gehörte Reuters Familie zu einer der »Tausend Familien«, die schon vor Jahrhunderten die Privilegien des Königs genossen hatten, was dem Anwesen in Bækkelaget noch heute deutlich anzusehen war. Reuter war auch die einzige Person, die Tommy kannte, die an der linken Hand einen Siegelring mit eingraviertem Familienwappen trug. In Tveita, wo Tommy zwischen gigantischen Wohnblocks aufgewachsen war, war die einzige Art von Gravur, die man kannte, die am Boden der Duralexgläser.
Trotzdem schien dieser Unterschied komplett ausgelöscht zu sein, als Reuter und Tommy das Arbeitszimmer betraten, das von Menschen mit ähnlich bescheidenem Hintergrund wie Tommy am ehesten als Bibliothek bezeichnet werden würde.
»Er ist da«, sagte Reuter ins Zimmer hinein und schloss die Tür.
Es war ziemlich dunkel im Raum, sodass Tommy den Mann, der hinten am Fenster saß, nicht gleich bemerkte. Er sah nur sein Profil. Die dünnen Beine übereinandergeschlagen, betrachtete der Mann den Himmel über Nesodden, wo das letzte Sonnenlicht langsam verschwand. Er war älter als Reuter, ging sicher auf die siebzig zu, und machte keine Anstalten, sich zu erheben.
In der rechten Hand hielt er eine nicht angezündete Zigarette.
Reuter hasste Zigaretten, woraus Tommy schloss, dass der Mann in dem Ohrensessel wichtig sein musste. Wie recht er hatte, begriff er, als Reuter ihm den Alten vorstellte.
»Tommy, das ist Jan Amundsen.«
Der anonyme, nichtssagende Name war wie geschaffen für die Arbeit, die er machte. Tommy wusste, dass Jan Amundsen der Vizekommandant des Polizeilichen Sicherheitsdienstes PST war. Und dass dieser Mann der eigentliche Chef war, nicht die Quotenjuristin mit Parteibuch der Arbeiterpartei, die im Fernsehen vorgezeigt werden konnte und sich Chefin des Dienstes nennen durfte. Amundsen leitete seit Jahrzehnten die operative Abteilung und hatte Ende der Achtziger die Überwachung von Arvid Storholt koordiniert. Vor noch längerer Zeit hatten Reuter und Amundsen gemeinsam beim Sicherheitsdienst der Polizei gearbeitet, weshalb Tommy die eine oder andere seltsame Geschichte über Amundsen kannte. In all den idiotischen Ranglisten über die mächtigsten Männer des Landes war Jan Amundsen nie vertreten gewesen, trotzdem wusste jeder, der sich ein bisschen auskannte, dass zwischen Gott und Jan Amundsen kaum Platz für andere war.
Auch deshalb war Tommy etwas desillusioniert, denn trotz der Ehrfurcht, die der Name weckte, wirkte der in die Jahre gekommene Mann so, als würde er sich einen Gefallen tun, endlich in Rente zu gehen, statt Tage und Nächte oben in Nydalen durchzuarbeiten und die Regierung mit guten und weniger guten Ratschlägen zu füttern.
Der alte, dünne Mann nickte Tommy stumm zu.
»Ja, also …«, begann Reuter, bevor er wieder verstummte und sich die Stille bedrückend über sie legte.
Tommy hatte das Gefühl, in eine Falle gegangen zu sein, ohne sagen zu können, warum. Es konnte nichts mit der Toten in Enebakk zu tun haben. Es musste etwas anderes sein.
»Kennen Sie jemanden bei den Streitkräften?«, fragte Jan Amundsen leise.
»Nein.«
Jan Amundsen holte tief Luft, ehe er seine Zigarette anzündete. Es machte beinahe den Eindruck, als wollte er ihm nur diese eine Frage stellen, bis er dann noch hinzufügte: »Kennt jemand bei den Streitkräften Sie?«
Tommy schüttelte den Kopf. »Nicht, dass ich wüsste.«
»Gut. Was Sie machen sollen, verstößt nämlich gegen alle Gesetze.«
November 1973Oslo
7
Der Wind war kälter, als Christel Heinze ihn aus Berlin gewohnt war, obwohl es auch dort im Winter eisig werden konnte. Besonders, wenn der kalte, sibirische Ostwind die Stadt noch fester umklammerte, als es die sowjetische Okkupationsmacht tat. Die Türen des Munchmuseums knirschten in der polaren Kälte. Es fühlte sich fast so an, als gefrören auch ihre Haare, dabei hatte sie nach dem Schwimmtraining in der Sporthochschule akribisch darauf geachtet, sie richtig trocken zu föhnen. Trotzdem waren ihre Ohren sofort zu Papier geworden, als wären sie noch immer von einer dünnen Schicht Chlorwasser umgeben. Eigentlich war das seit ihrer Kindheit so gewesen, auf jeden Fall nachdem ihre Eltern von den Stasitrainern besucht worden waren, die das Talent ihrer Tochter eines Morgens im Stadtbad Oderberger Straße im Prenzlauer Berg erkannt hatten.
Sie blieb für einen Moment im Eingangsbereich des Museums stehen, als zögerte sie. Die Busse standen am hinteren Ende des Parkplatzes, und es sah fast so aus, als versteckte der Bus der Schwimmmannschaft aus der Deutschen, sogenannten Demokratischen Republik sich hinter den anderen, größeren Bussen.
Es war ein Nachwuchswettkampf, an dem sie am nächsten Tag teilnehmen sollte, sonst nichts. Keiner in ihrer Mannschaft würde dadurch irgendwie weiterkommen. Es war ohnehin schwer genug, wenn nicht unmöglich, zur Elite aufzusteigen, doch wenn es einem gelang, wurde man von Honeckers Marionetten sogleich gezwungen, die Medizin zu schlucken, die auch die anderen der A-Mannschaft nahmen. Große, hässliche Lesben, dachte sie, wenn sie mal eine von denen sah. Sie mussten ihre Körper rasieren, sonst wuchsen überall dicke schwarze Haare, wie bei Männern. Vielleicht war sie nur neidisch. Sie war nicht so kräftig gewachsen, wie die Trainer es zu Beginn der Pubertät angenommen hatten, war ein feingliederiges Mädchen mit zu großen Brüsten geworden – ein echtes Hindernis, wenn man schnell durchs Wasser kommen wollte.
Nein, die B-Mannschaft ist doch ein Scheiß, dachte Christel und ließ die eiskalte Türklinke los. Sie schob die Hand in die Tasche der dünnen, graublauen Daunenjacke und holte das kleine Stück Seife hervor, das sie eingesteckt hatte.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.