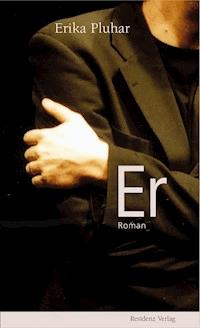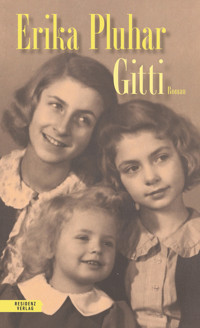Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die wichtigsten Reden und Essays der wunderbaren Autorin in einem Band. Wenn sie schon im Besitz einer Stimme ist, die wegen ihrem dunklen Timbre vielen auffällt, dann möge sie auch in einem anderen Sinn vernehmbar sein: als die Stimme einer Autorin und "Person öffentlichen Interesses", die Erika Pluhar nun einmal im Laufe ihres langen Lebens geworden ist. Ob zu ihrer persönlichen Haltung in politischen Fragen, zu gesellschaftspolitischen Belangen, die sie kommentiert, ob zu Ehrungen oder Verabschiedungen von Zeitgenossen, die sie liebte – immer wieder schrieb Erika Pluhar Essays und Artikel, wurde befragt, gab Antwort, oder meldete sich zu Wort, wenn es ihr notwendig erschien. Bei wichtigen persönlichen und öffentlichen Auftritten erhebt Erika Pluhar immer wieder ihre Stimme und beweist moralische Haltung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erika Pluhar
Die Stimmeerheben
Über Kultur, Politik und Leben
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2019 Residenz Verlag GmbH
Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
Umschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.com
Typografische Gestaltung, Satz: Lanz, Wien
Lektorat: Isabella Suppanz
ISBN ePub:978 3 7017 4623 1
ISBN Printausgabe:978 3 7017 3495 5
Inhalt
Starke Frauen am Theater (18. Februar 2002)
Das politische Lied (Februar 2002)
Zur Nationalratswahl am 24. November 2002 (24. September 2002)
Depression (November 2002)
Mein Lebensstil (3. Februar 2003)
Das Spargelessen (Mai 2003)
Obdachlos (27. September 2003)
Gesehenwerden (Februar 2004)
Männergesundheit (8. Juni 2004)
Die Macht der Gefühle (12. Juli 2004)
Haut (26. Dezember 2004)
Die Katastrophe (3. Januar 2005)
Susi, geliebte Freundin (16. Juni 2005)
John Irving (18. Februar 2006)
Achim Benning (März 2006)
Die Saharauis (Mai 2006)
Macht Schreiben glücklich? (Mai 2006)
Wahlkampf (September 2008)
Theater trifft (25. Oktober 2008)
Ein perfekter Tag (Juni 2009)
Wie erklärt man (3. Juli 2009)
Dankesrede (10. November 2009)
Vranitzky (November 2009)
Vom Vorlesen (April 2010)
Im Schatten der Zeit (März 2012)
Ich frage mich (September 2012)
Karlheinz Hackl (15. Juni 2014)
Murales (Juni 2014)
Integration (September 2014)
Glaube – Geld – Gelassenheit (5. Dezember 2014)
Brief an Österreich (7. Oktober 2016)
Fragen (8. Oktober 2017)
TROTZDEM (6. Januar 2018)
Trotzdem Überleben (13. Januar 2018)
Frau-Sein heute (28. Januar 2018)
Würde (5. Mai 2018)
Gemeinsam Demokratie retten (Juni 2018)
Rassismus (November 2018)
Schönheit im Alter (Dezember 2018)
ROMY (13. April 2019)
Beitrag für die Theaterzeitschrift »BÜHNE«
18. Februar 2002
Starke Frauen am Theater
Als Mädchen hat man meine Wünsche zur eigenen Kreativität sofort positiv gesehen, als diese in Richtung Theater gingen. Dass es Schauspielerinnen geben muss, schien einleuchtend, dass Frauen sich rein interpretatorisch der Kunst nähern, wurde sehr wohl als eine der wenigen Möglichkeiten einer solchen Annäherung gesehen.
Das war vor einigen Jahrzehnten, und man möchte meinen, dass diese Zeiten vorbei sind. Ich wurde also dazumal Schauspielerin, obwohl ich stets auch ein schreibender Mensch gewesen bin. Also einer, der im Schreiben Leben erfindet und sein Leben findet. Ich wurde Schauspielerin, wurde dabei das, was man erfolgreich nennt, hatte, wie ich es immer nenne, Hoch-Zeiten am Theater und habe diesen Beruf auch lange Zeit mit Intensität und Leidenschaft zu dem meinen gemacht. Ich konnte mit sensiblen Regisseuren und wunderbaren Kollegen Vorstellungen erarbeiten, an denen mir persönlich sehr viel lag. Aber irgendwann hat sich für mich all dies erschöpft. Eine Rolle – noch eine Rolle – noch eine Rolle – irgendwann wollte ich nicht mehr funktionell und als reines Instrument an diesem Rollenspiel teilhaben.
Wie kann eine Frau stark sein – besser, wie kann ein Mensch stark sein, der, wenn er die Fähigkeit dazu besitzt, dennoch nicht in der Lage sein darf, in Eigenregie zu imaginieren und Welten zu erschaffen?
Ich habe persönlich ziemlich drastisch erlebt, wie schwer es ist, aus den von der Gesellschaft verliehenen Rollen auszusteigen, die Schubladen zu verlassen, in denen man für die Umwelt übersichtlich eingeordnet zu sein scheint. Man hielt mich eine Zeit lang für entweder aus Altersgründen abgeschoben oder für verrückt, als ich begonnen habe, mich vom Schauspielerberuf zu lösen. Mittlerweile hat sich das wieder gelegt, und ich kann jetzt sein, was ich in Wahrheit bin. Jemand, der seinen eigenen, ihm wesentlich erscheinenden Inhalten Worte verleiht und die Profession der Schauspielerei dabei mit sich trägt, wie der Körper seinen Atem.
Nun ist es aber trotzdem nicht so, dass ich das Theater etwa verachte oder negiere. Es gehört – und wird das immer tun – zu den wesentlichsten Ausdrucksformen des Menschen. Auch war alles, was es mir im Lauf der Jahre abgefordert hat, eine Lebensübung. Disziplin, Konzentration, wenn der Augenblick es fordert, ohne Absicht das Beabsichtigte tun, nicht warten dürfen, bis die Muse einen küsst, sondern da sein, wenn der Vorhang hochgeht: alles Lebens-Übungen. Außerdem war es der stetige Umgang mit dem Wort, der mich meine Theaterjahre nicht als verlorene Jahre sehen lässt.
Nach wie vor liebe ich die Wechselwirkung zwischen Bühne und Publikum. Nach wie vor glaube ich an die Fähigkeit von Menschen, Wahres von Talmi unterscheiden zu können, nicht so sehr intellektuell, sondern einfach durch die Tatsache eines gemeinsamen Atem-Anhaltens, einer gemeinsam erzeugten Stille. Oder eines gemeinsam und auf Anhieb ausbrechenden Gelächters. Publikum, und wie es reagiert, hat mir immer wieder geholfen, meinen zerfledderten Glauben an die Menschheit ein wenig zu flicken. Und jetzt mehr denn je, wo ich von der Bühne her lesend, sprechend, musizierend, ja quasi »Auge in Auge« und nicht durch eine imaginäre vierte Wand abgeschirmt, diese Reaktionen vor mir haben darf. Wenn ich jetzt also meine kurzen Ausführungen niederschreibe, bin ich nach wie vor kompetent, diesen Austausch, diesen Wechsel von Energien, diese wie durch eine Lupe betrachtete Daseinsform, also all dies, was eine Bühne erreichen und manifestieren kann, zu beurteilen. Nur kann ich, wenn Sie so wollen, jetzt als »starke Frau« – viel besser jedoch: als eigenständiger Mensch – auf den Bühnen das zum Ausdruck bringen, woran mir liegt. Weil ich daran glaube, dass das eigene unverfälschte Anliegen immer auch das von anderen ist, und dass wir uns mit-teilen sollen. Ein Miteinander und das Teilen des Augenblicks, eines Stücks Gegenwart – als solches ist und bleibt Bühne, bleibt jede theatralische Form für mich lebenslang bestehen.
Einleitende Worte vor einem Konzert im Rahmen der Veranstaltungsreihe »Das politische Lied« im Kabarett-Theater »Distel«, Berlin
Februar 2002
Das politische Lied
Das ist so eine Sache mit dem politischen Lied.
Als ich begonnen habe, meine eigenen Texte zu singen, und das immer ausschließlicher, befand ich mich im Zustand erster politischer Erkenntnisse. Bis in meine Vierziger hatte ich in amorpherweise, viel zu sehr von Persönlichem und Privatem hergenommen die politischen Geschehnisse der Welt an mir halbinteressiert vorübergleiten lassen. Also eigentlich das getan, was ein Großteil der Menschheit zu allen Zeiten tut. Danach meinte ich, der Welt sofort und dringlich mit meinen Liedern mitteilen zu müssen, was ich selbst gerade erst verstanden hatte. Diese Intention fiel auch mit den ersten großen Friedenskonzerten in Dortmund und Bochum zusammen, und ich hatte kurzfristig den Eindruck, dabei mitzuwirken, im Nu die Welt zu verändern. Sehr bald konnte ich jedoch beobachten, dass es modisch wurde, ein »Friedenskünstler« zu sein, dass die Manager sich der Chose bemächtigten, und mein missionarischer Anspruch fiel langsam wieder in sich zusammen.
Und nicht nur der meine.
Plötzlich war es nicht mehr opportun, das »politische Lied«. Die wenigen, die daran festhielten, wurden belächelt. Man besang wieder viel lieber Privates, Überschaubares, es ging um Liebe, Leid und Lebenslust, und so auch bei mir.
Bis in Österreich Jörg Haider, Landeshauptmann von Kärnten, sich dermaßen widerwärtig auf alter Rechtspopulistenschiene etablierte, dass mir ohne viel inneren Aufwand Lieder entschlüpften, die man vielleicht wieder »Protestlieder« nennen konnte. Ich gab ihnen gar keinen Namen, ich sang sie einfach. Es war mir gleichermaßen selbstverständlich als auch notwendig, das zu tun. Ich streute sie übergangslos in meine Programme ein und erntete anfangs Reaktionen, die von Erstaunen – muss sie das denn tun? – bis Empörung – hat die Frau das notwendig? – reichten.
Dann begann man diese Lieder bei mir wieder zu erwarten, allmählich gehörten sie wieder zu mir. Und ich schrieb sie jetzt meist im Wiener Dialekt, um so unprätentiös und auch humorvoll wie nur möglich zu bleiben. Weil ich wahrgenommen habe, dass dies Menschen eher erreicht als bitterer Ernst. Über jemanden zu lachen ist eine der besten Waffen gegen ihn. Und eine Waffe, zu der ich stehe.
Leider bleibt einem nur immer wieder das Lachen im Halse stecken, und dann hilft’s nix. Dann muss er wieder her, der ernsthafte Widerstand, und das ohne Rücksicht auf Verluste.
Kommentar für die Zeitschrift »FORMAT«
24. September 2002
Zur Nationalratswahl am 24. November 2002
Ich vernahm heute, als ich Radio hörte, dass das Interesse an Politik bei der österreichischen Bevölkerung um 40 Prozent gestiegen sei. Man also eine höhere Wahlbeteiligung erwarte als 1999.
Was für eine gute Nachricht, dachte ich.
Und ich will vorerst, ehe ich eines Schlechteren belehrt werde, auch daran festhalten, dass es eine gute Nachricht war. Dass die Menschen unseres Landes sich dessen bewusst geworden sind, wie einschneidend und zukunftsbestimmend der Ausgang dieser Wahl sein wird. Dass er uns die Möglichkeit bietet, eine unzumutbare, unfähige, uns der Lächerlichkeit preisgebende Regierung endlich wieder abzuschütteln. Eine Regierung, die ja 1999 nicht durch das Mehrheits-Wahlergebnis der Staatsbürger, sondern durch eine Koalition Wolfgang Schüssels, ÖVP, mit der FPÖ zustande kam. Durch den Zusammenschluss zweier Parteien also, die einander partiell nicht ausstehen konnten und können. Durch Machtinteressen und nicht durch das Interesse, diesem Land in irgendeiner Form zu dienen. Immer wieder wurde behauptet, diese unsägliche Regierung, die nicht umsonst durch unterirdische Gänge zu ihrer Angelobung schreiten musste, sei »demokratisch gewählt« worden. Dass die Mehrheit der Österreicher jedoch sozialdemokratisch gewählt hatte, wurde – auch und vor allem von den Sozialdemokraten! – viel zu selten betont und klargestellt.
Inzwischen jedoch hat der FPÖ-Anteil dieser Regierung sich selbst derart demontiert, dass ich mir einfach nicht mehr vorstellen kann, wie irgendeine oder irgendeiner in unserem Land dies noch übersehen oder schönfärben kann. Ich denke, dass man weitgehend zu der Erkenntnis gelangte, dass Österreich aus der Geiselhaft einer irrealen Machtbesessenheit erlöst werden muss. Und da ich weiterhin an die Urteilsfähigkeit unserer Bürger glaube, glaube ich auch an einen Wahlausgang, der Österreich rehabilitieren wird. Ich habe niemals verschwiegen, dass mir, wenn ich es mir aussuchen könnte, an einer rot-grünen Koalition läge. Aber woran mir vor allem liegt, ist das endgültige Ausschalten der blauen Einflussnahme. Mein Wunsch wäre es auch, dass die Medien den unsinnigen blauen Spielchen schlicht und einfach nicht mehr so viel Raum geben. Damit würde das rechtspopulistische Getümmel endlich wieder in seine Bierkeller und Bärentäler verwiesen. Ich glaube auch an den immer wiederkehrenden Akt der Vernunft beim Menschen. Im jetzigen, speziellen Fall an den, vernünftig zu wählen. Eine Regierung zu wählen, die die Situation Vernünftiger in diesem Land wieder zu einer lebbaren macht.
Ich lebe in Österreich.
Ich liebe dieses Land.
Ich möchte mich seiner nicht mehr schämen müssen.
Geht es Ihnen nicht genauso?
Nachtrag:
Am 28. Februar 2003 einigten sich ÖVP und FPÖ, trotz starker Stimmenverluste der Freiheitlichen Partei, auf eine Fortsetzung der schwarzblauen Koalition.
Referat bei einem Anti-Depressions-Kongress in München
November 2002
Depression
Meine Damen und Herren,
ich begrüße aus tiefster Überzeugung und von eigenen Erfahrungen belehrt die sich mehr und mehr formierenden Versuche, das, was oberflächlich als Depression bezeichnet wird, auch wirklich beim Namen zu nennen. Die Depression aus der Dunkelheit schamvollen Schweigens und verborgenen Erleidens in den Bereich eines Krankheitsbildes, einer klaren Erkenntnis, eines möglichen Damit-Leben-Könnens hervorzuholen, ohne sich der Gesellschaft entziehen zu müssen. Ja, das Dunkel der Depression endlich mit Wissen darum zu erhellen.
Nun gilt aber vorerst einzukreisen, worüber wir sprechen.
Wer von uns ist nicht ab und zu deprimiert? Wir kennen alle diesen Zustand, der uns immer wieder mal überfällt: deprimiert zu sein. Will heißen: niedergedrückt. Dem Druck des Lebens ausgesetzt. Der meist aus Angst, aus Groll und aus Selbstmitleid besteht. Wir haben Angst vor unserer Endlichkeit und verdrängen sie. Wir grollen dem Leben, weil es uns unsere Wünsche nicht so erfüllt, wie wir meinen, dass sie erfüllt werden sollten. Wir tun uns selbst immer wieder fürchterlich leid, weil man uns nicht genug liebt, genügend lobt und anerkennt. Das alles sind Empfindungen, die zum Menschsein gehören. Ab und zu deprimiert zu sein, gehört zum Menschsein – und nichts ist törichter – und auch unerträglicher für alle anderen –, als eine unerschütterliche Frohnatur sein zu wollen.
Etwas anderes ist es jedoch, in eine echte Depression zu geraten. Ich bin nicht befugt, aus ärztlicher oder wissenschaftlicher Sicht darüber zu sprechen. Ich kann über diese Krankheit – und eine echte Depression ist eine echte und schwerwiegende Krankheit –, ich kann darüber nur als eine immer wieder einmal davon Betroffene sprechen. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, bis wohin eine Depression uns führen kann. Und ich weiß es in einem Ausmaß, das nichts mit dem gängigen Satz »Mein Gott, hab ich eine Depression!« zu tun hat. Wer wirklich unter Depressionen leidet, spricht nicht darüber. Im besten Fall ist er damit beschäftigt, durch jeden Tag hindurchzukommen. Meist – bei mir jedenfalls äußerte oder äußert es sich so – ist es eine Gewaltanstrengung, den Morgen zu bestehen.
Aufzustehen. Den Schlaf und das Bett zu verlassen. Sich den einfachsten Anforderungen zu stellen, ohne sie als unüberwindliche Gebirge vor sich zu sehen.
Mein persönliches Leben hat mir reichlich Verlust und Leid beschert. Trauer zu leben, Schmerz auszuhalten, im wahrsten Sinn dieses Wortes, das Leben nicht von sich zu werfen, sondern das Weitergehen auf sich zu nehmen – all dies führt an äußerste Grenzen des Erleb- und Ertragbaren. An äußerste Grenzen einer neuen Bewusstwerdung, die sowohl Vergänglichkeit als auch ein anderes Bestehen umschließt. Dabei wird einem alles abgefordert, was an Kraft in einem ist. Dabei kann man selbst erfahren, ob Kraft einem möglich ist oder nicht.
Aber mit einer Depression hat gelebtes Leid nichts gemeinsam. Weil gelebtes Leid lebendig ist. Und die Depression Leben verbietet.
Ich möchte aber jetzt nicht weiter theoretisieren, sondern Ihnen kurz von der ersten seelischen Erkrankung meines Lebens, die zu einer echten, lebensgefährdenden Depression führte, berichten: Als Mädchen mit etwa sechzehn Jahren geriet ich unvermutet in eine Magersucht, medizinisch Anorexie genannt. Es war bei mir keine Bulimie, also eine Essstörung, bei der man isst und dann erbricht, nein, ich aß einfach nichts mehr.
Als Gymnasiastin nur Vorzugsschülerin, stets pflichtbewusst und trotz Krieg und Nachkriegszeit ein gesundes Kind, war damals, also in den Fünfzigern, diese Erkrankung für alle ein Rätsel, sie stieß meine Eltern, mein Menschenumfeld in völlige Ratlosigkeit und Verzweiflung. Die Möglichkeit von Therapien war unbekannt, es schien dazumal für seelische Irrwege auch nur Irrenanstalten zu geben.
Ich war wohl auch der klassische Fall eines jungen Mädchens, das sein Frau-Sein verweigert, so erfuhr ich es später. Meine Mutter überlastet und mit ihrem Frauenleben unzufrieden, ein Tanzschulflirt, der zu einer Beinahe-Vergewaltigung führte, die Filme dieser Zeit ein Frauenbild demonstrierend, das aller ersehnten Eigenständigkeit widersprach – wie auch immer.
Ich hörte auf zu essen und ahnte gleichzeitig, dass ich daran sterben würde. Ich lebte als Maschine weiter. Ich erfuhr eine Trostlosigkeit, eine Dürre, eine Qual des Weiterlebens, wie es nur die Depression erzeugen kann. Es war eine, die ich bis heute nicht vergessen habe.
Aber ich überlebte. Und zwar in noch jungen Jahren. Man weiß, wenn Essstörungen nicht in der Jugend behoben werden, begleiten sie das weitere Leben oder führen frühzeitig zum Tod.
Bei einem Sommerurlaub der Familie am Attersee im Salzkammergut wurde mir geholfen. Und zwar von den zwei Frauen, bei denen wir einquartiert waren. Sie waren Schwestern, beide unverheiratet, beide tätig, im Haus oder bei ihren Kühen auf der Alm, beide sangen im Kirchenchor, beide waren braungebrannt und fröhlich, beide hatten vergangene Liebesgeschichten auf Lager, und beide forderten mich nie auf, »doch bitte was zu essen«. Ich erfuhr eine Therapie, die mir aus gesunder Wahrnehmung, aus gesundem Verständnis geschenkt wurde. Von Frauen, die selbstständig, ungebrochen, von keinem Mann gegängelt ihren Bedürfnissen, ihrer Natur entsprechend lebten, instinktiv erkannten, was mit mir los war, mir einen Sommer lang die mögliche Schönheit des Lebens bewusst machten, und mich auch langsam an eine gewisse Nahrungsaufnahme heranführten. Nach diesen Wochen am See begann ich zu gesunden. Ich konnte mich aus den Tiefen der Anorexie und der daraus resultierenden Depression befreien.
Doch ganz gesund, ganz frei von den Gefährdungen dieser seelischen Erkrankung wurde ich nie. Doch kann ich mich jetzt, im wahrsten Sinne, aus ihr erheben.
Natürlich gibt es die Möglichkeit einer so »natürlichen« Therapie, wie ich sie erfuhr, nur als Glücksfall. Deshalb auch meine Dankbarkeit.
Aber auch meine stetige Bereitschaft, zum Thema Depression das Wort zu ergreifen und als Wissende auf die Schwere dieser Erkrankung hinzuweisen.
Für eine Gesundheitsbeilage der »Kronen Zeitung«
3. Februar 2003
Mein Lebensstil
Um es kurz zu umreißen: mein Lebensstil ist der, keinen Lebensstil zu haben.
Sicher klingt dies für viele Ohren allzu lapidar, da ja schließlich jeder Mensch eine Lebensform wählt, oder sich ihr unterwerfen muss. Aber nicht umsonst habe ich jetzt lieber nach diesem Wort gegriffen: Lebensform. Form bedeutet, einen Inhalt zu umhüllen. Stil ist Selbstzweck. Jedenfalls sehe ich das so.
Wir sind so sehr in die Kriterien von »Lifestyle« verwickelt worden, aus den Medien werden wir derart davon überschwemmt, dass Menschen dazu neigen, nur noch den richtigen, gesellschaftlich richtigen Stil für ihr Leben zu suchen, und nicht mehr dessen Qualität.
Ich glaube von mir behaupten zu dürfen, dass es mir um Letzteres geht. Um Lebensqualität. Und so gesehen forme ich mein Leben, wenn auch mit geringem Einsatz jener formalen Mittel, die unser zeitgeistiger Lebensstil unerbittlich zu verlangen scheint.
Was ich also beharrlich verweigere, sind touristische Reisezwänge, In-Lokale, oder gar Trends à la »Wellness« oder Fitnessprogramme. Die Reisen in meinem Inneren haben bei mir Vorrang, beanspruchen viel Raum und Zeit. Auch esse ich gern gut, egal wo, aber möglichst gesellschaftlich unbeobachtet und mit Freunden, und mein Körper sucht auf ihm gemäße Weise Wohlgefühl und Bewegung, ich erlausche dies lieber, als ihn mit kommerziell gesteuerten Forderungen zu quälen.
Im Übrigen lebe ich in der Stille eines durchaus unmodischen, alten Hauses, das eines Tages eher auf mich zukam, als dass ich es gesucht hätte. Und ich baue und renoviere möglichst wenig an diesem Haus herum, erhalte es nur gesund. Der Drang nach dem letzten Schrei bei Design und Technik des Wohnens ist mir gänzlich fremd. Auch verändere ich nur, was unter mir schier zusammenbricht. Unentwegte Neuerungen in meinem Lebensumfeld würden mir zu viel Zeit dafür rauben, mich selbst und mein Leben zu erneuern. Ähnliches ist auch der Grund, warum ich relativ ordnungsliebend bin. Das ständige Nach-etwas-Suchen betrachte ich als Zeitverschwendung.
In allen anderen Belangen verschwende ich jedoch Zeit nach Herzenslust. Ob das nun Mußestunden sind oder tätige – ich verweigere Hast, so weit es nur irgend geht. Nehme mir Zeit. Lasse mich nicht fremdbestimmen. Das bedeutet natürlich auch, nicht kontinuierlich von Menschen begleitet zu sein, Einsamkeit leben zu können. Ein Menschenumfeld, dem man nahe ist und stetig zugehört, bedeutet immer auch Lebensdruck. Ich glaube, das muss man wissen.
Die Bäume vor meinen Fenstern, die Wanderungen in den Hügeln am Rande der Stadt. All die Bücher, die meine Räume füllen. Und die Menschen, die meinem Herzen nahe sind, sie vor allem – also was Liebe und Freude erweckt, ohne freies Atmen zu behindern –, all dies ist der von mir bejahten Form und Qualität meines Lebens gemäß. Half mir auch, Leid und Verlust anzunehmen. Dabei hilft einem nämlich kein »Lebensstil« der Welt weiter, sondern nur die selbst gewählte Form eines disziplinierten und gleichzeitig lebendigen Weitergehens, fernab genormter Vorschriften und nahe dem schlichten So-Sein.
Für die Zeitschrift »FORMAT«
Mai 2003
Das Spargelessen
Der Zweck heiligt die Mittel. Das ist eine Behauptung, die mir seit jeher als eine der suspektesten im Kreise aller suspekten Behauptungen erscheint. Dass irgendein Zweck Mittel »heiligen« könne, die miserabel sind, wollte mir nie in den Kopf. Wenn man durch Kot stapft, wird doch unweigerlich schmutzig, was man hinterher erreicht und betritt. Und auch, dass irgendein Ziel auf Erden eines schmutzigen und unwürdigen Hinwegs wert sein könnte, glaube ich nicht. Vor allem im Hinblick auf eine und auch meine Lebensphilosophie, die bejaht, dass »der Weg das Ziel« sei.
Der Schluss liegt also nahe, dass man sich meist der anfangs zitierten Behauptung zu bedienen pflegt, wenn es um Rechtfertigung von Unrecht geht. Wenn man verschleiern möchte, welches unrechte Ziel letztendlich verfolgt wird, was der wahre und eigennützige Zweck des Ganzen ist.
Wenn Bundeskanzler Gusenbauer Jörg Haider heimlich zum Spargelessen trifft – nicht von ungefähr drang das, was die beiden aßen, trotzdem so detailliert ins Bewusstsein der Öffentlichkeit, will mir scheinen. Gibt es da nicht den prägnanten wienerischen Ausdruck: »Red’ kan Spargel«? Also wenn Herr Gusenbauer Einhelligkeit mit, oder auch nur die leise Annäherung an die Person Jörg Haider und dessen Politik sichtbar werden lässt, wirft er die Ernsthaftigkeit und das Anliegen tausender Menschen auf den Mist, die dazumal gegen die blau-braune Einfärbung unserer Regierung in gewaltigen Demonstrationen auf die Straße und auf den Heldenplatz zogen. Und dabei unter anderem auch seinem, und dem Aufruf seiner Partei folgten! Weil es ihr eigener Ruf, ihre eigene Überzeugung war, die sie von Gusenbauer und den Sozialdemokraten geteilt wähnten.
Wenn Herr Gusenbauer Herrn Haider zum Spargelessen trifft, ist das kein Zweck, der irgendetwas heiligt, sondern Verrat. Der Verrat an vielen Bürgern unseres Landes, der Verrat an einer Grundhaltung seiner Partei, die diesen Bürgern, seinen Wählern, versprochen war.
Jörg Haider wird immer Jörg Haider bleiben, auch wenn er ab und zu Kreide frisst, sobald es ihm nützlich erscheint. Ich glaube, dass sogar die viel zitierten »kleinen Leute« dies mittlerweile weitgehend durchschaut haben. Dass er sie nie gemeint, nur benützt hat. Wer Haiders Winkelzüge bislang nicht erkennen konnte, ist schlicht mit Blindheit geschlagen. Aber letztlich sind Menschen nicht so blind, wie man sie gern hätte.
Im Versuch, der eigenen Bestürzung etwas entgegenzusetzen, fragt man sich natürlich, warum Gusenbauer so gehandelt hat. Da gibt es die Theorie, dass durch dieses Treffen und Haiders Aufwertung ein schnelleres Platzen der derzeitigen Regierung zu erwarten sei. Oder sogar die, dass ein rot-blaues Bündnis sich ankündige. In jedem Fall aber ging es um Gusenbauers verzweifelten Versuch, Macht nicht gänzlich zu verlieren, sich ins Spiel zu bringen. Egal, mit welchen Mitteln.
Aber da diese Mittel ganz offensichtlich und durchschaubar von ihrem Zweck nicht geheiligt wurden, war es dennoch nichts anderes als eine sinnlos entwürdigende Aktion.
Man kann nur hoffen, dass daraus im Rückblick nur eine Anekdote wird. Und nicht gar der überaus lächerliche Anfang vom traurigen Ende der Sozialdemokratie.
Beitrag für die Festschrift zum fünfzehnjährigen Bestehen des Hauses »Miriam«, einem Übergangswohnheim der Caritas für obdachlose Frauen
27. September 2003
Obdachlos
Das Wichtigste: ein Dach über dem Kopf.
Wer hat diesen Satz nicht schon einmal vernommen oder ausgesprochen.
Und meist hat man es ja auch, dieses Dach über dem Kopf. Man bedenkt selten oder nie, wie es sein könnte, dieses zu verlieren. Also obdachlos zu sein. Wenn man Menschen sieht, die auf Parkbänken oder unter Brücken schlafen, neigt man dazu, von »Randfiguren der menschlichen Gesellschaft« zu sprechen. Im Dünkel zu verharren, ein Zustand dieser Art sei vermeidbar und beruhe nicht zuletzt auf persönlichem Verschulden.
»Man« fühlt sich sicher.