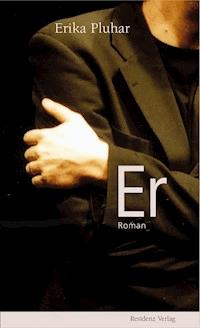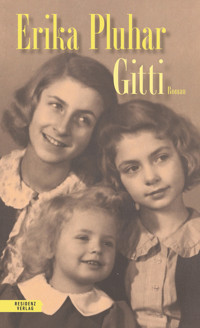Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Bestsellerautorin Erika Pluhar erzählt von einer Frau, die an einem Wendepunkt ihres Lebens steht. Mit 51 Jahren kehrt Hedwig Pflüger in die von ihrer Großmutter ererbte Wiener Wohnung zurück, nachdem sie diese Stadt und die alte Frau, bei der sie aufwuchs, einige Jahrzehnte gemieden hatte. Hedwig steht am Wendepunkt ihres Lebens und beginnt in der Stille des alten Wiener Wohnhauses, von Erinnerungen belagert, Vergangenes aufzuschreiben. Es wird zum Bericht vom Leben einer Frau, der nicht gelingen wollte, den genormten Forderungen ihrer Zeit zu genügen, die nach allem vergeblichen Bemühen immer wieder in Isolation und Einsamkeit geriet. Jetzt aber, während sie schreibend zurückblickt, erlernt Hedwig, Gegenwart anzunehmen und sich für neue Herausforderungen zu öffnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erika Pluhar
HEDWIG
heißt man dochnicht mehr
Eine Lebensgeschichte
© 2021 Residenz Verlag GmbHSalzburg – Wien
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.com
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
Umschlaggestaltung: Boutiquebrutal.com nach einer Idee von Erika Pluhar
Umschlagfoto: Evelin Frerk
Typografische Gestaltung, Satz: Lanz, Wien
Lektorat: Isabella Suppanz
ISBN ePub:
978 3 7017 4665 1
ISBN Printausgabe:
978 3 7017 1749 1
Inhalt
Hedwig
Hedwig saß am Fenster und sah in den Hinterhof hinaus.
Der war so lichtlos und grau wie damals, als ihre Großmutter hier saß und hinausschaute. Auf diesem Sessel, der immer hier stand. Dunkles Holz, Seitenlehnen, die Sitzfläche heller, von Schwere und Müdigkeit abgenutzt.
Hedwig war in die Wohnung ihrer Großmutter zurückgekehrt. Tags davor. Am Gang stand sie eine Weile regungslos vor der vertrauten Tür, hatte dann erst aufgesperrt und den Korridor zögernd betreten. Jedoch der Geruch aus diesen unbelebten, der Zeit überlassenen Räumen überfiel sie so drückend, dass sie weitereilte und alle Fenster öffnete.
Nur durch Zufall und verspätet hatte sie es erfahren. Dass nach dem Tod der Großmutter diese Wohnung lange leer stand, weil sie, Hedwig, als Erbin eingesetzt worden war. In Lissabon hatte sie es erfahren. Ein Verwandter rief sie aus Wien an. Er hieß Bernhard, sie hatten einander seit Kindertagen nicht mehr gesehen. Aber von ihm erfuhr sie es. Dass ihre Großmutter vor eineinhalb Jahren gestorben sei. Dass Hedwigs Erbanspruch leider längere Zeit beim Notar liegen geblieben sei, man ihn nicht früher übermitteln konnte. Aber jetzt, endlich!
Dieses Telefonat mit Cousin Bernhard, obwohl es ohne Liebenswürdigkeit geführt wurde und Fragen offenließ, hatte letztendlich bewirkt, dass sie nach langen Jahren der Abwesenheit ihre Zelte in Portugal abbrach und ein Flugzeug nach Wien bestieg. Es schien ein Ausweg zu sein, den das Leben ihr zugewiesen hatte.
Jetzt saß Hedwig auf dem alten Sessel ihrer Großmutter, stützte sich, ähnlich wie die es immer getan hatte, mit einem Arm am Fensterbrett ab und blickte auf die graue, abblätternde Wand gegenüber. Seitlich gab es andere Fenster aus anderen Hinterzimmern, aber kein Leben schien sich dahinter zu regen. Der Hof war eng und zu dunkel, nur die Großmutter hatte diesen Blick gemocht.
Als Kind schon war Hedwig oft hier in dieser Wohnung gewesen, man schickte sie von zu Hause mit der Straßenbahn los, die Großmutter zu besuchen. Dort kamen stets Hedwigs Lieblingsspeisen auf den Tisch, reichlicher und köstlicher als je bei den Eltern. Essensvorräte zu besitzen, und zwar so reichlich, um jederzeit üppig aufkochen zu können, das war für die Großmutter eine lebenslange Notwendigkeit geblieben. In jungen Jahren hatte sie im Krieg und in der Nachkriegszeit bitter erfahren, was es heißt, zu hungern. Jetzt war sie oft bei befreundeten Bauern am Land zu Besuch, machte sich dort nützlich, und brachte stets Essbares mit, wenn sie in die Stadt zurückkam. Sie »hamsterte« wie in Notzeiten, hortete alles in dem dunklen Kabinett, in dem sie auch schlief, der große Tisch dort war voll davon, Brot, Speck, Äpfel, Mehl, es roch wie in einem Lebensmittelladen.
Sogar jetzt noch, fand Hedwig.
Sie hatte die erste Nacht hier in der Wohnung im Bett der Großmutter verbracht, in diesem Kabinett. Nachdem sie noch rasch in einem nicht weit entfernten Laden zwei Kissen, Decken und Überzüge erstanden hatte. Im Schrank der Großmutter sah sie zwar Bettwäsche säuberlich gestapelt, aber seit Jahren unbenutzt und muffig riechend, Hedwig hatte die Schranktür rasch wieder geschlossen.
Ich werde alles in eine Wäscherei tragen müssen, dachte sie. Und irgendwann eine neue Waschmaschine brauchen. Und vielleicht einen neuen Herd. Auch das Badezimmer geht so nicht mehr, die uralte Wanne und nur kaltes Wasser, wenn der vorsintflutliche Durchlauferhitzer nicht mehr anspringt.
Und dann die Kleidung der Großmutter. Sie befand sich im anderen großen Schrank, Hedwig hatte nur einen kurzen Blick hineingeworfen und den Staub der Zeit gefühlt, der über allem lag. Sie würde es nicht so schnell über sich bringen, alles, was die Großmutter getragen hatte, durchzusehen. Ihre gemusterten Kleider, die sie gern anhatte, sommers und winters stets gern Kleider. Die Krägen waren meist weiß, die wechselte sie oft, wusch und bügelte sie sorgfältig.
Da ich mich nicht mehr bei ihr gemeldet, sie angerufen oder ihr einen Brief geschrieben habe, drang folgerichtig nicht einmal die Nachricht ihres Todes zu mir, dachte Hedwig. Sie betrachtete ihre eigenen Hände, die langsam auch ein wenig so auszusehen begannen, wie die der Großmutter, nur noch nicht so verbraucht, so dicht mit braunen Flecken übersät. Aber gerade so wie sie waren, hatte sie die Hände der alten Frau geliebt. Und trotzdem vergessen. Wie sie alles vergaß, als sie sich auf den Weg machte. Oder meinte, sich auf den Weg machen zu müssen, weg von hier, weg von der Trauer um ihre Eltern, weg vom Gefühl des Ausgeliefertseins, niemand mehr um sie, zwei ferne Cousins, irgendwelche Verwandte, die sie nie sah, auch die anderen Großeltern lange tot und nie kennengelernt. Nur noch diese alleinstehende Frau, ihre Großmutter väterlicherseits, bei der sie schließlich gelebt hatte.
Hedwig stand auf, verließ das Gangfenster und ging in die größeren Räume hinüber. Zwei gab es in dieser Wohnung, ein Speisezimmer und ein Schlafzimmer. Das große Doppelbett in letzterem hatte die Großmutter nach dem frühen Tod ihres Mannes nicht mehr benützt. Seltene Gäste schliefen hier. Und später das junge Mädchen Hedwig. Warum willst du denn unbedingt im Kabinett schlafen? hatte es die Großmutter gefragt. Um zu vergessen, antwortete die. Was denn vergessen? Was ein Mann so tun kann, Hedwig. Pass auf dich auf.
Auf dem Doppelbett mit seinen Matratzen lagen nur eine dünne geblümte Überdecke und eine feine Schicht Staub. Ich werde trotzdem versuchen, heute Nacht lieber hier zu schlafen, dachte Hedwig. Sie kannte jedes Möbelstück in beiden Zimmern. Altes dunkles Mobiliar. Im Wohnraum die geschnitzte ausladende »Kredenz«, von der Großmutter so benannt, sie war deren ganzer Stolz gewesen. Säulchen, kleine Balustraden, »altdeutsch« wurde dieser Stil genannt, wohl als die Großeltern jung waren, in Mode und begehrt. Auch der Schreibtisch, ebenfalls im Wohnzimmer, trug Verzierungen aus Holz über den kleinen Schubfächern, welche die grünsamtene Schreibfläche abschlossen. Davor ein Sessel, die Sitzfläche ebenfalls grün gepolstert. Alles verstaubt.
Durch die Fenster, von Hedwig tags davor eilig geöffnet, drangen Luftstöße herein und ließen feine Wölkchen Staub hochsteigen. Ich brauche unbedingt einen Staubsauger, dachte Hedwig. Und Staubtücher. Aber nicht jetzt. Später. Es ist Mittag und heiß draußen, ein heißer Sommertag, ich muss mich ausruhen. Muss liegen. Habe meine Wirklichkeit aufgegeben, kann mich nur noch in Erinnerungen aufhalten. Das Leben selbst hat sich mir verschlossen, deshalb bin ich jetzt ja hier.
Hedwig zog das Tuch vom Doppelbett, spähte aus dem Fenster, und als sie sah, dass unten niemand vorbeiging, schüttelte sie es über der Gasse aus. Der Staub vernebelte kurz die Sicht, bis er davonsank.
Dann holte Hedwig ihr Bettzeug aus dem Kabinett, spannte ein frisches Leintuch über eine der Matratzen und streckte sich dann auf dem Bett aus. Unter den Kopf hatte sie sich ein Kissen geschoben, sie lag angekleidet und kerzengerade da. Es war schattig im Zimmer, die Sonne erreichte die Wohnung nicht, dazu war die Gasse zu eng. Eigentlich hatte sie ja vorgehabt, irgendwo in einem Café zu frühstücken und einiges an Essensvorräten einzukaufen, aber ihr fehlte die Kraft dazu. Muss jetzt nicht sein, dachte sie, geht alles irgendwann später.
Als Hedwig die Augen schloss, sah sie ihren Hund Anton durch die Uferwellen der Praia do Guincho dahinsausen. So oft hatte sie das gesehen. Jetzt geschah es hinter ihren geschlossenen Augen. Für sie hieß der Hund sofort Anton, als sie zueinanderfanden. Als er sie fand. Diese Begegnung hatte in den nächsten Jahren ihrer beider Leben besiegelt. Sie verbrachten sie Seite an Seite. Bis vor Kurzem. Bis zu Antons Tod.
Hedwig blieb mit geschlossenen Augen liegen und ließ den Hund am Meeresufer weitertollen, ließ dieses innere Bild gewähren. Er hatte den Atlantik geliebt, nicht nur die äußersten Ausläufer der Wellen, manchmal war er in die riesigen, mit ihrer weißen Gischt heranrollenden Wogen gesprungen und hinausgeschwommen, viel mutiger als sie selbst. Beide hatten sie ihn geliebt, den Atlantik. In Hedwigs Augen gerieten jetzt Tränen, sie konnte nicht anders.
Schließlich richtete sie sich auf. Das nicht mehr, dachte sie, bitte nicht mehr dieses Weinen, genug geweint, jetzt lieber zu Stein werden. Sie wischte die Tränen von ihren Wangen und sah sich im Zimmer um. Sah die beiden gedrechselten Nachtkästchen, die gemusterten Pergamentschirme der Nachttischlampen, den ovalen Spiegel über der billig nachempfundenen Biedermeier-Kommode, das Bild mit knallroten Äpfeln in einer türkisblauen Schale, ein Apfel war aufgeschnitten und lag neben der Schale auf einem Spitzentuch, die Großmutter hatte dieses Gemälde, wie sie es nannte, geliebt. Hedwig sah alles, was sie als heranwachsendes Mädchen täglich hatte sehen müssen, was sie bedrückt und angeekelt hatte, und was sie eines Tages von hier flüchten ließ, weg aus dieser Enge, weg, weit weg, hinaus in die Welt.
Nach dem Abitur, der Matura, wie man hier in Österreich sagt, war die Großmutter stolz gewesen, dass ihre Enkelin diese mit Auszeichnung bestand. Die Großmutter war aber auch die Einzige, die das Maturazeugnis, nachdem sie die Brille aufgesetzt hatte, genau studierte und stolz darauf sein konnte, es gab sonst niemanden mehr, den das interessierte. Ihre Eltern waren damals schon tot. Schon seit fünf Jahren. Bei einer Bahnfahrt ins Salzkammergut war der Zug, in dem sie saßen, entgleist. Es gab nur wenige Tote, aber ihre Eltern gehörten dazu. Jeden Sommer hatten die beiden ihre Sommerfrische, wie es damals genannt wurde, an einem der Seen dort verbracht, und jedes Mal waren sie mit der Bahn dorthin gefahren. Nie mit dem Autobus, das erschien ihnen zu gefährlich. Nun war es aber genau der Waggon, in dem die Eltern Platz genommen hatten, der gerammt und nahezu gänzlich zerstört wurde und in dem fast alle Passagiere starben.
Die Großmutter trauerte um ihren Sohn, Hedwigs Vater, er war ihr einziges Kind. Mit der Schwiegertochter hatte sie nie viel anzufangen gewusst, aber sie war Hedwigs Mutter gewesen, und ihr Tod hatte das zwölfjährige Mädchen zur Vollwaise gemacht. Die elterliche Wohnung musste aufgegeben werden und die Enkeltochter zog zur Großmutter, es gab sonst niemanden, der sie hätte aufnehmen wollen. Hedwigs Anwesenheit wies der alten Frau jedoch eine neue Aufgabe zu, eine Verantwortlichkeit, die ihre Trauer mäßigte und sie weiterleben ließ.
Ihr Lebensinhalt hieß ab nun: Hedwig.
Ja, ich war alles für sie, dachte Hedwig. Wir beide lebten in einer Zweisamkeit, die sie nährte, und mich mehr und mehr hungern ließ. Ich verhungerte im Heranwachsen und Älterwerden fast vor Sehnsucht nach Leben. Lag hier in diesem Doppelbett, so wie jetzt, und wollte nur weg. Die Großmutter ahnte es vielleicht, aber sie wollte davon nichts wissen. Beisammenbleiben, möglichst für immer und ewig, das war ihre Idee von Zukunft, um die sie eisern rang.
Was willst du denn jetzt auf der Universität studieren? fragte sie mich. Nur eine akademische Laufbahn ihrer Enkelin schien für sie infrage zu kommen.
Ich werde Journalistin, gab ich zur Antwort.
Nie vergesse ich ihr ratloses Gesicht.
Was willst du werden?
Journalistin, Oma.
Sie starrte mich an. Was tut so eine?
In Zeitungen schreiben, Oma.
Was läuft denn da in meinem Kopf ab, dachte Hedwig, die immer noch aufrecht im Bett saß. Wie aufgeschrieben läuft es in meinem Kopf ab. Ich sehe Zeilen. Wie früher immer. Weil ich an den Kreis meiner vergangenen Lebensjahre dachte, der mich hierher zurückgeführt und sich anscheinend in gewisser Weise geschlossen hat?
Ich sollte vielleicht wirklich aufschreiben, wie er verlief, dieser Kreis. Sollte nicht hier in einer lange Zeit unbelebt gewesenen Wohnung im Staub der Vergangenheit untergehen. Ich muss tun, was ich, wenn ich halbwegs bei mir war, ja immer tat. Aufschreiben.
Hedwig erhob sich.
Sie tappte in das alte Badezimmer, es war kühl dort, roch nach Schimmel und abgestandener Feuchtigkeit. Kaltes Wasser kam aus dem Hahn über der Waschmuschel. Hedwig ließ es eine Weile auf ihre Hände fließen, erst dann wusch sie ihr Gesicht, auf dem die um Anton geweinten Tränen Spuren im eingetrockneten Make-up hinterlassen hatten. Sie sah es im fleckigen Spiegel über dem Becken.
Schrecklich, wie ich aussehe, dachte Hedwig. Habe mich nicht abgeschminkt, nicht wirklich gewaschen, seit ich hier in die Wohnung kam. Schon der unerlässliche Kauf von ein wenig Bettzeug war eine Überforderung. Aber mich in das seit Jahren ungemachte Bett der Großmutter zu legen, zwischen alte, muffige Kissen und Tuchenten, dazu reichten sogar meine Erschöpfung und Apathie nicht aus.
Auf dem schmalen Wandbord lag ein Kamm. Hedwig nahm ihn in die Hand. Da sah sie ein einzelnes weißes Haar und legte ihn wieder zurück.
Ich muss heute nochmals hinausgehen und mir einiges besorgen. Ich muss die Wohnung ein wenig säubern. Ich muss endlich meinen Koffer öffnen und das Wichtigste auspacken. Meinen Laptop zum Beispiel. Papier muss ich kaufen, ich muss anfangen, aufzuschreiben. Wenn ich weiterleben will.
Mit diesen Befehlen, die sie sich mit lauter Stimme erteilte, verließ Hedwig das Badezimmer. Sie suchte ihre Handtasche, überprüfte den Inhalt, Geldbörse, Kreditkarte, Pass. Gut. Zog den Schlüssel ab, mit dem sie die Wohnung von innen versperrt hatte, betrat den Gang, schloss von außen zu, stieg durch das alte, kühle Treppenhaus abwärts und trat ins Freie.
Nach Verlassen der schmalen, schattigen Schlösselgasse wandte sie sich nach rechts in die Florianigasse, ging Richtung Rathaus, schlenderte durch den Rathauspark, überquerte die Ringstraße und gelangte, am Burgtheater vorbei, in die Innenstadt. Der frühe Nachmittag war noch sehr warm.
Als Hedwig am Kohlmarkt dahinging, spiegelte sich in einer Auslagenscheibe eine Frau mittleren Alters, mit wirrem ungekämmten Haar, das grau zu werden begann, einem fahl und erschöpft wirkenden Gesicht, beherrscht von dunkel umschatteten Augen, das helle Sommerkostüm völlig zerknittert, die Bluse darunter eindeutig nicht mehr ganz sauber, es bot sich ihr ein Anblick von Verwahrlosung.
Na bravo, dachte Hedwig, aber egal, weiter jetzt. Wenn Oma mich so zur Kärntnerstraße gehen sähe, sie würde vor Scham umkommen. Aber sie sieht mich ja nicht mehr. Ich möchte das große Kaufhaus von damals finden. Da könnte ich alles mir Nötige rasch und ohne lange Zwischenwege besorgen. »Steffl« hieß dieses Kaufhaus früher, analog zum nahe gelegenen Stephansdom, den man ja auch so nennt. Mit der Großmutter war sie immer wieder in diesem mehrstöckigen Gebäude gewesen, wenn etwas Unerlässliches angeschafft werden musste. Die alte Frau durchwanderte es ehrfürchtig, tat sich ein wenig schwer mit den Rolltreppen, aber bewunderte diese Neuerung zugleich. Hedwigs gesamte Jungmädchengarderobe stammte aus dem Steffl.
Oma, es gibt auch Boutiquen.
Die sind nur voller Krimskrams.
Woher weißt du das, warst ja noch nie in einer!
Schau, Hedwig, dieser Rock, probier den! Die Oma lenkte sofort ab und blieb ihrem Steffl treu.
Die Oma.
Nach dem Verlassen der Großmutter, in den langen Jahren ihrer Abwesenheit, hatte auch diese Bezeichnung sich verloren. Oma, das bedeutete Nähe. Eine Nähe, aus der sie ja geflohen war. Wer irgendwann starb und ihr eine Wohnung in Wien vererbt hatte, das war die Großmutter. Eine Großmutter, die zu vergessen sie sich bemüht hatte. Jetzt musste Hedwig feststellen, dass sie in Gedanken mehr und mehr dazu überging, ihr wieder den vertrauten, früheren Namen zurückzugeben.
Oma.
Schau, Oma! Dein Kaufhaus! Da ist es. Modernisiert, aber an Ort und Stelle! Was sagst du dazu? Schäbig, wie ich aussehe, gehe ich jetzt trotzdem hinein, schäm dich nicht, Oma. Ich kaufe das Nötigste an Kosmetika, die mein eigenes ramponiertes Äußeres dringend benötigt, dann ein paar hübschere Garnituren Bettwäsche, Frotteetücher für das Bad, Geschirrtücher, all diese Sachen eben, dann brauche ich auch Essensvorräte, Brot, Butter, Milch, Kaffee. Und Schreibpapier kaufe ich, einen Block und Einzelblätter zum Ausdrucken. Das vor allem.
In einer Seitengasse befand sich ein Taxistand. Hedwig schleppte ihre Einkäufe dorthin, Gepäckraum und Rücksitz des Autos quollen nahezu über, als das Taxi losfuhr. Und in der Schlösselgasse war es der Taxifahrer, der ihr half, alles zur Wohnung hochzutragen. Er war ein jüngerer Mann, sie musste ihn kaum darum bitten, er war sofort bereit, es zu tun. Ein schönes altes Haus, sagte er, ein wenig keuchend unter der Last, die er schleppte.
Meine Großmutter lebte hier, antwortete Hedwig, ebenfalls atemlos.
Also eine ältere Frau? So ohne Aufzug?
Meine Großmutter liebte das Haus so, wie es war, sagte Hedwig.
Ich hasste es, dachte sie dann. Aber fange ich jetzt etwa an, es auch so zu lieben, wie es ist?
So ein Lift wäre aber schon gut für Sie, meine Dame, man schleppt sich ordentlich ab über diese alten Stiegen, sagte der Taxifahrer und schichtete schwer atmend eine weitere Last an Einkäufen vor ihrer Wohnungstür auf.
Bei einem so netten Helfer doch nicht! Ich danke Ihnen! antwortete Hedwig und drückte ihm das Doppelte der geforderten Fahrgebühr in die Hand. Der Mann lachte, grüßte dann und ging die Stiegen abwärts davon, sie hörte seine Schritte verklingen.
Jetzt erst sperrte Hedwig die Wohnung auf. Gemächlich, ganz ohne Eile, trug sie Stück um Stück all dessen, was sie besorgt hatte, durch das Vorzimmer in den Raum, der früher auch als Speisezimmer gedient hatte und in dem ein großer Tisch stand. Sie platzierte ihre Einkäufe vorerst auf diese riesige schwere Tischplatte, ein wahres Gebirge an Gegenständen und Tüten. Dann stand sie davor, betrachtete alles und sortierte es in Gedanken. Schließlich wählte sie aus. Ganz zu Beginn die Putzmittel, dazu Lappen, Handbesen, Staubtücher. Ehe sie zu ordnen beginnen konnte, musste die Wohnung halbwegs gesäubert sein, das stand fraglos fest.
Hedwig war nie eine besonders häusliche Frau gewesen, wenn möglich, ließ sie ihre Wohnungen von Putzfrauen säubern. Aber jetzt, an diesem späten Nachmittag, bei offenen Fenstern, die Haare zurückgebunden, begann sie mit einer gewissen inneren Wut die Räume sauber zu kehren, alle Möbel abzustauben, mit feuchten Tüchern nachzuwischen, sie geriet bei dieser Säuberungsaktion in eine seltsame und überraschend wilde Euphorie. Vielleicht, weil ihr dabei gelang, alles andere zu vergessen.
In der Küche nahm sie sich den alten Kühlschrank vor, er funktionierte sogar noch, und sie wusch ihn blitzblank aus. Auch die Küchenmöbel wurden unter ihren Händen wieder weiß, was sie ja ehemals gewesen waren. Alles an vorhandenem Geschirr schrubbte sie sauber, trocknete es mit den neuen Tüchern ab, und räumte es in den Küchenkasten oder auf die Geschirrborde zurück.
Das Badezimmer machte ihr am meisten Mühe. Die schäbigen Kacheln, der fleckige Spiegel, Wanne und Waschmuschel mit eingetrockneten Kalkrändern, es starrte ihr trübe entgegen. Aber zum eigenen Erstaunen gelang ihr sogar, den Durchlauferhitzer wieder in Funktion zu bringen, sie rieb und wusch, polierte die alten Armaturen, das Bad sah zuletzt nahezu schmuck aus, nicht mehr so, als müsse einem davor ekeln, es auch nur zu betreten.
Es begann zu dämmern, Hedwig musste Licht machen.
Da sie auch nicht vergessen hatte, Glühbirnen zu erstehen, konnte sie alle Lampen zum Leuchten bringen. Vor allem die Bürolampe mit gläsernem Schirm, die auf den Schubfächern über der Schreibtischplatte stand und dessen grünsamtene Fläche hervorhob, ließ Hedwig sofort ihren Laptop samt Drucker aus ihrem Gepäck hervorkramen und aufstellen, und alles an Schreibpapier legte sie wohlgeordnet daneben.
Dann aber wurde sie müde. Und Hunger meldete sich.
Nur noch das Bett richten und etwas essen, dachte sie, alles Weitere morgen.
Auf dem Doppelbett erschuf sie sich mit den neu gekauften Kissen und Decken, in frisches Bettzeug gehüllt, ein einladendes Nachtlager.
Das Bett der Oma im Kabinett trug jetzt nur noch eine Überdecke. Auch den Tisch dort, jetzt frei von Lebensmitteln, hatte Hedwig blank poliert und eine von Omas Stickereien auf ihn gebreitet. Trotzdem musste sie kurzfristig ihr schlechtes Gewissen bezwingen, als sei diese Verschönerung ein Vergehen an Omas heimlicher Speisekammer von ehemals.
Sie selbst hatte ihre Essenseinkäufe in der Küche untergebracht, den Kühlschrank gefüllt, den Brotlaib in Omas alter Brotdose aus hellblauer Emaille verstaut, und einige Flaschen Rotwein standen frei herum.
Nachdem sie sich im Badezimmer, wo jetzt auch die Dusche funktionierte, von Staub und Schweiß gesäubert hatte, saß Hedwig in einem wahllos aus dem Koffer gezerrten Nachthemd am Küchentisch. Gebeugt von Müdigkeit und wie abwesend aß sie ein paar Schinkenbrote zu einem Glas Wein. Dann schien etwas wie eine Ohnmacht sie zu überkommen. Leicht taumelnd stand sie auf, wankte in das Schlafzimmer, drehte am Weg dorthin mit Überwindung noch überall das Licht ab, dann auch die Nachttischlampe neben sich, und streckte sich auf dem Bett aus.
Hedwig schlief ein, ehe sie noch irgendeinen Gedanken denken konnte. Es war wie ein Verlöschen.
Anton, rief Hedwig, er war zu weit hinausgeschwommen, die anrollenden Wogen verwehrten ihr den Blick auf ihn, Anton, Hund, sei nicht so übermütig, bedenke das Meer, es ist wunderbar, aber gefährlich, Anton, ich sehe dich gar nicht mehr, bitte komm zurück zu mir, Anton, schau, diese Woge, was für eine Woge, hoch wie ein Haus, sie nähert sich so schrecklich vom Horizont her, Anton, beeile dich, sie wird uns beide verschlingen –
Als sich Hedwig mit einem lauten Schrei, den sie selbst erwachend noch vernahm, aus dem Traum löste und aufsetzte, war sie schweißnass. Es war hell im Zimmer, durch die geöffneten Fenster wehte warmer Sommerwind herein. Hedwig legte beide Handflächen über ihr Gesicht und versuchte in deren Schatten auszuatmen. Seit der Hund gestorben war, hatte sie immer wieder von ihm geträumt, jedoch noch nie so angstvoll, in solcher Panik. Ihre eigenen tiefen Atemzüge beruhigten sie langsam wieder.
Wie spät mag es sein, dachte sie, ich habe wohl sehr lang geschlafen. Ich muss mein Handy suchen, die Wanduhren im Schlafzimmer und in der Küche wurden lange nicht aufgezogen, ich habe keine Ahnung mehr von Zeit.
Sie warf die Decke von sich, stand auf, suchte barfuß herumtappend ihre Umhängetasche, fand sie am Fensterbrett im Vorzimmer, und zog das Handy hervor. Scheiße, es ging nicht mehr, der Akku war leer! Also musste sie weitertappen und in den zwei Reisekoffern, die derzeit all ihr Hab und Gut enthielten, auch nach dem Ladegerät kramen. Das dauerte.
Dann suchte sie die Wände der ganzen Wohnung vergeblich nach einer zeitgemäßen Steckdose ab. Nahezu bereits am Ende ihrer Hoffnungen, machte Hedwig endlich den überraschenden Fund: neben dem Schreibtisch hatte die Oma erstaunlicherweise eine solche Neuerung anbringen lassen. Für die hübsche gläserne Bürolampe wohl, die so einen Stecker benötigte.
Eben! Diese Lampe hatte es damals noch nicht gegeben! Hatte die Oma sie für sich selbst angeschafft, um etwa eines Tages das zu tun, was sie zuvor nie getan hatte – zu schreiben? War sie etwa versucht gewesen, ihrer Enkeltochter einen Brief zu schreiben? Wie denn, ohne Postanschrift. Selbst hatte sie der Oma ja keinen einzigen Brief zukommen lassen. Vielleicht hatte die alte Frau einfach nur darauf gewartet, dass sie, Hedwig, zurückkehren und den Schreibtisch eines Tages wieder benutzen würde? Denn auch der grüne Samtbelag auf der Schreibfläche war neueren Datums, Hedwig hatte als Schülerin ihre Hausarbeiten noch auf barem Holz erledigt, und wenn sie schlecht gelaunt war, wirre Zeichen und Herzen hineingeritzt. Aber wie auch immer, die Oma hatte ihre Enkeltochter umsonst zurückerwartet. Schluss jetzt.
Hedwig zog den Stecker der Bürolampe heraus und schloss das Ladegerät an. Ha, bereits elf Uhr vormittags! Erstaunlich! Aber wer weiß, wie spät es gestern schon war, als sie einschlief.
Sie setzte sich so wie sie war, noch im Nachthemd und ohne im Badezimmer gewesen zu sein, auf den Sessel vor dem Schreibtisch und begann einzelne Laden zu öffnen. Die kleinen Schubfächer auf der Konsole enthielten wenig. Ein paar alte Schillingmünzen, Bleistiftstummel, eine ewig nicht benutzte Füllfeder, einige uralte Rechnungsbelege.
Aber dann doch, im untersten Lädchen, ein Foto von ihr selbst. In Postkartengröße, schwarzweiß. Das Foto musste noch vor ihrer Matura aufgenommen worden sein. Das junge Mädchen blickte etwas verkrampft um ein Lächeln bemüht in die Kamera, Hedwig verstand das auch im Rückblick, gab es doch ihren lebenslangen Unwillen, sich fotografieren lassen zu müssen. Auf diesem Foto hatte sie helles, lockiges Haar, das ihr bis auf die Schultern fiel, sie trug eine weiße Bluse und drüber eine Strickweste. Oma hatte die Weste gestrickt. Mit Zopfmuster, aber recht hübsch. Überhaupt sah sie auf diesem Bild hübsch aus, hübscher als sie je dachte gewesen zu sein.
Hedwig schob den Sessel zurück, bückte sich und zog die große untere Schublade auf. Was sie da sah, trieb ihr plötzlich Tränen in die Augen. Es waren alle ihre Schulhefte, säuberlich nach Jahren gestapelt. Auch einige Schulbücher und der große Welt-Atlas für die Geografiestunden befanden sich in dieser Lade. Hedwigs gesamtes Schulleben, all die Jahre im Gymnasium waren von der Oma in einer Weise übersichtlich angeordnet und gepflegt worden, wie andere ein Heiligtum hüten. Deshalb vielleicht die neue Lampe! Vielleicht las sie in Hedwigs Schulaufsätzen! Wollte in Erfahrung bringen, was und wie ihre Enkeltochter schrieb. Oder sie studierte in anderen Heften auch die Rätsel der Mathematik, ohne sie je lösen zu können, nur so, sah geometrische Zeichnungen und Formeln, erfuhr aus den Geografieheften vom Zustand der Welt, vielleicht war diese große Lade zu Omas Bibliothek geworden, zu dem, was sie am Leben noch interessierte. Sie hatte vielleicht einen Filzbelag über die von ihrer Enkeltochter zerkratzte Schreibtischfläche spannen lassen, um so die Erinnerungsspuren vergangener Zeiten zu schützen. Vielleicht aber auch, um selbst beim Lesen und Umblättern eine ruhigere Unterlage und dieses sanfte Grün vor sich zu haben.
In Hedwig entstand ein Bild, das sie noch nie sah. Sie sah die Großmutter neu. Sah sie zum ersten Mal wieder vor sich. Ein halbes Leben lang hatte sie das vermieden. Und jetzt erblickte sie eine alte Frau, die genau auf diesem Sessel, vor genau diesem Schreibtisch, im Schein einer neu erstandenen Bürolampe behutsam in Heften und Büchern blätterte. Wie hatte sie sich in den vielen Jahren wohl verändert. Wie war sie gealtert. Hedwig wusste nichts. Nur dass sie mit über neunzig Jahren verstarb, ohne davor lange krank oder hinfällig gewesen zu sein, und diese Wohnung ihr, Hedwig, vermacht hatte. Weder Cousin Bernhard noch der Notar, bei dem sie nach ihrer Ankunft eine Unterschrift hatte leisten müssen und den Wohnungsschlüssel erhielt, konnten ihr mehr dazu sagen. Die Oma lebte also einsam und ohne viel Kontakt zum Rest der Familie und zur Welt weiter, nachdem ihre Enkeltochter sie verlassen hatte. Sie las in den Schriften und Lehrbüchern einer Gymnasiastin und holte sich von dort her die Wachheit, sehr alt zu werden.
Aber vielleicht auch aus der Erwartung, ihre geliebte Enkelin eines Tages wiederzusehen?
Hedwig wurde leicht übel, einige Tränen hatten sich aus ihren Augen gelöst und waren über die Wangen geflossen, sie wischte sie mit beiden Händen und voll Heftigkeit weg. Nein. Jetzt bitte kein schlechtes Gewissen, kein Bereuen, nein, nur das nicht! Übel war ihr wohl vor Hunger, sie sollte frühstücken. Und vorher ins frisch gesäuberte Badezimmer gehen und sich selbst auch erfrischen. Weg mit dem Nachthemd. Die Koffer auspacken, sich vernünftig ankleiden.
Hedwig erhob sich, schob die große Lade mit einem Knall zu und den Sessel wieder näher zum Schreibtisch hin. Später werde ich den Computer anwerfen, mir alles so einrichten, dass es funktioniert, und schreiben. Werde aufschreiben, warum ich nur so überleben konnte, Oma.
Nach einer Schale Milchkaffee und einem Butterbrot saß Hedwig am Küchentisch und wusste trotzdem wieder nicht so recht, was sie mit dem Tag anfangen sollte. Sie hatte ihre Toilettesachen im Badezimmer deponiert, sich gewaschen, Zähne geputzt, sie war in ein Sommerkleid geschlüpft, das zerknittert, aber frisch war. Als sie es herausholte, hatte sie beide Koffer entleert, alles lag flüchtig hingeworfen auf dem Boden herum. Sie müsste also Omas Kleiderschrank denn doch wieder einmal öffnen und – ja, ausräumen. Ihn für ihre eigene Garderobe freimachen. Wenn hier geblieben, Hedwig, muss das wohl sein. Es ist sommerlich heiß draußen und auch in der Wohnung nicht so kühl wie sonst. Mache ich das heute noch? Und wohin mit Omas Kleidung?
An Fragen des praktischen Alltags hatte sie immer schon gelitten. Nun war sie ja tags zuvor als Putzfrau gewaltig über ihren eigenen Schatten gesprungen, auch beim Erledigen all der nötigen Einkäufe davor, sie konnte sich selbst nur loben. Aber Omas Kleiderschrank baute sich jetzt plötzlich als gewaltige Hürde vor ihr auf.
Hedwig wusch die Kaffeeschale, den Brotteller, ordnete alles, was am Tisch herumstand, langsam und penibel an Ort und Stelle zurück, ließ sich Zeit, verschob. Bis es ihr selbst zu dumm wurde. Sie schritt langsam auf die Abstellkammer zu, in der sich, neben dem Wäschekasten, auch Omas Kleiderschrank befand. Wie früher manchmal üblich, besaß diese alte Wohnung einen schmalen, dunklen, fensterlosen Raum zwischen Küche und Schlafzimmer. Hedwig betrat ihn und drehte die Deckenlampe an, in die sie gestern mühevoll, auf einem Schemel balancierend, eine neue Glühbirne geschraubt hatte.
Dann öffnete sie den Schrank.
Der leicht muffige Geruch nach Vergangenheit überfiel sie wieder, aber Ordnung herrschte. Einige Fächer mit Unterwäsche, Strümpfen, Socken, Strickjacken, alles übersichtlich gestapelt. Und daneben auf Kleiderbügeln, brav nebeneinander, hing all das, was Hedwig nur allzu gut kannte. Die Großmutter schien bei ihrer Garderobe von damals geblieben zu sein, die wadenlangen Kleider mit Spitzenkrägen, die geraden Röcke und Jacken für den Winter, wenig Neues an Kleidungsstücken fiel Hedwig auf. Wonach es im Schrank roch, schien sich aus Staub und Kampfer zusammenzusetzen, es roch aber nicht unangenehm.
Wie hatte man es nur fertiggebracht, alles so geordnet zu hinterlassen, als wäre die Oma davongeflogen. Es musste doch ein Begräbnis gegeben haben, Menschen, die nach ihrem Tod etwas suchten, vielleicht sogar nach etwas wühlen mussten, ehe sie das Gewollte fanden. Wer hatte es organisiert, sie zu begraben? Sie für den Sarg zuzubereiten? Es gab ja außer diesem Cousin und dessen Umfeld keinerlei Verwandtschaft, also mussten die das ja irgendwie bewirkt haben, sie sollte sich vielleicht bedanken?
Hedwig wurde sich mit plötzlicher Scham bewusst, dass sie niemanden befragt hatte, was mit der Großmutter nach deren Tod geschehen war. Nicht diesen Cousin Bernhard, nicht den Notar. Letzterer hätte aber auch kein offenes Ohr für irgendwelche Fragen gehabt, er war kurz angebunden, es war vor Büroschluss, es gab nur seine Erleichterung, schien es ihr, dass die Sache jetzt vom Tisch kam. Und sie selbst war viel zu müde, wie abwesend und völlig am Ende. Als sie am Flughafen aus der portugiesischen TAP-Maschine gestiegen und gleich zur Kanzlei des Notars gefahren war, dachte sie an nichts anderes, als den Schlüssel zur Wohnung zu erhalten und sich endlich irgendwo fallen lassen zu können.
Jetzt aber die Empfindung von Scham. Hedwig stand vor dem Kleiderschrank und starrte ins Leere. In diese Leere, die nach Versäumnissen zu entstehen pflegt und die sie kannte. Hatte sie doch immer wieder einmal irgendetwas töricht verabsäumt. Hatte einfach nicht darauf geachtet, was das Leben ihr vielleicht anbieten oder gar schenken wollte. Darin war ich Meisterin, dachte Hedwig.
Jetzt aber stand sie da, eine Frau von über 50 Jahren, stand vor einem geöffneten Schrank, in den lange keiner mehr geblickt hatte, und wusste nicht wohin. Wohin mit der alten Kleidung, wohin mit sich selbst.
Hedwig zwang sich, ihre Starre aufzulösen und sachlich weiterzudenken. Es gab doch im Besitz der Oma sicher auch irgendwelche alte Koffer. Sie hob den Blick. Ja, sogar gleich da oben am Schrank! Zwei Uralt-Modelle, aus Pappendeckel noch, die Oma war ja nach Flucht und Kriegswirren in ihrem späteren Leben nie auf Reisen gewesen, soweit Hedwig sich erinnerte. Nie in ein anderes Land, nie in ein Hotel, nie mit zeitgemäßem Gepäck. Außer sie fuhr zu den Bauersleuten ins Waldviertel, dorthin immer mit dem Autobus, nie sehr lang diese Fahrt, und meist trug sie dabei nur zwei große Leinentaschen, in denen sie Essbares transportieren konnte. Wo die jetzt wohl waren, diese zwei Taschen. Gestreiftes, dickes Leinen, früher hingen sie in der Küche am Fensterknauf.
Der Schemel, auf den Hedwig stieg, war hoch genug, dass es ihr gelang, die Koffer vom Schrank herunterzuzerren. Es ging leicht, da beide Koffer leer waren. Wunderbar. Sie legte sie am Fußboden geöffnet nebeneinander.
Und dann begann sie, ohne noch zu zögern, alles aus dem Schrank in die Koffer zu schlichten. Der eine füllte sich mit dem, was in den Fächern gestapelt gewesen war, in den anderen breitete Hedwig alle Kleidungsstücke, die auf den Bügeln gehangen hatten, sorgfältig übereinander. Es ging sich genau aus, beide Koffer waren bis zum Rand voll.
Sie schloss die Koffer und schob sie in die Ecke des Raumes, dorthin, wo auch die Schuhe der Großmutter aufgereiht standen, wenige kräftige Halbschuhe und ein Paar Winterstiefel.
Ich werde diesen Bernhard anrufen, dachte Hedwig, seine Nummer ist in meinem Handy sicher noch auffindbar. Wenn auch mit Überwindung, ich muss es irgendwann tun. Muss mich bedanken, dass Omas Begräbnis und diese Ordnung in der Wohnung von ihm und seiner Familie übernommen worden waren, denn wer sonst sollte es gewesen sein.
Hedwig ging ins Wohnzimmer hinüber und setzte sich vor den Schreibtisch. Aus den immer noch offenen Fenstern strich warme Stadtluft herein, diese von Stein und Enge beatmete Sommerlichkeit in der Schlösselgasse, die sie von früher kannte. Selten war sie ja in den Schulferien mit der Großmutter ins Waldviertel gefahren, auch wenn die sie dazu aufforderte, ihr erschienen die Leute auf dem Bauernhof zu einfältig und öde. Andere Reisen, etwa mit Schulfreundinnen, nach Jesolo ans Meer oder ins Gebirge in Tirol, dafür konnte die Oma das Geld nicht aufbringen. Hedwig war sommers manchmal alleine geblieben, im Rathauspark saß sie zeitweise lesend unter den Bäumen, das war alles.
Hedwig sah sich die Schreibtischfläche mit Computer, Drucker und Papierstoß genauer an und begann zu überlegen. Diese grüne Filzbedeckung gefiel ihr gar nicht. Kurz entschlossen entfernte sie alles wieder, was sich auf ihr befand, und begann sie an einer Ecke einzureißen, was ohne Mühe gelang. Also zerrte sie weiter an dem grünen Filz, bis dieser langsam, Riss für Riss, die hölzerne Fläche zur Gänze wieder freigab. Da waren sie, die alten Runen, all das, was sie aus Langeweile oder in Gedanken während ihrer Hausaufgaben und später beim Studium in das Holz geritzt hatte. Klebstoff blieb keiner haften, der Filz war nur an den Rändern damit befestigt gewesen. Hedwig knüllte ihn zusammen und warf das grüne Bündel aufatmend beiseite.
Dann stellte sie alles wieder auf den Schreibtisch zurück. Sie schloss Computer und Drucker per Kabel an der neu entdeckten Steckdose an, nahm den Laptop in Betrieb und legte eine Datei an. Alles gelang.
Jetzt befand sich also endlich wieder diese unbeschriebene weiße Fläche vor ihr. Dieses leere Weiß, das, sei es auf Papier oder am Bildschirm, lebenslang so etwas wie Hoffnung in ihr geweckt hatte. Weil darauf noch nichts feststand und diese Leere allen Möglichkeiten Raum gab. Etwas, das das Leben selbst einem ja meist verwehrt. Hedwig hatte am unverrückbar Feststehenden, an der puren und alles beherrschenden Realität immer gelitten. Ihre Ausflucht wurde das Schreiben. Aufschreiben. Niederschreiben. Sogar im journalistischen Beschreiben realer Gegebenheiten war sie sich stets der Freiheit bewusst gewesen, ihrer eigenen Formulierung Folge zu leisten und dadurch auch verändernd wirksam werden zu können. Ja, sie hatte sich frei dabei gefühlt.
Hedwig fixierte am Bildschirm Schriftgröße und Seitenbild.
Dann lagen ihre Hände nochmals untätig im Schoß, sie blickte durch den Bildschirm, durch die leere Seite mit der Ziffer 1 rechts oben, zurück ins Vergangene. Wie hatte sich ihr Aufbruch angekündigt. Wie ließ alles sich an, nachdem sie diese Wohnung, die Schlösselgasse, Wien, und vor allem die Großmutter verlassen hatte. Wie erzähle ich es dir, Oma.
Und es ist wohl so, dachte Hedwig, dass ich es ihr erzähle. Dieser Frau, die vergeblich auf einen Brief, ein Schreiben gewartet hatte, einen Gruß vielleicht nur, irgendein Zeichen von der einzigen und geliebten Enkeltochter, von mir, von dieser Vagabundin, dieser Suchenden, die nichts fand außer zuletzt die Liebe eines Hundes. Es sind an die dreißig Jahre, von denen ich zu erzählen habe.
Aber jetzt eins nach dem anderen, Oma.
Hedwig hob ihre Hände über die Tastatur und schrieb.
Eins nach dem anderen, Oma.
Ja, du warst erstaunt und nicht sehr zufrieden damit, dass ich nicht Medizin oder Jus, sondern Publizistik studieren wollte. Du konntest dir unter diesem Studium nichts vorstellen, und hattest rückblickend vielleicht nicht ganz unrecht damit. Aber ich versuchte es trotzdem so zu erklären, dass dir verständlich würde, warum es mich anzog, Journalistin zu werden.
Ich will schreiben, Oma, sagte ich. Etwas schreiben für andere Menschen, für die Öffentlichkeit, verstehst du? Man nennt das auch Journalistik, man wird also Journalist. In Zeitungen schreiben, Bücher schreiben, für den Rundfunk Sendungen schreiben, für das Fernsehen schreiben –
Du willst ins Fernsehen gehen?
Die Oma unterbrach mich mit schreckgeweiteten Augen.
Hedwig hörte auf zu schreiben und betrachtete den Fernsehapparat. Auf einem Tischchen, neben die Kredenz gezwängt, stand er immer noch da wie ehedem. Die Oma benützte ihn ja fast nie, und wenn, dann mit sichtbarer innerer Ablehnung. Man musste ungemütlich am Tisch sitzen, um zuzusehen, und die Oma mochte es nicht. Das Radio war ihr ein Leben lang lieber gewesen. Werde ich je versuchen, dieses vorsintflutliche Fernsehgerät nochmals in Gang zu bringen? überlegte Hedwig. Besorge ich mir eines Tages noch ein heutiges Modell für hier, für diese Wohnung? Werde ich hier bleiben?
Egal. Jetzt schreibe ich weiter.
Nein, Oma, ich will nicht ins Fernsehen gehen, antwortete ich, ich will aufschreiben, was andere dann dort vielleicht sagen. Du wirst mich nicht im Fernsehen anschauen müssen, keine Angst! Ich will beobachten, was auf der Welt geschieht, und will es aufschreiben. Mitteilen, verstehst du?
Mitteilen?
Ja, es mit anderen Menschen teilen, die lesen oder zuschauen oder zuhören.
Also auch im Radio?
Ja, auch im Radio vielleicht.
Aha.
Das beruhigte die Oma am meisten, dem Radio war sie verfallen, seit der Nachkriegszeit hatte sie diese Leidenschaft für sich entdeckt. Aus dem Kabinett drang bei offener Tür stetig Radiomusik oder im Radio Gesprochenes, wenn sie in der Küche arbeitete.
Sie widersprach also kaum noch, als ich mich als Studierende im Institut für Publizistik und Medienwissenschaft anmeldete und sie sogar wahrnehmen durfte, dass auch dieses Studium etwas mit der Universität zu tun hatte. Die Universität! Das war für sie Heiligtum, Kirche!
Wir lebten also weiter in unserer Zweisamkeit, die keiner je aufstörte. Ich lud niemanden in die Wohnung der Großmutter ein, und für sie war das ein Selbstverständnis. Da sie ausschließlich für die Tochter ihres verstorbenen Sohnes lebte, ich ihr Lebensinhalt geworden war, forderte sie diese Ausschließlichkeit auch von mir ein. Das heißt – sie forderte nie. Ich fühlte mich ohne jede Forderung dazu gezwungen, tat es also freiwillig, oder unter einem Zwang, der nie ausgesprochen wurde. Klingt seltsam, Oma, aber so war mir zumute. Der plötzliche Tod beider Eltern hatte mich als kleines Mädchen in die Tiefe eines Schweigens gerissen, das keiner je aufbrach. Du redetest nie mit mir darüber, Oma. Ich war von einem Tag zum anderen gänzlich bei dir, nicht mehr nur zu Besuch, du quartiertest mich in das Schlafzimmer mit den Ehebetten ein, der Opa war schon lange tot, ich erhielt den Schreibtisch im Wohnzimmer zur alleinigen Verfügung, du sahst mich mit Befriedigung meine Hausaufgaben machen, du liebtest, dass ich ins Gymnasium ging und dort eine gute Schülerin war, du kochtest für mich, brachtest vom Land »noch nicht vergiftetes« Gemüse und Obst, ich sollte gesund sein und lernen. Es war deine eigene Sehnsucht, die du an mir erfüllt sehen wolltest. Gern hättest du gelernt, studiert, anders gelebt, Oma. Aber Kriege und Armut hatten es dir versagt, eine Heirat ohne Liebe, ein einziger geliebter Sohn, diese dunkle Wohnung in der Schlösselgasse, die ihr euch nur mit Verzicht auf alles, was Leben verschönt und erleichtert, erstehen konntet, war der Ehemann ja nur mit kläglich geringem Verdienst bei der Bahn tätig. Nach seinem Tod deine ebenso geringfügige Witwenrente und einsame Frauenjahre, Jahre eines genügsamen, sehr bescheidenen Lebens ohne Ansprüche. Manchmal zu Besuch bei den Waldviertler Bauern, die in den Nachkriegsjahren dir zu Freunden geworden waren, manchmal das Enkelkind zu betreuen, manchmal sonntags bei der Schwiegertochter eingeladen, du warst es zufrieden, denke ich.
Aber dann dieses Zugsunglück. Der Tod deines einzigen Sohnes, gemeinsam mit der Ehefrau, deine dir nah zugehörige Familie ausgelöscht. Nur noch ich da, Hedwig, ein kleines zwölfjähriges Mädchen, und dieses Mädchen war plötzlich an deiner Seite, neben dir, bei dir, bei einer bereits alt gewordenen Frau, und ganz und gar deren Obhut übergeben.
Ich glaube, es reicht für jetzt, dachte Hedwig, nachdem sie die Hände wieder in den Schoß gelegt und die letzte Passage zurückgelesen hatte. Hunger meldete sich. Vielleicht zum italienischen Lokal in die Florianigasse, auf eine Pizza? Und ich müsste mich unbedingt bei Cousin Bernhard melden, mitteilen, dass ich jetzt hier bin, und dass ich beim Notar alle Dokumente unterschrieben habe. Auch will ich mich bedanken: für das Begräbnis, die geordnet verbliebene Wohnung und vor allem die Geduld, mein Auftauchen abzuwarten. Am besten, ich rufe gleich an.
Hedwig griff nach dem Smartphone, es lag neben ihr am Schreibtisch, und überprüfte die eingegangenen Nummern der letzten portugiesischen Tage. Schnell entdeckte sie die einzige Wiener Nummer, es war Bernhards Anruf gewesen, als sie nach Antons Sterben selbst wie tot auf ihrem Bett lag, dann dennoch das Zeichen des Handys wahrgenommen und sich seltsamerweise gemeldet hatte.
Sie wählte.
Ja? sagte eine Männerstimme.
Bernhard?
Ja. Wer spricht?
Ich bin es, Hedwig, ich bin jetzt in der Schlösselgasse.
Ein Ausruf folgte, der fast einem Aufschrei glich, und dann in einem Lachen mündete.
Darf nicht wahr sein! Die Hedwig! Also wirklich in Wien?
Ja, Bernhard, seit zwei Tagen. Ich habe den Notar von Lissabon aus kontaktiert, du hast mir ja seine Nummer gegeben, hab gleich nach meiner Ankunft bei ihm alles erledigt, unterschrieben, und den Wohnungsschlüssel erhalten.