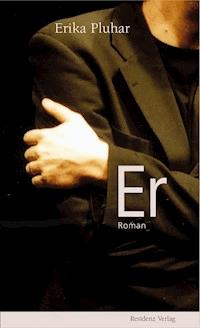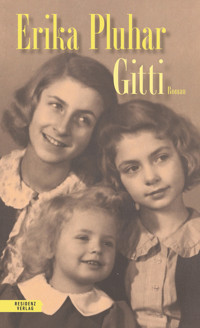Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Bestseller-Autorin nähert sich auf humorvolle und poetische Weise dem Mysterium Paar. Das Paar als Denkmal, das Paar als Ruine, das Paar als Arena, das Paar als Falle, das Paar als Abgrund, das Paar als Traum. Und dazu allerlei unerhörte Paare, verkuppelt vom Zufall, von der Sehnsucht oder vom hinterlistigen Leben: Da bildet ein kleines Mädchen mit seinem erfundenen Vater ein prachtvolles Lügner-Team; eine junge Frau verbündet sich mit ihrem ungeborenen Kind gegen dessen Erzeuger, den einzig seine künstlerische Arbeit beschäftigt; durch die Trennscheibe in einem Gefängnis-Sprechraum blühen zwischen Häftling und Besucherin grelle Erinnerungen auf... Mit diesen und anderen Begegnungen spürt Erika Pluhar dem rätselhaften dritten Wesen Paar' nach, das Gelegenheitsbekannte ebenso wie Liebende unweigerlich hervorbringen und das rasch machtvoll auf die beiden Individuen zurückwirkt. In Erzählungen und Gedichten führt sie uns die Verwandlung vor Augen, die Menschen widerfährt, wo immer einer sich am nächsten zu stärken sucht oder sich im anderen verliert - wenn einen das gepaarte Leben heimsucht, streift oder ergreift.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ERIKAPLUHARPAARWEISE
Erika Pluhar
PaarWeise
Geschichten und Betrachtungenzur Zweisamkeit
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2007 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten. Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:978-3-7017-4255-4
ISBN Printausgabe:978-3-7017-1472-8
(Ihr war, als ob alles sehr rasch dahingegangen sei. So rasch wie das Erzählen einer Geschichte. Auch wenn man meint, viel Zeit dabei verloren zu haben, Zeit verliert man nie, sie vergeht nur. Und innerhalb des Vergehens stets man selbst, unbelehrbar Dauer einfordernd. Als ob alles für immer sei, nur weil es ist.)
Im Zug
Der Intercity Schnellzug fuhr pünktlich von Frankfurt ab. Er beschloß, sich gleich in den Speisewagen zu setzen, denn er hatte seit dem Morgen nichts gegessen, und er hatte Lust auf ein Glas Weißwein. Die Kellner trugen Bierkisten vorbei und beachteten ihn eine Weile lang nicht. Er schaute aus dem Fenster. In der getönten Scheibe sah er sein Gesicht gespiegelt. Dahinter glitten Häuser vorbei. Der Zug überquerte einen Fluß.
Er betrachtete seine hervorspringende Nase, die schlecht rasierte Oberlippe, die schweren Linien neben seinem Mund. Ich sehe alt aus, stellte er fest. Da die Sonne durch das Waggonfenster auf ihn fiel, hing er selbst, in vorgebeugter Haltung, beide Unterarme auf den Tisch vor sich gelegt, überdeutlich vor der vorbeifliegenden Landschaft. Das wird nichts mehr Rechtes, dachte er, strich aber mit der einen Hand sein Haar hinter das Ohr. Dann versuchte er, die Augenbrauen etwas höher zu ziehen, doch dadurch gerieten sie über den Rand seiner dunklen Brillen und gaben seinem Gesicht etwas Clowneskes. Ich gebe auf, war sein nächster Gedanke. Eine Weile starrte er noch auf das hell beleuchtete Gesicht, hinter dem jetzt ein rötlicher Herbstwald durch das Fenster zog. Dann wandte er sich der Speisekarte zu.
Verwundert, hier finnische Spezialitäten angeführt zu finden, wählte er eine Erbsensuppe mit kompliziertem Namen und gefüllte Piroggen. Einer der Kellner trat an seinen Tisch, nahm die Bestellung entgegen, brachte kurz darauf den Weißwein und stellte einen Teller Piroggen vor ihn hin. Er trank sofort einen Schluck Wein und wandte sich dann wieder dem Fenster und dem unvermeidlichen Anblick seiner selbst zu. Der Einfallswinkel der Sonne hatte sich jedoch verändert, und jetzt war es das besonnte Land, das leuchtete, sein eigenes Gesicht lag wohltuend im Schatten. Sieht sofort besser aus, dachte er, es war das grelle Licht, das hat übertrieben.
Der Zug eilte nahezu geräuschlos dahin, er fühlte sich sanft gewiegt.
Als Kind hatte er auf Eisenbahnfahrten immer im Rhythmus der Fortbewegung Worte gebildet oder seltsame abgehackte Liedchen erfunden, damals war ihm alles laut und rhythmisch erschienen, die Menschen schwankten durch die Waggons, unter den Rädern ratterten die Schienenschwellen, die Lokomotive pfiff, alles war in lärmender Bewegung. Nichts von dieser abgeschirmten luxuriösen Ruhe, in der ich jetzt dahinfahre, dachte er.
Genau in diesem Moment aber legte sich der Zug abrupt in eine Kurve, die Türe des Speisewagens flog auf, und eine Frau wurde in seine Richtung geschleudert.
»Hoppala«, sagte sie und fing sich mit beiden Händen am Tischrand auf. Dann lachte sie ihn an. »Was hat er denn plötzlich, dieser feine Zug? Er wird uns doch nicht entgleisen wollen. Entschuldigen Sie bitte.«
Er lächelte höflich zurück.
Sie richtete sich auf und hielt Ausschau nach einem freien Tisch. Er sah, daß sie sehr groß war, um einiges größer als er.
»Wie blöd –«, hörte er sie murmeln. Sie nickte ihm zu, schob den Riemen ihrer Umhängetasche höher auf die Schulter und wollte weitergehen. Schnell sagte er: »Wollen Sie sich nicht zu mir setzen – da es Sie schon mal zu mir hergeweht hat?«
Sofort schämte er sich für diesen matten Scherz. Auch die Frau, deren Gesicht bereits freundliche Zustimmung erfüllt hatte, runzelte leicht die Stirn und schaute ihn unschlüssig an. Dann sagte sie: »Also gut«, und nahm ihm gegenüber Platz.
Er sah, daß sie nicht mehr jung war. Der Blick, den sie auf ihn richtete, besaß eine ungewöhnliche Bestimmtheit. Ihre Augen sind schön, dachte er.
»Mich weht es nirgendwohin«, sagte sie. »Ich habe mich jetzt freiwillig zu Ihnen gesetzt, weil dies der einzige freie Fensterplatz ist. Nur um das zu klären.«
»Natürlich.«
Sie muß mich für einen Trottel halten, dachte er. Erst lasse ich sie herwehen, und dann fällt mir nur ein, daß alles ganz natürlich ist.
Es erleichterte ihn, daß der Kellner jetzt die finnische Erbsensuppe brachte, die aussah wie eine normale Erbsensuppe, und den Teller mit einem »Bitte sehr« vor ihn hinstellte. Die Frau bestellte Eintopf und ebenfalls Weißwein.
»O je«, sagte sie dann, »man darf hier nicht rauchen.«
»Nein, leider«, sagte er und begann seine Suppe zu löffeln.
»Hm«, brummte die Frau, legte jedoch die Tasche, die sie bereits angehoben hatte, wieder neben sich auf die Bank. Dann schaute sie aus dem Fenster. Er sah jetzt ihr Gesicht, das von der Sonne beleuchtet war, in der Fensterscheibe gespiegelt. Sie selbst schien durch dieses Gesicht hindurchzusehen, ihr Blick war in die Ferne gerichtet, hinaus in das herbstliche Land, das vorbeizog.
»Ein schöner Tag«, sagte er und dachte gleichzeitig: Ich habe doch tatsächlich verlernt, eine Konversation zu führen. Sie wandte ihm jedoch den Kopf zu und lächelte. Es war ein Lächeln ohne Spott.
»Ja«, sagte sie, »es ist herrlich heute. Diese letzten Herbsttage, wenn sie vollkommen sind, greifen mir immer ans Herz.«
»Sie machen einen traurig«, sagte er.
Vor Überraschung vergaß er, den Löffel zum Mund zu führen. Er starrte den Löffel an und fühlte, daß er errötete. Machen mich die letzten schönen Herbsttage traurig? dachte er verwirrt. Das wußte ich gar nicht.
Er senkte den Löffel wieder in die Suppe und hörte auf zu essen. Statt dessen sah er jetzt ebenfalls aus dem Fenster und auf die Weinhänge, die in der Sonne glühten. Die Hügel schienen sich leise zu drehen und die abwärtslaufenden Bahnen der Weingärten wie einen Rock um sich zu schwingen.
Er fühlte, daß die Frau ihn immer noch anschaute, und zwang sich, ihr seinen Blick zuzuwenden. Sie lächelte nicht mehr, und daher ließ auch er den Versuch bleiben, sie anzulächeln. »Tja«, sagte er nur.
»Fahren Sie bis Hamburg?« fragte sie.
»Ja«, sagte er, »und Sie?«
»Ich nur bis Bonn.«
Unwillkürlich hatte er zurückgefragt, aber weder schämte er sich dafür, noch runzelte sie die Stirn. Unglaublich, was geschieht, wenn man über den Herbst spricht, dachte er.
Jetzt brachte der Kellner die Schüssel mit dem Eintopf und das Fläschchen Weißwein, stellte beides vor die Frau hin und goß ihr Wein in das Glas. »Danke«, sagte sie. Dann begann sie vorsichtig zu essen, sie blies auf ihren Löffel. »Ist noch heiß« erklärte sie und warf ihm dabei einen kurzen Blick zu. Wie ein Kind, dachte er, jetzt hat sie ausgesehen wie ein Kind.
»Darf ich mit Ihnen anstoßen?« fragte er und hob sein Glas. Auch dieser Satz war ihm leicht gefallen. Er wollte mit dieser Frau unbedingt auf etwas trinken. »Ich möchte mit Ihnen auf irgend etwas trinken«, fügte er hinzu.
Sie legte den Löffel beiseite, tupfte sich mit der Serviette den Mund ab und hob ihr Glas.
»Worauf?« fragte sie.
Ihre auf ihn gerichteten Augen waren wieder von einer Bestimmtheit, vor der es keine Ausflucht zu geben schien.
»Auf –«, er stockte. »Auf diesen Herbsttag«, sagte er dann, »weil er mich traurig macht.«
Sie erhob keinen Einwand, sah ihn nur ruhig an, und sie ließen ihre Gläser gegeneinander klingen.
Nachdem sie beide getrunken hatten, fragte sie: »Macht Sie denn selten etwas traurig?«
»Ich spreche selten darüber«, antwortete er.
»Und warum?« Sie nahm einen Löffel Eintopf und gab ihrer Frage dadurch Leichtigkeit.
»Ich spreche selten über so was.«
»So was?«
»Nun ja – über – über Gefühle.«
Sie schwieg und aß langsam weiter. Ihm gefiel, daß sie schwieg. Eigentlich hatte er, nachdem das Wort »Gefühle« ausgesprochen war, eine dieser Frauenantworten erwartet, in denen so schnell die Bemerkung »typisch männlich« vorkommt. Oder vielleicht hatte er sich nur daran erinnert, daß viele Frauen so zu kontern pflegen. Nein, sie sagt so etwas nicht, dachte er.
»Zu fühlen ist wichtiger als darüber zu reden«, sagte sie.
Sie schob die Schüssel mit dem Eintopf zur Seite und trank Wein. Dann lehnte sie sich zurück und seufzte.
»Jetzt wäre eine Zigarette wirklich gut.«
»Wir können in ein Abteil –«
»Nein, nein«, unterbrach sie ihn sofort, »es ist angenehm hier.«
Sie schaute ihn an, und wieder dachte er: Sie hat schöne Augen. Ihr Blick ist schön, das vor allem. Sicher, die Augen sind groß, die Farbe, dieses bläuliche Grau, ist auch nicht schlecht, aber was sie schön macht, ist dieser Blick. Er weicht nicht ab.
»Sie haben schöne Augen«, sagte er.
Wieder sah sie ihn nur forschend an. Der Zug glitt schnell dahin. Sie befanden sich nun im Rheintal, er fühlte das Aufblitzen das Flusses im Augenwinkel.
»Sie gefallen mir auch«, sagte sie ruhig.
»Ich?« Er hörte selbst, wie ungläubig das klang.
»Ja. Sie. Warum nicht?«
»Weil – ich habe mich vorhin im Fenster sehr deutlich gesehen. Ich bin alt.«
»Das bin ich auch«, sagte sie, »es hat nichts damit zu tun.«
Sie sahen einander noch immer in die Augen, und es verwirrte ihn nicht. Erstaunlich, dachte er, ich hatte immer Angst vor zu langen Blicken.
»Ich hatte immer Angst vor zu langen Blicken«, sagte er.
»Jetzt nicht?« fragte sie.
»Jetzt nicht.«
Der Kellner kam vorbei und fragte: »Sind Sie fertig?«
»Ja«, sagten beide gleichzeitig und ohne einander aus den Augen zu lassen, und der Kellner räumte ab. Nur die halbvollen Weingläser blieben vor ihnen stehen.
»Kaffee?« fragte der Kellner.
»Nein«, sagten wieder beide. Dann lachten sie und lösten den Blick voneinander.
»Nein, keinen Kaffee«, sagte er, zum Kellner hochschauend, »aber noch Wein.«
Sie hatte sich dem Fenster zugewandt. Ein Widerschein von Gold lag auf ihrem Profil.
»Hier, im Rheintal, sieht Deutschland so aus, als wäre es schön«, sagte sie.
»Ja, das Rheintal ist schön«, antwortete er, »vor allem heute.«
Der Fluß, die Weinhänge, Felsen und Burgen glitten vorüber, sie betrachteten es eine Weile schweigend. Ein Bild löste das andere ab, in großer Schnelligkeit, als würde ungeduldig in einem Bilderbuch geblättert, dachte er.
»Jemand blättert zu schnell um«, sagte sie plötzlich.
Mit einer heftigen Bewegung wandte er sich ihr zu. Er hätte sie gerne berührt, ihre Hände, ihr Gesicht, egal. Daß sie dasselbe gedacht hatte wie er, und im selben Augenblick, erfüllte ihn mehr, als je ein körperlicher Impuls es erreicht hatte. Mit sexueller Erregung hatte dies nichts zu tun. Aber das Verlangen nach Berührung verließ ihn nicht.
Der Kellner brachte eine kleine Flasche Weißwein und goß ihnen beiden nach. Sie sah nun nicht mehr aus dem Fenster, sondern legte die Unterarme auf den Tisch und beugte sich ihm zu.
»Ich bin bald in Bonn«, sagte sie.
»Steigen Sie nicht aus.«
»Doch.«
Er wagte es jetzt, es war ihm unmöglich, es nicht zu tun. Er hob seine Hand und berührte ihr Gesicht. Sie ließ es geschehen und sah ihn dabei an. Er fühlte ihre Wange, glatt und ein wenig welk. So fühlten sich die Blütenblätter großer Tulpen an, wenn sie abfielen und man sie in die Hand nahm. Seine Mutter hatte immer, wenn der Garten voller Tulpen war, Sträuße davon in allen Zimmern aufgestellt.
Seine Fingerspitzen berührten ihre Brauen, ihre Schläfen, dann den Haaransatz, und sie entzog sich nicht. Ihr Haar war kräftig, ein wenig spröde. Ihre Gesichter waren einander so nahe gekommen, daß er die feinsten Linien in dem ihren sah. Sie sieht mich auch, dachte er, genauso erbarmungslos genau wie ich sie. Aber Erbarmen tut nicht not.
»Nicht noch näher«, sagte sie jetzt, »ich muß bald aussteigen.«
»Ich möchte Ihnen ganz nahe kommen«, sagte er.
»Ich auch«, antwortete sie, »seltsamerweise ich auch. Aber es geht nicht.«
»Seltsamerweise?«
»Ja. Weil nichts geschehen ist, außer daß wir uns gegenübergesessen sind. Nur eine Stunde lang, oder so. Das ist seltsam.«
»Ja«, sagte er. Und dann: »Aber auch nicht. Ich kenne Sie. Ich glaube, ich habe noch niemanden so gut gekannt wie Sie.«
»Nicht übertreiben.«
Sie nahm seine Hand von ihrem Gesicht und richtete sich auf. Dann griff sie nach dem Weinglas und trank es zur Hälfte leer.
»Es ist der Herbst, es sind diese goldenen Hänge, die vorbeisausen, es ist dieses Licht. Es ist unsere Traurigkeit und Herzergriffenheit. Und es ist gut so. Trinken Sie auch.«
Nein, wollte er sagen, nein, nicht so.
Aber er hob sein Weinglas und trank.
Agonie 1
Sie hatte endlich aufgehört zu weinen. Die Bootsmasten am Hafen schlugen im Wind, und dieses Geräusch drang wieder in ihr Bewußtsein. Also stürmt es immer noch, dachte sie.
Sie richtete sich auf, wie ein Kind auf allen vieren, denn sie war bäuchlings auf dem Bett gelegen. Sie sah den feuchten Fleck auf dem Kissen unter sich und schüttelte den Kopf. »So viele Tränen, und für nichts«, sagte sie leise vor sich hin, während sie sich an den Bettrand setzte, mit langsamen Bewegungen, als wäre ihr Körper uralt. Den Rücken gebeugt, ließ sie ihre Arme und die verflochtenen Finger zwischen den Schenkeln herabhängen. Auch die Haarspitzen zu beiden Seiten ihres Gesichts waren nassgeweint. Sie schielte zu ihnen hin und schüttelte erneut den Kopf. Dann zwang sie sich, den Rücken zu strecken und die Haare aus dem Gesicht zu streichen.
Als sie sich entschloß, aufzustehen, klopfte es an der Türe. Sie öffnete nicht gleich, sondern trat zum Spiegel und betrachtete sich. Ihre Augen waren nur noch schmale Schatten zwischen rötlichen Schwellungen, das übrige Gesicht blaß, fast weiß. Die Haare strähnig und feucht. Schließlich zuckte sie die Achseln und ging so, wie sie war, zur Türe. Soll er mich ruhig so sehen, dachte sie.
Als sie öffnete, war er derjenige, der den Kopf schüttelte. »Du meine Güte«, sagte er, »mußte das sein?«
»Komm herein oder geh«, sagte sie, ließ ihn vor der geöffneten Türe stehen und setzte sich wieder an den Bettrand. Das Klappern der Bootsmasten verstärkte sich in den Windböen, und zwischen den halb zugezogenen Vorhängen sah sie ein Stück Himmel, über das schwarze Wolken trieben. Dämmerung erfüllte das Zimmer.
Er trat herein, schloß die Türe und setzte sich neben sie. Auch er saß vorgebeugt, die Ellbogen aufgestützt, die ineinandergeflochtenen Hände zwischen den Knien. In ähnlicher Haltung saßen sie nebeneinander und schauten vor sich hin.
Er seufzte auf.
»Ich wollte dich niemals unglücklich machen.«
»Ja, ich weiß«, sagte sie.
»Was ist also –«
»Ich bin unglücklich.«
»Aber warum?«
Sie sah ihn von der Seite her an und fühlte, daß ihr wieder Tränen in die Augen stiegen. Sie sah sein Profil, schwach erleuchtet vor dem dunklen Zimmer dahinter, sah die Schläfen, den Haaransatz, den schwarzen Bügel seiner Brille. Ohne ihren Blick zu erwidern, legte er plötzlich seinen Arm um ihre Schultern.
»Warum nur bist du unglücklich?« fragte er nochmals. »Alles könnte so schön sein, so ohne Schatten, wenn du glücklich sein könntest.«
»Es geht nicht so einfach«, sagte sie und schaute wieder vor sich hin. Sie fühlte seinen Arm und seine Hand warm auf sich.
»Es geht nur so einfach«, antwortete er.
Sie schluckte und sagte dann: »Einfach ist –«
»Ja?«
»– daß ich – bei dir sein will.«
»Du bist bei mir.«
Er wollte sie an sich ziehen, aber sie sprang auf. Sie durchquerte einige Male das Zimmer und atmete schwer. Dann riß sie den Vorhang der Balkontüre auf und trat hinaus. Das Meer hatte die Farbe von dunklem Schwefel und brach sich an der Kaimauer. Der Wind fuhr ihr ins Gesicht, er war lau und feucht. Sie kniff die Augen zusammen und schrie jetzt.
»Ich kann es nicht mehr hören! Das stimmt alles nicht! Alles stimmt nicht! Ich bin allein! Sag nicht, ich sei bei dir! Alles ist viel zu real, um metaphorisch darüber zu sprechen. Ich leide – verstehst du das nicht? Ich leide!!!«
Sie schrie weiter, und er kam zu ihr heraus. Ihr Schreien vermischte sich mit dem Brausen des Sturmes, dem Anprall der Wogen, und dennoch wandte ein Mann, der am Hafen sein Boot vertäute, den Kopf. Sein Haarschopf flatterte im Wind. Mit gerötetem Gesicht zog er an einer Leine und starrte zu ihnen herauf.
Da sie nicht aufhörte zu schreien, hob er sie hoch und trug sie ins Zimmer zurück. Er warf sie auf das Bett. Dann hielt er sie fest, über sie gebeugt, und schrie ebenfalls.
»Hör auf!!« schrie er mit einer Wildheit, daß sie verstummte.
Schweratmend starrten sie einander an.
»Schau uns beide an«, sagte er dann leise, »ist es nicht schrecklich?«
»Ja«, flüsterte sie.
Er legte sich auf sie und umarmte sie. Sie hob die Arme und umschlang ihn ebenfalls. Langsam rollten sie zur Seite, bis sie einander zugewandt auf den Kissen lagen, die Gesichter so nahe, daß sie sich fast berührten. Ohne sie aus den Augen zu lassen, nahm er mit einer ruhigen, schnellen Bewegung seine Brille ab und legte sie zur Seite. Sie sah die Färbung seines Augapfels, jede Linie der Pupille, sah seine Wimpern, der Schlag seines Lides schien die Luft zu bewegen und als ein leichtes Wehen bis zu ihr zu dringen.
Zadis
Zadis lief mit großen Schritten auf das Haus zu. Es war ein einstöckiger, quadratischer Bau, aus Holzbrettern gefertigt. Dahinter lag der Schilfgürtel, und das Haus schien bereits die Farbe des Schilfs angenommen zu haben, fast darin zu verschwinden. Zadis jedoch erkannte sogar im Laufen, daß die Vorhänge an den Fenstern zurückgezogen waren und die Türe offenstand. Zadis kannte dieses Haus gut, allzu gut.
Dennoch hielt sie in einigem Abstand zur Türschwelle plötzlich an. Stand still und versuchte ihre heftigen Atemzüge zu bezwingen, die den Körper wie Windstöße bewegten. Gleichzeitig hörte sie das Klavierspiel.
Er arbeitet, dachte Zadis. Ich muß ihn trotzdem stören.
Sie hatte eine Weile zugehört, und ihr Atem war ruhig geworden, als sie schließlich das Haus betrat.
Es bestand aus einem einzigen großen Raum, in den aus vielen Fenstern hell das Tageslicht fiel.
Der ausgebleichte Bretterboden hatte ebenfalls die Farbe von Schilfblättern. Außer dem ausladenden Flügel befand sich in dem Haus nur ein Tisch und ein grünbezogener Lehnstuhl, auf dem, achtlos hingeworfen, ein Regenmantel lag.
Zadis setzte sich auf den Fußboden, gleich neben der Eingangstüre, lehnte den Rücken gegen die Holzwand und zog die Beine dicht an sich heran. Sie tat es lautlos und ohne Diego aus den Augen zu lassen. Er spielte konzentriert und hatte ihr Hereinkommen nicht bemerkt. Sein Profil zeichnete sich gegen eines der Fenster ab, dahinter bewegte sich das Schilf in einem leichten Wind. Die ferne Wasserfläche und der Himmel schienen ineinander überzugehen, von diesem einheitlich dumpfen Grau hob sich auch das verwaschene Gelb des Schilfgürtels nur wenig ab. Der ganze Raum war von gelblichgrauer Helligkeit erfüllt, von einem Licht, das kaum Schatten warf, nur unbarmherzig alles durchdrang.
Als Diego unterbrach und mit Blick auf das Notenblatt kurz innehielt, sagte Zadis: «Ich bin hier.«
Er wandte den Kopf und sah sie an. Erst nach einer Weile lächelte er. Sie kannte das, diese Mühe, mit der er sich aus der Arbeit löste und den Menschen wahrnahm, der ihn unterbrach. Sie kannte es gut, denn sie mußte ihn fortwährend unterbrechen. Es war die einzige Möglichkeit, zu ihm zu gelangen.
»Hallo«, sagte Diego.
»Hallo«, gab sie zur Antwort.
Er rieb sich die Stirn. Dann fragte er: »Ist etwas?« Seine Stirn war jetzt gerötet und die Augen darunter ebenfalls. Er sieht müde aus, dachte sie, aber ich werde es ihm trotzdem sagen.
»Ich bin schwanger.« sagte sie.
Er blieb unbeweglich sitzen, und in seinem Blick schien sich nichts zu verändern. Dann räusperte er sich.
»Bist du sicher?« fragte er.
»Ich habe es eben erfahren.«
Das Zimmer zwischen ihnen dehnte sich weit aus, unmöglich, es zu überqueren. Im Gegenteil, es schien sie unaufhaltsam auseinanderzurücken.
»Bin ich der Vater?« fragte er. Als sie schwieg, fügte er hinzu: »Ich dachte, ich wäre dafür schon zu alt.«
Ja, du bist sehr alt, dachte sie und sah ihn an, aber nicht zu alt für dafür. Du bist alt geworden, weil du dich dem Leben entziehst.
»Du bist der Vater«, sagte sie, »aber es spielt keine Rolle. Ich wollte es dir nur sagen, damit du weißt, warum ich weggehe.«
Jetzt veränderte er seine Haltung am Klavier, drehte sich mit den Knien zu ihr hin. Wieder rieb er sich die Stirn, er hat wohl Kopfschmerzen, dachte sie. Dann verschränkte er die Arme und lächelte.
»Lächle nicht!« sagte sie. »Mach dir nicht solche Mühe.«
»Wohin willst du gehen? Was soll dieser Unsinn?« Er hatte tatsächlich aufgehört zu lächeln.
»Weg von dir«, antwortete sie. »Nur das.«
»Zadis.«
Er sagt ihn schön, meinen Namen, dachte sie. Er hat ihn immer sehr schön gesagt, so, daß ich meinen Namen zu lieben begonnen habe, so schön. Er brauchte nur meinen Namen zu sagen, es genügte. Heute genügt es nicht.
Und sonst?
Sie hatten mit den Rotweingläsern angestoßen und einander dabei flüchtig in die Augen gesehen. Nun aßen sie schweigend. Das Lokal war halbleer, vom Tonband kam italienische Musik, alle die zeitlosen wohlbekannten Schlager, jedoch leise gestellt. Ein Lampenschirm aus gelochtem, kupferfarbenem Metall hing über dem Tisch. Das Licht fiel über ihre Hände und die Teller, die Gesichter blieben im Schatten, nur die Löcher im Schirm sprenkelten Stirn, Nase und Wangen mit Lichtpunkten.
»Die Kräuterravioli sind ausgezeichnet«, sagte er nach einer Weile, ohne das Kauen zu unterbrechen.
Sie nickte nur, da gerade ein zu großes Salatblatt in ihren Mund geraten war und sie den Kampf damit elegant austragen wollte. Nachdem sie sich mit der Serviette das Öl von den Lippen getupft hatte, sagte sie: »Die kochen nach wie vor sehr gut.«
Jetzt war er es, der nickte und mit allzu vollem Mund nicht sprechen wollte. Sie trank Wein und er schenkte ihr nach.
»Hast du heute viel zu tun gehabt?« fragte sie schließlich.
»Na ja«, sagte er und spießte eines der letzten Ravioli mit der Gabel auf, »das übliche. Aber es sieht recht gut aus mit dem Projekt, die Geldgeber bleiben bei der Stange.«
»Gut«, sagte sie und zündete sich eine Zigarette an. Der Kellner sah es und brachte ihr einen Aschenbecher. »Danke«, sagte sie.
»Und sonst?« fragte er nach einer Weile.
Auch er schob nun den leeren Teller von sich und lehnte sich zurück. Er legte sein silbernes Feuerzeug auf den Tisch, dann erst zog er gemächlich die Pakkung Zigarillos, die er zu rauchen pflegte, aus der Jackettasche.
»Sonst?« antwortete sie.
»Nun ja – gibt es etwas Neues?«
»Nein«, sagte sie, »alles ist alt.«
Er hob den Blick, ein Lichtstrahl sprenkelte seine Wimpern.
»Meinst du das etwa doppelbödig?« fragte er.
»Schon möglich«, antwortete sie und lächelte.
Er lächelte kurz zurück und begann dann sein Zigarillo zu rauchen.
»Vorzüglich«, sagte er, nachdem er den Rauch genußvoll aus rundem Mund von sich geblasen hatte, »das ist und bleibt die beste Marke.«
Sie nickte.
September
Die Kastanienbäume boten in diesem Herbst einen traurigen Anblick. Von irgendeiner Motte oder Milbe befallen, hingen die Blätter bereits in den ersten Septembertagen braun und verkrümmt an den Ästen, flatterten bei den leichtesten Windstößen zu Boden, ächzend, als geschähe es unter Schmerzen. Es hieß, diese Schädlinge, die den berühmten Wiener Kastanienbäumen derart zusetzten, seien versehentlich einem Laboratorium entkommen.
»Da sieht man’s wieder«, sagte Agathe seufzend, »wir haben ja keine Ahnung davon, was diesen Labors alles entwischt.«
»Komm, laß das heute«, murmelte Hans, der neben ihr in der Sonne lag. Es war Sonntag. Sie hatten ihre Liegestühle auf dem Balkon aufgeschlagen, die Gasse lag still unter ihnen.
»Warum soll ich gerade heute irgend etwas lassen?« Agathes Stimme klang gereizt, obwohl ihr Körper sich weiter entspannt der Sonne und Wärme hingab.
»Weil es heute und jetzt angenehm ist, hier zu liegen und einmal nicht über die Katastrophen unserer Welt nachzudenken.«
Hans gähnte und schmiegte sich noch tiefer in den blauweiß gestreiften Liegestuhl. Agathe hob den Kopf und schaute ihn an.
»Du bist nicht nur heute und jetzt, sondern zu jeder Zeit zu faul, über irgend etwas nachzudenken.«
»Agathe«, sagte Hans leise und beschwörend, ohne die Augen zu öffnen.
»Aber es ist doch so!« Agathe richtete ihren Oberkörper auf. »Du bist an nichts interessiert, nur an deiner Bequemlichkeit. Neben dir kann der Teufel los sein, und du bemerkst es nicht.«
»Ich bemerke sehr wohl, daß neben mir der Teufel los ist«, sagte Hans ruhig und mit weiterhin geschlossenen Augen.
»Du bist ein Arschloch«, sagte Agathe und legte sich wieder zurück.
Sie schwiegen. Der Wind rauschte leicht durch die vertrocknete Kastanienallee, im blauen Himmel überschnitten sich die Kondensspuren entschwundener Flugzeuge, bildeten weiche Muster, verschwammen. Eine Frau ging unten vorbei, ihr kurzer energischer Schritt hallte auf dem Pflaster und verklang langsam wieder.
»Verzeih«, sagte Agathe.
Hans streckte die Hand aus und fand, ohne hinzuschauen, die ihre. Sie schlangen die Finger ineinander und lagen jetzt so, Hand in Hand, unter der Sonne.
»Natürlich bin ich ein Arschloch«, sagte Hans nach einer Weile.
»Und bei mir, in mir, ist wirklich manchmal der Teufel los«, sagte Agathe. »Was kann ich nur dagegen tun? Gegen diesen Zorn.«
»Du bist zornig, weil immer alles ganz anders ist, als du es haben möchtest. Du möchtest, daß die Bäume nicht sterben – aber sie tun’s. Du möchtest, daß deine moralischen Ansprüche sich erfüllen – aber sie tun’s nicht. Und du möchtest mich lieben – kannst es aber nicht.«
»Ich liebe dich«, sagte Agathe.
»Nein«, sagte Hans und drückte ihre Hand.