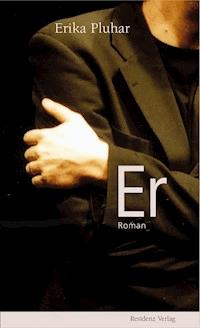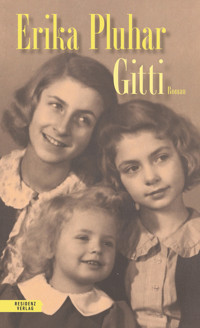Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erika Pluhar lässt die Freundschaft zweier ungleicher Frauen entstehen, sie erzählt von Lebensmustern, von Alter und Vergänglichkeit. Henriette Lauber blickt auf ein kreatives und arbeitsreiches Leben zurück. Als Cutterin von Kinofilmen tauchte sie in spannende Welten ein und konnte an der Seite eines geliebten Mannes tätig sein. Doch dies ist lange her und sie lebt nun kontaktscheu und weitgehend isoliert in einer kleinen Innenstadtwohnung. Ihrem Patensohn aus der Westsahara gilt all ihre Liebe und Sehnsucht. Nach einem Schwächeanfall macht sie die Bekanntschaft ihrer jungen Nachbarin Linda, die sich um Henriette zu kümmern und ihre Nähe zu suchen beginnt...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erika Pluhar
Gegenüber
Roman
Residenz Verlag
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2016 Residenz Verlag GmbHSalzburg – Wien
Alle Rechte, insbesondere das des auszugsweisen Abdrucks und das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.
Umschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.comUmschlagfoto: Christina Häusler Lektorat: Isabella Suppanz
eISBN: 978 3 7017 4532 6ISBN Print: 978 3 7017 1674 6
Denn das Vergangen-Sein ist vielleicht die sicherste Form von Sein überhaupt.
Viktor E. Frankl
Es war das Schlagen eines Fensters, das ihr ins Bewußtsein drang. Sie öffnete die Augen. Dunkelheit umgab sie. Erst nach einer Weile konnte sie schräg über sich einfallendes Licht wahrnehmen, ein helles Viereck und daneben das Wehen einer dünnen Stoffbahn. Also liege ich auf dem Boden, dachte sie. Warum liege ich hier auf dem Boden. Das dort oben scheint mein Schlafzimmerfenster zu sein, es ist wohl Nacht und der Wind weht. Warum liege ich nicht in meinem Bett.
Sie versuchte, den Kopf zur anderen Seite zu drehen, und es gelang. Ich sollte aufstehen, sagte sie sich. Doch eine schwere Mattigkeit hielt ihren Körper nieder, so, als wäre er ein mit Sand oder Steinen gefüllter Sack, ein fremder Gegenstand, den aufzuheben sie nicht die Kraft besaß. Sie schloß die Augen und blieb regungslos liegen. Wieder schlug ein Fensterflügel im Wind.
Bin ich ohnmächtig geworden? überlegte sie, oder war es ein Schlaganfall? So viele Leute meines Alters erleiden zur Zeit Schlaganfälle. Ihr wurde heiß bei dieser Überlegung, sie bekam plötzlich keine Luft, und ihr Herz begann so heftig zu schlagen, daß sie selbst es hören konnte. Ich habe Angst, dachte sie, vielleicht ist es Todesangst, bitte beruhige dich, Henriette, sonst stirbst du noch an dieser Angst.
Schließlich bewegte sie vorsichtig die Zehen und stellte erleichtert fest, daß diese ihr gehorchten. Ihre Füße waren nackt, also hatte sie wohl das Bewußtsein verloren, als sie dabei war, ins Bett zu steigen.
Oder als sie vom Bett aufgestanden war, um in das Badezimmer zu gehen. Mehrmals pflegt sie ja nachts ins Badezimmer zu gehen, auch wenn es nur ihrer Schlaflosigkeit wegen ist. Ins Bad, in die Küche, sie unternimmt nächtliche Wanderungen, nachdem auch stundenlanges Lesen im Bett sie nicht wieder einschlafen läßt. Eine Nacht durchzuschlafen gelingt ihr seit Jahren nicht mehr.
Aber wie angestrengt Henriette auch zurückdachte, es wollte sich keine Erinnerung einstellen. Was war los gewesen, ehe sie umfiel. Wie spät war es. Wie spät ist es jetzt. Trägt sie schon ihr Nachthemd? Oder noch Tageskleidung? Vielleicht hatte sie sich beim Auskleiden verletzt, war mit dem Kopf irgendwo angerannt. Aber wo. Sie lag in einiger Entfernung zum Bett auf den Holzbohlen ihres Schlafraums, das war ihr mittlerweile klargeworden, links über ihr, in einiger Entfernung, das geöffnete Fenster, der dünne weiße Vorhang noch nicht vorgezogen, die Nacht war warm und der stürmische Wind kündigte vielleicht ein Gewitter an. Ich sollte das Fenster schließen, dachte Henriette.
Mit jetzt weit geöffneten Augen versuchte sie das Halbdunkel des Zimmers zu durchdringen. Dann zwang sie sich, einen Arm hochzuheben. Sie sah, daß auch dieser nackt war, wie ihre Füße. Sie sah es in der spärlichen Beleuchtung, die von den Straßenlampen in das Zimmer fiel. Bin ich etwa zur Gänze nackt? fragte sie sich. Sollte ich jetzt sterben, würde man hier nach einiger Zeit eine nackte, alte, tote Frau vorfinden. Was für ein unangenehmer Gedanke, also besser jetzt nicht sterben.
Henriette hörte sich kichern und erschrak. War sie mittlerweile vielleicht verrückt geworden? Nicht mehr bei Sinnen? Deshalb hier auf dem Fußboden hingestreckt, ohne zu wissen, warum? Alt genug für solche Schübe war sie ja. Eine Frau, die auf die achtzig zugeht, ist alt genug für jede Form von Hinfälligkeit und Verfall. Ohnehin verwunderlich, wie sie sich bisher gehalten hatte.
Jetzt verwende ich auch schon diese idiotische Formulierung, dachte Henriette. Wie gut Sie sich gehalten haben! Als wäre man Dosenfleisch, das glücklicherweise noch nicht schimmelt.
Jetzt waren auch ferne Donnerschläge zu hören, die Windstöße wurden immer heftiger und warfen einen der Fensterflügel knallend hin und her. Das Glas wird zerbrechen, wenn es so weitergeht, dachte Henriette. Aber sie zögerte nach wie vor, ihren Kopf zu heben, etwas beunruhigte sie, ein ferner, dumpfer Schmerz. Jedoch ließ sie den Arm wandern und wagte ein vorsichtiges Betasten ihres hingestreckten Körpers. Nein, sie war nicht nackt. Ihre Hand fühlte dünne Baumwolle, es war wohl eines der leichten Hemden, die sie bei Hitze daheim zu tragen pflegte. Also hätte man den Leichnam nicht unbekleidet vorgefunden, wenn sie gestorben wäre.
Wer hätte sie eigentlich gefunden? Sicher nicht so bald jemand, denn keinem Menschen wäre sie zunächst abgegangen. Wenn man alt und familiär nicht eingebunden ist, wenn man alleine lebt und bislang den Eindruck machte, es funktioniere klaglos, ohne irgendwelche Scherereien für andere, eine ordentliche Wohnung, keine sichtbaren körperlichen Gebrechen, vernünftiges Grüßen und Gespräch möglich, dann schert sich keiner um einen. Vielleicht wäre es den Nachbarn irgendwann doch aufgefallen, daß man sie schon lang nicht mehr gesehen hätte, im Haus oder auf der Gasse. Aber man sah sie ja normalerweise auch nicht oft, höchstens durch Zufall manchmal am Gang oder vor der Wohnungstür. Das hätte Tage gedauert, bis man sie tot aufgefunden hätte. Nur Maloud. Maloud hätte sich schnell gewundert, wäre schnell beunruhigt gewesen, sie am Handy nicht zu erreichen. Aber trotzdem wäre auch bei ihm viel Zeit vergangen, bis er jemanden zu ihr in die Wohnung hätte schicken können, so etwas ist nicht so leicht von einem anderen Kontinent aus zu organisieren. Und sie hatten außerdem nie besprochen, wen er in so einem Fall kontaktieren solle, ein Fehler.
Eine neuerliche Sturmböe warf sich gegen das offene Fenster und ließ es wild schlagen, Ausläufer wehten bis zum Fußboden herab. Henriette fühlte den warmen Wind über ihren Körper streichen. Ich sollte nicht über Tod und Verwesung nachdenken, schalt sie sich, schließlich lebe ich noch und sollte unbedingt aufstehen, bevor alle Fensterscheiben zu Bruch gehen. Warum nur fürchte ich mich davor, den Kopf zu heben. Los.
Grell zuckte ein Blitz auf, erleuchtete kurz das Zimmer, und gleich darauf krachte in großer Nähe ein gewaltiger Donnerschlag herab, der das Haus leicht erzittern ließ. Erschrocken hob Henriette jetzt den Kopf, aber nichts geschah. Weder fiel sie nochmals in Ohnmacht, noch verstärkte sich der Schmerz. Also richtete sie sich weiter auf. In sitzender Stellung konnte sie sehen, wie es draußen zu regnen begann. Vorerst waren es nur einige harte Tropfen, die auf das Fensterbrett schlugen, aber in Windeseile wurde daraus ein wild herabprasselnder Gewitterregen. Da rappelte Henriette sich hoch. Es gelang ihr, indem sie vorerst auf allen vieren zum Bett kroch, sich dort mit einiger Mühe abstützte, und schließlich aufstand. Alle Knochen taten ihr weh, aber daran war sie gewöhnt. Sie taumelte vorwärts, erfaßte die im Sturm schwingenden Fensterflügel, und es gelang ihr, das Fenster zu schließen. Danach glitt sie wieder zu Boden. Über ihr, hinter dem jetzt geschlossenen Fenster, tobte der Gewitterregen weiter, auch Hagelkörner knallten gegen die Scheiben. Durchnäßt, mit geschlossenen Augen und in unsäglicher Erschöpfung blieb Henriette sitzen, unterhalb des Fensters gegen die Wand gelehnt, ihr war egal, wie lange noch.
Sie saß da und lauschte. Schon als Kind hatte sie Gewitter mehr geliebt als gefürchtet. Sie hatte alles geliebt, was die Natur ihr bot, auch so ein Sommergewitter wie dieses heute Nacht. Vielleicht wurde ich deshalb bewußtlos, dachte Henriette, weil das Gewitter sich atmosphärisch angekündigt hat, vielleicht fiel ich deshalb um. Oder ist es einfach nur mein alter Körper, der langsam aufgibt.
Es läutete an der Tür. Mehrmals.
Was soll das, dachte Henriette, meine Klingel ist doch laut genug, um auch bei Gewitter nicht überhört zu werden. Sie öffnete die Augen und sah vor sich hin. Wer meinte da, sie mitten in der Nacht und bei Blitz und Donner aus dem Schlaf wecken zu müssen. Nie läutete jemand bei ihr, höchstens ab und zu der Briefträger, für eine Unterschrift, wenn Maloud ihr ein Päckchen schickte. Und jetzt plötzlich dieses Geklingel. Einfach nicht melden, dachte Henriette, sicher ist es ein Versehen.
Aber die Klingel schrillte weiter.
»Mist«, brummte Henriette. Dann kroch sie quer durch das Zimmer, richtete sich in der Nähe des Lichtschalters auf und drehte die Deckenlampe an. Das Licht fiel auf den Korridor hinaus, an dessen Wänden sie sich abstützte, während sie zur Wohnungstür schwankte. Ich bin noch nicht ganz in Ordnung, dachte sie, vielleicht war das vorhin wirklich was Ernsteres, mir schwindelt, als wäre ich seekrank.
Als Henriette öffnete, stand die junge Frau aus der Nachbarwohnung hoch aufgerichtet vor ihr. Sie war barfuß, trug ein geblümtes Nachthemd, und die langen Haare hingen ihr in Strähnen über die Schultern. Sie sah aus wie jemand, den man aus dem Schlaf gerissen hatte.
»Was ist denn mit Ihrem Fenster los?« rief sie, »es hat unaufhörlich im Wind geschlagen, ein Geknalle bis zu uns herüber, ich wollte einfach nachsehen, ob bei Ihnen alles in Ordnung ist, sind Sie in Ordnung?«
»Aber ja«, Henriette hielt sich am Türstock fest, »ich hab das Fenster schon zugemacht, entschuldigen Sie.«
»Aber Sie sehen blaß aus, Frau Lauber, gar nicht gut sehen Sie aus.«
Die junge Frau starrte sie an, und nicht nur mit Besorgnis. Klar, dachte Henriette, sie sieht mich hier in einem durchnäßten Hemdchen stehen, mein alter Körper dürftig verhüllt, die Beine nackt, wer schaut sich schon gern eine alte, halbnackte Frau an. Noch dazu, wenn man so jung ist, sie ist so um die dreißig, denke ich, da muß dieser Anblick sie ja abstoßen. Ich glaube, sie heißt Krutisch, Linda Krutisch, an der Wohnungstür steht ›Linda und Helmut Krutisch‹, jeden Tag gehe ich daran vorbei.
»Es geht mir gut, danke«, sagte Henriette, »nochmals, tut mir leid wegen der Störung, ich hoffe, Sie können jetzt weiterschlafen, gute Nacht.«
Henriette wollte die Tür schließen, ihr war plötzlich übel, nichts wie ins Bett, dachte sie. Aber die junge Frau blieb ungerührt vor ihr stehen, sie schien das Gespräch noch nicht beenden zu wollen.
»Wer kann bei diesem Gewitter schon schlafen«, sagte sie, »vorhin hat es auch noch gehagelt wie verrückt, was für ein Lärm. Nein, nein, eigentlich habe ich mir Sorgen gemacht um Sie. Mein Mann ist aufgewacht und hat sich gewundert, ob da drüben nicht was los ist? Da bin ich schließlich aufgestanden und hab bei Ihnen zu läuten begonnen, aber Sie haben sich lange nicht gemeldet. Fühlen Sie sich wirklich gut? Ganz grün sind Sie im Gesicht, soll ich Ihnen nicht vielleicht irgend etwas –«
»Entschuldigung«, konnte Henriette nur noch stammeln.
Sie hielt sich die Hand vor den Mund und wankte zurück in ihre Wohnung. Die Badezimmertür aufzureißen gelang ihr, alles um sie herum drehte sich, einige taumelnde Schritte, auf ihren Knien landete sie vor der Kloschüssel und erbrach dort. Es schien ihren ganzen Körper zu zerreißen und wollte nicht enden, sie hörte zwischendurch ihr Aufstöhnen. Danach ließ sie sich auf den gekachelten Boden gleiten, blieb hingestreckt liegen und schloß die Augen. Gott ist mir schlecht, dachte sie, hätte eine Ohnmacht nicht genügt, warum denn heute auch das noch.
Henriette fühlte eine Hand an ihrer Schulter.
»Frau Lauber«, hörte sie flüstern. Als sie die Augen öffnete, hing über ihr das Gesicht von Linda Krutisch, jetzt mit dem Ausdruck echter Besorgnis.
»Es ist nichts«, Henriette versuchte zu lächeln und mit fester Stimme zu sprechen, »ich kenne das, gehen Sie ruhig wieder hinüber.«
»Soll ich einen Arzt rufen?«
»Nein, nein, ich bleibe hier nur noch ein bißchen liegen, bitte gehen Sie wieder ins Bett, Frau Krutisch.«
Da setzte sich die junge Frau neben Henriette auf den Boden.
»Nein, wer jetzt unbedingt ins Bett gehört, sind Sie«, sagte sie mit Entschlossenheit, »und nennen Sie mich bitte Linda.«
»Nicht böse sein, Linda, aber ich kann jetzt noch nicht aufstehen«, murmelte Henriette. Sie wußte, daß jede Drehung des Kopfes neuerlichen Brechreiz hervorrufen würde. In jungen Jahren hatte so ein Drehschwindel sie mehrmals heimgesucht, danach gab es eine ganze Reihe von Untersuchungen, es fand sich aber nichts, kommt von den Nerven, hatte man ihr gesagt.
»Ich helfe Ihnen«, sagte Linda.
»Nein bitte. Bitte lassen Sie mich.«
Wenn die Frau nur ginge, dachte Henriette, ich kenne sie nicht, sie ist mir zu nah, meinem ungeschützten Körper viel zu nah, ich möchte allein sein, auch im Elend allein sein, wie ich es mein Leben lang war. Ich möchte hier in meinem Badezimmer liegenbleiben und sterben, vielleicht gelänge mir zu sterben, ohnehin taugt alles andere nicht mehr.
Da Henriette ihre Augen wieder fest geschlossen hielt, um weder den mitfühlenden Blick der jungen Frau noch die um sie kreisende Welt wahrzunehmen, hatte sie nicht bemerkt, daß Linda Krutisch aufgestanden und hinter sie getreten war. Plötzlich fühlte sie zwei kräftige Arme, die sie unter den Schultern packten und mit sich zogen. Henriette stöhnte auf, »bitte nicht, was soll das«, aber sie wurde von der jungen Frau weitergeschleppt. »Ich glaube – wenn ich Sie nicht umdrehe –«, hörte sie Lindas Stimme über sich, sie sprach zwischen angestrengten Atemzügen, »ja, genau – wenn wir das so machen – müssen Sie nicht kotzen –« Und sie schleifte Henriettes Körper behutsam aus dem Badezimmer, durch den Korridor und bis hin zu ihrem Bett. Henriette hatte sich schließlich ergeben, Kacheln und Holzbohlen unter sich gefühlt, gut, daß sie Teppiche nicht mochte und die Böden genügend glatt waren. Und geradewegs am Rücken dahinzugleiten, ohne den Kopf drehen zu müssen, verhinderte tatsächlich ein neuerliches Erbrechen.
»So.« Linda stand aufgerichtet über ihr, als Henriette schließlich vor dem Bett lag. »Jetzt mache ich oben alles bereit, schlage die Decke zurück, und dann stütze ich Sie, Sie stehen ganz kurz auf, und flugs liegen Sie wieder – nur in Ihrem Bett, wo Sie hingehören, ja?«
Henriette murmelte eine schwache Zustimmung. Dann vernahm sie, wie Laken, Kissen, Bettdecke mit schnellen Griffen angeordnet wurden. Und ehe sie es sich versah, zerrte die kräftige junge Frau sie mit einem Ruck hoch und bettete sie auf das Lager, so unvermutet und rasch, daß Henriettes Körper keine Zeit fand, zu revoltieren. Kerzengerade am Rücken liegend fand Henriette sich wieder, das vertraute Bett um sich und ohne drängende Übelkeit. »Sie sollten lieber Ihr Hemd ausziehen«, sagte Linda, die Decke in der Hand und mit prüfendem Blick.
»Das jetzt nicht. Das mache ich später, bitte!« stammelte Henriette erschrocken. Du lieber Himmel, jetzt nicht auch noch völlig nackt vor dieser jungen Frau daliegen müssen! Ihre Bitte schien so flehentlich geklungen zu haben, daß Linda ohne zu widersprechen die Decke über sie breitete. Endlich wieder umhüllt und geschützt, fühlte Henriette, daß ihr Körper entspannte. »Danke«, sagte sie.
»Es regnet nicht mehr«, sagte Linda, »soll ich vielleicht das Fenster doch wieder aufmachen? Es ist sehr warm und stickig im Zimmer, unter der Decke wird Ihnen heiß werden.«
»Wie Sie wollen«, murmelte Henriette mit geschlossenen Augen, sie fühlte, daß sie dabei war, einzuschlafen. Als das Fenster geöffnet wurde, wehte regenfeuchte, kühle Luft bis zu ihr her, sie spürte es auf ihren Wangen, auf ihrer Stirn, hütete sich jedoch, den Kopf zu bewegen. Mich nicht mehr rühren, schlafen, nur schlafen, und so liegenbleiben bis ans Ende meiner Tage, was gäbe es Schöneres, dachte Henriette.
Da schrillte die Klingel. Und wieder mehrmals hintereinander.
Henriette öffnete mit Anstrengung ihre Augen und sah Linda, mit einer begütigenden Geste zu ihr her, vom offenen Fenster aus zur Wohnungstür eilen. »Ach was, das ist sicher der Helmut!« rief sie, »keine Aufregung, Frau Lauber, ich sage ihm, was los ist.«
Eine laute Männerstimme war zu hören, in der Ungeduld und Verärgerung schwang, die Entgegnungen der Frau obsiegten jedoch rasch, sie berichtete und beschwichtigte, die Tür schloß sich, und Linda kehrte an Henriettes Bett zurück.
»Bis Männer etwas kapieren, das dauert«, sagte sie.
Dann trat sie zum kleinen Tisch neben dem Bett und drehte die Lampe an. Es war eine alte Bürolampe, ein Ungetüm aus Messing, über der ein gelbes Tuch hing, das dem Licht eine milde Tönung gab. Danach durchquerte Linda mit schnellem Schritt das Zimmer und schaltete die Deckenbeleuchtung aus. Zurückgekehrt, setzte sie sich an das Fußende des Bettes.
»So ist es besser, nicht wahr?« sagte sie.
Henriette vermied es zu nicken und gab einen zustimmenden Laut von sich, ohne den Kopf zu bewegen. Was ist jetzt, dachte sie, bleibt diese Frau jetzt bei mir? Sie war mir wirklich sehr hilfreich, aber jetzt bliebe ich gern wieder allein, ich kann mit menschlicher Zuwendung mittlerweile nur schlecht umgehen, wenn man zu viel alleine ist, kann einem das Alleinsein gar nicht mehr zuviel werden. Maloud schilt mich immer, wenn ich ihm etwas in der Art sage oder schreibe, aber es ist so. Die junge Frau sollte jetzt wirklich gehen.
»Ich danke Ihnen sehr, Linda«, Henriette zwang sich, möglichst unbekümmert zu sprechen, »aber bitte gehen Sie jetzt zu Ihrem Mann und in Ihr Bett zurück, ich komme jetzt wirklich wieder alleine zurecht.«
Linda Krutisch blieb ungerührt sitzen.
»Was ist, wenn Sie sich nochmals übergeben müssen?« fragte sie.
»Muß ich nicht«, sagte Henriette.
»Sind Sie eigentlich immer allein?«
»Meist.«
»Wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf?«
»Ich werde achtzig.«
»Ist nicht wahr«, sagte Linda.
»Ist sehr wahr«, antwortete Henriette.
Sie schwiegen jetzt beide. Linda betrachtete Henriette, als sähe sie etwas vor sich, das sie zuvor noch nie gesehen hatte, ihr Blick war grüblerisch. Auf der nächtlichen Straße fielen nach dem Gewitterregen immer noch Tropfen von den Dächern, und wenn ab und zu ein Auto vorbeifuhr, rauschte Nässe auf.
»Meine Großmutter wäre jetzt so alt wie Sie«, sagte Linda, »aber sie lebt nicht mehr.«
»Viele Menschen meines Alters leben nicht mehr«, antwortete Henriette.
»Sind Sie deshalb immer alleine?«
»Nicht nur. Aber auch.«
Diese Linda beginnt mich auszufragen, dachte Henriette. Ich will nicht von den Menschen meines Lebens erzählen, die gegangen sind, ich bin todmüde und fühle mich schlecht, sie soll jetzt bitte gehen.
»Gibt es jemanden, der sich um Sie kümmert?« fragte Linda.
»Niemand soll sich um mich kümmern!« Henriette wurde plötzlich laut. »Auch Sie nicht, liebe Linda, Ihr Mann wartet, gehen Sie jetzt bitte in Ihre Wohnung hinüber! Nicht böse sein, aber ich –«
Sie mußte unterbrechen, da ihr übel wurde, vielleicht hatte sie in der Erregung doch den Kopf ein wenig zur Seite gedreht. Mit geschlossenen Augen blieb sie regungslos liegen, um den Brechreiz wieder abklingen zu lassen.
»Ich bin nicht böse«, sagte Linda ruhig, »und ich gehe dann auch gleich. Aber trotzdem wüßte ich gern jemanden, den ich anrufen oder holen könnte für Sie, es geht Ihnen nämlich wirklich schlecht, und ich hätte keine Ruhe, wenn ich Sie einfach allein daliegen lasse, und Sie müßten wieder ins Bad, alles das. Irgendwen muß es doch geben in Ihrem Leben.«
»Maloud«, murmelte Henriette.
»Wie bitte?«
»Maloud, meinen Sohn –«
»Ihr Sohn? Ja dann! Wo erreiche ich ihn?!«
Als Henriette ihre Augen öffnete, sah sie in Lindas erwartungsvolles Gesicht.
»Maloud ist mein Patensohn und er kann heute sicher nicht zu mir kommen, er lebt in Afrika. Aber es gibt ihn in meinem Leben.«
»Ach so«, sagte Linda.
»Ich verspreche Ihnen, daß ich allein zurechtkomme, wenn Sie mir jetzt nur noch den Plastikeimer aus dem Badezimmer bringen, er steht bei der Waschmaschine, und ihn neben mein Bett stellen.«
»Mach ich«, sagte Linda und blieb am Bettrand sitzen.
»Schauen Sie nicht so«, sagte Henriette, »ich kenne mich aus mit so einem Drehschwindel, glauben Sie mir. Morgen bin ich wieder in Ordnung, Sie können unbesorgt nach Hause gehen. Wirklich, ein Kübel neben meinem Bett genügt.«
Linda stand auf, ging durch den Korridor zum Badezimmer, kam mit einem gelben Plastikeimer zurück und stellte ihn neben dem Bett ab. Dann blickte sie auf Henriette hinunter.
»Danke«, sagte Henriette.
»Darf ich morgen nach Ihnen sehen?« fragte Linda.
»Jetzt schlafen Sie mal, langsam wird es hell draußen«, antwortete Henriette.
»Soll ich Ihre Lampe abdrehen?« fragte Linda.
»Ja, bitte.«
Linda knipste das Licht neben dem Bett aus. Der erste fahle Schein des Morgens erfüllte das Zimmer.
»Ich hoffe, Sie können schlafen«, sagte Linda.
»Gute Nacht«, sagte Henriette.
»Lieber guten Morgen«, sagte Linda, »aber ich geh jetzt auch noch ins Bett.«
»Gut so.«
»Also bis dann.«
Henriette hörte die Schritte der jungen Frau sich entfernen, das Öffnen und Schließen der Wohnungstür, draußen am Gang einen Wortwechsel, der sich verlor, und dann herrschte Stille. Wenige Autos fuhren vorbei, die Stadt schlief noch.
Henriette lag mit weit offenen Augen regungslos da. Ihr Hemd war immer noch ein wenig klamm vom Regen und sie fröstelte unter der Decke. Nur nicht bewegen, dachte sie. Einschlafen. Hinwegschlafen. Verschwinden. Ich habe heute mein Bewußtsein verloren, warum mußte ich es wiederfinden? Um von einer jungen Frau aufgestört zu werden, vor ihr mit meinem alten Körper und halbnackt an der Kloschüssel zu hängen und zu kotzen, mich von ihr ins Bett schleppen zu lassen, und jetzt bewegungsunfähig, frierend und schlaflos den Tag zu erwarten? Lohnte sich das? Lohnt sich für mich dieses Leben denn noch?
Unten auf der Straße wurde lärmend ein Rollladen hochgezogen, Henriette kannte dieses Geräusch, das täglich zur selben Zeit die Stille der Morgendämmerung zerriß. Der Besitzer des Gemüseladens hatte diese frühe Öffnungszeit wohl sein Leben lang praktiziert und ließ davon nicht ab. Auch war er der letzte weit und breit, der sein kleines, düsteres Geschäft mit einem schw eren, eisernen Rolladen verschloß. Herr Watussil hieß er. Vom Alter gebeugt und ohnehin bereits dünn wie ein Skelett, trug er dennoch stets einen ehemals eleganten, jetzt jedoch fleckiggrauen Herrenhut tief in die Stirn gedrückt, und woher er sein bißchen Gemüse bezog, blieb Henriette ein Rätsel. Trotzdem kaufte sie bei ihm ab und zu einen Salatkopf oder ein Bündel Karotten, obwohl beides so ermattet wirkte wie der alte Mann selbst. Sie verspeiste nie, was sie bei ihm erstand, aber es fiel ihr schwer, vorbeizugehen, wenn Herr Watussil ihr aus dem Dunkel des Ladens zunickte. Immer saß er alleine zwischen den armseligen Verkaufstischen, niemand schien ihm je behilflich zu sein, es gab kaum Kundschaft, mühsam erhob er sich von seinem schäbigen Holzsessel und füllte das Gewünschte mit zitternden, alten Händen in unsaubere Plastiksäcke, strich das wenige Geld ein, »danke, Frau Lauber«, und mit einem leisen Aufstöhnen setzte er sich wieder.
Ja, der Herr Watussil und ich, dachte Henriette. Er lebt ja auch nur noch, um sein nahes Ende zu finden, genau wie ich. Er sitzt jetzt im Morgengrauen unten in seinem elenden Laden zwischen halbverdorbenem Gemüse und sortiert es aus, während ich mich bemühe, nicht in einen Plastikkübel neben meinem Bett zu kotzen, und deshalb daliege, als wäre ich bereits aufgebahrt. Wenn Maloud mich so sehen könnte. Gottlob kann er das nicht. Er hat mich ja schon länger nicht mehr gesehen, und als er letztes Mal hier war, fehlte mir eigentlich nichts. Maloud. Vielleicht würde er lachen, wenn er mich so sähe, sein stets bereites, alles erhellendes Lachen. Vielleicht sollte ich ihn morgen anrufen.
Die frühe Dämmerung wurde plötzlich von einem hellroten Schein durchdrungen. Irgendwo geht jetzt die Sonne auf, dachte Henriette, steigt aus Hügeln oder Seeflächen hoch und ist vom erwachenden Himmel umgeben, hier über der Stadt sind es nur Ausläufer, die uns zwischen Betontürmen und Dächern erreichen, aber trotzdem sieht mein Zimmer jetzt aus, als würde es erröten.
Ohne sich zu regen ließ Henriette ihren Blick schweifen. Außer einem Wandschrank gab es in dem weißgetünchten Raum kaum Mobiliar. Nur in einer Ecke der uralte Korbstuhl, ein Relikt aus dem Haus ihrer Eltern. Auf ihm lag Kleidung, locker hingeworfen. Aha, das trug ich also gestern, dachte Henriette, und ausgezogen habe ich mich wie immer, die Sachen auf dem Stuhl gelassen wie immer, bin in ein Hemd geschlüpft wie immer, ein Hemd, das jetzt auf meinem Körper, unter der Decke, langsam trocken wird, und ich weiß von all dem nichts mehr. Hoffentlich bin ich wenigstens bei Verstand geblieben, wenn ich schon nicht sterben konnte.
Henriette schloß die Augen und fühlte, daß endlich doch der Schlaf nach ihr griff.
Eine Hand strich über ihre Wange und Henriette riß die Augen auf.
»Erschrecken Sie nicht«, sagte Linda Krutisch. Sie stand neben dem Bett.
»Ich bin schon erschrocken«, sagte Henriette, »wie kommen Sie in meine Wohnung?«
»Ich habe nachts den Schlüssel mitgenommen, er ist innen gesteckt, und ich dachte, Sie sollten vielleicht heute nicht aufstehen müssen, um mir aufzumachen, Ihnen war doch so schlecht bei jeder Bewegung.«
Henriette schwieg, obwohl sie gern aufgeschrien hätte. Was für eine Unverschämtheit, einfach den Schlüssel an sich zu nehmen. In ihrer Wohnung ein Kommen und Gehen, als sei sie selbst nicht bei Sinnen, was sollte das. Sie lag immer noch so im Bett, wie sie eingeschlafen war, hatte weder den Kopf zur Seite gedreht noch ihren Körper bewegt. Es war taghell im Zimmer.
Die junge Frau beugte sich über sie und kam ihr viel zu nah, Henriette schwitzte mittlerweile unter der Decke, sie spürte ihre eigene Ausdünstung, ihr Mund war trocken.
»Geht es Ihnen besser?« fragte Linda.
»Weiß ich nicht«, sagte Henriette.
»Waren Sie schon auf?«
»Nein.«
»Wollen wir versuchen, wie es geht, wenn Sie aufstehen?«
Sie soll mich nicht anfassen, dachte Henriette. Sie soll wieder gehen, ich will es allein ausprobieren.
»Also – wollen wir, Frau Lauber?«
Als die junge Frau mit Entschiedenheit zur Bettdecke griff, um sie von ihrem Körper wegzuziehen, bewegte Henriette zum ersten Mal wieder ihre Arme, hielt die Decke mit beiden Händen umklammert und rief: »Nein!«
Linda sah sie erstaunt an.
»Was ist denn? Sie sollten wirklich versuchen, aufzustehen, und das geht doch nur ohne die Decke!«
»Ich mache es alleine«, sagte Henriette, »gehen Sie bitte wieder.«
Jetzt schwieg Linda, sie schien zu überlegen. Dann setzte sie sich an den Bettrand. Henriette hatte die Decke bis unter das Kinn hochgezogen, hielt sie eisern fest und schloß die Augen.
»Ich verstehe Sie gut, Frau Lauber, glauben Sie mir«, sagte Linda, »aber ich kann nicht gehen und Sie allein weitermachen lassen, verstehen Sie bitte auch mich. Die ganze Nacht habe ich nicht mehr geschlafen, weil ich Sorge um Sie hatte. Sie sollten jetzt wirklich nicht alleine aufstehen, ich weiß doch, wie es Ihnen ergangen ist.«
Henriette antwortete nicht, sie blieb mit geschlossenen Augen starr und unbeweglich unter der Bettdecke liegen. Vielleicht zwingt das die Frau, zu gehen, dachte sie. Bitte, sie soll gehen, ich muß mich hochrappeln, ich muß auf die Toilette, ich habe noch immer alles alleine geschafft.
»Wir sind doch beide Frauen«, sagte Linda, »Sie müssen sich vor mir doch nicht genieren.«
Irrtum, dachte Henriette grimmig, ich bin keine Frau mehr. Ich bin nur noch ein sehr alter Mensch, der Diskretion benötigt. Gehen Sie, junge Frau, gehen Sie endlich.
Linda Krutisch seufzte auf. Dann schwieg auch sie und es wurde still im Zimmer. Unter dem geöffneten Fenster hörte man ab und zu die Schritte von Passanten oder das Surren gemächlich vorbeifahrender Autos, das Haus lag zum Glück an einer einspurigen Nebenstraße, die zwei Hauptverkehrsadern der Stadt zwar verband, aber selbst von Autokolonnen verschont blieb. Seit Henriette hier wohnte, und das schon seit einigen Jahren, hatte die relative Ruhe vor ihren Fenstern sich nicht verändert. Mitten in der Stadt und doch wenig Verkehrslärm, das bewog sie damals, diese bescheidene Wohnung in einem bescheidenen Mietshaus als ihre wohl letzte Behausung zu wählen. Um hier alleine und ungestört den Rest ihrer Lebenszeit zu verbringen.
Und jetzt saß da eine junge Person an ihrem Bett, wachte über sie, und war nicht abzuschütteln. Der Tag schien wieder sehr heiß zu werden, Henriette jedenfalls schwitzte. Ihr Körper verkrampfte sich mehr und mehr, verlangte aber andererseits quälend danach, seine Notdurft zu verrichten. Irgend etwas mußte geschehen, sie war dabei, zu kollabieren. Henriette öffnete die Augen. Linda saß unverändert am Bettrand und schaute sie forschend an.
»Gehen Sie wenigstens aus dem Zimmer«, sagte Henriette, »ich stehe auf, und wenn ich umfalle, hören Sie es ja.«
»Also gut«, sagte Linda, »so können wir’s machen, ich warte hinter der Schlafzimmertür, bis –«
»Nein!« Henriette unterbrach sie mit einer Stimme, in der jetzt Panik schwang, »warten Sie bitte nebenan – ich meine – im anderen Zimmer – oder in der Küche – warten Sie einfach irgendwo, bis ich im Bad bin – ich –«
Jetzt schien Linda verstanden zu haben. »Nur die Ruhe, Frau Lauber, ja, ich mache das!« rief sie, »ich schau nicht zu Ihnen hin, ich höre nur, wenn Sie mich rufen, ja?« Sie erhob sich und ging rasch aus dem Zimmer.
Henriette war nicht mehr fähig, sich zu überzeugen, ob Linda wirklich in einem Nebenraum verschwunden war, sie richtete sich sogleich im Bett auf. Als die Welt um sie herum nicht wieder zu kreisen begann, schob sie die Decke zur Seite, ließ ihre Beine über den Bettrand gleiten und suchte mit den Füßen Halt. Auch jetzt blieben Schwindelgefühl und Brechreiz aus. Also stand sie auf und tappte mit schnellen Schritten ins Badezimmer, ihre Vorsicht wich der notwendigen Eile, gerade noch rechtzeitig die Toilette zu erreichen.
Danach stand Henriette vor der Waschmuschel und sah in den Spiegel. Sie sah ein fremdes Gesicht, das bleich wie Papier war und kaum noch Konturen besaß. Wo sind meine Augen, mein Mund, dachte sie, alles hat sich aufgelöst zwischen den Furchen des Alters, die Haut ist auch nicht mehr Haut, wurde zu einer trüben Hülle, um alles nur noch ein wenig zusammenzuhalten. Henriette streifte das durchgeschwitzte Hemd ab, drehte den Hahn auf und spülte Wasser und Seife über ihren Körper, gleich hier am Waschbecken, unter die Dusche getraute sie sich noch nicht. Dann griff sie nach einem Frottiertuch, rieb sich trocken, und zog den Bademantel an, der an seinem Haken innen an der Tür hing. Nachdem sie auch noch mit dem Kamm durch ihr feuchtes Haar gefahren war, trat sie auf den Korridor hinaus. Niemand war zu sehen.
»Frau Krutisch?«
Da trat Linda schnell aus dem anderen Raum der Wohnung.
»Toll!« rief sie, »ist also gelungen! Wie gut Sie aussehen, gottlob!«
»Übertreiben Sie nicht.«
»Und kein Drehschwindel mehr? Keine Übelkeit?«
»Wie Sie sehen.«
»Kann ich Ihnen noch irgendwie helfen?«
»Nein, Linda, Sie können jetzt unbesorgt gehen, ich danke Ihnen.«
»Wie wäre es mit Kaffee? Mit einem Frühstück?«
»Bitte, Linda.« Diese Frau ist eine Klette, dachte Henriette, werde ich sie denn je wieder los? »Nebenan wartet mit Sicherheit Ihr Mann auf Sie und will frühstücken, nochmals vielen Dank, aber ich möchte jetzt wirklich wieder für mich bleiben.«
»Mein Mann ist längst zur Arbeit gegangen, die fangen früh an in seinem Betrieb. Er ist Kraftfahrzeugmechaniker.«
»Ach ja.«
Ein Gefühl der Schwäche durchdrang Henriettes Körper, die Schrecknisse dieser Nacht und ihr völlig entleerter Magen machten sich bemerkbar. Plötzlich fehlte ihr die Kraft, weiterhin darauf zu bestehen, daß Linda Krutisch sie verließ. Sie stolperte an der jungen Frau vorbei und sank auf den Sessel vor ihrem Schreibtisch. Dort stützte sie ihre Arme auf und starrte in die müden Blätter des Baumes hinaus, dem es gelungen war, zwischen den Hauswänden hochzuwachsen. Der Schreibtisch befand sich direkt am Fenster, das auf diesen Innenhof hinausführte. Sie nannte den zweiten, noch stilleren Raum ihrer Wohnung aus alter Gewohnheit ihr Arbeitszimmer, obwohl sie hier alles andere tat als zu arbeiten. Hier standen der Fernsehapparat, ein Sofa, ein wandfüllendes Bücherregal, ein kleiner Eßtisch mit zwei Stühlen, hier verbrachte sie ihr Leben, wenn sie nicht schlief.
Linda trat hinter sie.
»Klar, daß Sie müde sind«, sagte sie, »ich mache jetzt Kaffee, bleiben Sie ruhig sitzen.«
»Aber Sie –«, Henriette versuchte zu widersprechen.
»Keine Sorge, ich finde mich sicher zurecht«, unterbrach Linda sie sofort, drückte sanft ihre Schulter und begab sich in die Küche. Henriette hörte Lindas lebhafte Schritte, das Öffnen und Schließen der Küchenschränke, den Wasserstrahl im Kessel, das Klirren von Geschirr. Schließlich bedeckte Henriette ihr Gesicht aufseufzend mit beiden Händen. So dunkel sollte es sein, dachte sie, nur noch dunkel und still. Der Eifer dieser jungen Frau belästigt mich, aber sie scheint das nicht zu bemerken.
Wäre ich jetzt allein, würde ich mich auf das Sofa legen und den Fernseher aufdrehen. Höchstwahrscheinlich wäre ich auf diese Weise rasch nochmals eingeschlafen und hätte mich dann später selbst um mein leibliches Wohl kümmern können. Im Moment bin ich einfach nur geschwächt und todmüde, man sollte mich in Ruhe lassen.
»So!«
Mit diesem Ausruf stellte Linda ein Tablett auf den Eßtisch. Henriette schrak hoch, löste die Hände von ihrem Gesicht, und wandte sich um. Da dampfte Kaffee, da gab es Milch und Zucker, Brot, Butter, Honig, die junge Frau hatte in der spärlich ausgerüsteten Küche sichtlich alles entdeckt, was es zu entdecken gab.
»Wie Sie sehen, Frau Lauber, habe ich ein echtes Frühstück zusammengebracht«, sagte Linda fröhlich, »kommen Sie doch an den Tisch! Ich trinke jetzt übrigens auch gern Kaffee mit Ihnen, heute habe ich ja noch nichts im Magen!«
Das darf nicht wahr sein, dachte Henriette, jetzt bleibt diese Linda auch noch und frühstückt mit mir. Da – sie schiebt den Sessel zu sich her und setzt sich. Gern würde ich sie mit Entschiedenheit ersuchen, mich alleine zu lassen, aber ich habe jetzt nicht die Kraft dazu. Außerdem wirkt die junge Frau so zufrieden, nahezu beglückt, wenn nichts weiter als unser gemeinsames Frühstück Ursache dafür sein sollte, meinetwegen. Aber danach muß wieder Ruhe einkehren. Ruhe und Alleinsein.
Henriette mußte sich am Schreibtisch abstützen, als sie aufstand, band den Bademantel fester um ihre Taille, ging vorsichtig und langsam die wenigen Schritte zum Tisch hin und setzte sich.
»Gleich geht es Ihnen besser«, sagte Linda. Sie teilte Tassen und Teller aus und goß dann Henriette und sich selbst Kaffee ein. »Milch? Zukker?« Henriette nickte wortlos und Linda gab ihr von beidem. »Ein Honigbrot?« Wieder wortloses Nicken. Linda bestrich eine Scheibe Vollkornbrot mit Butter und Honig und ließ sie mit einem liebenswürdigen »Bitte!« auf Henriettes Teller gleiten. Alles tat sie lächelnd und mit Lebhaftigkeit, sie wirkte, als mache dieses improvisierte Frühstück ihr selbst unverhofft Freude.
Henriette trank in langsamen Schlucken vom Kaffee und fühlte seine belebende Wärme und Süße sich in ihrem geschwächten Körper ausbreiten. Als sie danach zum Honigbrot griff und einen Bissen davon nahm, fragte Linda sofort: »Schmeckt es?«, und Henriette nickte kauend.
Ich benehme mich wie ein Kleinkind, dachte sie. Oder in meinem Fall eher wie eine hinfällige Greisin. Das kommt davon, wenn man sich gegen seinen Willen betreuen läßt, nach diesem Frühstück werde ich mich bei der jungen Frau nochmals bedanken und sie dann mit aller Entschiedenheit und für immer hinauskomplimentieren. Nachts ging es mir wirklich schlecht, aber noch bin ich ja nicht hinfällig. Noch möchte und kann ich mein Leben alleine meistern.
Linda hatte mit Appetit in ein ebenfalls mit Butter und Honig bestrichenes Brot gebissen.
»Eigentlich ist es schön, gemeinsam zu frühstücken, finden Sie nicht?« sagte sie.
Henriette schwieg. Um Gottes willen nein, dachte sie.
»Mein Mann hält nichts davon«, fuhr Linda fort, »wochentags ist er immer ganz früh weg, und wenn er frei hat, geht er am Morgen lieber allein joggen.«
»Wo joggt er denn da?« fragte Henriette, um irgend etwas zu einem Gespräch beizutragen, »doch sicher nicht hier, nur Asphalt und Autos rundherum –«
»Es gibt doch den Kanal mit einem Uferweg bis hin zu den Flußwiesen, sogar ein paar Bäume und Büsche gibt es dort. Da laufen sie alle, die Jogger. Waren Sie noch nie dort?«
»Ich jogge nicht«, sagte Henriette.
Linda starrte sie an, und lachte dann auf.
»Da staune ich aber, Frau Lauber!«
»Schade, nicht wahr? Wo ich doch dermaßen prädestiniert wäre fürs Joggen!«
Henriette wußte selbst nicht, woher ihr Sarkasmus kam, aber sie schob die Ärmel ihres Bademantels bis über die Ellbogen hoch, wies mit dem Stolz eines Bodybuilders auf ihre alten, dünnen Arme und deren welke Haut.
»Bitte sehr!« rief sie.
Linda stutzte.
Dann begannen beide Frauen zu lachen. Daß eine vergleichsweise geringfügige Ursache dieses Gelächter hervorrief, lag wohl an beider labilem körperlichen Zustand. Schließlich hatten sie eine weitgehend schlaflose Nacht hinter sich.
Henriette verstummte plötzlich. Sie lehnte sich im Sessel zurück und schloß die Augen. War das wieder ein beginnender Drehschwindel oder nur Schwäche? Rote Ringe kreisten hinter ihren Augenlidern, ihr Körper schien ins Unermeßliche hinabzusinken.
»Was ist? Geht es etwa wieder los?«
Auch Linda hatte abrupt aufgehört zu lachen und starrte Henriette über den Tisch hinweg besorgt an.
»Ich glaube nicht«, murmelte Henriette, »hab nur zu heftig gelacht, glaube ich.«
»Ja, blöd waren wir. Blöd war vor allem ich, ich hätte diesen Lachanfall nicht zulassen sollen, verzeihen Sie, Frau Lauber.«
»Lachen ist etwas Schönes, Linda«, sagte Henriette mit immer noch geschlossenen Augen, »ich habe lange nicht mehr gelacht, wissen Sie.«
»Aber Sie sollten sich erst ganz und gar erholen, dann kann ja gern wieder gelacht werden.«
Henriette öffnete die Augen. Sie sah in das Gesicht der jungen Frau, sah ihren wachsamen Blick, sah das leichte Lächeln. Diese Linda schaut mich tatsächlich mit Freundlichkeit an, dachte Henriette, so selten schauen Menschen freundlich. Und sie ist recht hübsch. Hat wunderschönes langes Haar.
»Hab ich was im Gesicht?« fragte Linda, »nur, weil Sie mich so streng anschauen, Frau Lauber.«
»Ich schau doch nicht streng.«
»Doch, ein bißchen. Aber macht nichts.«
»Mir ist aufgefallen, daß du schöne Haare hast.«
»Ha!« rief Linda, »Sie haben du gesagt!«
»Verzeihung«, sagte Henriette, »ist mir so herausgerutscht.«
»Bleiben Sie bitte dabei, es freut mich.«
Henriette schwieg. Wobei soll ich bleiben, dachte sie, jetzt wird’s Zeit, daß wir uns trennen, ich muß die junge Frau nach Hause schicken.
»Ist wirklich nichts passiert? Sind Sie okay?« fragte Linda.
»Mir geht es gut«, sagte Henriette, »Sie müssen jetzt gehen.«
»Nur eine Frage – heißen Sie wirklich Henriette, Frau Lauber?«
Linda hatte beide Unterarme auf den Tisch gelegt, sich interessiert vorgebeugt, und schien die Aufforderung, zu gehen, überhört zu haben. Jedenfalls machte sie keinerlei Anstalten, den Tisch zu verlassen.
»Warum soll ich so nicht heißen? Steht doch so an meiner Tür.«
»Ich weiß – nur, weil das so ein komischer Name ist, einer mit vielen Zacken. Nicht so, wie Sie sind.«
»Finden Sie?«
»Nun ja, irgendwie so – ja, gezackt, wie ein Zaun, wirkt der Name für mich. Während Sie –«
»Lassen Sie’s gut sein. Und schön ist mein Name ja wirklich nicht.«
»Das meine ich nicht!« rief Linda, »ist ein schöner Name, nur –«
»Ist eben ein altmodischer Name, Linda, und das stört sie wohl. Ich weiß auch nicht genau, warum man mir gerade den gegeben hat. Vielleicht, um mich in einer Zeit, wo alle Heidrun, Sieglinde, Erika, Ingrid und so weiter genannt wurden, völlig unpassend zu benennen. Er paßte ganz und gar nicht ins Nazireich, mein Name, und da meine Eltern auch nicht dorthin gepaßt haben, sondern emigrieren mußten, verstehe ich diese Wahl denn doch irgendwie.«
»Sie sind im Ausland geboren?«
»Nein, noch hier, aber als Kleinkind kam ich nach England und bin dort aufgewachsen.«
»Und warum sind Sie jetzt nicht mehr in England?«
»Weil auch meine Eltern aus London wieder hierher zurückgekommen sind, einige Jahre nach dem Krieg.«
»Wie alt waren Sie da?«
»Fünfzehn.«
»Und haben Sie da nur Englisch gesprochen?«
»Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ich konnte ohne Probleme an einem hiesigen Gymnasium maturieren.«
»Ich habe leider keine Matura machen können«, sagte Linda, »nach der Hauptschule mußte ich gleich Lehrling bei einem Friseur werden.«
Sie sah plötzlich traurig vor sich hin, ein verborgener Kummer schien bei dieser Feststellung wach geworden zu sein.
»Ach ja«, murmelte Henriette. Jetzt bitte nicht weiter unsere Lebensgeschichten ausbreiten, dachte sie, jetzt Schluß machen, es geht mir nicht gut.
»Ich wurde aber prima ausgebildet und hatte sogar eine Zeitlang einen eigenen Frisiersalon.«
»Ist doch toll.«
»War nicht so toll.«
»Ach nein?«
»Nein. Drum hab ich dann den Helmut Krutisch geheiratet.« Jetzt lachte Linda wieder. »Auch nichts Tolles, aber man lebt.«
»Wie alt sind Sie denn?« fragte Henriette.
»Siebenunddreißig«, sagte Linda.
»Schönes Alter«, erwiderte Henriette noch.
Dann aber fühlte sie, wie ein Schauer durch ihren Körper fuhr, es war, als fröre sie trotz der Hitze. Sie rappelte sich hoch und taumelte die wenigen Schritte zum Sofa, auf das sie niedersank und regungslos liegenblieb.