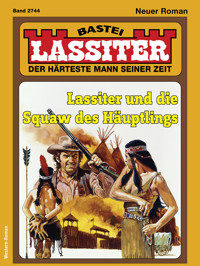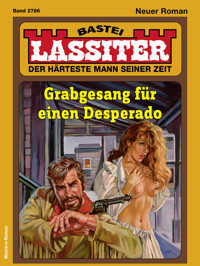Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Stunde der Apachen: 12 Romane einer großen Western-Saga Von Pete Hackett Dieser Band enthält die Romane 1-8 der Apachen-Saga "Chiricahua" sowie deren Fortsetzung, die Bände 1-4 der "Chochise-Saga. Zusammengenommen ein einzigartiger historischer Western-Epos, wie es ihn kein zweites Mal gibt. Der Autor Pete Hackett schildert darin das dramatische Schicksal des Apachenvolkes so wirklichkeitsnah und spannend, wie es bis dahin niemandem gelungen ist. Historische Genauigkeit verbindet er mit sprachlicher Wucht. Mit seinem großen 8bändigen Epos "Chiricahua - Die Apachen-Saga" beeindruckte Pete Hackett die Freunde des historischen Western-Romans. Doch das Schicksal der Apachen ließ ihn nie los. So ließ er mit "DIE CHOCHISE-SAGA" eine Fortsetzung und Ergänzung folgen, nämlich die Geschichte von Cochise, dem Häuptling der Chiricahua-Apachen... Folgen Sie Pete Hackett, diesem einmaligen Kenner der Geschichte des Westens in dieses einzigartige Abenteuer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1688
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Stunde der Apachen: 12 Romane einer großen Western-Saga
Pete Hackett
Published by Alfred Bekker, 2020.
Inhaltsverzeichnis
Title Page
Die Stunde der Apachen: 12 Romane einer großen Western-Saga | Von Pete Hackett
COPYRIGHT
Chiricahua Sammelband | Band 1 – 8 | Western von Pete Hackett | Über den Autor
Band 1 | Apachenhass
Band 2 | Die Spur führt nach Mexiko
Band 3 | Die Saat des Hasses
Band 4 | Mit Blut geschrieben
Band 5 | In tödlicher Mission
Band 6 | Ausgestoßen und gehetzt
Band 7 | Die Gejagten der Sierra Madre
Band 8 | Die Fährte der Hoffnungslosen
Die Cochise Saga Teil 1 bis 4 | Sammelband | von Chiricahua-Autor Pete Hackett | Nach Chiricahua 1 bis 8 jetzt die große Saga um den Apachen-Häuptling
Band 1
Band 2
Band 3
Band 4
Über den Autor
Further Reading: 10 Extra Western Januar 2020: Sammelband
About the Publisher
Die Stunde der Apachen: 12 Romane einer großen Western-Saga
Von Pete Hackett
––––––––
Dieser Band enthält die Romane 1-8 der Apachen-Saga „Chiricahua“ sowie deren Fortsetzung, die Bände 1-4 der „Chochise-Saga.
Zusammengenommen ein einzigartiger historischer Western-Epos, wie es ihn kein zweites Mal gibt.
Der Autor Pete Hackett schildert darin das dramatische Schicksal des Apachenvolkes so wirklichkeitsnah und spannend, wie es bis dahin niemandem gelungen ist. Historische Genauigkeit verbindet er mit sprachlicher Wucht.
Mit seinem großen 8bändigen Epos "Chiricahua - Die Apachen-Saga" beeindruckte Pete Hackett die Freunde des historischen Western-Romans.
Doch das Schicksal der Apachen ließ ihn nie los. So ließ er mit "DIE CHOCHISE-SAGA" eine Fortsetzung und Ergänzung folgen, nämlich die Geschichte von Cochise, dem Häuptling der Chiricahua-Apachen... Folgen Sie Pete Hackett, diesem einmaligen Kenner der Geschichte des Westens in dieses einzigartige Abenteuer.
COPYRIGHT
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author / Cover Firuz Askin
© dieser Ausgabe 2020 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Chiricahua Sammelband
Band 1 – 8
Western von Pete Hackett
Über den Autor
Unter dem Pseudonym Pete Hackett verbirgt sich der Schriftsteller Peter Haberl. Er schreibt Romane über die Pionierzeit des amerikanischen Westens, denen eine archaische Kraft innewohnt - eisenhart und bleihaltig. Seit langem ist es nicht mehr gelungen, diese Epoche in ihrer epischen Breite so mitreißend und authentisch darzustellen.
Mit einer Gesamtauflage von über zwei Millionen Exemplaren ist Pete Hackett (alias Peter Haberl) einer der erfolgreichsten lebenden Western-Autoren. Sein Lektor Peter Thannisch: "Pete Hackett ist ein Phänomen. Seine Western sind mannhaft und von edler Gesinnung."
Hackett ist auch Verfasser der neuen Serie "Der Kopfgeldjäger".
––––––––
Ein CassiopeiaPress E-Book
© by Author
© 2012 der Digitalausgabe 2012 by AlfredBekker/CassiopeiaPress
www.AlfredBekker.de
Band 1
Apachenhass
Colonel Loyd McIntosh führte die Verhandlungen. Eine Delegation begleitete ihn. Es waren Angehörige der Armee sowie einige weiße Händler und zwei Politiker, die die Interessen der Apachen in Washington vertraten. Ihre Namen waren John Olson und Todhunter Blake.
Victorio war mit einigen Unterhäuptlingen erschienen.
Das Sternenbanner, das gehisst worden war, hing schlaff an dem von Regen und Hitze gekrümmten Mast und bewegte sich träge im Wind. Im Schatten einer Korkeiche stand ein großes Zelt. In einem Seilcorral tummelten sich etwa zwei Dutzend Armeepferde. Männer in blauen Uniformen und mit Karabinern patrouillierten. Misstrauische Indianeraugen beobachteten sie. Die Fronten hatten sich verhärtet. Der Friede stand auf der Kippe ...
Es war heiß. Die Sonne setzte Mensch und Tier zu, saugte ihnen regelrecht das Mark aus den Knochen. Wie eine zerlaufende Scheibe aus Weißgold stand das Gestirn am Firmament, fast senkrecht über den Vertretern der beiden Rassen.
Das Treffen fand am Frenchs Arroyo, einem kleinen Fluss südlich des Zuni-Plateaus statt.
Die Delegierten saßen oder standen im Kreis herum. Der Colonel hatte auf einem zusammenklappbaren Feldstuhl Platz genommen. Die Indianer hockten am Boden. Vögel zwitscherten, Bienen summten in den Sumac-Dickichten und über den Feldern blühenden Salbeis. Die Gesichter der Indianer waren unbewegt.
Jetzt erhob Victorio das Wort und sagte laut, mit klarer Stimme: »Das Land, auf dem wir leben, ist gut. Es ist fruchtbar, und es gibt Wild, das wir jagen können. Wir haben ausreichend Wasser, und unsere Tiere gute Weidegründe. Warum sollen wir das Land verlassen? Es ist uns zugesichert.«
»Der Weiße Vater in Washington möchte das so«, erwiderte der Colonel mit Bedacht. »Er möchte, dass ihr in die White Mountain Reservation zurückkehrt.« Der Colonel machte eine kurze Pause, um seine Worte wirken zu lassen. Dann fuhr er mit erhobener Stimme fort: »Du weißt sicher, dass ihr euch widerrechtlich hier befindet. Niemals hättet ihr die White Mountain Reservation verlassen dürfen, um nach Ojo Caliente zu gehen.«
»Das Land in White Mountain ist schlecht«, versetzte Victorio. Seine Hand fuhr wegwerfend durch die Luft; eine Geste, die nichts als Geringschätzung zum Ausdruck bringen sollte. »Es gibt dort nur Staub, Sand und Steine. Klapperschlagen, Eidechsen und Skorpione treiben in San Carlos ihr Unwesen. Mögen andere Häuptlinge einverstanden sein mit den Verhältnissen dort. Wir -« der Häuptling schlug sich mit der Faust vor die Brust, »- wollen nicht dorthin.«
»Ihr müsst!« Der Colonel stieß es mit aller Härte hervor, seine Stimme duldete keinen Widerspruch. Er hatte seine Weisungen, und diese galt es hier durchzusetzen. Auf Biegen und Brechen.
»Wir sind in diesem Land geboren«, erwiderte Victorio kehlig. »Es ernährt uns. Hier können wir in Frieden leben. Warum will man uns nach San Carlos zurückbringen? Wir nehmen in Ojo Caliente niemandem etwas weg. Lasst unsere Kinder in dem Land aufwachsen, in dem auch ihre Väter und Vorväter aufgewachsen sind.«
»Es geht nicht, Victorio. Der Befehl, euch nach San Carlos in das White Mountain Reservat zurückzubringen, ist unwiderruflich. Wenn ihr nicht freiwillig geht, wird man euch deportieren. Warum willst du, dass wir Gewalt anwenden? Das Land um Fort Wingate müsst ihr verlassen. Da führt kein Weg dran vorbei. Also warum nicht in Frieden?«
Victorio erhob sich. Sein Gesicht war wie aus Granit gemeißelt. Strähnig fielen die langen Haare über seine Schultern. Er hatte sich ein rotes Tuch um den Kopf gebunden. Bekleidet war er mit einem Baumwollhemd, einer gelben, zerschlissenen Leinenhose sowie kniehohen Mokassins aus weichem Leder. »Ihr könnt unsere Frauen und Kinder mit euren Wagen fortbringen«, stieß er grimmig hervor. »Meine Männer und ich gehen nicht.«
Ein Schatten schien über das Gesicht des Colonels zu huschen. »Ist das dein letztes Wort, Häuptling?«
»Mein letztes, Nantan.«
»Dann habt ihr euch selbst zuzuschreiben, was kommt. Himmel, warum seid ihr Kerle bloß so stur? Habt ihr denn nicht aus euren Niederlagen gelernt?« Die Stimme des Offiziers hatte zuletzt nahezu beschwörend geklungen.
»Wir gehen nicht.«
Jetzt erhoben sich auch die Unterhäuptlinge. Finster musterten sie die Weißen. Ihre Mienen waren verschlossen. Keiner von ihnen wollte in das White Mountain Reservat zurück. Vor einem Jahr hatten sie es verlassen, nachdem sie von dem Agenten dort betrogen worden waren. Man hatte von ihnen verlangt, Mais und Weizen anzubauen. Doch das Land war kaum ertragreich. Als sie White Mountain verließen, nahmen aus den Corrals des Reservats Pferde und Maultiere mit. Apachenpolizei folgte ihnen und nahm ihnen das Diebesgut wieder ab, ließ sie aber weiterziehen. So gelangten sie in das ihnen angestammte Gebiet um Fort Wingate ...
»Dann wird man euch zwingen!«, versicherte Colonel McIntosh.
»Enju – gut. Man wird es versuchen. Aber lieber sterben wir im Kampf, als dass wir in White Mountain langsam verhungern.«
Victorio machte abrupt kehrt und ging zu den Pferden, die etwas abseits an Büschen festgebunden waren. Seine Begleiter folgten ihm. Sie banden die Tiere los, schwangen sich auf ihre Rücken, zerrten wortlos die Pferde herum und ritten an.
Die Weißen blickten ihnen mit gemischten Gefühlen hinterher.
»Man sollte Victorio einsperren und seine Mimbres zwingen, nach White Mountain zu gehen«, sagte einer der Armeevertreter mit gepresster Stimme. »Wenn wir ihm nicht zeigen, wer die Herren im Lande sind, tanzt er uns bald auf der Nase herum.«
»Warten wir ab, was er tut«, knurrte der Colonel. »Wir siedeln jedenfalls seinen Stamm nach San Carlos um. Und wenn sich die Rothäute dagegen auflehnen, dann wenden wir Gewalt an. Die Umsiedlung hat auf jeden Fall zu erfolgen.« Es klang abschließend und endgültig.
»Das kann einen neuen Krieg geben«, verlieh dennoch ein Mann in Wildlederkleidung seiner Befürchtung Ausdruck. An seinem Gürtel hing rechts ein Holster mit einem schweren Armee-Revolver, an seiner linken Hüfte steckte ein schweres Messer in einer mit Nieten und Stickereien verzierten Scheide. Er hatte die Delegation der Weißen zum Frenchs Arroyo geführt. Seine Worte klangen wie eine düstere Prophezeiung ...
*
Fort Wingate, September 1878.
Der Herbst nahte. Man nannte diese Jahreszeit den Indianersommer. Die Tage waren nicht mehr so heiß, und in den Nächten war es schon ziemlich kühl. Zwei Dutzend Reiter waren angetreten. Die Männer hielten ihre Pferde an den Zaumzeugen fest. Die Tiere prusteten, peitschten mit den Schweifen und stampften mit den Hufen. Hin und wieder war helles Wiehern zu vernehmen. Gebissketten klirrten.
Colonel McIntosh trat vor die Gruppe hin. Major Martin Garretson legte die Hand an den Hut und sagte: »Patrouille angetreten, Sir. Wir sind zum Abmarsch bereit.«
Der Colonel erwiderte den Gruß, dann rief er: »Gott sei mit Ihnen, Männer. Jeder von Ihnen weiß, um was es geht. Es gilt, eine Bande aufrührerischer Apachen zu finden, sie festzunehmen und zu veranlassen, nach San Carlos zu gehen. Es kann gefährlich werden, Männer. Aber Sie sind gut ausgebildet. Jeder von Ihnen hat genügend Erfahrung mit den Apachen. Ich wünsche jedem von Ihnen, dass er gesund und heil nach Fort Wingate zurückkehrt.«
»Danke, Sir!«, riefen die Kavalleristen wie aus einem Mund.
»Sie können fortfahren, Major«, sagte der Colonel.
»Lassen Sie aufsitzen, Lieutenant!«, befahl Garretson.
»Jawohl, Sir!« Lieutenant Tyler Whitlock salutierte, dann ließ er seine Stimme erklingen: »Mount up!«
Die Kavalleristen schwangen sich in die Sättel. Die Pferde tänzelten. Mit eisernen Fäusten bändigten sie die Soldaten.
»Auf Wiedersehen, Sir«, sagte der Major. »Wir werden in spätestens einem Monat zurückkehren. Hoffen wir, dass uns Erfolg beschieden ist.«
»Auf Wiedersehen, Major. Hals- und Beinbruch.« Der Colonel reichte dem Major die Rechte, dieser schüttelte sie, dann ging er zu seinem Pferd und stieg auf.
Lieutenant Whitlock war inzwischen aufgesessen. Als der Major sich im Sattel zurechtgerückt hatte, rief er: »Rechts um!«
Die Pferde wurden herumgezogen. Die Kavalleristen bildeten Dreierreihen.
»Fall in!«, ertönte Whitlocks Stimme.
Die Truppe setzte sich in Bewegung. Voraus ritten drei indianische Scouts. Ihnen folgten der Lieutenant und ein Sergeant, dann kamen die Trooper. Der Major ritt an der Seite des kleinen Zuges.
Im klirrenden Trab verließen sie das Fort. Kameraden winkten ihnen hinterher. Niemand beneidete diese Männer. Auf sie wartete das Fegefeuer, vielleicht sogar die Hölle. Sie zogen nach Süden. Um sie herum war nur totes Land, Felswüste, Staub und dorniges Gestrüpp; Comas und Mesquitesträucher. Das Gebiet war trocken und zerklüftet wie eine Mondlandschaft. Weit im Süden ragten die Zinnen und Grate der Zuni Mountains in ein Meer aus weißen Wolken hinein.
Es war früh am Morgen. Die Sonne stand noch weit im Osten. Gleißendes Licht lag auf den Flanken der Hügel und den Ostwänden der Felsen. Die Pferdehufe wirbelten Staub auf. Staub kroch unter die Uniformen, scheuerte auf der Haut und knirschte bald zwischen den Zähnen der Reiter, puderte ihre blauen Uniformen und verklebte ihre Poren.
Victorio war mit einer großen Gruppe von Kriegern aus Ojo Caliente geflohen. Man vermutete, dass sich die Apachen in den Mimbres Mountains verkrochen hatten. Der Befehl lautete, Victorio und die Unterhäuptlinge festzunehmen und die Apachen zu zwingen, ins Reservat bei Fort Wingate zurückzukehren, von wo aus sie den Marsch ins Arizona-Territorium nach San Carlos antreten sollten.
Die Agentur, die sich am Zusammenfluss des San Carlo River und Gila River befand, war sogar bei den Offizieren der Armee verhasst. Einer von ihnen beschrieb sie als einen kiesbedeckten Landstrich, der sich etwa zehn Meter über dem Flussbett hinzog ... >Darauf standen da und dort die graubraunen Ziegelbauten der Agentur. Dürre, vertrocknete, fast blattlose Baumwollsträucher säumten die Flüsse. Regen war so selten, dass er einem, wenn er einmal fiel, fast wie ein Naturwunder erschien. Fast ständig fegten trockene, heiße, Staub aufwirbelnde Winde über die Ebene und entblößten sie jeglicher Vegetation. Im Sommer empfand man eine Temperatur von über 40 Grad im Schatten als kühl. Zu allen anderen Jahreszeiten schwärmten Millionen von Fliegen, Mücken und unbekannten Käfern umher ...<
Das war San Carlos. Zwei Armeeposten, Fort Apache und Fort Thomas, wachten über den Frieden in dem Reservat.
Meile um Meile ging es nach Süden. Die Scouts ritten voraus und erkundeten den besten Weg. Eine Straße gab es nicht. Es ging durch Schluchten, vorbei an übereinander getürmten Felsblöcken, über windige Plateaus, zwischen Felsen und Geröllhängen hindurch. Es war ein Land, in dem man aus den Lektionen, die es einem erteilte, entweder schnell lernte, oder in einem namenlosen Grab verschwand.
Am Mittag lagerten die Soldaten. Sie befanden sich am Rio Pescado. Die Kavalleristen tränkten ihre Pferde, dann wuschen sie sich Staub und Schweiß aus den Gesichtern. Schließlich aßen sie Pemmikan, den sie in den Satteltaschen mit sich führten. Major Garretson hatte darauf verzichtet, einen Küchenwagen mitzunehmen. In diesem Irrgarten aus Felsen, Schluchten, Arroyos und sandigen Hügeln wären sie mit einem schwer manövrierbaren Fuhrwerk nur schlecht vorwärts gekommen und hätten weite Umwege in Kauf nehmen müssen. Also waren sie auf das angewiesen, was sie in den Satteltaschen mit sich führten und was ihnen die Natur bot.
Der Major hatte eine Karte am Boden ausgebreitet. Er, Lieutenant Whitlock und Sergeant Burmester waren darüber gebeugt. Es gab zwischen Fort Wingate und den Mimbres Mountains keine Ortschaft, sondern nur Wüste. Sie rechneten damit, dass sie fünf Tage benötigten, um in die Berge zu gelangen, in denen sie Victorio und seine Anhänger vermuteten. Dies, nachdem Kunde nach Fort Wingate gelangt war, wonach die Apachen auf ihrem Weg nach Süden Farmen und Ranches überfallen hatten. Und im Süden lagen die Mimbres Mountains, ein unwegsames, menschenfeindliches Gebiet.
»Morgen Abend sind wir am Frenchs Arroyo«, meinte der Major. »Übermorgen erreichen wir die Mangas Mountains. Am Abend des vierten Tages kommen wir am Beaver Creek an, und vierundzwanzig Stunden später werden wir in den nördlichen Ausläufern der Mimbres Mountains sein.«
Whitlock nickte. »Und dann beginnt unsere eigentliche Aufgabe. Es gibt in den Mimbres Mountains tausend Verstecke, in denen sich die Apachen verkriechen können. Ihre Späher werden uns ausmachen.«
Der Lieutenant war ein großer, geschmeidiger und dunkelhaariger Mann, der Ruhe ausstrahlte, der Sicherheit verlieh und zu dem man sofort Vertrauen fassen konnte. Sein Gesicht war hohlwangig und wurde von einem blauen Augenpaar beherrscht. Seine Lippen waren schmal, ohne brutal zu wirken, sein Kinn war eckig, was Härte und Energie verriet, seine Haltung war aufrecht, in seinen Zügen lag Kampfgeist. Er war gewiss ein energischer, willensstarker Mann, der sich durchzusetzen vermochte.
»Victorio wird uns sicherlich angreifen«, sagte der Major im Brustton der Überzeugung. Doch ihm entging nicht Whitlocks zweifelnder Blick, und er fragte: »Oder sind Sie der Meinung, dass er sich zurückhält und vielleicht sogar flieht?«
Der Major schaute den Lieutenant fragend an.
»Ich denke nicht, dass er flieht«, meinte an Stelle des Lieutenants der Sergeant. »Seine Gruppe Krieger ist dreimal so stark wie wir. Ich schätze, dass er uns angreift, sobald er uns ausmacht.«
»Dessen bin ich mir nicht so sicher«, wandte Whitlock ein. Er sprach abgehackt. »Die Apachen sind schlecht bewaffnet. Man hat ihnen so ziemlich alles an Waffen abgenommen, nachdem sie vor über einem Jahr San Carlos verlassen haben. Das Land fordert sicherlich einen hohen Tribut von ihnen. In den Mimbres Mountains haben Eidechsen und Schlangen kaum eine Chance ...«
»Selbst in einem solchen Gebiet sind die Apachen noch in der Lage, ihr Leben zu fristen«, versetzte Sergeant Burmester.
»Victorio ist ein Stratege«, fuhr Whitlock fort. »Ich denke, dass er zunächst keinen Feindkontakt sucht, sondern dass er uns ausweicht und an der Nase herumführt, bis sich ihm eine günstige Gelegenheit bietet.«
»Sie haben eine hohe Meinung von der Kriegskunst dieses Wilden, Lieutenant, wie?«, schnarrte der Major.
»Er ist gefährlich«, versetzte Whitlock. »Wir dürfen ihn auf keinen Fall unterschätzen...«
»Sie meinen, ihm ist jeder Ehrenkodex fremd!«, stieß der Major hervor. »Die Apachen sind wie die wilden Tiere.« Er verbesserte sich. »Nein. Wilde Tiere töten um zu überleben. Die Apachen töten um des Tötens Willen.«
Sekundenlang herrschte betroffenes Schweigen. Doch dann ergriff Whitlock wieder das Wort. »Wenn sich ein Apache bereit erklärt, zu kämpfen, dann ist das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.«
»Ich wünsche, dass er uns angreift«, knurrte der Major. »Dann werden wir ihm die heilige Mannesfurcht beibringen. Wie Sie richtig bemerkten, Lieutenant, sind die Apachen nur unzureichend bewaffnet. Aufgrund ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit jedoch denke ich, dass sie uns attackieren werden. Und dann ...«
Der Major brach ab und schnippte mit Daumen und Mittelfinger. Eine Geste, viel sagend genug, um weitere Worte überflüssig zu machen - und erschreckend war in ihrer Unmissverständlichkeit.
Einer der Scouts kam zurück. Er meldete, dass das Land nach Süden bis zu den Lava Beds frei sei, dass also kein Hinterhalt zu befürchten war.
Nach einer Stunde Rast brach die Patrouille wieder auf.
*
Es war Nacht. Der Himmel war bewölkt. Mond und Sterne waren hinter einer dicken Wolkendecke verschwunden. Die kleine Farm lag in Finsternis. Kein Licht brannte. Die Zikaden zirpten im Gras. Vom Rio Grande her war das leise Rauschen und Gurgeln des Wassers zu vernehmen. Ein schraler Wind erfüllte die Nacht mit einem feinen Säuseln und ließ die Blätter im Ufergebüsch rascheln.
Eine Gruppe Reiter hielt zwischen den Hügeln die Pferde an. In der Finsternis wirkten die Gebäude der Farm wie viereckige, schwarze Kleckse. Dumpf pochten die Hufe, als die Tiere auf der Stelle traten.
Ein Hund schoss aus seiner Hütte, bis ihn die Kette bremste, und kläffte wie von Sinnen. Die Kette rasselte. Das Bellen trieb in die Nacht hinaus und wurde von den Echos wiederholt. Es klang wie eine Warnung vor Unheil und Tod.
Es dauerte nicht lange, dann wurde die Tür des Farmhauses geöffnet. Ein Mann, der eine Laterne in der Hand hielt, trat in den Hof. »Was ist denn, Odin? Still! Du weckst alle auf!« Die Stimme wurde schärfer. »Ruhe, Odin! Sei still, verdammt!«
Der Hund beruhigte sich nicht. Der Farmer ging in den Hof. Die Laterne schaukelte am Drahtbügel und quietschte leise. Licht- und Schattenreflexe huschten über den Boden. Der Mann erreichte den Hund, hob die Hand mit der Laterne und der Lichtkreis, der ihn umgab, vergrößerte sich etwas. »Still jetzt!«, fauchte der Farmer. »Da ist nichts!«
Jetzt hörte der Hund zu bellen auf. Er knurrte leise.
»So ist's brav«, grollte der Farmer und schickte sich an, ins Haus zurückzukehren.
Da kam trommelnder Hufschlag auf. Die Erde schien zu erbeben. Einen Augenblick lang war der Farmer wie gelähmt, zu keiner Reaktion fähig. Als er schließlich die Reiterschemen in einer weit auseinander gezogenen Linie näherdonnern sah, kam Leben in seine Gestalt.
»Alarm!«, brüllte er mit sich überschlagender Stimme. »Wir werden angegriffen!« Er rannte los und verschwand im Haus, warf die Tür hinter sich zu. Der Hund begann wieder wie von Sinnen zu bellen.
Es waren zwei Dutzend Reiter, die auf die Farm zustoben. Erste Schüsse krachten. Die Blendläden vor den Fenstern des Farmhauses wurden aufgestoßen. Mündungsfeuer leckten durch die Nacht, die Detonationen vermischten sich zu einem einzigen, lauten Knall, der auseinander rollte und über den Hügeln zerflatterte. Aufbrüllend antworteten die Echos.
Mit einem kläglichen Winseln verstummte der Hund. Die Apachen ritten im Kreis um die Gebäude der Farm herum. Heißes Blei fegte den einen oder anderen Pferderücken leer. Staub wirbelte nebelhaft, Pulverdampf vermischte sich damit. Immer wieder peitschten Schüsse. Einige Indianer sprangen von den Pferden und stürmten, Tomahawks und Kriegskeulen schwingend, in das Farmhaus.
Sehr schnell war alles vorbei. Der Farmer, seine Frau und zwei Farmhelfer wurden niedergemacht. Die Indianer trieben Schafe, Ziegen, eine Milchkuh und zwei schwere Kaltblüter aus den Stallungen. Dann holten sie aus dem Haus, was sie brauchen konnten, vor allen Dingen Kleidung für den Winter, und dann zündeten sie die Farm an. Bald schlugen die Flammen aus den Fenstern und Türen und leckten an den Außenwänden in die Höhe. Das alte, ausgetrocknete Holz brannte wie Zunder. Funken stoben, Aschefetzen wirbelten, das Feuer machte bald die Nacht zum Tage. Die Gebäude brannten wie Scheiterhaufen. Dichter Rauch quoll in die Höhe, wurde vom sanften Westwind über den Fluss getrieben und zerpflückt. Brenzliger Geruch breitete sich aus.
Die Apachen ritten fort und trieben die erbeuteten Tiere mit sich. Ihre Toten und Verwundeten nahmen sie mit.
Zurück blieb ein Werk der Zerstörung. Krachend und berstend brachen die ersten Dächer ein. Hoch schlugen die Flammen. Sie kündeten vom Irrsinn brutaler Gewalt. Wie ein mahnend erhobener Zeigefinger ragte bald nur noch der gemauerte Kamin des Farmhauses aus den kreuz- und querliegenden, verkohlten Brettern und Balken, wie ein Mahnmal an die Vergänglichkeit ...
*
Las Cruses, September 1878. Die Stadt am Rio Grande war eine Ansammlung von Häusern und Hütten und nur vierzig Meilen von El Paso entfernt. Am Ortsrand gab es Pferche und Corrals, in denen sich Schafe, Ziegen und Kühe tummelten. Der Geruch von Tierkot und Urin hing in der Luft. Die Hauptstraße des Ortes war breit und staubig. Die Häuser waren ohne besondere Ordnung errichtet worden. Aber es gab alles, was eine Stadt ausmachte; einen Store, einen Saloon, eine City Hall, ein Hotel, einen Mietstall und eine Kirche. Sie war im spanischen Stil erbaut worden, wie überhaupt die ganze Stadt einen mexikanischen Einschlag aufwies. Viele Häuser waren aus Adobeziegeln gemauert, an Stelle von Gartenzäunen hatte man hüfthohe Mauern errichtet, in der Ortsmitte gab es einen Brunnen inmitten einer Gruppe von Bäumen.
Der Ort vermittelte Ruhe und Frieden. Kinder spielten am Straßenrand, Hunde lagen in den Schatten, einige Frauen standen beim Store zusammen und unterhielten sich. Beschaulichkeit - das war der Eindruck, den die Stadt vermittelte.
Ein Rudel Reiter kam in die Stadt. Es waren sieben Männer. Die Hufe ihrer Pferde rissen kleine Staubfahnen in die warme Luft. Die Kerle waren stoppelbärtig, Staub und Schweiß verklebte die Gesichter und das Fell der Pferde, sie trugen die Hüte tief in der Stirn und waren allesamt bewaffnet. In den Holstern steckten schwere Revolver, in den Scabbards moderne Gewehre.
Sie lenkten ihre Pferde zum Brunnen und saßen ab. Sattelleder knarrte, ein Pferd wieherte, einer der Männer sagte staubheiser: »Verdammtes Land. Es muss der Satan persönlich geschaffen haben.«
Die Winde quietschte, als einer der Kerle einen Eimer voll Wasser in die Höhe hievte. Er stellte ihn auf den Brunnenrand. Am Balken des Gewindes hing an einem rostigen Nagel eine Schöpfkelle. Die Reiter tranken. Ihre Augen waren entzündet, die Lider gerötet. Staub rieselte von den Krempen ihrer Hüte und ihren Schultern. Sie trugen lange, zerschlissene Mäntel.
Dann wuschen sich die Kerle die Gesichter und zuletzt tränkten sie die Pferde. Einer von ihnen löste sich aus dem Pulk und ging hinüber zur City Hall, die eigentlich nur ein flacher Bau mit einer falschen Fassade war, in der sich das Büro des Bürgermeisters und des Sheriffs befand, und in der es kleinen Saal für Versammlungen des Bürgerrates gab.
An einem Anschlagbrett neben der Tür des Gebäudes hingen amtliche Bekanntgaben und Steckbriefe. Der Bursche studierte sie. Er war ungefähr eins fünfundachtzig groß, hager, um die vierzig und sah ziemlich verwegen aus. Einen der Steckbriefe riss er kurzerhand vom Brett und kehrte zu seinen Gefährten zurück. »Tausend Dollar für die Ergreifung Victorios. Er soll sich in den Mimbres Mountains herumtreiben.«
»Also nicht weit von hier«, sagte einer. »Etwa sechzig, siebzig Meilen.«
»Das Problem ist, dass er mit fast achtzig Kriegern unterwegs ist«, sagte der Hagere. Sein Name war Scott Wilburn.
»Wer hat die Prämie ausgesetzt?«
»Die Regierung.«
Ein Mann kam näher. Er trug einen Stern. Ihm gefielen diese Kerle nicht. Sie sahen aus wie eine Horde Banditen. Der Sheriff schaute nicht begeistert drein.
Er erregte die Aufmerksamkeit der Kerle und sie wandten sich ihm zu. Leise klirrten ihre Sporen, Stiefelleder knarrte. »Sie sind auf dem Durchritt?«, fragte der Sheriff, als er das Rudel erreicht hatte und stehen geblieben war.
Wilburn nickte und erwiderte: »Ich habe den Steckbrief von Victorio abgenommen, Sheriff. Er ist tausend Dollar wert. Ist die Meldung, dass er sich in den Mimbres Mountains aufhalten soll, noch aktuell?«
Der Gesetzeshüter nickte. »Er hat eine Blutspur von Ojo Caliente bis hier in den Süden gezogen. Erst vor wenigen Tagen haben die Apachen die Hellman-Farm überfallen. Der Farmer, seine Frau und zwei Helfer wurden getötet, das Vieh wurde abgetrieben, die Farm haben diese elenden Mörder niedergebrannt. Möchten Sie sich die Prämie verdienen?«
»Warum nicht.«
»Wann werden Sie weiterreiten?«
»Das hört sich ja gerade so an, als wollten Sie uns hier nicht haben, Sheriff.«
»Das ist eine friedliche Stadt, und sie soll es auch bleiben.«
»Keine Sorge. Wir bringen keine Unruhe in dieses Nest. Sobald wir gegessen und getrunken haben, verlassen wir es wieder.«
»Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt«, knurrte der Sheriff ohne die Spur einer Freundlichkeit im Tonfall, schwang herum und stiefelte davon.
Er ging in sein Büro, zog den Schreibtischschub auf und holte ein Bündel teilweise vergilbter Steckbriefe hervor. Nach und nach schaute er den Packen durch, zwei Steckbriefe sortierte er aus. Sie waren auf zwei Männer namens Glenn Farley und Dexter Morgan ausgestellt. Der Sheriff glaubte die beiden in dem Rudel erkannt zu haben.
Er schätzte sie richtig ein. Es waren Sattelstrolche, deren Heimat dort war, wo sie gerade vom Pferd stiegen. Abenteurer, die immer wissen wollten, was sich hinter dem nächsten Hügel abspielte. Und zumindest zwei von ihnen waren Banditen.
Der Sheriff faltete die beiden Steckbriefe zusammen, schob sie in die Innentasche seiner Jacke, holte entschlossen eine Schrotflinte aus dem Gewehrschrank und lud beide Läufe. Dann verließ er das Office.
Die sieben Männer hatten ihre Pferde zum Holm beim Saloon geführt und banden sie an. Dann gingen sie in den Schankraum. Ihre Absätze weckten ein dumpfes Echo auf den Bohlen des Vorbaus und den Dielen des Fußbodens im Gastraum. Sie setzten sich an zwei der runden Tische und riefen nach Bier. Der Keeper beeilte sich, sieben Krüge vollzuschenken.
Da kam Sheriff Matt Baxter in den Gastraum. Knarrend und quietschend schlugen die Türpendel hinter ihm aus. Er machte zwei Schritte, hielt an, richtete das Gewehr auf die Kerle und sagte mit klarer, präziser Stimme: »Unter euch sind zwei Männer, die gesucht werden. Glenn Farley und Dexter Morgan. Steht auf. Ich verhafte euch im Namen des Gesetzes.«
Zwei der Kerle stemmten sich am Tisch in die Höhe. Einer sagte gedehnt: »Ich bin Glenn Farley. Was wirft man mir denn vor?« In seinen Augen war ein heimtückisches Glimmen wahrzunehmen.
»Das müssen Sie selbst am Besten wissen, Farley«, antwortete der Sheriff. »Aber ich will Ihnen gern auf die Sprünge helfen. Postkutschenüberfall und Bankraub. Na, fällt der Groschen bei Ihnen?«
Die Kiefer Farleys mahlten. Es sah aus, als kaute er einen Priem. Seine Hand stahl sich zum Knauf des Revolvers an seinem rechten Oberschenkel.
»Das ist Unsinn«, knurrte Farley. »Man beschuldigt mich zu Unrecht.«
»Das festzustellen wird Sache des Gerichts sein«, erklärte der Sheriff, und die Schroffheit seiner Worte ließ erkennen, dass er keine Lust hatte, groß zu debattieren. »Legen Sie Ihren Revolver auf den Tisch, heben Sie die Hände und kommen Sie her. Dasselbe gilt für Sie, Morgan. Und keine krummen Gedanken. Ich würde nicht zögern.«
»Wir werden hier essen und trinken«, sagte Morgan, »und dann reiten wir weiter. Sie sollten nicht versuchen, den Helden zu spielen, Sheriff. Wenn doch, reißen wir Ihnen den Blechstern von der Weste und spucken drauf.«
Die Atmosphäre im Saloon war plötzlich angespannt und explosiv, die Luft schien vor Spannung zu knistern wie vor einem schweren Gewitter. Das Rudel vermittelte einen erschreckenden Eindruck von Wucht und Stärke, von kompromissloser Härte und von kalter Entschlossenheit.
Auch Scott Wilburn erhob sich, trat einen Schritt vor und rief halblaut: »Lassen Sie die Männer in Ruhe, Sheriff. Wir haben uns entschlossen, Victorio zu jagen und zu stellen. Das muss wichtiger sein als die kleinen Gesetzesverstöße, die man meinen Freunden vorwirft.« Wilburn grinste schief.
»Gehen Sie aus der Schusslinie!«, presste der Sheriff hervor, da donnerte auch schon ein Revolver. Die Detonation drohte den Raum aus allen Fugen zu sprengen. Der Sheriff bekam die Kugel in die Schulter und wurde halb herumgerissen.
Einer der Kerle hatte gezogen und geschossen. Pulverdampf wolkte vor seinem Gesicht, aus der Mündung seines Colts kräuselte ein feiner Rauchfaden.
Der Sheriff hatte die Schrotflinte fallen lassen und presste die linke Hand gegen die zerschossene Schulter. Blut quoll zwischen seinen Fingern hervor. Der Schmerz verzerrte sein bleiches Gesicht und wühlte in seinen Zügen.
Die Kerle starrten ihn an wie ein Rudel Wölfe, das eine Beute gestellt hatte und jeden Moment über sie herfallen würde. Ohne die Spur einer Gemütsregung, mitleidlos und feindselig.
Der Sheriff wandte sich ruckartig um und verließ auf unsicheren Beinen den Schankraum. Wieder schlugen die Türpendel. Die Anspannung fiel von den Strolchen ab. Bill Latimer, der geschossen hatte, ließ den Revolver einmal um den Finger rotieren, dann stieß er ihn ins Holster. »Dieser Narr«, murmelte er. »Hat der wirklich gedacht, dass wir uns von ihm ans Bein pinkeln lassen?«
»Besitzt die Stadt eine Bürgerwehr?«, so wandte sich Wilburn an den Keeper, der wie zur Salzsäule erstarrt hinter dem Tresen stand.
Er schüttelte den Kopf. Seine Stimmbänder versagten ihm den Dienst.
Wilburn setzte sich in Bewegung, verließ den Saloon, trat draußen an das Vorbaugeländer heran und schwenkte seinen Blick die Straße hinauf und hinunter. Der Sheriff ging mitten in der Fahrbahn. Sein Blut tropfte in den Staub. Auf den Gehsteigen waren einige Passanten stehen geblieben. Wilburn schaute teilnahmslos hinter dem Gesetzeshüter her, der des Öfteren stolperte und Mühe hatte, sich auf den Beinen zu halten. Von Wilburns Gesicht war nicht abzulesen, was hinter seiner Stirn vorging. Ebenso wenig verrieten seine Augen.
Plötzlich wandte Wilburn sich um und kehrte in den Schankraum zurück. Der Keeper trug gerade die Bierkrüge zu den Tischen. Einige der Kerle hatten sich Zigaretten gedreht und rauchten. Schlieren von Tabakqualm zogen unter der Decke dahin. »Trinkt aus!«, stieß Wilburn hervor. »Wir verschwinden. Ich traue dem Frieden in diesem Nest nicht. Auch wenn es angeblich keine Bürgerwehr gibt. Es finden sich immer ein paar Narren ...«
Er verstummte viel sagend.
Die Kerle schütteten das Bier in sich hinein, und ohne zu bezahlen verließen sie den Saloon. Der Keeper wagte nicht aufzubegehren. Er war froh, das Rudel wieder los zu sein. Die Kerle banden die Pferde los, saßen auf und ritten. Niemand hinderte sie daran. Die Stadt schien den Atem anzuhalten und sich zu ducken.
*
Eine kleine Ranch am Alamosa River. Im Corral standen über zwanzig Pferde. Im Hof pickten Hühner in den Staub. Aus dem Kamin des Küchenanbaues stieg Rauch. Es war die Zeit der Abenddämmerung. Der Himmel im Westen schien in Flammen zu stehen. Rötlicher Schein lag auf dem Land. Die Schatten waren lang und scharf. Ein Ranchhelfer schob eine Karre voll Pferdemist aus dem Stall. Ein Cowboy schloss das Corralgatter. Einige Cowboys gingen zum Brunnen in der Hofmitte. Ihre Oberkörper waren nackt und sie trugen Handtücher mit sich.
Hassvolle, dunkle Augen beobachteten die Ranch. Niemand sah den Späher auf dem Hügel. Gebüsch verdeckte ihn. Die Cowboys beim Brunnen wuschen sich. Es waren vier Männer. Der Späher ahmte den Ruf eines Eichelhähers nach. Der Ruf wurde beantwortet. Dann trieben Apachen ihre Pferde hinter den Hügeln hervor, sammelten sich in einer Mulde, einige Befehle erklangen, kehlig, abgehackt, und schließlich setzte sich der Pulk in Bewegung. Schließlich schien die Erde unter nahezu hundert Pferdehufen zu erbeben, als die Krieger ihre Mustangs antrieben.
Auf der Ranch wurden Stimmen laut. Die Männer beim Brunnen rannten in die Unterkunft. Der Bursche mit der Schubkarre stellte sie ab und folgte ihnen. Aus der Scheune kam ein weiterer Mann. Auch der Cowboy beim Gatter begann zu laufen. Die Hühner stoben mit schlagenden Flügeln und vorgereckten Hälsen aufgeregt gackernd auseinander.
Die Indianer sprengten heran und sprangen im vollen Galopp von den Pferden, als sie im Ranchhof angelangt waren. Aufwirbelnder Staub hüllte sie ein. Nervenzermürbendes, durchdringendes Kriegsgeschrei erschallte, Tomahawks und Keulen schwingend drangen die Krieger in die Gebäude ein. Schüsse krachten. Todesschreie erklangen. Indianer und Weiße starben. Der Tod war wieder einmal unersättlich in seiner Gier.
Stille hatte sich wie ein Leichentuch zwischen die Gebäude gesenkt. Nur das Stampfen der Pferde und ihr Schnauben waren zu vernehmen. Einige Indianer rannten zum Corral. Andere trieben Pferde und einige Milchkühe aus den Stallungen. Auch hier versorgten sich die Krieger wieder mit Kleidung. Dann versammelten sie sich im Ranchhof. Der eine oder andere hielt einen blutigen Skalp in der Hand.
»Wann werden die Weißaugen endlich einsehen, dass wir stärker sind als sie?«, rief einer der Krieger und hob die Faust mit dem Kriegsbeil. »Brennt alles nieder. Es soll den Weißen als Warnung dienen.«
Die Pferde wurden aus dem Corral getrieben. Wiehern erfüllte die Luft. Dann züngelten Flammen, und bald brannte alles lichterloh. In dem ausgetrockneten Holz fand das Feuer ausreichend Nahrung. Es brannte wie Zunder.
Die Apachen trieben die erbeuteten Tiere davon und kehrten in die Mimbres Mountains zurück, um Victorio von einem erneuten Sieg zu berichten und ihm die Beute zu präsentieren.
*
Der Scout stand in den Steigbügeln und witterte wie ein wildes Tier, dann sagte er: »In der Nähe wurde etwas niedergebrannt. Folgen wir dem Geruch.« Er ließ sich in den Sattel zurückfallen.
Sie ritten nach Osten. Es waren drei Apachen, Mescaleros, die als Kundschafter für Major Garretson ritten. Unter ihren Armeehüten quollen lange, schwarze Haare hervor. Sie trugen Feldblusen und dazu farbige Leinenhosen. Ihre Füße steckten in hohen Mokassins.
Sie folgten dem Brandgeruch, und schließlich verhielten sie ihre Pferde bei der niedergebrannten Ranch. Hier und dort stieg noch Rauch aus den Trümmern, an manchen Stelle glomm es, wenn der Wind in die Schutthaufen fuhr, manchmal flackerte sogar das Feuer wieder auf.
Tod und Verderben, Hass und brutale Vernichtung - das war das Bild, das sich den Scouts bot. An Stelle der Embleme mit den gekreuzten Säbeln trugen sie weiße Andreaskreuze auf den Kronen der Hüte, einfach mit Farbe daraufgepinselt, was sie als Kundschafter kennzeichnete.
»Wir müssen es dem Major melden«, sagte einer im Apachendialekt. »Ich reite. Bleibt ihr hier und haltet Ausschau. Es kann sein, dass sich die Kriegshorde noch in der Nähe befindet.«
Der Scout zog sein Pferd um die linke Hand und trieb es mit einem Schenkeldruck an. Er folgte den Windungen zwischen den Hügeln und Felsen, die sich westlich der niedergebrannten Ranch erhoben. Die Patrouille befand sich etwa eine Meile weiter im Westen. Der Mescalero ließ das Pferd traben.
Drei Reiter trieben ihre Mustangs über den Kamm des Hügels zu seiner Rechten. Drei kamen über den Hügel zu seiner Linken. Er hämmerte seinem Pferd die Sporen in die Seiten. In schräger Linie jagten die beiden kleinen Trupps die Abhänge hinunter und trafen schließlich nur fünfzig Yards hinter dem Scout zusammen. In wilder Karriere stoben sie hinter dem Mescalero her.
Die Hufe der Pferde schienen kaum den Boden zu berühren. Der Scout ritt um sein Leben. Noch klappte bei seinem schweren Armeepferd das Zusammenspiel von Muskeln und Sehnen. Das Tier schien dahinzufliegen, als hätte es gewusst, dass seine Schnelligkeit und Ausdauer über Leben oder Tod entschied.
Die Krieger jagten hinterher. Spitzes, abgehacktes Kriegsgeschrei holte den Scout ein und ließ ihn einen eisigen Schauer den Rücken hinunterrinnen. Der Tod streckte die knochige Klaue nach ihm aus. Er zog seinen Revolver und feuerte nach hinten. Aber die Distanz zu seinen Verfolgern war für einen Schuss mit dem Sechsschüsser zu weit. Er vergeudete nur seine Munition. Das Krachen der Schüsse vermischte sich mit dem Trommeln der Hufe zu einer Art Höllensymphonie.
Vor den Nüstern des Pferdes bildete sich weißer Schaum, der Reitwind riss ihn fort und trieb ihn gegen die Beine des Scouts. Der Hufewirbel verlangsamte sich. Das Pferd röchelte und röhrte. Und jetzt begannen die Verfolger zu feuern. Plötzlich brach das Pferd unter dem Scout zur Seite aus. Eine Kugel hatte es gestreift. Es begann wie verrückt zu bocken. Dann stieg es auf die Hinterhand. Der Scout sprang ab, riss das Gewehr aus dem Scabbard und rannte in den Schutz einer verdorrten Korkeiche, deren Stamm ihm Schutz bot. Sein Pferd stob mit fliegenden Steigbügeln davon.
Der Mescalero repetierte und schoss. Er traf einen Krieger. Dieser warf beide Arme hoch, machte das Kreuz hohl, und stürzte vom Pferd. Das Tier stob im Pulk der anderen weiter.
Wieder schoss der Scout. Ein Pferd brach zusammen. Sein Reiter flog wie von einem Katapult geschleudert durch die Luft, überschlug sich einige Male am Boden und rührte sich nicht mehr.
Dann waren die anderen vier Krieger heran. Sie sprangen von den Pferden und fielen über den Scout her. Es gab keine Gnade und kein Erbarmen. Es gab nur den tödlichen Hass.
Als eine Viertelstunde später einer seiner Kameraden erschien, den das ferne Peitschen der Schüsse auf die Fährte des Scouts gelockt hatte, hatten ihn die Apachen an den Beinen an einem Ast der verdorrten Eiche aufgehängt. Er war skalpiert. Blut tropfte auf den Boden. Sein Gesicht war von den Hieben mit den Tomahawks grässlich verstümmelt.
Der Scout gab seinem Pferd die Sporen. Er hatte plötzlich das Empfinden, von zig Augenpaaren beobachtet zu werden. Die Angst kam kalt und stürmisch wie ein Blizzard und eine eisige Hand schien nach dem Mescalero zu greifen. Er ließ sein Pferd galoppieren. Und dann sah er auf einer Ebene die Patrouille. Er jagte auf sie zu und riss sein Pferd in den Stand, als er sie erreichte.
»Eine Ranch!«, rief er. »Am Alamosa River. Niedergebrannt. Keine Lebenden, der Corral ist leer. Die Spur der Pferde führt in die Berge. Black Eagle ist tot. Sie haben ihn skalpiert.«
Die Kavalkade hatte angehalten. Im Gesicht Major Garretsons arbeitete es. »Diese elenden roten Heiden!«, entrang es sich ihm mit heiserer, belegter Stimme. »Jetzt ziehen wir seit einer Woche kreuz und quer durch diese Region und sind auf keinen einzigen von ihnen getroffen. Die Hölle verschlinge diese niederträchtigen Mörder.«
Lieutenant Whitlock schwieg. Was er zu sagen gehabt hätte, würde seinem Vorgesetzten wohl nicht gefallen haben, nämlich, dass sich die Apachen nur gegen eine Indianerpolitik wehrten, die ihnen immer mehr von ihren Rechten nahm und sie mehr und mehr ins soziale Abseits drängte.
»Ich denke, die Renegaten befinden sich noch in der Nähe, Nantan«, sagte der Scout. »Es ist davon auszugehen, dass ihre Späher uns schon beobachten, seit wir in den Mimbres Mountains angelangt sind.«
»Woraus schließen sie das?«, fragte der Major.
»Es ist wohl so«, übernahm es Whitlock, die Antwort zu geben. »Sicher wurde schon unsere Annäherung an das Gebiet südlich der Plains of Saint Augustine beobachtet.« Er ließ seinen Blick in die Runde schweifen. Die Ebene wurde von hochragenden Bergen begrenzt, es gab Schluchten und Risse. »Irgendwo vor uns wird etwas vorbereitet«, sagte Whitlock. »Ich kann die Apachen geradezu riechen.«
»Wir reiten weiter!«, gebot der Major.
»Eskadron, Marsch!«, rief Whitlock.
Die Patrouille setzte sich in Bewegung.
Der Scout ritt wieder voraus und verschwand bald aus dem Blickfeld Whitlocks. Dieser sicherte unablässig um sich. Seine Augen waren in ständiger Bewegung. Er verspürte Anspannung und ein seltsames Kribbeln zwischen den Schulterblättern. Als Whitlock sagte, dass er die Rothäute geradezu riechen konnte, so war das keine Metapher. Die Apachen gerbten das Leder mit Tran und Urin, und diesen Geruch verströmten die Krieger. Und wenn der Wind richtig stand...
Sie erreichten die Stelle, an der der tote Scout am Baum hing. Einer der jungen Soldaten wurde ganz grün im Gesicht, er sprang ab, lief zu einem Felsen und übergab sich.
»Wir müssen ihn begraben«, sagte der Lieutenant.
»Ja. Es ist unsere Christenpflicht«, pflichtete der Major bei.
Whitlock gab vier Soldaten den Befehl, ein Grab auszuheben. Den anderen gebot er, abzusitzen und in die Runde zu sichern. Springfield-Karabiner wurden durchgeladen. Die Soldaten verteilten sich. Nichts geschah. Der Major sprach ein Gebet am offenen Grab des Kundschafters, dann schaufelten die vier Kavalleristen den trockenen Sand auf ihn und bedeckten den Hügel mit Steinen, damit wilde Tiere den Leichnam nicht wieder herausscharrten.
Blutsaugende Fliegen, angezogen vom süßlichen Schweißgeruch, setzten Pferden und Reitern zu. Im Sand glitzerten winzige Kristalle. Es handelte sich um Glimmerschiefer, der im Laufe der Jahrmillionen verrottet und zerfallen war. Es war ein schönes Land, aber auch ein gefährliches Land. Hinter jedem Hügel konnte Gefahr lauern, der Tod war allgegenwärtig.
Sie zogen weiter und erreichten die niedergebrannte Ranch. Die Menschen waren in den Häusern verbrannt. Der laue Wind wirbelte Asche in die Höhe und trug sie mit sich. Die Blicke schweiften hinweg über diese Stätte des Todes. In den Zügen der Männer drückten sich tiefer Ernst und maßloses Grauen aus. Aber längst nicht jeder schob den Apachen die Schuld zu. Sie wehrten sich wie in die Enge gedrängte Raubtiere. Die Hoffnungslosigkeit ihrer Situation, ihre Ausweglosigkeit war es, die sie gefährlich und unberechenbar machte.
Der Major war abgesessen und ging hin und her. Der Staub im Hof war von Hufen und Füßen aufgewühlt. Abgesehen von den Kavalleristen und ihren Pferden vermittelten nur noch einige Hühner Leben.
Lieutenant Whitlock ritt zu der Stelle, wo die Spur der gestohlenen Pferde und der unbeschlagenen Mustangs nach Südwesten führte. Einer der Scouts befand sich bei ihm. »Folge der Spur«, sagte Whitlock. »Folge ihr bis zu ihrem Ende, komm zurück und führe uns.«
Der Scout nickte und ruckte im Sattel. Sein Pferd ging an. Im Schritttempo verschwand er zwischen den Felsen.
Es dauerte etwa eine Stunde, dann stiegen im Südwesten Rauchzeichen zum Himmel. Zuerst war es nur eine Rauchsäule. Sie wurde jäh unterbrochen, um sich dann erneut zu erheben. Der Rauch ballte sich am Himmel und trieb träge nach Osten.
»Was sagen diese Zeichen?«, fragte Whitlock den anderen Scout, der zurückgeblieben war.
»Ein Späher teilt dem Haupttrupp mit, dass jemand auf seiner Spur reitet. Big Bird werden wir wohl nicht mehr sehen.«
Whitlock schaute betroffen. Wenn der Scout ums Leben kam, dann hatte er ihn in den Tod geschickt. Er schalt sich einen Narren, und er versuchte sich zu beruhigen. Du musst dir keine Vorwürfe machen, zog es durch seinen Verstand. Es ist sein Job. Wenn wir hier umkommen, macht sich Colonel McIntosh sicher auch keine Vorwürfe.
Der Versuch misslang. Es beruhigte ihn nicht. Whitlock fand das alles plötzlich so sinnlos, so überflüssig. Das Land ertrinkt im Blut seiner Menschen, durchfuhr es ihn voll Verbitterung. Und die Armee schürt den Hass noch. Alles nur wegen der unstillbaren Habgier einiger weißer Männer, die den Indianern die Luft nicht gönnen, die sie atmen.
Whitlock beobachtete die Rauchsignale. Soeben wurde die dunkle Rauchsäule wieder unterbrochen. Der Späher hatte grünes Laub in die Flammen geworfen, darum war der Rauch fast schwarz. Immer wieder schickte er seine Signale zum Himmel. Whitlock ahnte, dass das Kommunikationssystem in der Wüste vorzüglich funktionierte. Tatsächlich stiegen bald in der Ferne ebenfalls Rauchzeichen zum Himmel. Das Feuer brannte auf der Kuppe eines Felsens. Senkrecht stiegen die Rauchbahnen empor...
*
Whitlock begab sich zum Major. »Sie haben unseren Scout entdeckt.« Er deutete mit einer matten Geste seiner Linken nach Südwesten. »Seine Chancen sind die eines Schneeballs in der Hölle. Wir sollten nicht auf seine Rückkehr warten, Sir, sondern aufbrechen. Noch ist die Fährte frisch.«
»In Ordnung, Lieutenant. Lassen Sie das Camp abbrechen und die Männer aufsitzen.«
Eine Viertelstunde später waren sie auf dem Weg. Die Geräusche, die sie verursachten, rollten vor ihnen her. Wo der Boden sandig war, konnte man die Spur, die die räuberischen Indianer gelegt hatten, deutlich sehen. Aber auch auf felsigem Untergrund gab es immer wieder Hinweise wie Pferdedung, Kratzspuren, losgetretene Steine und Pferdehaare, die an dornigen Büschen hängen geblieben waren...
Der letzte der drei Scouts ritt voraus. Es ging durch einen Canyon, dessen Wände senkrecht nach oben stiegen. Oben schienen sich die Felsen zu vereinen. Staub wehte über die Ränder, leises Prasseln erfüllte die Luft. Die Luft schien stillzustehen, nur aus Seitenschluchten strömte den Reitern kühle Luft entgegen. Zwischen den Felsen wurden die Geräusche von den Echos verstärkt und muteten besonders intensiv an. Von einem vorspringenden Felsen tropfte Wasser und färbte den Sand am Boden dunkel. Es war wie ein steinernes Grab des Schweigens, das sie durchritten. Stellenweise war die Schlucht fast hundert Yards breit, dann verengte sie sich wieder und war gerade so breit, dass drei Reiter nebeneinander durchkamen.
Der geeignete Platz für einen Überfall.
Dort, wo die Schlucht endete, fanden sie den Scout, den der Lieutenant losgeschickt hatte. Er war tot und skalpiert. Sein Körper war mit Pfeilen gespickt. Neben ihm steckte eine Kriegslanze im Boden. Myriaden von kleinen Mücken saßen auf dem Leichnam oder umschwärmten ihn.
Whitlocks Kehle war salztrocken. Er hatte das Gefühl, von einer unsichtbaren Faust gewürgt zu werden. Sein Befehl hatte den Mann in den Tod geschickt. Mit Indianern, die der Armee dienten, gingen die aufrührerischen Apachen besonders grausam um.
Vor ihren Blicken lag ein staubiger Talkessel. Einige Kakteen und Hickorys sowie Korkeichen erhoben sich. Rundum gab es Felsen und Hügel. Die Sonne gleißte. Der Major ließ absitzen. Der Scout wurde begraben. Dann ritt die Patrouille in den Kessel hinein. Er hatte einen Durchmesser von etwa dreihundert Yards. Jeder der Soldaten war ein Bündel angespannter Aufmerksamkeit. Die Nerven waren zum Zerreißen angespannt, die Anspannung vertiefte die Linien in den Gesichtern. Sie präsentierten sich den Apachen wie auf einem Schießstand. Rundum schien das Land tot und leer zu sein. Aber sie gaben sich keinen Illusionen hin. Die Ruhe war nicht echt, sie war gefährlich und trügerisch. Die Apachen würden sich erst sehen lassen, wenn es zu spät war und es kein Zurück mehr gab.
Und dann kamen sie.
Die Kavalleristen befanden sich mitten in dem Kessel. Die Apachen griffen von allen Seiten an. Ihr schrilles Geschrei erhob sich zum Himmel und vermischte sich mit dem Trommeln des Hufschlages.
»Absitzen! Rundumsicherung! Benutzt die Pferde als Deckung. Und vergeudet keine Munition!«
Gellend kamen die Befehle. Das Entsetzen fuhr den Männern in die Knochen. Der eine oder andere verspürte Gänsehaut. Mit dem Entsetzen kam die Angst, und mit der Angst der Selbsterhaltungstrieb, eines der ältesten, angeborenen Prinzipien der Menschheit.
Die Soldaten handelten, warfen sich von den Pferden, die Karabiner flirrten aus den Futteralen. Trockenes, metallisches Geräusch erklang, als die Männer durchluden. Sie bildeten einen Kreis. Eine Wand aus zuckenden Mündungsblitzen und Pulverdampf stellte sich den Angreifern entgegen.
Deutlich war der Strom des Vernichtungswillens, der von der näherbrandenden Schar ausging, zu spüren. Die Kavalleristen zwangen sich dazu, ihren Anblick zu ertragen.
Pferderücken wurden leergefegt. Die reiterlosen Gäule preschten in der donnernden Angriffwelle weiter, wurden regelrecht mitgerissen. Jetzt schossen auch die Angreifer wie rasend. Aus der flatternden Wolke, die die Soldaten umhüllte, torkelten Gestalten hervor und brachen zusammen.
Das hochträllernde Geschrei zermürbte die Gemüter. Tomahawks wirbelten durch die Luft, Kriegslanzen zogen ihre lautlosen Bahnen. Pferde brachen zusammen. Die Soldaten schossen die Rohre heiß. Die Indianer waren in eine Kreisbahn eingeschwenkt, hingen an den den Soldaten abgewandten Seiten der Pferde und feuerten mit alten Revolvern und Gewehren unter den Köpfen der Tiere hindurch.
Dann aber verschwanden sie ebenso schnell, wie sie gekommen waren. Wahrscheinlich merkten sie, dass der Blutzoll, den sie Ihrem Hass zu bezahlen hatten, zu hoch war. Sie stoben über die Kämme der Hügel ringsum und es war, als hätte sie die Erde geschluckt, als hätte es sie nie gegeben. Doch die toten Pferde, Indianer und Soldaten waren Zeugnis dafür, dass sie Realität gewesen waren - bittere, unselige Realität.
Staub und Pulverdampf zerflatterten, wurden vom Wind fortgetragen oder legten sich auf den Boden zurück.
»Rückzug in die Schlucht!«, rief der Major. Seine Stimme klang heiser und mitgenommen. »Decken Sie mit drei Mann unseren Rückzug, Lieutenant!«
Fünf tote Soldaten blieben zurück. Sieben Pferde waren getötet worden. Einige Mustangs standen herum und spielten nervös mit den Ohren.
»Wir nehmen die toten Kameraden mit!«, kommandierte Whitlock, als Major Garretson mit dem Haupttrupp in der Schlucht verschwunden war. Sie luden die reglosen Gestalten auf die Pferde und führten die Tiere zwischen die Felswände. Zwei Soldaten blieben zurück, um den Zugang zu bewachen.
»Fünf Tote, vier Verwundete«, zog Major Garretson Resümee. »Und wir haben sieben Pferde verloren. Welch ein Irrsinn. Sie sind über uns gekommen wie der Adler über eine Feldmaus.«
»In dieser Wildnis sind sie uns haushoch überlegen«, knurrte Whitlock.
Die Verwundeten wurden verbunden. Einer der Kavalleristen hatte einen Schuss in die rechte Brustseite bekommen. Ein anderer hatte einen Bauchschuss davongetragen. Die beiden anderen Verwundeten hatten nur leichte Verletzungen.
»Wir müssen Schleppbahren bauen«, erklärte der Lieutenant. »Zunächst einmal aber sollten wir die Nacht abwarten. Kehren wir zum Beginn der Schlucht zurück, Sir?«
»Ja.« Der Major nagte an seiner Unterlippe. »Wir sind noch neunzehn Männer. Sieben Mann fallen aus. Das heißt, dass wir um mehr als fünfundzwanzig Prozent dezimiert sind. Noch ein solcher Überfall, und wir können einpacken.«
»Ich habe im Fort meine Bedenken angemeldet, Sir«, versetzte Whitlock vorsichtig. »Aber der Colonel meinte, dass wir als kleine Gruppe beweglicher wären. Er hat die Apachen unterschätzt.«
»Sie zweifeln den Befehl des Colonels an?«, fragte der Major scharf. Zwei steile Falten hatten sich über seiner Nasenwurzel gebildet.
»Nein, Sir«, wehrte Whitlock ab. »Das wäre vermessen. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, dass wir zu schwach sind, um gegen Victorio und seine Krieger bestehen zu können. Der Colonel ist davon ausgegangen, dass Victorio die Aussichtslosigkeit seines Kampfes einsieht und sich ergibt. Das war jedoch ein Trugschluss. Ich will damit dem Colonel auf keinen Fall zu nahe treten.«
Der Major winkte resigniert ab. »Schon gut. Ich weiß, was Sie meinen, Lieutenant. Lassen Sie aufsitzen. Wir ziehen uns in die Schlucht zurück. Und dann sehen wir weiter.«
»Wir sollten uns einige Pferde zusätzlich beschaffen, Sir«, räumte Whitlock ein. »Es kann nie schaden, ein paar Tiere in der Reserve zu haben.«
»Veranlassen Sie, dass die Tiere der Apachen eingefangen werden.«
Whitlock rief die Namen dreier Kavalleristen und befahl ihnen, die Pferde zu holen, die die Apachen zurückgelassen hatten. Dann zogen sich in die Schlucht zurück. Eine kleine Gruppe sicherte nach hinten, vier Soldaten und der Scout ritten voraus. Immer wieder wanderten die Blicke an den Felswänden nach oben. Und als die Vorhut eine der Engstellen passiert hatte, geschah es. Steine stürzten in die Tiefe. Eine ganze Gerölllawine. Es krachte und barst. Staub wallte dicht. Die Pferde scheuten. Geschrei erschallte. Die Vorhut war von der Patrouille getrennt. Immer wieder krachten Felsklötze in die Tiefe. Und dann kam Hufgetrappel auf. Ein Dutzend Apachen stoben durch die Schlucht. Im vollen Galopp feuerten sie ihre Waffen ab. Der Scout und die vier Soldaten hatten keine Chance. Die Apachen sprangen von den Pferden und erklommen den Haufen Gestein, der von oben in die Schlucht gestürzt war. Blindlings feuerten sie in die Patrouille hinein. Im Nu wälzte sich ein Knäuel ineinander verkeilter Menschen- und Pferdeleiber am Boden. Das Sterben ging weiter. Nur einem kleinen Rest Soldaten gelang es, in Deckung zu laufen und zu kämpfen. Pferde gingen durch und stoben von Panik erfasst davon. Die Nachhut war aufgerückt. Die Indianer, die durch die Schlucht gekommen waren, verschwanden wieder.
Der Spuk war plötzlich zu Ende.
Lieutenant Whitlock, Sergeant Burmester und fünf Soldaten waren noch einsatzfähig. Die anderen waren entweder tot oder schwer verwundet. Sie hatten nur noch drei Pferde. Es war eine bittere Niederlage, die sie einstecken mussten.
»Wir brechen die Mission ab«, sagte Whitlock. »Die Toten begraben wir an Ort und Stelle. Mit den Verwundeten versuchen wir, uns nach Norden durchzuschlagen.«
Seinen Worten fehlte die Hoffnung. Später, als die Männer Felsbrocken über die toten Kameraden schlichteten, sagte er zu dem Sergeant: »Wir sind verheizt worden. Der Colonel ist von völlig falschen Voraussetzungen ausgegangen. Aber was zählen schon ein paar Soldaten. Es ist im Sold inbegriffen, gegebenenfalls vor die Hunde zu gehen. Als Kavallerist bist du nichts weiter als ein Stück Ausrüstung, die zum Pferd gehört. Das ist so und wird mir immer klarer.« Der Tonfall in der Stimme Whitlocks war an Verbitterung nicht zu übertreffen.
»Haben wir überhaupt eine Chance?«, fragte der Sergeant.
»Solange ein Funke Leben in uns ist – ja. Es wird zehn bis zwölf Tage dauern, bis wir Fort Wingate erreichen. Ja, wir haben eine Chance.» Whitlock nickte, als wollte er so seinen Worten Nachdruck verleihen. »Wir marschieren nachts und ruhen am Tag. So schaffen wir es, Sergeant. Ganz bestimmt.«
Der Gesichtsausdruck des Sergeanten verriet, dass er Whitlocks Zuversicht nicht teilte.
Es starben noch zwei der Verwundeten. Sie waren zu siebt und mussten sich um drei Verwundete kümmern. Für sie hatten sie noch Pferde. Whitlock, der Sergeant und die anderen fünf Soldaten, die noch einsatzfähig waren, mussten marschieren.
Als die Dunkelheit den Tag nach Westen vertrieben hatte, brachen sie auf. Sie verließen die Schlucht und wandten sich nordwärts. Die Angst war ihr Begleiter, die Apachengefahr hing wie ein Damoklesschwert über ihren Köpfen. Dazu kamen bald Hunger und Durst. Der kleine Vorrat an Pemmikan war schnell aufgebraucht, die drei Wasserflaschen, die sie hatten, waren leer. Auf die Jagd wagten sie sich noch nicht zu gehen, denn ein Schuss konnte den Indianern ihren Standort verraten.
Die Nacht war finster. Die Dunkelheit zwischen den Felsen mutete fast stofflich und greifbar an. Sie kamen nur schlecht vorwärts. Die Geräusche, die sie verursachten, rollten vor ihnen her. Schon bald begannen Whitlocks Füße in den Stiefeln zu brennen. Den anderen ging es nicht besser. Mit den glatten Sohlen rutschte der eine oder andere auf dem oftmals glatten Fels aus. Die Männer stöhnten und ächzten. Einmal sagte einer der Kavalleristen: »Wenn ich das zehn oder zwölf Tage durchhalten soll, schieße ich mir lieber gleich eine Kugel durch den Kopf.«
»Das erledigen vielleicht die Rothäute«, knurrte ein anderer.
Unbeirrt ließ Whitlock marschieren. Gegen Mitternacht gönnte er sich und den Männern eine Pause. Nach einer halben Stunde ging es weiter. Die Füße wurden schwer wie Blei. Oftmals stieg das Land an und der Aufstieg war beschwerlich. Dann ging es wieder steil nach unten. Sie stolperten über Geröll, traten in Risse, stießen sich an Felsvorsprüngen. Als der Morgen graute, waren sie fix und fertig. Sie ließen sich zu Boden sinken und rissen sich die Stiefel von den Füßen.
Zwei Mann mussten Wache halten. Die anderen durften sich ausstrecken und schlafen. Sie befanden sich am Beginn einer Schlucht. Die Erschöpfung hatte die Muskeln in ihren Gesichtern erschlaffen lassen. Ihre Augen brannten. Sie hatten sich die Füße wundgelaufen und in den Gemütern saß die Angst. Sie waren psychisch und physisch fertig.
*
Eine kleine Gruppe von Apachen befand sich auf der Jagd. Sie hatten einen Hirsch erlegt und das tote Tier auf dem Rücken eines Mustangs festgebunden. Jetzt waren sie auf dem Rückweg in ihr Lager in einem Canyon. Es war um die Mittagszeit.
Es gab nicht viel Wild in den Mimbres Mountains. Nur Wölfe, Coyoten und Pumas, vielleicht auch Bären. Die Bisons, die früher über die Prärien gezogen waren, hatten weiße Jäger zu hunderttausenden abgeschlachtet und ihre Häute verkauft. Die Hauptnahrungsquelle der Indianer gab es nur noch selten, und vor dem Winter würden die wenigen kleinen Herden, die jetzt die weiten Prärien noch bevölkerten, nach Süden ziehen. Auch das Wild würde sich aus den gebirgigen Regionen in die Wälder flüchten.
Die Apachen wussten, dass ihnen ein harter Winter bevorstand. Darum versuchten sie, soviel Fleisch wie möglich zu erjagen und es zu trocknen, damit sie in den Wintermonaten überleben konnten. Dazu dienten hauptsächlich die auf den Ranches erbeuteten Rinder.
Auf einem Felsen stand ein Weißer. Das Rudel mit dem erlegten Hirsch war an ihm vorbeigezogen, ohne ihn zu bemerken. Er hielt die Winchester mit beiden Händen schräg vor seinem Körper.
Auf einem anderen Felsen erschien ebenfalls ein Weißer. Stoppelbärtig, mit einem langen Staubmantel bekleidet, ein Gewehr in den Fäusten haltend. Verkommenheit und Niedertracht standen ihm ins Gesicht geschrieben. Seine stahlblauen Augen blickten eisig. Er winkte seinem Gefährten zu.
Zwischen den Felsen zeigte sich ein dritter der Kerle.
Am Ende waren es sieben Männer, die die Indianer zwischen sich hatten. Es handelte sich um Scott Wilburn und seine Bande – um eine Horde skrupelloser Skalpjäger. Die Regierung in Arizona zahlte für jeden Indianerskalp fünf Dollar. Der Tucson-Ring, dessen Transporte immer wieder von den Apachen überfallen wurden, ebenfalls. Ein Indianer war also zehn Dollar wert.
Die Kerle waren aus Brutalität, Niedertracht, Heimtücke und allem, was hart und unmenschlich macht, zusammengesetzt. Jetzt gab Wilburn das Zeichen. Die Gewehre flogen an die Schultern und begannen zu krachen. Es war ein Crescendo des Todes, das die Waffen hinausposaunten. Die Indianer wurden herumgerissen und von den Treffern geschüttelt, tot und sterbend sanken sie zu Boden.
Das Krachen brach ab. Die Gewehre schwiegen. Mit geisterhaftem Geraune verrollten die Echos.
Die Skalpjäger kamen zwischen den Felsen hervor und gingen zu den Indianern hin. Einer rührte sich noch. Wilburn zog seinen Colt und gab ihm mit erschreckendem Gleichmut in den Zügen den Rest. »Sechs Skalps Leute. Sechzig Dollar. Nicht schlecht. Gekostet hat es uns lediglich einige Unzen Blei.«
Das Wort Mitleid oder Anteilnahme gab es nicht in seinem Sprachschatz. Ein Menschenleben war ihm gerade mal den Preis für eine Kugel wert. Sie zogen ihre Messer und machten sich an die blutige Arbeit. Die Skalps stopften sie in blutbesudelte Leinensäcke.
Dann verließen sie diesen Ort und zogen weiter. Sie wollten so viele Skalps wie möglich erbeuten und vor allem wollten sie Victorio. Er war der Regierung tausend Dollar wert. Und für tausend Dollar wären Wilburn und seine Komplizen in die Hölle geritten und hätten dem Satan ins Maul gespuckt.
*
»Ich will nicht mehr. Lasst mich hier zurück.« Der junge Soldat ließ sich einfach auf den Boden sinken, zog die Beine an und schlug beide Hände vor das schmutzige Gesicht. Er war am Ende. Etwas in ihm war zerbrochen. Er hielt die Strapazen des Marsches nicht mehr länger aus. Seit vier Tagen marschierten sie nun über Stock und Stein. Sicher, tagsüber hatten sie Zeit, sich zu erholen. Aber die Nächte waren schon lang, und das Land schenkte ihnen nichts. Der Weg war eine Tortur. Der Bursche war bereit, aufzugeben.
»Hoch mit Ihnen, Trooper Stillwell! Nehmen Sie sich ein Beispiel an Ihren Kameraden. Wir können alle nicht mehr. Dennoch marschieren wir.« Lieutenant Whitlock hatte angehalten, das rechte Bein auf einen Felsen gestellt und beugte sich weit über den Kavalleristen. »Wir lassen Sie nicht zurück.«
»Ich – ich kann nicht mehr, Sir«, brach es rasselnd über die bebenden Lippen des Jungen. Seine Augen glitzerten in der Dunkelheit wie Glaskugeln. Ein Ächzen stieg aus seiner Kehle. Es hörte sich an wie trockenes Schluchzen.
Die anderen waren weitermarschiert und Whitlock konnte sie nur noch schemenhaft wahrnehmen. Die Pferdehufe krachten und klapperten. Niemand kümmerte sich um Stillwell, der schlapp zu machen drohte. Jeglichen Gedankens, jeglichen Willens beraubt stapften die Soldaten dahin. Jeder Schritt war eine Anstrengung, eine Überwindung, die all den Willen erforderte, der in den Männer noch steckte. Es war das Gesetz der Selbsterhaltung, das nur noch der Instinkt diktierte und sie vorwärts peitschte.
»Stehen Sie auf, Soldat!«, keuchte Whitlock. »Das ist ein Befehl. Sie werden mir doch den Gehorsam nicht verweigern?«
»Erschießen Sie mich von mir aus, Lieutenant. Es ist mir egal. Lieber tot sein, als...« Stillwell brach ab. »Tut mir Leid, Sir. Ich kann wirklich nicht mehr. Meine Füße sind wund. Ich – ich fühle mich ausgehöhlt wie ein morscher Baumstamm. Bitte, Lieutenant, lassen Sie mich zurück.«
»Niemals, Stillwell!« Whitlock nahm sein Bein von dem Felsen. »Geben Sie mir Ihre Hand, ich helfe ihnen.« Er streckte den Arm aus. »Anhalten!«, gebot er gleichzeitig mit lauter Stimme. Seine Worte holten den kläglichen Rest der Patrouille ein. »Sergeant, warten Sie mit den Männern! Stillwell kann nicht mehr.« Seine Stimme sank herab. »Geben Sie mir die Hand, Soldat!« Whitlocks Worte fielen zwingend und duldeten keinen Widerspruch. Stillwell reichte ihm die Hand. Whitlock zog ihn auf die Beine. Schwankend stand der Trooper. »Kommen Sie, ich stütze sie.«
»Wie lange wollen Sie das schaffen, Sir? Ein paar hundert Yards, dann sind wir beide fix und fertig.«
»Wahrscheinlich haben Sie Recht. In Ordnung. - Sergeant!«
»Sir!«
»Ich ordne eine Pause von einer Stunde an. Die Männer sollen sich ausruhen.«