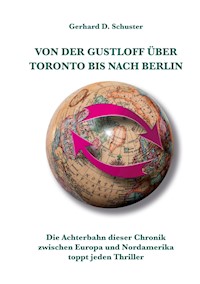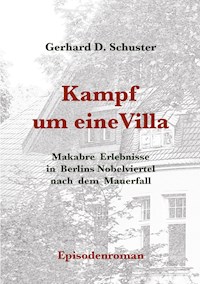Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ich verstehe mich als Chronist, einer, der sich zeitlebens Notizen über Erlebnisse und Gefühle in ungewöhnlichen Situationen machte und diese Erfahrungen nun schriftlich festgehalten hat. Aus der in meinem turbulenten Leben auf zwei Kontinenten durchaus umfangreich gewordenen Sammlung heraus entstand dieser Band über die Seele Amerikas: nicht zu greifen, nicht zu sehen, nur zu spüren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 102
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Umbuchung meines Rückfluges nach Europa war komplizierter als erwartet. Eine Kollegin der Boden-Stewardess sollte das Durcheinander entwirren.
Ich blickte auf und schaute in das Gesicht einer wahren Göttin unter den Frauen. Was tut ein Löwe-Geborener in solch einer Situation? Er versucht, Punkte zu sammeln!
Und so erwähnte ich möglichst beiläufig, dass ich an einem Buch über Amerikas fehlender Seele arbeite. Jetzt wurde die etwa 40-jährige Schöne ganz aufgeregt und bat mich zu einer Tasse Kaffee in einen Hinterraum.
Genau das sei ihr Problem, aber wenn sie versuche, mit ihrem Ehemann, einem kanadischen Ingenieur, darüber zu reden, verstehe er sie nicht. Und bei ihrer Single-Schwester sei es noch schlimmer, diese pendle zwischen Hollands Enge und Nordamerikas fehlender Seele hin und her und komme zu keiner Entscheidung.
„Bringen Sie unbedingt Ihr Buch heraus!“ bat mich Lijn Malenstein beim Abschied.
Ihr ist dieses Buch gewidmet.
Inhalt
Vorwort
Teil 1
1. Alexis de Tocqueville
2. Sinclair Lewis
3. Arthur Feiler
4. Vicki Baum
5. Somerset Maugham
6. Friedrich Sieburg
7. Harald Ingensand
8. Peter Grubbe
9. Joachim Fernau
10. Hans Habe
11. Arthur Miller
12. Max Frisch
13. Fritz J. Raddatz
14. Chris Hedges
15. Durs Grünbein
16. Jean-Jacques Schuhl
17. Katja Eichinger
18. Czeslaw Milosz
19. Monte Vanton
20. Bob Dylan
Teil 2
1. Ankunft im „Kanadischen Sibirien“ - Weihnachten 1949
2. Anpassung im stockkonservativen Toronto der 1950er Jahre
3. Mein Desaster mit kanadischen „Dates“
4. Die quirlige Schwedin im nächtlichen Greyhound
5. Eine kanadische Verlobung
6. Drei Europäer als Trainees im Mittleren Westen der USA
7. Mit Familie zum MBA nach Toronto
8. Mit dem deutschen „Mr. Shakespeare“ auf Amerika-Reise
9. Meine Büroleiterin auf Werksbesuch in den USA
10. Worte eines „Shooting-Stars“, neun Jahre lang mein Chef
11. Las Vegas - Tiefpunkt der amerikanischen Zivilisation
12. Zwei amerikanische Top-Manager auf Europa-Tour
13. Mein berufliches „Pearl Harbour“ am 6. Dezember 1983
14. Neuntägiger Aufenthalt im „Big Apple“
15. Wiedersehen mit Chicago - der „Windy City“
16. Der amerikanische Schulden-Student im Airport-Express
17. Die Tragödie von Margarethe und Eberhard Vischer
18. Hollywoods „Golden Boy“ Robert Redford und Europa
19. Amerikas Jahrhundert-Idole und Europas Frauen
20. Eine Wanderin zwischen Europa und Amerika
Vorwort
Ich verstehe mich nicht als Literat, eher als Chronist, einer, der sich zeitlebens Notizen über Erlebnisse und Gefühle in ungewöhnlichen Situationen machte und diese Erfahrungen nun schriftlich festhalten will. Aus der in meinem turbulenten Leben auf zwei Kontinenten durchaus umfangreich gewordenen Sammlung heraus entstand dieser Band über die „Seele Amerikas“: nicht zu greifen, nicht zu sehen, nur zu spüren.
Die erste Hälfte erwuchs aus einer Sammlung von Zeitungsartikeln und Buchauszügen, die ich zusammengestellt, manchmal analysiert und kommentiert habe, und die schon allein deswegen hochinteressant sind, weil sehr prominente Persönlichkeiten „amerikanische“ Erfahrungen gemacht haben, die sich mit meinen eigenen in vielerlei Hinsicht decken. Mein Leben lang faszinierten mich Vergleiche zwischen Amerika und Europa, auf die ich unvermeidlich gestoßen bin, seit meine Eltern mit mir, dem damals Zwölfjährigen, und meinen beiden Schwestern - eine älter, die andere jünger – 1949 nach Kanada auswanderten. Die dramatischen Auslöser für diese Entscheidung werden Gegenstand meines folgenden Buchs „Von der Gustloff über Toronto bis Berlin“ sein.
Zu gerne hätte ich die wundervollen, teils ironischen Ansichten anderer Prominenter über die angebliche Gleichheit in Amerika in meine Sammlung aufgenommen. Zum Beispiel von D. H. Lawrence, einem englischen Literaten, der mit seiner deutschen Ehefrau Frieda von Richthofen zeitweise in den USA lebte („Pleased to meet you, Mr. Dobbs“) oder auch die Erkenntnisse des Filmregisseurs Wim Wenders, die ihn bewogen haben, den (niederschmetternden!) Film „Paris, Texas“ über die seelische Verfassung Amerikas zu drehen. Aber mir stand nicht immer ausreichendes Material zur Verfügung.
Ich bin kein Soziologe. Daher erheben meine knapp zwei Dutzend Beispiele mitnichten den Anspruch, das Bild Amerikas aus dem Blick europäischer Intellektueller umfassend und genau wiederzugeben. Vier von ihnen haben Amerikaner geschrieben.
Die 20 oft recht kurzen Kapitel, die von André de Tocqueville über Max Frisch bis Bob Dylan reichen, sollen Denkanstöße liefern, eigene Nachforschungen zum Thema anzustellen. Sie würden vermutlich Erstaunliches zutage fördern.
Die zweite Hälfte dieses Bändchens hat sehr persönliche Erlebnisse zum Inhalt. Jede dieser Geschichten aus Nordamerika belegt in unterschiedlichster Form seelische Unterschiede zwischen den beiden Kontinenten und den Menschen, die dort leben.
Betonen möchte ich an dieser Stelle, dass ich in keiner Weise ein Amerikahasser bin. Ich empfehle vielmehr jungen Deutschen bei jeder Gelegenheit, vom amerikanischen Optimismus und Selbstvertrauen zu lernen. Beide helfen, sich im so kritikfreudigen und leicht neidischen Deutschland stärker zu fühlen und besser durchzusetzen. Als junger Angestellter wurde ich aufgrund meines kanadischen Backgrounds in deutschen Firmen grundsätzlich gemobbt, in amerikanischen nie!
Die Stunden auf den Langstreckenflügen über die USA versetzen mich immer wieder in derart euphorische Stimmungen, dass ich die „unbegrenzten Möglichkeiten“ dieses so widersprüchlichen Landes beinahe körperlich spüre. Ich habe sie ausprobiert, lebe aber seit langem lieber wieder im guten, alten Europa. Mein Schicksal – Stichwort Zinsniveau – hat ein regelmäßiges Pendeln zwischen Wohnsitzen auf zwei Kontinenten für mich leider nicht vorgesehen, und das ist wahrscheinlich gut so.
Gerhard D. Schuster im Winter 2021/2022
Teil 1
1. Alexis de Tocqueville
Es war das Jahr 1831, ein halbes Jahrhundert nach der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika, als ein talentierter 26-jähriger französischer Beamter, gelangweilt von seiner Stellung als Richter in Versailles, einen Auftrag zur Untersuchung des amerikanischen Gefängnissystems für sich akquirieren konnte.
Obwohl Alexis Charles-Henri-Maurice Clérel de Tocqueville zu Beginn seiner Reise kaum des Englischen mächtig ist, bereist er neun Monate lang gemeinsam mit seinem Freund Gustave de Beaumont die „jugendlichen“ USA und führt etwa 200 Interviews durch. Zu seinen Gesprächspartnern zählten der siebente Präsident der USA Andrew Jackson und auch dessen Vorgänger John Quincy Adams.
Der junge Franzose liefert pflichtgemäß seinen (langweiligen) Bericht über die Organisation der amerikanischen Gefängnisse ab. Nur kurze Zeit später schiebt er die gemeinsam erarbeitete, umfangreiche soziologische Analyse „Von der Demokratie in Amerika“ („De la Démocratie en Amérique“, 1. und 2. Band, Paris 1835/1840) nach, die zum Klassiker werden und ihn weltberühmt machen wird.
Als Urenkel eines royalistischen Märtyrers der Französischen Revolution zeigt sich Tocqueville skeptisch in Bezug auf die Folgen einer möglichen Massendemokratie. Gleichwohl ist er überzeugt, dass nur Chancengleichheit für alle der Weg in die Zukunft sein kann. Und er staunt über die tatkräftigen Amerikaner, die ein Eingreifen seitens irgendwelcher staatlichen Behörden vielfach unnötig machen.
Amüsiert beobachtet Tocqueville, dass schon die damaligen Amerikaner eine sehr hohe Meinung von sich selbst und ihrer Staatsform hatten und nicht weit davon entfernt waren, zu glauben, sie seien eine einzigartige Menschengattung, die es auf der Erde nicht noch einmal gebe.
In Kapitel 13 reflektiert Tocqueville die Ruhelosigkeit der Amerikaner, in welchem Rausch von Tatendrang und Ehrgeiz sie ständig nach für sich selbst attraktiveren Möglichkeiten der Selbstverwirklichung Ausschau hielten. Dies zeige sich in solchen, immer wiederkehrenden Situationen:
Der Amerikaner baut ein Haus für sein Auskommen und Wohnsitz im Alter, verkauft es aber weiter, noch bevor das Dach daraufgesetzt wird.
Er bestellt seinen Acker und überlässt das Ernten bereits dem nächsten Eigentümer des Grund und Bodens.
Hat er ein paar Tage Zeit, trägt ihn seine nie nachlassende Neugier gleich ganze Tagesreisen weit durchs Land.
Hielten ihn zudem in seinem sozialen Umfeld weder Gesetze noch Bräuche, ergäben sich daraus zusätzliche Beschleuniger für seine innere Unruhe. Der Amerikaner wechselt immer wieder die Spur und tut dies noch heute, nur aus Sorge, den kürzesten Weg zu seinem persönlichen Lebensglück zu verpassen. Wirkliche Lebensfreude sieht anders aus.
In meine Erinnerung haben sich diese Sätze von Tocqueville eingraviert:
„Ich lasse meinen Blick über die unzählige Menge aus gleichen Einzelnen schweifen. Diese Leute mögen physisch frei sein, psychisch sind sie versklavt. Das Schauspiel dieser Verwandlung zur Gleichheit macht mich traurig und zu Eis.“
2. Sinclair Lewis
Den ersten in die Vereinigten Staaten von Amerika verliehenen Nobelpreis für Literatur bekam Sinclair Lewis für „Main Street“ (Die Hauptstraße), seinen satirisch-sozialkritischen Roman, der 1920 erschien und in der amerikanischen Verlagsgeschichte zu einem sensationellen Ereignis wurde. Die Erstauflage wagte sich an bescheidene 10.000 Exemplare, aber schon drei Jahre später war das Buch millionenfach verkauft, in mehrere Sprachen übersetzt und verfilmt worden.
Dr. Kennicott, beliebter und geschätzter Landarzt in Gopher Prairie, einer nicht einmal 3000 Seelen zählenden Gemeinde im mittleren Westen, findet seine Carol Milford in Chicago im Osten der Vereinigten Staaten und heiratet sie. Carol, in der deutschen Übersetzung seines Romans Carola, hat einen wachen Geist, Soziologie studiert und vielerlei Interessen in Richtung Kultur und Kunst. Ihr neuer Lebensmittelpunkt entspricht in keiner Weise ihren Vorstellungen und Erwartungen, aber ambitioniert und intellektuell anspruchsvoll versucht sie, Kultur nach Gopher Prairie zu bringen. Ablehnung schlägt ihr entgegen. Klatschsucht, kleinstädtisches Denken und Routine beherrschen das Städtchen, sie akzeptiert man lediglich als die Frau des dort beliebten Docs.
Lewis selbst muss Ästhet gewesen sein, sonst hätte er die neue Umgebung durch Carols Augen nicht derart niederschmetternd beurteilt. In nur 32 Minuten durchquert sie das komplette Örtchen in alle vier Himmelsrichtungen und ist erschüttert von seiner Eintönigkeit, die die Öde der sie umgebenden Prärie widerspiegelt oder besser fortführt.
Entlang der Hauptstraße reihen sich zweigeschossige Backsteinsowie anderthalbstöckige Holzhäuser mit schmuddeligen Autos und Holzkarren dazwischen aneinander. Parks gibt es nicht, repräsentative Bauten ebenso wenig. Die Rasenflächen vor den Wohnhäusern sind zwar mit Liebe angelegt, aber das ist noch lange keine Kultur nach Carols Vorstellungen. Sie kämpft gegen ihre aufkommenden Depressionen, redet sich ein, dass sie lediglich übernervös sei. Bei ihren Spaziergängen durch die Stadt beobachtet sie alle Details der Straße, macht sich zu jedem Haus ihre – durchaus wohlwollenden – Gedanken. Es nutzt nichts. Sie sieht in den kleinen Häusern „Schuppen für Sperlinge“ anstelle von Wohnungen für lebhafte, lachende Menschen. Die Geschäfte und Läden können sie nicht aufmuntern.
Einzig das Bankgebäude gefällt Carola, ansonsten gibt es kein Dutzend Gebäude, die bewiesen hätten, dass Neuankömmlinge aus den letzten 50 Jahren „ihre Heimat wohnlich, schön oder abwechslungsreich anlegen wollten.“ Scheinbar jedermann hat unter kühnster Missachtung alles Vorhandenen gebaut. Das Ergebnis ist ein Sammelsurium unschöner, bestenfalls zweckmäßiger Bauten.
Die Beziehung der beiden Eheleute verschlechtert sich. Dr. Kennicott erkennt nicht, dass seine Frau ihre kulturellen Bedürfnisse nicht erfüllen kann, sie ihrerseits ist nicht in der Lage zu verstehen, dass ihren Mann seine Arbeit als Landarzt durchaus erfüllt.
Später flieht Carol mit ihrem kleinen Sohn nach Washington, arbeitet als Sekretärin, tritt in die Gewerkschaft ein und kämpft gemeinsam mit Frauenrechtlerinnen. Aber Stumpfsinn regiert auch hier. Im Vergleich zu vielen anderen empfindet sich Carol jedoch jetzt nicht wie früher attraktiv und interessant, sondern eher verbraucht und unansehnlich. Niemand interessiert sich für sie. Nach einem Besuch ihres Mannes und kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes kehrt sie mit ihm gemeinsam nach Gopher Prairie zurück und akzeptiert nunmehr ohne Widerwillen das Leben dort.
Sinclair Lewis beobachtete scharf und schrieb schlicht und präzise. Als einem der Ersten gelang ihm mit seinem Roman eine Art soziologische Betrachtung des amerikanischen Mittleren Westens und des typischen Kleinstadtmilieus überhaupt, die bis heute an Aktualität wahrscheinlich nicht viel verloren hat.
3. Arthur Feiler
Im Juni 1982 entdeckte ich in der Oldenburger „Kunsthandlung Walter Menges“ das Buch, das mich mehr als alle anderen hier zitierten Bücher und Essays zu meinen eigenen Amerika-Analysen inspirieren sollte: den in rotes Leinen gebundenen und nach fast einem Jahrhundert noch heute in erstaunlich gutem Zustand befindlichen, 338 Seiten starken Band:
Arthur Feiler – „Amerika-Europa, Erfahrungen einer Reise“, New York, 1926
Feiler, ein deutscher Wirtschaftsjournalist, der 1879 in Breslau geboren wurde und 1942 in New York verstarb, beschrieb unter seinen vielen anderen, häufig wirtschaftlichen Themen immer wieder die ständige Unruhe und ewige Rastlosigkeit, das „Weiterziehenwollen“ des Amerikaners. Er zitierte dazu Sinclair Lewis:
„Es gibt außer bei den Intellektuellen und bei den reichen Leuten wenig Beständigkeit in der Wohnung wie in der Beschäftigung.“
Auch viele geistig tätige Menschen, sogar Geistliche, kennen kaum Pausen der Sammlung.
Viele würden versuchen, die Eintönigkeit ihres Lebens und die innere Leere im ehemals „kolonialen Land“ (Zitat Feiler) durch rastlose Tätigkeit zu überdecken. Aber ein dunkles, unklares Gefühl, dass nicht alles stimme, dass es anders und besser gehen müsse, bliebe. Daher zögen sie ruhelos von einem Stadtteil zum