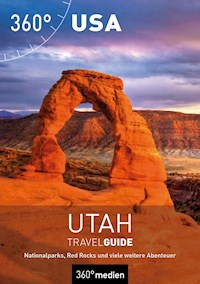10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie kämpft für das Leben bedrohter Tiere und setzt ihr eigenes aufs Spiel.
Für die 31-jährige Ava erfüllt sich ein Lebenstraum: Sie soll die bedrohten Berggorillas im Kongo erforschen. Doch das Leben im Virunga-Gebirge ist hart, und als Frau stößt sie auf Feindseligkeit. Allein der Kontakt zu den Menschenaffen, die sich schnell an ihre Gegenwart gewöhnen, spendet Trost. Als dann ihr Lager überfallen wird und Ava wegen einer Intrige ins Gefängnis muss, wird ihre Situation zunehmend brenzlig. Nur mithilfe des Tierfotografen Jack gelingt ihr die Flucht. Dabei kommen sie sich näher als sie dürften, denn Jack ist verheiratet ...
Eine mitreißende Geschichte voller Emotionen – inspiriert von dem Leben Dian Fosseys.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Eigentlich soll Ava als amerikanischer Filmstar Karriere machen. So hat es sich zumindest ihre Mutter immer gewünscht. Doch Ava hält nicht viel vom Glamour, und schon seit Kindertagen fühlt sie sich den Tieren weitaus verbundener als den Menschen. Als sie 1960 von den bedrohten Berggorillas im Kongo hört, ist das Feuer in ihr entfacht. Unermüdlich arbeitet Ava darauf hin, die Tiere eines Tages selbst aus nächster Nähe zu sehen – und sie vor Wilderei zu schützen. Schließlich fährt für ein Forschungsprojekt ganz allein in die Gebirge Virungas. Ava schließt innige Freundschaften zu den sanften Gorillas, während ihr die Menschen vor Ort eher misstrauisch bis feindselig begegnen. Einzig von dem verheirateten Tierfotografen Jake fühlt Ava sich verstanden. Doch nicht nur das – sie entwickelt auch Gefühle, die sie gegenüber einem vergebenen Mann auf keinen Fall haben sollte.
Über Claudia Seidel
Claudia Seidel hat nach einer Bankausbildung die Richtung gewechselt und Soziologie und Komparatistik in Hamburg und Berlin studiert. Nach vielen Jahren in Führungspositionen im Verlagswesen ist sie jetzt als Autorin und Autorencoach selbständig. Für das Buch »Die Tierforscherin« ist sie nach Ruanda gereist, um die Schauplätze des Romans hautnah selbst erleben zu können. Sie lebt mit ihrer Tochter in Hamburg.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Claudia Seidel
Die Tierforscherin
Sie sucht das Abenteuer und rettet die Tiere der Wildnis
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Hinweis
Prolog — Cambridge, England, September 1969
Der Anfang — Louisville, Kentucky, April 1966
Der ferne Kontinent — Kenia, Dezember 1966
Bei den Schimpansen
Ankunft
Herzklopfen
Ein jähes Ende, ein neuer Anfang
Auf der Flucht
Neuanfang
Erfolge und Niederlagen
September 1967
Zwei Silberrücken — Karisoke, November 1967
Freud und Leid
Erste Annäherung
Ein bisschen Glitzer
Der Ausflug — März 1968
Das Fest
Ein Neuzugang
Zwei neue Bewohner
Abschied
Erkenntnisse
Eine böse Überraschung
Zweifel
Schreie in der Nacht
Unruhen — Juni 1968
Ein verschollener Silberrücken
Das Wiedersehen
Der Vortrag — Karisoke, September 1968
Das Versprechen
Am Ziel — Cambridge, England, September 1969
Nachwort
Impressum
To all the fantastic people in Ruanda, especially Egide, Edgar, Benina and Innocent. I admire you in devotion!
Und für Annett
Dieses Werk wurde gefördert durch ein Hamburger Zukunftsstipendium der Behörde für Kultur und Medien in Zusammenarbeit mit der Hamburgischen Kulturstiftung.
Prolog
Cambridge, England, September 1969
»Verehrte Damen, werte Herren,
ich habe heute die Ehre, meine Doktorarbeit über das Sozialverhalten und die genetischen Strukturen der frei lebenden Berggorillas des Virunga-Gebirges vor Ihnen verteidigen zu dürfen. Mehr als zwei Jahre lang habe ich diese Feldforschung auf dreitausendsechshundert Meter Höhe betrieben. Tage und Nächte habe ich diese Tiere unter schwersten und herausforderndsten klimatischen Bedingungen beobachten, ›Freundschaften‹ schließen, Babys auf die Welt kommen, Tiere sterben sehen dürfen, Letzteres oft durch Menschenhand.
Je intensiver Sie die Würde dieser sensiblen, zärtlichen, tiefgründigen Tiere erleben, desto mehr möchten Sie den Kontakt zu Menschen vermeiden. Aber wie Sie sehen: Ich stehe vor Ihnen.«
An diesem Punkt erntete Ava Lacher. Das hatte sie einkalkuliert. Der Hörsaal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Sie hatte sogar gehört, dass ihr Vortrag per Lautsprecher auch in das Foyer übertragen wurde. Im Gegenlicht der Scheinwerfer konnte sie die Gesichter der Zuhörer nicht erkennen, sie wusste aber, dass Henry Winter, der Mann, der ihr all dies ermöglicht hatte, und auch ihr Doktorvater am Fachbereich Zoologie der University of Cambridge, Professor Dr. Robert Hinde, in der ersten Reihe saßen.
Sie hatte lange überlegt, welche Garderobe sie zu diesem Anlass wählen sollte – am Schluss hatten eine hochgeschlossene hellblaue Bluse und eine cremefarbene Bundfaltenhose sowie das türkis-rote Kitenge-Kleid, das sie vor einem Jahr mit Jake auf dem Markt in Kigali gekauft hatte, auf dem Bett ihres Hotelzimmers gelegen. Nun stand sie in dem traditionellen Gewand hier am Pult. Eine Verneigung vor Ruanda, nicht unbedingt vor seinen Menschen.
»Wir haben schwierige Zeiten gemeistert in Karisoke, einem Camp, das wir mit wenig mehr als dem, was Menschen mit ihren Händen leisten können, errichtet wurde. Angesiedelt auf dreitausendzweihundert Meter Höhe auf dem Sattel zwischen den Vulkanbergen Mount Visoke und Mount Karisimbi, wurde mir dieses feuchte und oft nebelverhangene Fleckchen Erde zur zweiten Heimat.
Wenig wusste man seinerzeit über die Big Apes, die größten unter den Menschenaffen. Mythen rankten sich um die Spezies, die angeblich weiße Frauen entführte und halb New York in Schutt und Asche legen könnte. Nichts, wirklich nichts, läge diesen friedlichen, vegetarisch lebenden Tieren ferner. Noch einmal: Sie sehen, ich stehe vor Ihnen!
Berggorillas leben in Familien, wie wir sie kennen. Die Mütter tragen ihre Babys vor der Brust, bis sie sechs Monate alt sind. Dann geht es auf dem Rücken weiter. Sie spielen, toben, tollen, groomen – säubern – sich gegenseitig das Fell. Ein Silberrücken wacht über seine Familie, beschützt sie und folgt dem Weg der saftigsten Blätter und Pflanzen. Aggressivität oder blutige Auseinandersetzungen, wie wir sie kennen, gibt es bei den Berggorillas nicht. Weswegen ich bestreiten möchte, dass der Mensch, in welcher Linie auch immer, von ihnen abstammen könnte … Das, was den Menschen oft ausmacht und ihn zu den finstersten Taten antreibt – Gier, Neid, Rache, Hochmut –, all das ist den Gorillas fremd.
Ich habe unter ihnen gelebt. Mit ihnen. Nicht umsonst eilt mir der Ruf der Nyiramacibily, der Frau, die allein in den Wäldern lebt, voraus. Aber so allein war ich nicht. Da waren die Gorillas, Mister. Strong, Major, Clark und seine Familien. Und natürlich das wunderbare Team im Research Center.
Gemeinsam haben wir ein Wissen über diese Spezies in die Welt gebracht, das die Öffentlichkeit weltweit aufgerüttelt hat. Die Wilderei – ein wirklich drängendes Problem im Nationalpark – wird heute stärker bekämpft denn je, auch ohne meine nicht immer gern gesehenen eigenen Maßnahmen …« Ava lächelte und vernahm zustimmendes Gemurmel. »Die Coverstory in der National Geographic vor einem Jahr konnte dank der wunderbaren Bilder des brillanten Fotografen Jake Evans …« Ava stockte kurz, »Sponsoren anziehen, die uns helfen, die Bestände im Virunga-Gebirge weiter zu stabilisieren und sogar zu erweitern. Heute leben etwa sechshundertfünfzig Menschenaffen auf einer Fläche von rund dreihundert Quadratkilometern über drei Länder verteilt, und dass sie heute als Schutzgebiet gilt, haben wir auch Ihnen zu verdanken.«
Ava machte eine Pause und nahm einen Schluck Wasser. Was jetzt kam, kostete sie alle Kraft. Ihre Hand zitterte. Niemand, wirklich niemand rechnete mit dem, was sie nun sagen würde.
Der Anfang
Louisville, Kentucky, April 1966
»Doktor Winter!« Atemlos eilte Ava durch das Foyer der Universität von Louisville. »Doktor Winter!«
Als sie vor einigen Wochen in der Zeitung gelesen hatte, dass der berühmte Primatenforscher ausgerechnet hier in Louisville einen Vortrag zum Thema Menschenaffen halten würde, hatte sie ihr Glück kaum fassen können. Und kein Termin hatte dicker in ihrem Kalender gestanden als genau dieser Samstag, der 16. April 1966.
»Doktor Winter«, rief sie ein drittes Mal und näherte sich langsam der Traube, die sich so dicht um den Wissenschaftler gebildet hatte, dass man ihn kaum noch sah – was bei seiner gebückten Erscheinung allerdings auch nicht verwunderlich war. Da hatte sie mit ihren ein Meter zweiundachtzig klar einen Vorteil. »Haben Sie meine Briefe erhalten? Mein Name ist Ava Carter, und ich möchte die Gorillas erforschen. Ich habe eben Ihren Vortrag gehört. Brillant! Ich weiß, dass Sie noch jemanden suchen.« Einige der Journalisten und Wissenschaftler drehten sich bei diesen Worten zu ihr um, und Ava errötete, als sie die amüsiert abschätzigen Blicke bemerkte. Sie konnte sich schon vorstellen, was sie von ihr, einer schlanken, fast schon dürren weißen Amerikanerin mit blasser Haut und Sommersprossen, dachten, wenn es um das Thema Leben im Busch ging. Doch Ava ignorierte die offensichtliche Skepsis. Stattdessen nutzte sie die Gelegenheit, die sich ihr heute eröffnet hatte. Sie wollte schließlich nicht ewig als Physiotherapeutin im Kosair-Kinderkrankenhaus bleiben. »Mister Winter, bitte … Sie müssen mir kurz zuhören.« Ava war über die Entschlossenheit in ihrer Stimme selbst ein wenig überrascht, aber sie zeigte Wirkung. Die Menge machte ihr Platz. Über den Rand seiner Brille hinweg musterte Winter kurz die blonde Frau mit dem hochgesteckten Haar, die ihn um einen Kopf überragte.
»Wie sagten Sie, war Ihr Name?«
»Carter, Ava Carter … Ich habe Ihnen geschrieben, und mein Freund George, George Sullivan, hat Ihnen von mir erzählt«, versuchte sie es.
»Waren Sie das, die mir in der Olduvai-Schlucht vor drei Jahren auf mein Giraffenfossil gekotzt hat?«
Ein paar der Journalisten lachten kurz auf, doch Ava schüttelte nur den Kopf. »Nein, Mister Winter. Das war ich nicht. Ich war noch nie in Afrika, geschweige denn in Tansania.«
Interessiert kam Winter einen Schritt näher. »Sie waren noch nie in Afrika und wollen ernsthaft die Gorillas erforschen? Nehmen Sie es mir nicht übel, junge Dame, aber das Leben im Dschungel ist nichts für ein verwöhntes Fräulein, das wilde Tiere bislang nur im Zoo bestaunt hat.«
Ava reckte ihr Kinn nach vorn. »Das ist eine höchst interessante Feststellung, Mister Winter. Sie zeigt mir, wie wichtig es ist, die Primaten besser zu studieren, sofern man dadurch auch den Menschen auf die Spur kommen will. Denn interessanterweise ist nichts von alldem, was Sie mir soeben unterstellt haben, korrekt: Ich bin keinesfalls verwöhnt. Das Gegenteil ist wohl der Fall. Und ich war nur ein einziges Mal im Zoo und wurde dort Zeugin eines zutiefst barbarischen Aktes menschlicher Grausamkeit gegen wehrlose Tiere. Gorillas, im Übrigen. Auch bin ich mit dreiunddreißig Jahren wohl kein Fräulein mehr. Und wenn ich mich recht erinnere«, Ava machte eine Pause und genoss die staunenden Blicke ringsum, »war Miss deBreun sogar erst einunddreißig, als sie nach Tansania ging. Ihr Forschungsprojekt im Kongo täte also sehr gut daran, schleunigst Gestalt anzunehmen. Und schauen Sie …« Ava öffnete ihre braune Ledertasche und holte ein Notizheft und ein abgegriffenes Buch heraus. Beides hielt sie Winter unter die Nase. »Ich lerne sogar schon Suaheli. Hier: Habari ya Siku, Ninaitwa Ava Carter.« Erwartungsvoll sah sie ihn an.
Winter nahm sich nun die Brille ab. Avas kleiner Vortrag hatte seine Wirkung nicht verfehlt. »Was sagten Sie … Sie haben mir Briefe geschrieben?«
»Sechs an der Zahl, ja, Doktor Winter.«
Winter nickte. »Und was glauben Sie, zeichnet ausgerechnet jemanden wie Sie aus, auf dreitausend Meter Höhe isoliert vom Rest der Welt und umgeben von wilden Tieren und noch wilderen Menschen allein bei sechs Grad in einem feuchten Zelt zu schlafen, nicht wissend, was der nächste Tag bringen wird und ob sie ihn überhaupt überleben wird?«
Ava hielt seinem Blick stand und legte ihre ganze Überzeugungskraft, all ihr Wollen und Sehnen in die Antwort. »Ich vermute, dasselbe wie Sie, Doktor Winter, oder wie Cynthia deBreun: Ich will verstehen, wer ich bin.«
Winter wiegte den Kopf hin und her. »Soso … Und was verstehen Sie von Ihren Vorfahren?«
Fragend sah Ava ihn an.
»Was wissen Sie über die Menschenaffen?«
Diese Frage hatte sie erwartet. Und ihre Antwort war die dünnste und ehrlichste, die sie ihm geben konnte: »Außer dass sie die prachtvollsten Geschöpfe dieser Erde sind, meinen Sie? Nun, ich denke, wenn ich schon alles über sie wüsste, würde ich nicht vor Ihnen stehen und alles dafür tun, um nach Zentralafrika zu reisen und es herauszufinden.«
Ava meinte ein leichtes Schmunzeln in Winters Gesicht erkannt zu haben. »Ich überlege es mir«, sagte er nur und setzte sich in Bewegung.
»Wann höre ich von Ihnen?«, rief Ava ihm nach.
»Schreiben Sie mir noch einen Brief«, sagte er im Gehen. »Und lassen Sie sich Ihren Blinddarm rausnehmen, falls Sie noch einen haben. Sie können sich da im Dschungel eine Menge Ärger ersparen.«
Der kleine Tross entfernte sich, und Ava blieb verblüfft zurück. Den Blinddarm rausnehmen? Sollte das ein Witz sein? Und wieso hatte er sie überhaupt nicht nach ihren Vorkenntnissen gefragt? Damit hatte sie fest gerechnet und war bereit gewesen, ihm ein nicht vollständig abgeschlossenes veterinärmedizinisches Studium vorzugaukeln. Zwei Semester waren es ja immerhin gewesen, bis sie in Physik und Chemie durch die Prüfungen gerasselt war. Und ihre Arbeit mit behinderten Kindern hier in Louisville könnte man im weitesten Sinne auch als Verhaltensforschung werten. Aber nichts von alledem hatte ihn interessiert. Je klarer ihr das wurde, desto lauter frohlockte Ava innerlich. Also, wenn es weiter nichts war, als sich den Blinddarm rausnehmen zu lassen und wetterfeste Kleidung einzupacken, dann sollte es daran wohl nicht scheitern. Mit einem Lächeln verließ sie das Gebäude, setzte sich auf die Stufen vor der Fakultät und zündete sich eine Zigarette an. Die Luft war trotz der frühen Jahreszeit noch immer angenehm warm, und auch die Steine strahlten die Wärme des Tages ab. Hier und da kreuzte ein Dozent oder ein später Besucher der Bibliothek den kleinen Campus der Universität. Würde sie all das bald hinter sich lassen? Vermissen würde sie es nicht. Das wusste sie schon jetzt. Ihr Job machte ihr Spaß, keine Frage. Aber Erfüllung fand sie darin nicht. Und für Shep und Brownie, ihre beiden Pflegehunde, mit denen sie etwas außerhalb der Stadt in einem kleinen Haus am Waldrand lebte, würde sie schon ein anständiges Zuhause finden.
Einen Moment überlegte sie, ob sie Lester anrufen und ihn auf ein Bier treffen sollte. Doch sie verwarf diesen Gedanken sofort wieder. Mit Lester war es … kompliziert. Und speziell heute war er sowieso sauer auf sie.
»Ava, meine Mutter hat dich explizit persönlich eingeladen. Das ist doch eine bedeutsame Geste«, hatte er vor einer Woche zu ihr gesagt.
»Ja, lieber Lester, und ich habe mich explizit persönlich bedankt und ihr gesagt, dass ich an diesem Tag leider keine Zeit habe«, hatte sie erwidert.
»Weil du zu einem Vortrag von irgend so einem Anthropologen willst. Das konnte ich ihr wohl schlecht erklären. Mein Onkel ist nach vier Jahren endlich mal wieder aus Südafrika zu Besuch, und meine Verlobte hat keine Zeit.«
Ava verdrehte die Augen. »Er ist Paläoanthropologe, das ist ein Unterschied. Und weißt du, wenn du deine südafrikanischen Wurzeln nicht immer verleugnen würdest und dich nicht amerikanischer geben würdest als der letzte texanische Viehtreiber, hättest du deinen geliebten Onkel ja längst mal in Südafrika besuchen können. Da wäre ich sicher gern dabei gewesen. Aber davor hast du ja Schiss! Nur habe ich keine Lust, bei eurem Theater mitzumachen und der stolzen Mama zuliebe die Vorzeigebegleitung zu spielen!« Die Sache mit der Verlobten hatte sie unkommentiert gelassen. Sie hätten sowieso einfach nur gute alte Freunde bleiben sollen.
Ava schüttelte den Kopf. Dieses Bier würde sie heute Abend allein trinken. Und morgen einen Brief an Professor Winter schreiben. Den siebten.
Sie stand auf und ging hinaus in die milde Nacht, aus der in der Ferne das Rattern einer dieser schier endlos langen Güterzüge zu hören war.
Ava stand auf der Veranda ihres gelb gestrichenen Holzhauses und fächelte sich mit einem Strohhut Luft zu. Schon um sieben Uhr früh war es an diesem Augustsamstag so heiß, dass sie beschloss, jetzt sofort mit den Hunden eine Runde zu drehen. Sie würde nicht, wie die letzten drei Monate über, erst auf Callie, die Postbotin, warten in der Hoffnung, endlich Nachricht von Dr. Winter zu erhalten.
Der zehn Jahre alten Shep machte die Hitze ohnehin zu schaffen, da war ein früher Gang besser. Sie schnippte nach den beiden Hunden und marschierte über die nahe gelegenen, bereits von emsig surrenden Bienen bevölkerten Wiesen zu dem kleinen Buchenwäldchen, das sich hinter einem Hügel anschloss. Von hier aus sah man nur einzelne Häuser in der Ferne, wie weiße Tupfen, und Menschen traf man hier so gut wie nie. Auch deswegen beschwerte sich Ava nie über die beinahe einstündige Fahrt nach Louisville zu ihrem Arbeitsplatz im Krankenhaus. Die Weite und die saftige Natur waren das, was ihr hier in Kentucky am besten gefiel.
Sie waren gerade im kühlen Schatten der Bäume angekommen, wo Brownie es sich schon gemütlich machte, als Shep, der eigentlich zu alt und zu träge zum Jagen war, Witterung aufgenommen hatte und wie ein Blitz durchs Dickicht schoss. Eine halbe Stunde musste Ava ihn rufen und suchen, bis er schließlich hinkend und mit blutiger Vorderpfote angehumpelt kam. Offensichtlich war er in einen dicken Akaziendorn oder einen rostigen Nagel getreten. Ava sah sich die Wunde kurz an und wusste, dass sie genäht werden musste und eine Tetanusspritze fällig war.
Pünktlich um neun Uhr stand sie bei Dr. Morrisson vor der Praxis. Es war zum Glück nichts Schlimmes, aber Shep, der früher über Jahre in einem viel zu kleinen Zwinger mit anderen Hunden gehalten wurde und panische Angst vor Enge hatte, gebärdete sich wie ein Verrückter und musste sediert werden, damit der Doc überhaupt an die Wunde herankam.
So war es fast zwölf Uhr, als sie, ohne Kaffee oder Sandwich im Magen, mit dem noch halb benommenen Hund wieder zu Hause war. Genervt betrat sie die Veranda, und wäre da nicht der leuchtend pinke Notizzettel gewesen, wer weiß, ob sie den Brief überhaupt gesehen hätte. Aber da lag er, mit einer Nachricht von Callie: Is it this you are waiting for?
Noch bevor sie das Haus betrat, riss sie den Luftpostumschlag mit den Marken aus Kenia auf.
Liebe Miss Carter,
ich hoffe, Sie sind wohlauf und noch im Vollbesitz Ihres Blinddarms. Eine Arbeitskollegin wäre hier neulich fast an einer Entzündung gestorben, denn, Sie müssen wissen, Penicillin finden Sie im Kongo nicht so einfach um die Ecke wie bei Ihnen in Louisville. Dennoch war es meine Art des Eignungstests. Eigenwillig, ich weiß. Aber auf meine alten Tage bin ich ja auch ein Fossil, nicht wahr? Ich musste einfach wissen, wie weit Sie bereit sind zu gehen, um sich dem mit Sicherheit faszinierendsten, aber auch entbehrungsreichsten Abenteuer zu stellen, das Ihnen das Leben bieten wird. Und auch wenn Sie sich noch keine Vorstellung machen können, so habe ich doch beschlossen, Sie, Miss Carter, dazu einzuladen … Ihr Biss ist bewundernswert, Ihre Halsstarrigkeit fast anstrengend, aber ich sehe etwas in Ihren Augen, das mich überzeugt.
Ava zitterten so die Hände, dass sie kaum weiterlesen konnte. Sofort dachte sie an die Hepatitis- und Gelbfieberimpfungen, die sie sich vorsichtshalber schon mal hatte verabreichen lassen. Drei Tage lang war ihr danach elend zumute gewesen. Sie ließ sich in die Hollywoodschaukel sinken. Stand hier wirklich geschrieben, was sie zu lesen glaubte? Würde Winter tatsächlich sie, die ewige Außenseiterin, in die Regenwälder Zentralafrikas schicken, um dort eine Spezies zu erforschen, der bislang noch kaum ein Mensch wirklich nahe gekommen war?
Avas Augen huschten über die restlichen Zeilen: … Finanzierung durch National Geographic gesichert … zwei Jahre … Abreise frühestmöglich … Treffen in Nairobi … Hochachtungsvoll, Ihr Henry Winter
Mit einem spitzen Schrei, der die Hunde zusammenzucken ließ, sprang Ava von der Schaukel und drehte sich dreimal trommelnd im Kreis. »Wraaaagh«, brüllte sie den hügeligen Weideflächen Kentuckys entgegen. »Ich fahre«, rief sie, »ich fahre!« Und dann, ein wenig ruhiger: »Ich komme! Ich komme! Und die Welt wird es zur Kenntnis nehmen.«
Mit diesem Versprechen an sich selbst lief sie ins Haus und hob den Hörer vom Telefon im Flur ab.
Es klingelte dreimal, bis sie die vertraut rauchige Stimme hörte.
»Hi Mom, ich bin’s, Ava.« Sie räusperte sich. »Wie geht es dir?«
»Wie soll’s mir schon gehen? Wie immer«, war die gelangweilte Antwort. Ava meinte, ein leichtes Lallen zu hören. Mittags um eins. Ihr Elan, ihrer Mutter die Neuigkeit zu überbringen, verflog sofort wieder. Was für eine blöde Idee.
»Also … ich«, fuhr sie etwas sachlicher fort, »ich habe ein Forschungsprojekt im Kongo angenommen und werde Amerika noch in diesem Jahr verlassen. Vielleicht für immer.« Am anderen Ende der Leitung, in Kalifornien, vernahm sie das Geräusch klirrender Eiswürfel.
»Bist du jetzt völlig verrückt geworden?«, blaffte ihre Mutter. »Hundertmal habe ich dir die Chance geboten, hier in Hollywood ein paar der besten Regisseure und Produzenten der Welt kennenzulernen, aber meine stolze Tochter war sich ja immer zu fein dazu. Und jetzt willst du auch noch durch die Weltgeschichte reisen? Du bist ja echt völlig verrückt!«
Es knackte in der Leitung, und Ava war klar, dass ihre Mutter, die ewig verkannte Glenn Carter, einfach aufgelegt hatte. Ava schloss für einen Moment die Augen und atmete tief aus. Was hatte sie auch erwartet?
Wie gern hätte sie auch ihren Vater angerufen. Sie war sich sicher, dass er sich am ehesten mit ihr gefreut hätte. Von ihm hatte sie wohl einen Teil ihrer Abenteuerlust und ihrer Freiheitsliebe geerbt. Zumindest erinnerte sie sich, wie sie gemeinsam mit Captain Ahab auf Walfang gegangen waren oder zusammen den isländischen Vulkan Snæfellsjökull bestiegen hatten, um von dort aus zum Mittelpunkt der Erde zu reisen. Der Tag, als ihre Mutter ihr sagte, nun würde »Vadder« nie mehr aus dem Krankenhaus nach Hause kommen, war ein Donnerstag gewesen. Es hatte geregnet. Ava war damals gerade vierzehn Jahre alt gewesen, und unter einer »seltenen Muskelkrankheit« hatte sie sich nicht viel vorstellen können. Unter dem Begriff »nie mehr nach Hause« schon. Heute dachte sie, dass ihr Fernweh auch mit seinem Tod zusammenhängen könnte. Als könnte sie den Vater an einem anderen Ort wiederfinden, nachdem sie ihn hier verloren hatte.
Sie ging in die Küche, schenkte sich drei Fingerbreit Whiskey in ein Glas, setzte sich erneut in die Hollywoodschaukel auf der Veranda und überlegte, ob es sonst jemanden gab, dem sie von der Nachricht erzählen konnte. Jemanden, der sich aufrichtig mit ihr freuen würde. Lester sicher nicht. Ihm würde sie es später berichten müssen. Mary fiel ihr ein, die Sekretärin im Kosair Charity’s Hospital, mit der sie sich nach der Arbeit gern auf einen Tee traf. George wäre auch gut, aber der war gerade in Peru unterwegs.
Ava seufzte und tippte mit dem Fuß auf den Boden, um sich etwas Anschwung zu geben. Eine warme Welle des Glücks durchströmte sie, und sie dachte, dass sie später den Gorillas davon erzählen könnte, wie lange sie auf diesen Moment gewartet hatte. Sie würden es verstehen. Auf ihre Art. Da war sie sich sicher.
Der ferne Kontinent
Kenia, Dezember 1966
Ava erwachte aus ihrem Dämmerschlaf, als sich das Flugzeug unter leichtem Rütteln langsam zu senken begann. Sie sah hinunter auf ein Meer aus roten und braunen Dächern, die wie Inseln aus den üppigen grünen Landschaften herausragten. Seit sie das amerikanische Festland verlassen hatten, war der Himmel wolkenlos gewesen. Sie hatte Glück. Von Dezember bis Februar war das Klima trotz der tropischen Einflüsse in diesen Breitengraden gemäßigt.
Die Morgensonne spiegelte sich auf der Tragfläche der Boeing, als sich das Flugzeug sanft seinem Ziel zubewegte. Ava erkannte erste Menschen, Radfahrer und einige wenige Autos, die sich ameisengleich auf den Straßen fortbewegten. Bunt sah es aus. Und staubig. Auffallend staubig.
Irgendwo da unten würde auch Henry Winter stehen und auf sie warten. Er hatte versprochen, sie vom Flughafen abzuholen, um mit ihr die nächsten Schritte und vor allem die ersten Aufgaben zu besprechen. Immerhin hatte sie auch noch zweitausendfünfhundert Kilometer vor sich bis in den Kongo. Etwas gewundert hatte sie sich schon, dass Winter ihr Nairobi als Ziel genannt hatte. Aber solange Winter und Richard Smith, der Tierfilmer von National Geographic, bei ihr waren, sollte das nicht ihre Sorge sein.
Mit einem leichten Schlag setzte die Maschine auf und verlor mit aufgestellten Bremsklappen auf dem Rollfeld sofort an Geschwindigkeit. Ein paar Marabus staksten mit ihren greis wirkenden Köpfen über die Rasenflächen des Airports, bevor die Maschine langsam links abbog, auf das Gate 24C zu. Landed würde das Display in der Ankunftshalle jetzt anzeigen. Aber für Ava war es viel mehr. Sie war angekommen.
Die Pass- und Zollkontrolle verlief erstaunlich geschmeidig, und sie musste keine ihrer vielen vorbereiteten Antworten geben. Im Gegenteil, die Beamten waren ausnehmend freundlich, und nur wenig später hielt sie ihren Reisepass mit dem kostbaren Stempel in den Händen. Das nachfolgende Ehepaar musste sie beinahe zur Seite drängen, so gebannt sah sie auf den Stempel mit der in blauer Tinte gedruckten Flagge. Die Farben, Schwarz, Rot, Grün, konnte man nicht erkennen, aber allein das Schild und die Speere im Zentrum des Motivs signalisierten ihr, dass sie wirklich da war. Angekommen an einem Ort, den sie bislang nur aus Erzählungen oder Magazinen kannte. Wie es wohl sein würde, die Luft nun zu atmen, das Licht zu sehen, die Geräusche wirklich zu hören?
Aufgeregt wartete Ava am Gepäckband auf ihre Koffer, passierte ohne Zwischenfall den Zoll und betrat die Ankunftshalle. Kurz schaute sie sich um, und als sie Winter neben einem Coffeeshop erblickte, winkte sie ihm mit weit in die Höhe gestrecktem Arm zu. Nötig gewesen wäre das nicht, denn als große weiße Frau war sie ohnehin kaum zu übersehen.
Winter kam auf sie zu, lüpfte kurz seinen Safarihut und wollte den Trolley übernehmen, worauf Ava mit einer heftigen Abwehrbewegung reagierte. In diesen drei Koffern steckte die Essenz ihres Lebens; die würde sie sicher nicht aus der Hand geben. Der Container mit weniger wichtigen Habseligkeiten war bereits vor zwei Monaten nach Nairobi verschifft worden, und Ava hoffte, diesen direkt am Gütergepäckschalter abholen zu können.
»Miss Carter, willkommen in Kenia«, sagte Winter und überging ihre vielleicht etwas rüde Geste. »Hatten Sie eine angenehme Reise?«
»Ja. Ja, unbedingt. Ich danke Ihnen«, erwiderte Ava etwas unbeholfen und klammerte sich an den Griff ihres Gepäckwagens. Ein paar Kinder hatten sich lachend auf ihre Koffer gesetzt, als wollten sie gefahren werden, aus unterschiedlichen Richtungen streckten sich ihr Hände entgegen. »Dollar! Dollar!«
Ava fuhr sich nervös durchs Haar und Winter fasste ihren Ellbogen, um sie aus dem Getümmel nach draußen zu geleiten. »Keine Angst. Sie sind eine Exotin! Die Leute bewundern Sie«, sagte er nur, und Ava beruhigte das verschmitzte Funkeln in seinen Augen, nicht aber seine Wortwahl. Weder wollte sie als Exotin gelten noch bewundert werden.
Als sie mit Winter den Vorplatz des Flughafengebäudes betrat, blieb Ava kurz stehen und atmete tief ein. Die Luft war warm und schwer, gesättigt von einer würzigen Süße. Es war anders, als sie es sich vorgestellt hatte. Auch dass sie nach nur fünf Minuten draußen in der Wärme bereits zu schwitzen begann, hatte sie so nicht erwartet. Diese feuchte Schwüle kannte sie aus Amerika nicht. Mit dem Ärmel wischte sie sich über die Stirn. Eine kleine Wolke schob sich vor die Sonne, was jedoch keine Abkühlung brachte. Auch wehte kein Lüftchen. Wie anders sich selbst Windstille anfühlen konnte, dachte Ava, wurde aber von Winter in ihren Beobachtungen unterbrochen, der sie zu einem mit blühenden Oleander bepflanzten Parkplatz manövrierte. Dort standen drei zerbeulte Jeeps, außerdem etwa ein halbes Dutzend Schwarzer Männer. Ava schluckte. Beschämt dachte sie an Lesters Worte zurück. »Du bist doch total naiv, Ava. Was glaubst du denn, was dich dort erwartet? Trommelschläge zum Sonnenuntergang und tanzende Frauen in bunten Kostümen, die dich willkommen heißen?« Verständnislos hatte Lester den Kopf geschüttelt. »Ganz Ostafrika war von den Europäern besetzt und kolonialisiert worden. Die Weißen sind die Ausbeuter. Hinzu kommen Bürgerkriege in den einzelnen Ländern, Armut, fehlende Bildung. Und dann du als weiße Frau, die sich um Affen kümmern will. Wach auf, Ava!«
Doch Ava hatte damals nur das Kinn stolz nach oben gereckt und Lester vorgeworfen, dass er selbst ja auch nicht wisse, wovon er spreche, er habe schließlich noch nie einen Fuß auf afrikanischen Boden gesetzt.
Wenn sie sich jetzt aber so umsah, in die Gesichter von Menschen, deren Ausdruck sie nicht deuten konnte, fragte sie sich, ob in Lesters Worten vielleicht doch ein Fünkchen Wahrheit steckte.
Als sie an den drei Wagen ankamen, blieb Winter stehen und nickte den Männern kurz zu. Einer von ihnen, ein untersetzter Mann mit einem Schlapphut, trat hervor. Auf seinem Gesicht erstrahlte ein breites Grinsen, das tiefe Lachfältchen um seine Augen herum sichtbar machte.
»Darf ich vorstellen: Das ist Sanwekwe. In ganz Ostafrika der vermutlich beste Tracker und Fährtenleser. Sie sollten ihn sich zum Freund machen, Miss Carter, denn ohne ihn sind Sie ziemlich aufgeschmissen …«
Ava schluckte trocken und hielt dem Mann die Hand hin. Das waren ja rosige Aussichten. »Ich freue mich, Sie kennenzulernen«, sagte sie fast fließend auf Suaheli, woraufhin sich der Mann kurz verbeugte, ihre Hand jedoch nicht ergriff.
Fragend schaute sie zu Winter hinüber, der kaum merklich den Kopf schüttelte.
»Es ist mir eine große Ehre, Miss Carter«, erwiderte Sanwekwe. »Meine Männer und ich werden gut auf Sie aufpassen.« Damit gab er den Blick frei auf fünf weitere Männer, deren Alter Ava schwer einschätzen konnte. Ein recht junger Bursche war dabei, knapp über zwanzig, schätzte Ava, wenn überhaupt. Er hielt den Kopf gesenkt und sah sie nicht an. Die anderen musterten sie jedoch unverhohlen. Einer von ihnen sagte etwas zu den anderen, worauf sie auf sie zeigten und lachten. Ava konnte es aber nicht verstehen. Es musste ein Dialekt sein, den sie nicht kannte. Mit einem strengen Blick brachte Sanwekwe sie zum Schweigen.
»Und dann wäre da noch Lily«, sagte Winter schließlich und klopfte dem Jeep auf das Stoffdach.
»Lily?«, fragte Ava.
»Ja, Lily, der Land Rover, der Sie in den Kongo fahren wird.« Ohne Avas Reaktion abzuwarten, schickte er sich an, die Fahrertür zu öffnen. »Nun, dann wollen wir mal«, fuhr er fort. »Ich habe mir erlaubt, zu veranlassen, dass Ihr Container direkt an den Mount Mikeno geschickt wird. Ich denke, bis Sie dort ankommen, sollte das Gepäck auch dort sein.«
Ava aber war wie angewurzelt stehen geblieben. »Sie meinen das doch nicht ernst, Mister Winter?«
»Was?«, fragte er beinahe unbekümmert. »Und nennen Sie mich doch endlich Henry, jetzt, wo wir immerhin so eng zusammenarbeiten, wenn man so will …«
»Sie wollen mich ernsthaft in dieser …«, Ava zeigte auf den staubigen, zerkratzten und an manchen Stellen auch verbeulten Range Rover, »… Rostlaube allein durch halb Afrika schicken?«
Als wäre er beleidigt, strich er mit dem Finger über den Lack des Geländewagens und hinterließ dabei einen dunkle Spur. Um den Schmutz loszuwerden, rieb er sich Daumen und Zeigefinger. »Also, so würde ich Lily niemals nennen. Sie hat erst sechzigtausend Kilometer runter. Und glauben Sie mir, in einem nagelneuen Mercedes würden Sie gefährlicher reisen. Aus vielen Gründen … Nun kommen Sie schon. Richard Smith und Susan warten auf uns. Sie erholen sich jetzt erst mal ein paar Tage und machen sich dann auf den Weg. Sanwekwe und seine Männer werden Sie begleiten. Von allein kann also keine Rede sein. Sie haben doch keine Angst?« Erwartungsvoll sah er sie an. »Noch ist Zeit. Wir können Ihnen direkt einen Rückflug buchen.«
Ava spürte, wie ihr trotz der Wärme kalte Schauer über den Rücken liefen. Wenn es eine Option für sie nicht gab, dann die, unverrichteter Dinge wieder nach Hause zu fahren. Ein Zuhause, das ohnehin nicht mehr existierte.
»Von Angst kann keine Rede sein, Mister Winter … Henry …«, erwiderte sie entschlossener, als sie sich fühlte, denn trotz der Sonne und des blauen Himmels konnte sie ein gewisses Gefühl der Beklommenheit nicht verhehlen. Davon aber musste Winter nichts merken. »Ich dachte nur, ich dachte, dass Sie mich begleiten und am Anfang mit im Lager sein würden.« Jetzt, wo sie es aussprach, wurde ihr klar, wie absurd dieser Gedanke war. Winter würde keine Gorillaforscherin anheuern, wenn er die Arbeit letztlich selbst erledigen würde. Er war ja auch nicht bei Cynthia deBreun oder Birutè Galdikas. Kurz sah sie zu Sanwekwe, der seelenruhig seine Pfeife stopfte. Ihn schien das Ganze nicht weiter anzufechten. Und wenn der versierte Fährtenleser so unbesorgt war, dann konnte sie es ja wohl auch sein. Er kannte sein Land und würde sicher nicht in den Wagen steigen, wenn er fürchtete, es könnte das Letzte sein, was er tat.
»Nun gut«, sagte sie kurzerhand und drängte sich an Winter vorbei. »Aber dann fahre ich! Und zwar von Anfang an.« Herausfordernd hielt sie ihm die Hand hin, und er legte bereitwillig den Schlüssel hinein. »Haben wir das also auch geklärt«, sagte er zufrieden. »Sehr schön.«
Es dauerte eine Weile, bis sich die Blechlawine, in der sie sich im Schritttempo und begleitet von Hupkonzerten durch das nicht enden wollende Nairobi Richtung Südosten quälten, endlich aufgelöst hatte. Über eine schmale, aber asphaltierte Bundesstraße und vorbei an einigen aus Wellblech gezimmerten Häusern erreichten sie schließlich eine grüne, hügelige Zone. Spätestens da bereute es Ava, selbst am Steuer zu sitzen. Ständig glitt ihr Blick rechts und links von der Fahrbahn. Sie besah sich knorrige Eukalyptusbäume, Papyrusfelder in den feuchten Ebenen, Frauen, die lachend und mit ihren Kindern vor und hinter sich ganze Ernten oder Matratzenlager auf dem Rücken trugen, und staunte über spektakuläre Ausblicke von den Erhöhungen hinab in die Täler. Eine Gruppe Grüner Meerkatzen kreuzte unbehelligt die Fahrbahn, so dass Ava, deren Aufmerksamkeit gerade bei den Baumkronen lag, eine Vollbremsung hinlegen musste.
Nach dreistündiger Fahrt hatten sie ihr Ziel in Narok, einer selten hässlichen Stadt an der östlichen Seite des Masai-Mara-Nationalparks, erreicht. Die Unterkunft der Smiths war einfach, aber heimelig, ein kastenförmiges, alleinstehendes Haus über zwei Etagen mit Gittern vor den Fenstern, an denen Bougainvilleen emporrankten. Ein kleiner Garten, umgeben von einer mit Glasscherben gesicherten weißen Mauer.
»Henry, alter Freund, wie schön, dich endlich mal wieder begrüßen zu dürfen, und dich erst, Sanwekwe.« Mit diesen Worten kam Richard freudestrahlend auf die beiden Männer zu, um sich dann ihr zuzuwenden. »Und Sie sind das Wunderkind aus den USA, nicht wahr? Willkommen in Kenia«, sagte er überaus herzlich.
Ava sagte gar nichts. Sie merkte, wie der Flug, die Fahrt hierher, all die neuen Eindrücke sich wie ein bleierner Schleier über sie legten. Sie wurde plötzlich unendlich müde, was wiederum Susan, die Frau des Hauses, zu merken schien. Sie war groß gewachsen, fast so groß wie Ava, nahm sie an den Schultern und führte sie zu der Sofa-Ecke im hinteren Wohnbereich. »Meine Liebe, Sie schlafen ja beinahe im Stehen ein. Möchten Sie noch eine Erfrischung oder lieber direkt nach oben ins Bett?«
»Ein Wasser wäre nett, danke.«
Dankbar nahm Ava das Zitronenwasser, serviert in einem geschnitzten Holzbecher, entgegen und lehnte sich in dem tiefen Sitz zurück. Es war schön, den warmen Stimmen und dem Gelächter folgen zu dürfen, ohne selbst etwas sagen zu müssen. Sie lauschte Richards Schilderungen über die Gnu-Wanderung in der Masai Mara, die offenbar spektakulärer zu sein schien, als Ava vermutet hätte. Er reichte ein Foto herum, das eine Gnu-Herde beim Durchqueren eines schlammigen braunes Flusses zeigte. Erst auf den zweiten Blick erkannte man, wie eines von ihnen am Hinterteil von einem Krokodil ins Wasser gezogen wurde. »Die National Geographic war völlig aus dem Häuschen!«, meinte Richard begeistert und erntete einen strafenden Blick von seiner Frau, die offenbar Schonzeit für Ava angeordnet hatte.
Ava bekam jedoch ohnehin nur die Hälfte mit. Immer wieder fielen ihr die Augen zu, und als die Rede dann auf die diversen Stammeskämpfe und Flüchtlinge kam, die vor allem aus dem Kongo und Ruanda kommend nach Kenia oder Uganda strömten, da schaltete ihr Gehirn förmlich in den Autopiloten. Sie hätte sonst beschämt zugeben müssen, wie wenig sie überhaupt von dem Land wusste, in dem sie großspurig die Big Apes erforschen wollte.
Um kurz nach neun löste sich die Gruppe auf, und Ava war auf ihr Zimmer gegangen. Der Raum war sauber und einfach, mit einem Holzschrank, einem Bett und einem Nachttisch, aber er verfügte über ein Waschbecken mit fließend kaltem Wasser. Das schien Ava schon jetzt ein echter Luxus zu sein, denn auf dem Weg vom Flughafen hierher hatte sie alle paar Kilometer Wasserstellen gesehen, an denen die Menschen, Frauen, junge Männer, Kinder, mit großen gelben Kanistern Schlange standen, um sich ihre zwanzig Liter abzufüllen.
Ava wollte das Gefühl zwar nicht aufkommen lassen, aber so ganz konnte sie eine gewisse Bedrücktheit nicht leugnen. Alles hier war fremd und neu, und wenn sie jetzt an die Bilder von Sonnenuntergang und Savanne dachte, musste sie zugeben, dass sie sich von einer gewissen Romantik hatte einfangen lassen, mit der man in Amerika dieses Land nun einmal verklärte. Mit der Realität hatte das zunächst wenig zu tun. Würde sie einen Zugang finden? Würde sie in alldem noch ihre eigene persönliche Schönheit entdecken? Seufzend drehte Ava sich auf die Seite und zog ihre Beine an den Bauch. Jetzt bloß nicht zaghaft werden, sagte sie sich in Gedanken. Die erste Nacht ist immer schwierig, aber man kann ja nicht mit der zweiten anfangen. Und mit diesem Gedanken glitt sie doch langsam in das Reich der Träume.
Bei den Schimpansen
Es dauerte ganze sechs Tage, bis Ava, Sanwekwe und Richard, der sich sehr zu Avas Freude bereit erklärt hatte, sie bis nach Gombe zu begleiten, an der Forschungsstation von Cynthia und Albert deBreun angekommen waren. Nach den ersten vier Tagen hatte Ava das Gefühl, ihren Hintern nicht mehr zu spüren, so dermaßen wurden sie Kilometer für Kilometer auf einer Straße, die man noch nicht mal Schotterpiste nennen konnte, durchgeschüttelt. Steinbrocken, gefühlt so groß wie ein halber Block zum Bau einer Pyramide, und Schlaglöcher, die ähnlich tief waren, hatten die Fahrt nicht nur sehr langsam, sondern eben auch extrem holprig gemacht. Konnte Ava sich zu Beginn an der roten Erde, auf der sich immer wieder Baboons, Zebras und auch Warzenschweine tummelten, gar nicht sattsehen, nahm sie sie schon bald kaum mehr wahr und musste aufpassen, dass ihr nicht total übel wurde.
Kaum hatten sie die Grenze zu Tansania überschritten, wurden die Straßen schlagartig besser. Sie waren nicht gut, aber wenigstens aus festem Sand oder Kies, teilweise sogar aus Asphalt.
»Ja, das ist das Erbe der Deutschen. Die sind ja bekanntlich sehr gründlich«, hatte Richard gescherzt, dabei aber nicht gelächelt. Auf Avas fragenden Blick hin hatte er ihr erklärt, dass Tansania eine ehemals deutsche Kolonie war, bevor erst die Belgier und dann die Engländer »Deutsch-Ostafrika« übernahmen. 1961 erkämpfte sich das Land die Unabhängigkeit zurück.
Wieder einmal musste Ava sich mit einem Anflug von Scham eingestehen, wie arglos sie sich auf diese weltumspannende Reise begeben hatte, und gelobte innerlich Besserung.
»Miss Carter. Wie schön, dass Sie den Abstecher in unser bescheidenes Reich gewagt haben. Herzlich willkommen in Gombe. Mein Freund Henry hat mir schon so viel von Ihnen erzählt.« Cynthia deBreun reichte ihr lächelnd die Hand, ihr Blick blieb aber merkwürdig taxierend.
»Vielen Dank, Miss deBreun. Aber ich glaube, die Ehre liegt eher auf meiner Seite. Ich habe ja noch nichts bewirken können. Ihr Name hingegen steht bereits heute für eine große Forscherin und Friedensbotschafterin.« Ava sah ihr fest in die Augen. Cynthia war etwas genauso groß wie sie selbst. Hochgewachsen und schlank, mit einer langen hervorstechenden Nase und einem leichten Überbiss. Ava erinnerte sie an eine Krähe.
»Papperlapapp, nun kommen Sie erst mal rein. Sie müssen entsetzlich erschöpft sein.« Sanwekwe und seine Männer waren noch draußen bei den Wagen gewesen, um sie auf mögliche Schäden zu untersuchen. Richard hingegen war bereits in den behaglichen Wohnraum gegangen, der ganz mit hellem Holz ausgekleidet war – der Boden, die Wände, die Säulen, die das Dach hielten –, und hatte sich einen Drink eingegossen, als würde er hier ein und aus gehen. Ava machte ein paar zaghafte Schritte. Es roch gut, nach Holz und Erde, und das Feuer im Kamin knisterte behaglich. Auf dem Boden lagen bunte, handgeknüpfte Teppiche, die Couch war mit hellem Leinen bezogen. Die Masken an den Wänden und die Fotos von Schimpansen signalisierten deutlich, wo sie hier war. Dazu passte, dass von draußen kein Sonnenlicht hereindrang, nur der sattgrüne Ton großer Dattelpalmen und mannshoher Kaffeebüsche. Es hätte Ava nicht gewundert, wenn eine Horde Affen direkt durch Cynthias Wohnzimmer spaziert wäre. Trotzdem gab es etwas, das Ava missfiel, sie konnte aber nicht sagen, was es war.
Wie auf Kommando tauchte plötzlich eine kleine drahtige Frau mit weißer Schürze im Salon auf. Ihre Haare hatte sie zu kleinen, eng am Kopf liegenden Zöpfen geflochten, und ihre Haut war so dunkel, dass Ava die Augen kaum sehen konnte.
»Tee?«, fragte Cynthia nur, und ohne eine Antwort abzuwarten, nickte sie der Bediensteten kurz zu, die mit einem Knicks sofort lautlos verschwand. »Mein Mann ist ja Belgier«, fuhr Cynthia fort, »aber ich gebe zu, dass ich meine englischen Wurzeln nicht gut verbergen kann. Richard, möchtest du auch eine Tasse oder bleibst du beim Whiskey?«
Lächelnd hob Richard Smith sein Glas.
»Na dann«, sagte Cynthia nur und bot Ava einen Platz an. »Sind wir wohl nur zu zweit. Edward kommt erst zum Dinner. Er ist noch im Dorf.«
In Ermangelung einer passenden Erwiderung nickte Ava nur und setzte sich auf einen der großen ausladenden Sessel, die zum Sofa passten.
»Aber nun erzählen Sie doch mal. Was bringt eine so junge Frau dazu, sich einem solchen Abenteuer auszusetzen?«, fragte Cynthia, nachdem die Hausangestellte, die Cynthia mit Lala ansprach, den Tee serviert hatte.
Ava versuchte, ein Stirnrunzeln zu unterdrücken. Von welcher jungen Frau war hier die Rede? Ava wusste, dass Cynthia ein knappes Jahr jünger war als sie selbst und bereits seit fünf Jahren hier lebte.
»Nun, ich vermute, dasselbe wie Sie, oder? Ich möchte eine unbekannte Spezies erforschen, die mehr mit uns gemein hat, als wir denken. Die uns in vielerlei Hinsicht vielleicht sogar überlegen ist.«
Cynthia zog die Augenbrauen hoch. »Überlegen? Das müssen Sie mir näher erklären. Wir sprechen doch beide von den Primaten, oder?«, erwiderte Cynthia und nahm seelenruhig einen Schluck aus der feinen Porzellantasse.
Ava spürte, wie ihr langsam die Hitze in den Kopf stieg. Sie konnte nicht behaupten, dass Cynthia ihr sympathischer wurde.