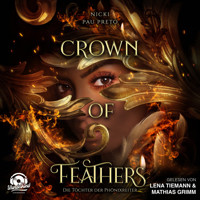6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Töchter der Phönixreiter-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Ein Mädchen, ein Phönix, ein Bund für die Ewigkeit
Einst wurde das Reich von Pyra von mächtigen Phönixreitern regiert. Bis der Krieg zwischen zwei königlichen Schwestern das Land zerriss.
16 Jahre später träumen die Kriegswaisen Veronyka und ihre ältere Schwester Val davon, selbst Phönixreiter zu werden. Doch als Val Veronyka aufs Schlimmste hintergeht, beschließt Veronyka, sich alleine auf die Suche nach den letzten verbliebenen Reitern zu machen. Auch wenn das bedeutet, dass sie sich als Junge verkleiden muss. Gerade als Veronyka das Gefühl hat, in den Reihen der Phönixreiter akzeptiert zu werden, kehrt Val zurück und enthüllt ein Netz aus Lügen, das alles für immer verändern wird.
Eine epische Fantasy über furchtlose Phönixreiter, das Band zwischen Schwestern und die Macht der Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 804
Ähnliche
NICKI PAU PRETO
Die Töchter der Phönixreiter
Aus dem Englischen von Gabriele Haefs
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2021 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
© 2019 by Nicki Pau Preto
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Crown of Feathers« bei Margaret K. McElderry Books, an imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division, New York
Aus dem Englischen von Gabriele Haefs
Lektorat: Stefanie Rahnfeld
Covergestaltung: © Alexander Kopainski, www.kopainski.com, unter Verwendung mehrerer Motive von © Shutterstock.com (Eduard Muzhevskyi / hideto999/kzww / Jingjing Yan / BCFC)
sh · Herstellung: UK
Satz und E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-641-24572-6V005
www.cbj-verlag.de
Für meine Mutter,
die rothaarige Kriegerkönigin, die
mich nicht nur das Fliegen gelehrt hat,
sondern auch das Kämpfen
Was taten die großen Helden,
als die Sonne vom Himmel stürzte?
Sie sprangen auf die wilden Flammen
und lernten fliegen.
Altes pyrenisches Sprichwort
Ich hatte einmal eine Schwester. Wenn ich damals gewusst hätte, was ich jetzt weiß, hätte ich mich vielleicht entschieden, sie nicht zu lieben. Aber gibt es bei Liebe wirklich jemals eine freie Wahl?
– Kapitel 1 –
Veronyka
Veronyka sammelte die Knochen der Toten ein.
Wildbret, am Spieß gebraten und rußgeschwärzt, Rippen, so lange geschmort, bis sie brüchig und trocken waren wie Treibholz. Sie grub durch verfaulte Salatblätter und Kartoffelschalen nach winzigen, messerscharfen Fischgräten und hohlen, zarten Vogelknochen.
Der kleine Euler, der auf ihrer Schulter hockte, stieß angesichts der neuesten Entdeckung vor Ekel einen leisen Schrei aus. Veronyka brachte das Eulenmännchen behutsam zum Schweigen, legte die Vogelknochen zu den anderen in ihren Korb und richtete sich auf.
Es war später Abend, die kühle Nachtluft kündigte Frost an. Die Gassen im Dorf waren leer und still, und niemand bemerkte das einsame Mädchen, das die Abfallhaufen durchwühlte. Die Wolken über ihnen leuchteten eisengrau, verdeckten den Vollmond und machten es fast unmöglich, in der Dunkelheit etwas zu sehen. Deshalb hatte Veronyka sich den Euler zu Hilfe geholt. Seine Augen sahen in der dunklen Nacht einfach alles und mit einem kleinen gedanklichen Anstupser zeigte er Veronyka den Weg über Stein und Felsbrocken und unter tief hängenden Zweigen hindurch. In ihrer Hast stolperte sie trotzdem immer wieder; Val hatte gesagt, sie müsse sich beeilen, und sie war nicht dumm genug, ihre Schwester warten zu lassen.
Aufregung und Erwartungen prickelten in ihren Adern, aber auch eine ziemliche Menge Furcht – würde diese Nacht endlich die Nacht sein?
Ihr Atem bildete Wolken vor ihrem Gesicht, als sie zurück zu der Hütte ging, die sie und Val miteinander teilten. Die Hütte war klein und verlassen gewesen, als sie sie gefunden hatten, die hellblaue Farbe blätterte von der Tür, und die Fensterläden waren zerbrochen; vermutlich war die Hütte während der wärmeren Monate beim Jagen benutzt worden und stand in der regnerischen Winterzeit leer. Das Wetter wurde jedoch mit jedem Tag trockener und heißer, sie würden also nicht mehr lange bleiben können. Ein weiteres Zuhause, das sie gefunden und verloren hatten.
Als die Hütte in Sichtweite kam, verkrampfte sich Veronykas Magen. Die dicke Rauchsäule, die bei ihrem Aufbruch aus dem Schornstein gequollen war, war jetzt nur noch ein dünner, gespenstischer grauer Faden. Die Zeit lief ihnen davon.
Sie rannte die letzten Schritte, und die brüchige Holztür knallte gegen die Mauer, als sie sich in das einzige Zimmer drängte. Alles war dunkel bis auf das orange Flackern der schwelenden Asche. Der Rauchgeruch hing schwer in der Luft und der Aschegeschmack lag bitter auf ihrer Zunge.
Val stand vor der runden Feuerstätte mitten in der Hütte und drehte sich um, als sie Veronyka kommen hörte. Ihre Miene zeigte Ungeduld und Aufregung, als sie ihr den Korb aus der Hand riss und dessen Inhalt anstarrte.
Sie schnaubte unzufrieden. »Wenn du nichts Besseres zustande bringst …«, sagte sie, ließ den Korb achtlos fallen, sodass sich die Hälfte der Knochen auf dem festgetrampelten Lehmboden verteilte.
»Du hast gesagt, ich soll mich beeilen«, widersprach Veronyka, schaute an Val vorbei und sah, dass das Feuer unter einer neuen Reisigschicht heiß und flach brannte. Darin waren jedoch nicht die gekochten oder am Spieß geschwärzten Knochen von Tieren. Sondern große weiße.
Knochen, die wie Menschenknochen aussahen.
Val folgte ihrem Blick und beantwortete die nicht gestellte Frage: »Und trotzdem hast du so lange gebraucht, da habe ich mich selbst auf die Suche gemacht.«
Trotz der Hitze lief Veronyka ein Schauer über den Rücken.
Sie zupfte an dem schweren wollenen Umhang, den sie sich um die Schultern gelegt hatte, und der Eulenpfadfinder, den sie völlig vergessen hatte, plusterte sein Gefieder auf.
Diese Bewegung erregte die Aufmerksamkeit ihrer Schwester. Veronyka erstarrte, ihre Muskeln spannten sich an, als sie auf Vals Reaktion wartete. Würde ihre Schwester durchdrehen, wie es so oft geschah, oder würde sie die Anwesenheit des Tieres durchgehen lassen?
Der Euler zuckte nervös und trat unter Vals Blick von einem Fuß auf den anderen. Veronyka versuchte, das Tier zu beruhigen, aber ihre eigene Besorgnis verursachte ihr eine Gänsehaut. Gleich darauf schlug der Euler seine Krallen in ihre Schulter und glitt dann lautlos aus der noch offenen Tür.
Sie schloss die Tür und ließ sich Zeit, ehe sie sich zu ihrer Schwester umdrehte; sie hatte Angst vor dem Streit, der jetzt sicher kommen würde. Val und sie waren beide Animagen – sie konnten Tiere verstehen und mit ihnen kommunizieren –, aber sie hatten sehr unterschiedliche Ansichten über die Bedeutung dieser Tatsache. Val meinte, Tiere sollten als Werkzeug behandelt und benutzt werden. Beherrscht, bezwungen, kontrolliert.
Veronyka ihrerseits fühlte sich mit Tieren verwandt, nicht ihnen überlegen.
»Sie zu lieben ist Schwäche«, sagte Val warnend, mit dem Rücken zu ihr, als sie vor der Feuerstätte kauerte. Sie legte einige der kleineren Knochen aus Veronykas Korb in die wachsenden Flammen und stapelte sie sorgfältig um zwei glatte graue, von Ruß gestreifte und geschwärzte Eier herum. Die Eier lagen in der Glut, in einem Bett aus Knochen und Asche, Flammen züngelten rings um sie hoch.
Obwohl Veronyka Vals Gesicht nicht sehen konnte, konnte sie sich das Feuer in deren Augen vorstellen. Veronyka atmete langsam und leicht genervt aus. Sie führten dieses Gespräch nicht zum ersten Mal.
»Die Reiter haben ihre Reittiere nicht wie Schoßhündchen behandelt, die verwöhnt und verhätschelt werden sollten, Veronyka. Sie waren Krieger, Phönixeren, und ihre Bindung war nicht Liebe. Sondern Pflicht. Ehre.«
Phönixeren. Trotz Vals Tadel loderte in Veronykas Herz Erregung auf, wenn ihre Schwester die Phönixreiter erwähnte – Animagen, die eine Bindung mit Phönixen eingegangen waren. Die wörtliche Übersetzung des uralten pyrenischen Wortes war »Phönixmeister«, wie Val ihr oft vorhielt. Nur Animagen konnten Reiter werden, denn nur durch ihre Magie konnten sie diese sagenumwobenen Wesen zum Brüten bringen, sich mit ihnen verständigen und sie reiten.
Veronyka hatte sich niemals etwas anderes gewünscht. Sie wollte eine Phönixreiterin sein, wie die Kriegerköniginnen in alten Zeiten.
Sie wollte auf Phönixrücken durch die Luft jagen, wollte tapfer und angriffslustig sein, wie Lyra die Verteidigerin oder Avalkyra Aschenfeuer, die Königin mit der Federkrone.
Aber es war über sechzehn Jahre her, dass die letzten Phönixreiterinnen und Phönixreiter den Himmel des Goldenen Imperiums verschönert hatten. Die meisten waren im Blutkrieg gefallen, als Avalkyra und ihre Schwester Pheronia im Kampf um den Thron des Imperiums gegeneinander angetreten waren. Die übrigen waren später als Verräter des Imperiums gebrandmarkt, gehetzt und hingerichtet worden. Tiermagie ohne Erlaubnis und ohne hohe Steuern zu zahlen war als illegal erklärt worden, und Animagen wie Veronyka und Val mussten im Geheimen und im Schmutz leben, mussten ihre Fähigkeiten verbergen und immer Angst haben, gefangen genommen und in die Leibeigenschaft gezwungen zu werden.
In ihren großen Zeiten hatten die Phönixreiter vor allem als Schutztruppe gedient und für Veronyka war in ihrer Kindheit schon diese Vorstellung ein Leuchtfeuer der Hoffnung gewesen. Ihre Großmutter hatte ihr immer versprochen, dass die Phönixreiterinnen und Phönixreiter eines Tages zurückkehren würden. Eines Tages würde es keine Gefahr mehr bedeuten, eine Animage zu sein. Und nach dem Tod ihrer Großmutter hatte Veronyka sich geschworen, selbst eine zu werden. Sie wollte für andere arme, einsame, im Untergrund lebende Animagen das Licht in der Finsternis sein. Sie wollte die Kraft und die Möglichkeit haben, andere wie sich und Val zu verteidigen und zu beschützen. Die Kraft, die ihr gefehlt hatte, weshalb sie ihre Großmutter nicht beschützen konnte.
Vielleicht gab es die Phönixreiter als militärischen Orden nicht mehr, aber man brauchte nur zwei Dinge, um eine Phönixere zu sein: Tiermagie und einen Phönix oder eine Phönice.
Sie ging um Val herum und kniete neben der Feuerstätte nieder. Die Phönixeier, die dort lagen, hätten ungefähr ihre hohlen Hände gefüllt und waren in ihrer Farbe und Oberfläche Steinen so ähnlich, dass sie leicht übersehen werden konnten. Es sei ein Schutz, hatte Val gesagt, damit Phönixe ihre Eier insgeheim legen und sie jahrelang sich selbst überlassen konnten, bis sie – oder ein Animage – zur Brut zurückkehrten. Die Reiter versteckten Eier ebenfalls oft, sie legten sie in geheime Höhlungen innerhalb von Statuen und verborgenen Stätten, aber viele davon waren während des Krieges vom Imperium zerstört worden.
Veronyka und Val hatten jahrelang nach Phönixeiern gesucht – in jedem zerfallenen Tempel, jedem verlassenen Stützpunkt der Reiter und jedem vergessenen Gebäude, das sie finden konnten. Sie hatten Lebensmittel gegen Informationen eingetauscht, hatten gestohlene Gegenstände für Mitfahrgelegenheiten verkauft und andere Geschäfte gemacht, die Val sie nicht sehen lassen wollte. Nach dem Tod ihrer Großmutter hatte Val beschlossen, sie von Aura Nova, der Hauptstadt des Imperiums, nach Pyra zu bringen – aber das war nicht leicht gewesen. Wer sich seit Kriegsende aus dem Imperium hinausbegab, wurde streng überwacht, da viele von Avalkyra Aschenfeuers Verbündeten versucht hatten, nach Pyra zu fliehen, um der Leibeigenschaft oder Armut aufgrund der Magiersteuer zu entgehen. Pyra war früher einmal eine Provinz des Imperiums gewesen, hatte sich unter Avalkyras Herrschaft jedoch für unabhängig erklärt. Seit dem Tod der Königin mit der Federkrone war Pyra zu einer gesetzlosen, ziemlich gefährlichen Gegend geworden – aber es war für Animagen doch nicht so riskant wie das Imperium.
Ohne richtige Ausweispapiere hatten Veronyka und Val die Grenze nicht überqueren können. Außerdem waren sie Animagen – wenn ihre Magie entdeckt worden wäre, hätte das Leibeigenschaft bedeutet. Deshalb hatten sie durch das Imperium ziehen müssen, Val an der Spitze, Veronyka hinterher. Sie hatten in Straßengräben geschlafen, auf Dächern, im strömendem Regen und in sengender Sonne. Val verschwand häufig – manchmal für Tage – und kam dann mit Blut am Hemd und einem Beutel voller Münzen in den Händen zurück.
Es waren harte Zeiten gewesen, aber irgendwann hatten sie sich durch Bestechung einen Platz in einer Handelskarawane sichern können und waren nach Pyra geschmuggelt worden, in die Heimat ihrer Eltern. Veronyka war sicher gewesen, dass sich ihr Schicksal nun endlich gewendet hatte. Und nach mehreren langen Monaten war es so weit gewesen.
Val hatte in einem zerfallenden Tempel tief in der Wüste von Pyra zwei perfekte Phönixeier gefunden. Für jede eins.
Bei dem bloßen Gedanken daran traten Veronyka Tränen in die Augen, eine Gefühlsaufwallung, die sie zu unterdrücken versuchte. Immer wenn Val ihr begeistertes Lächeln bei der Aussicht darauf sah, was ihnen bevorstand, reagierte sie mit der kalten, harten Wahrheit: Manchmal schlüpfte nichts aus einem Ei. Manchmal entschied sich der Phönix im Ei gegen eine Bindung oder starb während des Brutprozesses.
Auch jetzt noch lächelte Val nicht und sie schien sich über den Anblick der Eier nicht zu freuen. Ihr Brutort war so düster wie der Scheiterhaufen bei einer Totenfeier.
Ein Knochen zerbarst in der Feuerstätte und eine Aschewolke stob hoch. Veronyka hielt den Atem an, um nichts Totes einzuatmen, und beschrieb auf ihrer Stirn einen Kreis.
»Hör auf«, fauchte Val, die es gesehen hatte, und schlug Veronykas Hand zur Seite. Ihr schönes Gesicht war eine strenge Maske, ihre warme braune Haut bemalt mit schwarzen Schatten und dem roten und orangen Widerschein des Feuers. »Wegen eines albernen Aberglaubens darf Axuras Auge nicht angerufen werden. Das ist etwas für Bauern und Fischer, nicht für dich.«
Val hatte nie viel Interesse an Religion gehabt, aber Axura war die Göttin, die die Pyrener – und die Phönixreiter – am tiefsten verehrten, deshalb erlaubte sie es Veronyka, Gebete oder Danksagungen zu sprechen. Doch sie hasste diese kleinen Aberglauben, rümpfte die Nase und tat so, als wären sie und Veronyka etwas Besseres als die Leute hier im Dorf und die hart arbeitende Bevölkerung, unter der sie ihr ganzes Leben verbracht hatten. Sie hatten kein richtiges Zuhause mehr, seit sie Kinder gewesen waren, und auch das war damals nur eine Hütte in den Gängen gewesen, dem ärmsten Teil von Aura Nova. Und jetzt hatten sie die Hütte von irgendwelchen Fremden besetzt. Was waren sie denn, wenn keine armen Leute?
»Hast du etwas gegessen?«, fragte Veronyka, um das Thema zu wechseln. Val machte wieder dieses fanatische Gesicht und hatte tiefe Ringe unter den Augen. Sie war erst siebzehn, aber wenn sie erschöpft war, wirkte sie viel älter. Leise entfernte sich Veronyka vom Feuer, um ihre Essensvorräte zu durchsuchen, die allmählich bedrohlich zur Neige gingen.
»Ich hab etwas von dem gesalzenen Fisch genommen«, antwortete Val, ihre Stimme klang fern, wie so oft, wenn sie zu lange ins Feuer gestarrt hatte.
»Val, wir haben seit zwei Tagen keinen Fisch mehr.«
Val zuckte ruckhaft mit den Schultern und Veronyka seufzte. Val hatte nichts mehr gegessen, seit sie die Eier gefunden hatte. Obwohl sie so intelligent und listig war, verlor sie doch oft den Überblick über die Alltagsdinge, aus denen das tägliche Leben bestand. Veronyka war diejenige, die das Essen kochte und die Kleider flickte, die dafür sorgte, dass sie genügend schliefen und aßen, und die das Haus sauber hielt. Vals Gedanken waren immer anderswo – bei längst verlorenen Menschen und Orten oder bei vagen Träumen und zukünftigen Möglichkeiten.
Bei ihrer Suche hob Veronyka nun einen Sack mit einem Rest Reis hoch. Sie würden etwas finden müssen, das sie am nächsten Tag im Dorf eintauschen könnten, oder sie würden Hunger leiden.
»Das werden wir nicht, das weißt du«, sagte Val in die Flammen.
Veronyka, die ihren Fehler sofort erkannt hatte, schloss die Augen. Sie hatte ihre Gedanken und Sorgen in die Luft projiziert, wo sie von allen – wo sie von Val aufgeschnappt werden konnten. Während viele in die Gedanken von Tieren sprechen konnten – das konnte unter zehn Menschen einer, sagte Val, auch wenn die Zahl in Pyra höher lag –, war ihre Fähigkeit, in Menschengedanken zu sprechen, seltener als ein Phönixei. Schattenmagen wurden sie genannt, und dass zwei Schwestern diese Fähigkeit besaßen, kam noch seltener vor. Anders als Tiermagie wurde Schattenmagie nicht vererbt, und soweit Veronyka wusste, hielten viele Menschen sie für eine Sage. Schattenmagie gab es angeblich nur in alten Geschichten und Heldengedichten, es war eine magische Fähigkeit, die den alten pyrenischen Königinnen und längst verstorbenen Heroen vorbehalten war.
Mit ihrer Tiermagie mussten sie vorsichtig sein, da sie im Imperium verboten war, aber wenn es um Schattenmagie ging, mussten sie sich noch viel mehr vorsehen. Die Menschen in Pyra ließen Animagen meistens in Ruhe, aber wenn irgendwer Val und Veronyka bei Schattenmagie erwischt hätte, würden sie fast mit Sicherheit den Behörden gemeldet werden. Für jede verlockende Sage über eine mächtige Königin der Phönixreiter mit der mysteriösen Fähigkeit, Lüge und Wahrheit zu unterscheiden, gab es auch eine warnende Geschichte über eine düstere Hexe, die Seelen verdarb und Gedanken kontrollierte. Das war fast alles Unsinn, nahm Veronyka an, aber die Menschen reagierten auf Dinge, die sie nicht verstanden, oft mit Abwehr und Misstrauen. Für sie und Val war es am sichersten, ihre Schattenmagie für sich zu behalten.
Das konnte Val natürlich nicht daran hindern, sie bei Veronyka anzuwenden, wann immer ihr das gerade passte.
Hüte deine Gedanken, sagte Val, und zwar nicht laut, sondern in Veronykas Kopf. Wie das Sprechen zu Tieren konnte Schattenmagie zur Kommunikation benutzt werden, aber auch dazu, den Willen eines anderen Menschen zu beeinflussen, um zu befehlen und zu kommandieren. Val machte das oft, um ihnen Essen oder Kleidung oder ein Dach über dem Kopf zu beschaffen, benutzte Schattenmagie bei Veronyka aber nur zur Kommunikation. Soweit Veronyka wusste. Sie konnte jedoch sehen, dass Val oft in Versuchung geriet, wenn Veronyka ihr nicht gehorchte oder nicht auf sie hören wollte, und ihr war klar, welche Gefahr eine dermaßen mächtige Fähigkeit bedeutete.
»Ich mach was zu essen«, teilte Veronyka mit, zog ihre Gedanken und Gefühle in sich hinein und richtete ihre geistigen Wände auf, um sie zu umgeben und zu beschützen, so, wie sie es von Val gelernt hatte. Meistens gelang es ihr besser, ihre Gedanken zu behüten, aber sie bewachten das Feuer jetzt schon seit zwei Tagen, und in ihrer Erschöpfung waren ihre Gefühle zu wund und zu dicht an der Oberfläche. Kochen würde sie von dem Aufflackern zitternder Erwartung und schmerzhafter Furcht abhalten, die sich in ihr immer wieder mischten. Je näher sie dem Schlupfaugenblick kamen, desto größer wurde ihre Angst, es könnte ein Fehlschlag sein und jede Mühe wäre umsonst gewesen.
Alles ruhte jetzt auf diesen beiden runden Steinen im Feuer.
Veronyka hob den schweren Tontopf hoch und hievte ihn an den Rand der Feuerstätte, während sie den Sack mit dem Reis unter dem Arm klemmen hatte. »Wir haben noch ein paar Zwiebeln und Dörrfleisch, um eine Suppe zu machen, und … Val?«
Veronyka nahm den Geruch versengten Stoffes wahr. Val hockte so dicht vor den Flammen, dass der Saum ihres Kittels rauchte, aber sie war bewegungslos wie ein Standbild und bemerkte die Hitze nicht, während ein stetiger Tränenstrom über ihre rußverschmierten Wangen lief.
Veronykas Herz krampfte sich zusammen. Sie schaute in die Flammen in der Erwartung, dort den Grund für Vals Kummer zu entdecken. Stattdessen war das leise Geräusch von vorsichtigem Kratzen durch das Zischen und Knacken des Feuers zu hören.
Mächtige, reine Hoffnung wogte in ihrer Brust auf.
Sie sah sich zu Val um und stellte die Frage – bat um Bestätigung.
Val nickte, ihre Antwort war kaum lauter als ein Flüstern: »Es ist so weit.«
Im Anfang waren Licht und Finsternis, Sonne und Mond – Axura und ihre Schwester Nox.
Axura herrschte über den Tag, Nox herrschte über die Nacht, und gemeinsam schufen sie ein Gleichgewicht.
Aber Nox war immer hungrig und wollte mehr. Sie fing an, sich tagsüber an den Himmel zu schleichen, und ließ ihre Kinder, die Strigae, Schatten über die Welt werfen.
Um sich gegen Noxens Übergriffe zu wehren, warfen sich Axuras Kinder, die Phönixe, in die Schlacht. Nur Licht kann Finsternis besiegen, und das taten sie und schlugen die Strigae wieder und wieder zurück.
Der Krieg dauerte viele Jahrhunderte und die Welt litt unter diesem Zustand. Aber Axura war weise, und in der Menschheit sah sie keine Untertanen, sondern Verbündete, um Seite an Seite zu kämpfen.
Auf dem höchsten Gipfel des Pyrmont nahm Axura Phönixgestalt an und wandte sich an die dort lebenden pyrenischen Stämme.
»Wer unter euch ist die Tapferste und Furchtloseste?«, fragte sie.
»Es gibt keine Tapferkeit ohne Furcht«, sagte Nefyra, die Anführerin ihres Stammes.
Axura war mit dieser Antwort zufrieden und bot Nefyra an, sie auf die Probe zu stellen. Als Glaubensprobe entzündete Axura ein baumhohes Feuer und forderte Nefyra auf, in die Flammen zu treten.
Das tat Nefyra und sie verbrannte bei lebendigem Leibe. Aber ihr Tod war nicht das Ende.
Sie trat als Stammesführerin ins Feuer und heraus als Animage, als Schattenmage und als Erste Reiterkönigin.
»Nefyra und die Ersten Reiterinnen«, aus:
Die pyrenischen Epen, Band 1, circa 460 VI.
Ich bin eine Tochter des Todes. Ich tötete meine Mutter, als ich aus ihrem Leib gezogen wurde, ich erhob mich aus der Asche wie ein Phönix aus dem Totenfeuer.
– Kapitel 2 –
Veronyka
Veronyka und Val lagen auf Knien vor dem Feuer und sahen zu, wie im Ei ein winziger Riss entstand, der wuchs und sich ausbreitete, so kompliziert wie ein Spinngewebe, bis die Schalenstücke nur noch von einer dünnen Haut zusammengehalten wurden. Das Ei dehnte sich aus und zog sich zusammen, es pulsierte wie ein Herzschlag, und in den gezackten Öffnungen waren Teile von rotem Gefieder zu sehen. Das Ei erbebte und ein kleiner goldener Schnabel lugte hervor.
Veronyka zitterte am ganzen Leib – sie hätte gern geklatscht, gejubelt –, aber sie unterdrückte diesen Drang und blieb starr und unnatürlich still. Sie hatte Angst zu atmen, zu blinzeln, sie wollte nicht einen einzigen wundervollen Augenblick versäumen. Sie hörte ein Dröhnen, ein Rauschen in ihren Ohren, das alles auf der Welt außer ihr und diesem Ei in leeres weißes Nichts verwandelte.
Sie wusste nicht, wie lange sie schon zuschauten, aber Stunden – oder vielleicht Minuten – später barst das Ei endlich, und ein Phönix fiel seitlich in die schwelende Asche. Er war von einem leuchtenden, strahlenden Rot – eine Farbe, die Veronyka in ihrem Leben noch nicht gesehen hatte, heller als ein Edelstein, edler als gefärbte Seide.
Sie starrte das Wesen an, und der Jubel, der in ihr aufstieg, war vermischt mit tiefem und unendlichem Erstaunen – sie hatten es wirklich geschafft. Nach so langer Zeit hatten sie endlich einen Phönix schlüpfen lassen.
Als der Vogel mühsam auf die Beine kam, zischte und rauchte sein feuchtes Gefieder bei der Berührung mit der Holzkohle, auf der er gelegen hatte.
Veronyka, die für einen Augenblick vergessen hatte, dass sie einen Feuervogel vor sich hatte, dass die Hitze einem aus Asche und Flamme geborenen Wesen nichts anhaben konnte, keuchte auf und streckte die Hand aus. Val hielt ihre Hand fest und gab Veronyka einen Moment, damit ihr Gehirn ihren Körper einholen konnte.
Der Phönix stolperte über die Schalenreste, unbeeindruckt von der Hitze, dann stand er endlich fest da und drehte sich um, um Veronyka und Val anzusehen. Er sah aus wie jedes normale frisch geschlüpfte Vogeljunge – wackelig und unsicher, mit noch kaum vorhandenen Flügeln und einem schmalen, dünnen Hals, der den Kopf nur mit Mühe tragen konnte. Aber seine Augen … die waren groß und weit und aufmerksam.
Und sie fingen Veronykas Blick ein.
Sie atmete aus, ein letzter Lufthauch, der das Ende eines alten Lebens bedeutete – eines, das in Ziel und Reichweite klein gewesen war. Als Veronyka wieder Luft holte, war es der Beginn von etwas Neuem – einem Leben, das vom Wind zerzauste Haare, endlosen blauen Himmel und ein heißer als die Sonne brennendes Feuer verhieß. Ihre Finger prickelten, ihre Sinne waren geschärft, und die Welt lebte auf eine Weise, wie sie nie zuvor gelebt hatte. Veronykas Magie summte in ihr, pochte wie ein zweiter Herzschlag – oder vielleicht war es der Puls dieses Wesens, der im Takt ihres eigenen schlug.
In diesem Moment wusste Veronyka, dass Val recht gehabt hatte, was den Bund zwischen Animage und Phönix anging. Es war keine Liebe – ein solches Wort konnte nicht einmal den Versuch wagen, die Gefühle von Respekt und Zuneigung, von Vertrauen und gegenseitiger Abhängigkeit zu beschreiben, die zwischen Mensch und Tier existierten. Die Bindung war eine in den Sternen geschriebene Einheit, älter als das Imperium und das Tal und der Berg, älter als die Gottheiten, eine Verbindung, die nicht einmal der Tod erschüttern konnte. Endlos, grenzenlos und auf irgendeine Weise zeitlos war Veronykas Schicksal an dieses Wesen gebunden und sie würden immer zusammen sein.
Sie waren Verbündete.
Ein kühler Windhauch streifte ihre Haut und sie brach den Blickkontakt. In der Hütte leuchtete ein fahles Licht, die Tür stand weit offen. Val war nirgendwo zu sehen.
2 2 2
Einige Zeit später kehrte sie zurück. Mit gleichgültiger Miene brachte sie einen neuen Sack Reis, ein wenig Maismehl, gesalzenen Fisch und gedörrtes Wildfleisch, einen kleinen Tonkrug voll Honig und ein Säckchen Datteln. Die Datteln waren ein seltener Leckerbissen. Sie waren teuer und wuchsen nur in der Provinz Stel. Selbst Mais war in den Bergen nur schwer aufzutreiben, obwohl einige Bauern ihn auf den unteren Felsplateaus pflanzten.
Veronyka sprang auf, ließ ihren Phönix auf dem Boden sitzen und wischte sich die schweißnassen Handflächen an der Hose ab. Val lief oft davon, wenn sie außer sich war, und verschwand dann für Stunden – oder Tage –, ohne eine Erklärung abzugeben. Wenn Veronyka Glück hatte, dann brachte die Zeit Val dazu, sich zu beruhigen und ihren Zorn zu vergessen. Wenn sie kein Glück hatte, dann reifte und faulte Vals Zorn, während sie nicht zusammen waren, und wurde nur noch mächtiger.
Manchmal begriff Veronyka nicht einmal, was Vals Zorn erregt hatte – aber diesmal glaubte sie, es zu wissen. Der erste Phönix hätte Val gehören müssen – sie war die Ältere und sie hatte die Eier gefunden. Veronyka hatte Gewissensbisse, aber sie gab sich alle Mühe, sich davon nicht diesen wunderschönen, strahlenden Augenblick zerstören zu lassen. Val würde sich schon wieder beruhigen. Sie brauchten doch einfach nur auf das Schlüpfen des zweiten Vogels zu warten.
Der Phönix zwitscherte leise, als er am Rand der Feuerstätte herumpickte. Die Hitze hatte seine feuerroten Daunen in weichen Flausch verwandelt, und sein Schnabel und seine Füße waren golden wie die Phönixstatuen, die Veronyka als Kind auf dem Götterplatz in Aura Nova gesehen hatte – bevor sie abgebaut worden waren. Die Phönixreiter, ehemals Hüterinnen und Verteidiger des Imperiums, hatten ihren Posten verlassen und stattdessen Avalkyra Aschenfeuer Treue geschworen. Das machte sie zu Verrätern, sie und auch ihre Phönixe. Während Avalkyra die wahre Thronerbin war, hatte sie doch Verrat begangen und war schon als Verbrecherin abgestempelt gewesen, ehe sie alt genug war, um gekrönt zu werden, und danach war sie aus dem Imperium vertrieben worden. Die Gouverneure scharten sich hinter der unmagischen Schwester Pheronia zusammen, während Avalkyra in Pyra einen neuen Anfang versuchte. Sie und ihre Anhänger waren als »Rebellen« bezeichnet worden, die sich weigerten, dem Gesetz des Imperiums zu gehorchen oder sich für ihre angeblichen Vergehen zu verantworten. In den auf ihren Tod folgenden Jahren hatte das Imperium alles zerstört, das auf irgendeine Weise sie oder ihr Erbe zu unterstützen schien – vor allem alle Darstellungen von Phönixen.
Es war keine einfache Aufgabe, da Phönixe von den ersten Anfängen an zur Geschichte des Imperiums gehört hatten. Sie waren Symbole der königlichen Erbfolge und der höchsten Göttin des Imperiums – Axura, was in der Sprache der Händler, der üblichen Verständigungsform des Imperiums, zu »Azurec« geworden war. Aus einem Tempel nach dem anderen waren die Statuen entfernt und die Gebete verändert worden – Axura, die immer als Phönice dargestellt worden war, wurde vermenschlicht, und sogar Lieder, Gedichte und Theaterstücke, in denen Phönixe vorkamen, wurden verboten.
Obwohl sie mit diesem Prozess schon während des Blutkrieges begonnen hatten, hatte der Rat der Gouverneure Jahre gebraucht, um ihn zu vollenden. Veronyka hatte immer wieder kleine Hinweise darauf aufgeschnappt, dass die Phönixe weiterhin existierten, bis zu ihren letzten Tagen im Imperium vor einigen Monaten: verblasste Wandbilder, die unter einer abblätternden Farbschicht hervorlugten, oder bröckelnder Putz, der Glasmosaike freilegte.
Veronyka stellte sich oft vor, wie sie auf einem Phönixrücken an diese Orte zurückkehrte, wie sie die Farbe abkratzte oder die Platten vom Fußweg riss, um die darunterliegende Wahrheit freizulegen.
Sie fuhr zusammen, als ihr aufging, dass dieser Tagtraum nun durchaus Wirklichkeit werden konnte.
Veronyka beobachtete ihre Schwester wachsam; zuerst räumte Val die Vorräte weg, dann riss sie das Säckchen mit dem Maismehl mit den Zähnen auf, gab etwas davon in eine kleine Schale, rührte Honigtropfen darunter und erhielt eine feine, körnige Paste.
»Für den Vogel«, sagte sie endlich und nickte in Richtung des Phönix hinüber. »Später kann er dann Datteln und frisches Obst essen, wenn wir das auftreiben können.«
Val wusste alles, was es über Phönixe zu wissen gab, das verdankte sie ihrer und Veronykas Maiora, die zu ihrer Zeit Phönixreiterin gewesen war – eine der wenigen, die der Aufmerksamkeit des Imperiums entgangen waren, wenigstens für eine gewisse Zeit. Ihre Großmutter hatte so gern Geschichten erzählt, und während Veronyka sich für Schlachtepen und Romanzen interessiert hatte, hatte Val nach den praktischen Dingen gefragt.
Veronyka nahm Val, die ihrem Blick auswich, die Schale ab und stellte sie neben den Phönix auf den Boden. Der Vogel betrachtete die Mischung zuerst, ehe er den Schnabel in die klebrig-süße Mischung steckte. »Der andere wird doch auch bald schlüpfen, oder, Val?«
Val sah sich das steinähnliche Ei an, das zwischen den brennenden Kohlen thronte.
»Wird schon«, sagte sie ausweichend und schloss die Fensterläden mit einem lauten Klack.
Der Kopf des Phönix hob sich bei diesem Geräusch, aber dann wandte sich der Vogel schnell wieder seiner Mahlzeit zu. Die zerbrochenen Fensterläden sperrten die späte Vormittagssonne fast vollständig aus und die Hütte lag bis auf das warme Leuchten des Feuers in Dunkelheit.
Seltsam, dass sie nun zu dritt waren, wo es für die meiste Zeit ihres Lebens nur Veronyka und Val gegeben hatte. Ihre Eltern waren im Blutkrieg umgekommen, und ihre Großmutter, bei der sie eine Zeit lang gelebt hatten, war fast zehn Jahre später von einer wütenden Meute totgeschlagen worden.
Während die Zeit unmittelbar nach dem Krieg offenbar die schlimmste gewesen war, hatte es auch in den folgenden Jahren immer wieder Zwischenfälle gegeben – berühmte Reiter, die in ihren Verstecken aufgestöbert und vor Gericht gestellt worden waren, kleine Gruppen von Widerständlern, die zusammengetrieben und hingerichtet wurden –, und das hatte den Eifer des Imperiums neu entfacht. Der Rat – das leitende Gremium des Imperiums, das aus den vier Provinzgouverneuren sowie aus Gesetzesmachern, Bankiers, Grundbesitzern und anderen wichtigen politischen Anführern bestand – statuierte ein Exempel an allen, die sich nicht anpassten, und verhängte rasche und schwere Strafen. Die Animagen wurden immer ängstlicher und tauchten noch tiefer unter, während die, die sie durch den Krieg hassen gelernt hatten, noch gnadenloser Jagd auf sie machten und sie wieder an die Oberfläche zerren wollten.
Ein solcher Krawall war ihrer Großmutter zum Schicksal geworden. Er hatte nach einem Prozess vor dem Gerichtsgebäude angefangen und dann auf die Gänge übergegriffen, wo sich viele Animagen versteckt hielten.
Als ihre Maiora die Meute kommen hörte, hatte sie Veronyka und Val befohlen, zu fliehen und sie zurückzulassen. Die Mädchen waren klein und schnell gewesen und hatten aus dem Fenster und durch Gassen schlüpfen können, was der Großmutter unmöglich gewesen war.
Veronyka hatte sich geweigert und die alte, welke Hand ihrer Großmutter festgehalten. Als die Tür aufgebrochen worden war, hatte sich ihre Großmutter zu ihr umgedreht, so gelassen und Geborgenheit schenkend wie das Auge des Hurrikans.
»Beschützt euch gegenseitig«, hatte sie Veronyka ins Ohr geflüstert, ehe sie von ihr losgerissen und zur Tür geschleift worden war.
Val hatte einen Arm um Veronykas Taille geschlungen und sie weggezogen, aber Veronyka wollte einfach nicht schweigend verschwinden. Sie trat um sich und schrie und biss Val in den Arm, doch ihr Widerstand war zwecklos. Mit wildem Blick und voller Panik hatte sie zusehen müssen, wie ihre Maiora von der wütenden Menge verschlungen wurde. Sie wusste nicht, wie ihre Großmutter entdeckt worden war oder was sie verraten hatte, aber die Meute war dermaßen außer sich, dass mit ihr nicht zu reden war.
Val hatte Veronyka schließlich durch das kleine Fenster ihrer Behausung gezerrt und nur um ein Haar konnten sie den gierigen Händen der Menge entkommen.
Als sie vor dem Chaos flohen, hörte Veronyka in Gedanken immer wieder die geflüsterten Worte ihrer Großmutter. Beschützt euch gegenseitig.
Damals hatte sie das so verstanden, dass Val und sie aufeinander aufpassen sollten, aber je länger sie darüber nachdachte, umso stärker vermutete sie, dass ihre Großmutter noch mehr damit gemeint hatte. Angesichts von Hass und Angst und Tod hatte ihre Maiora von Liebe und Schutz gesprochen. Für Veronyka bedeutete auch das, eine Phönixreiterin zu sein. Die Reiterinnen und Reiter beschützten und verteidigten – und das wollte sie auch. So würde sie die Erinnerung an ihre Großmutter am Leben erhalten.
Doch damals hatte Veronyka ihre Schwester gehasst und sie verabscheut, weil sie ihre Maiora so einfach zurückgelassen hatte. Sie selbst hatte gekämpft, egal, wie erfolglos, Val hatte das nicht.
Später begriff Veronyka, dass Val genau das gewesen war, was sie beide zum Überleben gebraucht hatten. Veronykas Tränen und Panik hatten nicht geholfen. Vals Entschlossenheit und Gelassenheit hatten sie gerettet. Val war erst elf gewesen, als ihre Großmutter gestorben war – gerade mal ein Jahr älter als Veronyka –, und seither trug sie die Verantwortung für sie beide.
Als Val sich jetzt auf ihr Lager vor der Mauer legte, verkrampfte sich Veronykas Magen vor lauter Schuldgefühlen. Val hatte so viel für sie getan, hatte ihr mehr gegeben, als sie selbst jemals zurückzahlen könnte. Und jetzt hatte Val ihr einen Verbündeten gegeben – das größte Geschenk von allen.
Nach kurzem Zögern verließ Veronyka den Phönix – allein sich von ihm zu entfernen, war wie ein schmerzhaftes Ziehen an ihrem Herzen – und ging zu ihrer Schwester. Sie schliefen immer zusammen, weil es notwendig war oder wärmer oder weil es zu wenig Platz gab. Val hätte das niemals zugegeben, aber Veronyka wusste, sie taten es auch, weil es Trost schenkte.
Als sie sich an ihre Schwester schmiegte, lockerte sich der Knoten des Unbehagens, der sich nach Vals Verschwinden in ihr gebildet hatte. Beschützt euch gegenseitig. Egal, wie, das taten sie – und sie würden es immer tun. Val war schwierig. Sie war fähig zu Gleichgültigkeit und kalter Grausamkeit. Aber sie war auch Veronykas Schwester, der Mensch, den sie am meisten liebte und respektierte, und ja, auch fürchtete. Sie würden das hier durchmachen, wie sie alles in ihrem Leben durchgemacht hatten: zusammen.
Val hatte sich zur Mauer gedreht und Veronyka starrte ihren Hinterkopf an. Die langen dunkelroten Haare ihrer Schwester fluteten über das Lager zwischen ihnen, es war eine seltene und unter den braunhäutigen Pyrenern fast einzigartige Farbe. Das Licht des Feuers ließ die Strähnen leuchten und Perlen und bunte, in Dutzende von Zöpfen verflochtene Fäden funkeln. Diese Frisur war seit der Zeit vor dem Goldenen Imperium eine pyrenische Tradition, seit der Herrschaft der Königinnen, als Pyra von einer Folge von Kriegerinnen regiert worden war, allesamt Phönixreiterinnen. Männer und Frauen verzierten ihre Haare mit Edelsteinen oder gefundenen Erinnerungsstücken, um wichtiger Ereignisse zu gedenken.
Selbst nachdem Pyra dem Imperium einverleibt worden war, hatten Phönixreiter Phönixfedern und Obsidianstücke getragen und sich damit als Eliteklasse der Krieger gekennzeichnet. Jedes Stück vulkanischen Glases, das in den alten Zeiten oft für Speere und Pfeilspitzen benutzt worden war, stellte einen Sieg in einer Schlacht dar, zeigte Stolz und Erfahrung an. Avalkyra Aschenfeuer hatte angeblich so viele in ihren Haaren verknotet, dass sie ihre Haut zerschrammten und zerkratzten und ihren Schultern einen Umhang aus Blut auferlegten.
Inzwischen waren Zöpfe im Tal überaus selten zu sehen, denn die Verzierungen konnten als Zeichen für Loyalität den Phönixreitern und Avalkyra Aschenfeuer gegenüber betrachtet werden – und als Mangel an Loyalität für die Gouverneure des Imperiums. Val hatte sich geweigert, die Tradition aufzugeben, deshalb hatten die Schwestern fast ihre ganze Kindheit hindurch Kopftücher getragen. Die waren im Imperium üblich und halfen ihnen, sich unter die Menge zu mischen und zu verbergen, wer sie wirklich waren.
Zerstreut fuhr Veronyka mit den Händen durch Vals seidige rote Haare, die unbedingt Pflege gebraucht hätten. Knoten und Nester hatten sich zwischen den einzelnen Strähnen gebildet und viele Zöpfe lösten sich auf und wurden zu lang. Sie mussten in regelmäßigen Abständen erneuert werden, damit die schweren Perlen und Andenken nicht herausfielen, und da pyrenische Haare meistens glatt und glänzend waren, wurden sie mit Wachs oder Öl behandelt, um besser zu liegen. Wenn Veronyka das nicht für sie übernahm – und selbst das war etwas, das Val sich nur widerwillig gefallen ließ –, dann hatte ihre Schwester keinerlei Interesse daran, ihre Haare zu waschen, zu bürsten oder zu pflegen.
Während Vals tiefrote Tönung bei ihrem Volk begehrt war wie das feurige Gefieder des heiligen Phönix, waren Veronykas Haare einfach nur schwarz. Sie waren etwas kürzer als die ihrer Schwester, aber ebenso mit Zöpfen voller Glücksbringer und bunter Perlen versehen. Sie hatten sogar einige identische Zöpfe, die Veronyka manchmal hervorholte, um sich an alle Gemeinsamkeiten zu erinnern, die sie trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten hatten.
Sie fand die perlmuttern schimmernden Muscheln von damals, als die Maiora ihnen in den Fingern Schwimmunterricht erteilt hatte, dem Netzwerk aus Flüssen, das sich von der Hand aus verbreitete und an der Hauptstadt vorbeischlängelte. Dieses Gewässersystem wurde Hand Gottes genannt und speiste sich aus dem Fluss Aurys, der auf dem Pyrmont entsprang und in verschiedenen Armen ins Tal floss, um sich dann fast im gesamten Imperium zu verteilen. Ihre Großmutter hatte gesagt, alle Pyrener müssten im Aurys schwimmen lernen, dem Fluss ihres Heimatlandes, und näher als im Wasser der Finger könnten sie dieser Heimat nicht kommen.
Nach Wochen des Übens waren Veronyka und Val, deren junge Herzen von Entschlossenheit erfüllt gewesen waren, zum gegenüberliegenden Ufer des breitesten Fingers geschwommen, hatten vom Kieselstrand je eine Muschel aufgesammelt und waren zurückgekehrt. Val war schneller gewesen, natürlich, aber ausnahmsweise einmal hatte sich Veronyka deshalb nicht unterlegen gefühlt. Danach saßen sie am Ufer, mit leuchtenden Gesichtern und klappernden Zähnen, während ihre Maiora ihnen die Muscheln in die Haare flocht.
Mit einem sehnsüchtigen Seufzer ließ Veronyka die mit Muscheln besetzten Zöpfe los und suchte sich die hölzernen Perlen heraus, die sie in ihrer ersten Nacht in Pyra geschnitzt und bemalt hatten, und daneben die Baumwollfäden, die sie in Tinte und Asche getunkt und dann zur Erinnerung an ihre Großmutter in ihre Haare geknüpft hatten.
Jeder Zopf, jede Perle stand für eine Erinnerung an ihr gemeinsames Leben, verwoben in einen lebenden Behang, eine Bindung für immer.
Als Vals Atem regelmäßiger wurde, ließ Veronyka ihre Haare los, setzte sich auf und kroch zum Feuer hinüber. Lautlos durchsuchte sie die Asche am Rand der Feuerstätte, während der Phönix neugierig zusah. Sie sah durch ihre Bindung Bruchstücke seiner Gedanken – eine Folge von Bildern, Geräuschen und Empfindungen –, die die Welt um sie herum heller und interessanter zu machen schienen. Der Phönix war zu jung, um richtige Gedanken zu formen, aber schon jetzt war seine Nähe für sie eine Beruhigung.
Als sie das Gesuchte gefunden hatte – Teile von gebogener, gezackter Phönixeierschale –, suchte Veronyka sich ein nicht allzu scharfes Stück heraus. Sie legte es beiseite und holte die kleine Dose mit den Fäden und dem Wachs, das sie zur Pflege ihrer und der Haare ihrer Schwester benutzte. In der Dose lagen auch ein hölzerner Kamm, dazu Zwirn, Nadeln, eine Feile und anderes kleines Werkzeug. Veronyka suchte die Feile heraus und bearbeitete behutsam die scharfen Kanten der Eierschale, die um einiges dicker war als die normaler Vogeleier. Dann nahm sie eine Nadel, um vorsichtig ein Loch durch die dickste Stelle zu bohren, wie ihre Großmutter es mit den zarten Flussmuscheln aus den Fingern gemacht hatte.
Schließlich zog sie eine Haarsträhne von ihrem Nacken nach vorn. Sie wollte den Zopf nicht verstecken, aber er sollte auch nicht zu auffällig sein, für den Fall, dass er Val wütend machte. Sie würde sich sicher nicht über die Erinnerung daran freuen, dass Veronyka eine Verbündete hatte und sie nicht.
Noch nicht.
Wenn Val recht hatte, dann setzte der Bindungsprozess schon ein, ehe der Phönix überhaupt geschlüpft war; deshalb war es wichtig, während der gesamten Brutzeit in der Nähe zu bleiben. Jeder Phönix suchte sich seinen Verbündeten, bevor er auf die Welt kam, formte zuerst eine magische Bindung und dann eine physische. Und aus irgendeinem Grund hatte sich der erste Phönix für Veronyka entschieden.
Veronyka rieb sich handwarmes Wachs in die Haare, ehe sie zu flechten anfing, und die vertrauten Bewegungen linderten ihre Gewissensbisse ein wenig.
Val würde ihr verzeihen – das tat sie immer. Bald würde das zweite Ei schlupfreif sein und dann wäre alles in Ordnung. Sie würden ihre Phönixe zusammen großziehen und Reiterinnen werden, wie früher ihre Eltern – und ihre Großmutter.
Dieser Gedanke entzündete ein Feuer in Veronykas Bauch.
Mit Phönixen würden sie und Val problemlos das gesamte Imperium bereisen können. Sie würden natürlich vorsichtig sein müssen, aber sie würden bald andere wie sie selbst finden – Phönixeren, die sich versteckt hielten. Einst hatte es Hunderte gegeben. Und es würde wieder Hunderte geben. Zusammen würden die Reiterinnen und Reiter stärker sein, stark genug, um anderen zu helfen, und sie würden nicht mehr in Angst leben müssen.
Und wenn diesmal jemand wagte, Veronykas und Vals Tür aufzubrechen und ihren Lieben etwas anzutun, würde Veronyka kämpfen können. Was ihrer Großmutter passiert war, würde nie wieder einem Menschen passieren, der ihr wichtig war.
Veronyka war am Ende der Strähne angekommen, wickelte ein Stück Faden um den Zopf und befestigte das Schalenstück dann behutsam mit mehreren Knoten. Sie sah es an und dann den Phönix, der neben ihr auf dem Boden herumpickte. Nicht irgendein Phönix, sondern ihr Phönix.
Mit einem Lächeln hob sie ihren Verbündeten auf und kehrte zu Val ins Bett zurück. Der Phönix brachte nicht nur körperliche Behaglichkeit; Ruhe breitete sich über Veronyka aus wie eine warme Decke, und endlich kam der Schlaf.
Sie saß in einem sonnigen Zimmer voller weicher Teppiche, feiner Holzmöbel und mit Schriftrollen gefüllter Steinnischen. Eine Bibliothek. Veronyka war noch nie in einer Bibliothek gewesen und hatte niemals ein so schönes Zimmer gesehen, aber in ihrem Traum wusste sie, wo sie war; sie fühlte sich wie zu Hause.
Ihr gegenüber am Tisch saß ein Mädchen. Veronyka kannte dieses Mädchen nicht, es kam ihr jedoch bekannt vor – als ob sie sie schon früher im Traum gesehen hätte. Ihre dunklen Haare waren mit kunstvoll geschnitzten Perlen und funkelnden Edelsteinen verflochten, die Lippen konzentriert zusammengekniffen, während sie sich stirnrunzelnd durch eine Schriftrolle mühte.
Die Traum-Veronyka war begeistert von ihr – Liebe stieg in ihrer Brust auf, Belustigung und Zuneigung sprudelte aus ihrem tiefsten Herzen, ein Quell von Empfindungen, die jedoch nicht ihre eigenen waren. Sie sah das Leben einer anderen, einer, deren Körper sie jetzt bewohnte.
»Was ist einPhönovo?«, fragte das Mädchen verzweifelt. »Es sieht fast aus wie Phönix, aber am Ende hat es andere Buchstaben.«
»Denk an die Wurzelwörter«, sagte Veronyka zu ihrer eigenen Überraschung, und ihre Stimme klang ein wenig tadelnd – und eindeutig weiblich. »Wenn das halbe Wort aussieht wie ›Phönix‹, wie sieht dann die andere Hälfte aus?«
Das Mädchen schwieg für einen Moment und biss sich auf die Unterlippe. »Ovo … ovo… Ei!«, flüsterte sie, und ihr Gesicht leuchtete triumphierend auf. »Es ist also ein … Phönixei?«
Veronyka nickte und ihr Traum-Ich war mit dem Mädchen zufrieden. »Sie sind überaus selten, und es ist sehr schwer, sie auszubrüten. Sie symbolisieren das Leben, aber auch den Tod – es ist ein Kreis. Deswegen können sie wiedergeboren werden … Der Tod gibt ihnen Leben. Wenn sie nicht sorgfältig in der Asche der Toten ausgebrütet werden, holen sie sich das Leben anderswo, im Notfall sogar von ihren eigenen Brüdern und Schwestern.«
»Sie bringen sich gegenseitig um?«, fragte das Mädchen.»Ihre eigenen Geschwister?« Ihre triumphierende Miene wurde düsterer, misstrauischer und das Zimmer um sie herum wurde kälter.
Veronyka zuckte mit den Schultern, aber sie hatte das Gefühl, dass hier von mehr die Rede war als nur von Phönixen. »Sie schalten sich gegenseitig aus. Ein Tod für ein Leben. Das wird Gleichgewicht genannt,xe xie«, sagte Veronyka.
»Xe xie«war ein pyrenisches Kosewort und bedeutete »Süße«, »Süßer« oder »Liebling«. Als sie es hörte, dachte Veronyka, dass die beiden vermutlich miteinander verwandt waren. Schwestern, vielleicht.
Im Traumgang waren Schritte zu hören und beide Mädchen schauten zur Tür hinüber. Ihr gemeinsamer Nachmittag neigte sich dem Ende entgegen …
Der Traum verblasste, und Veronyka erwachte in der kalten, dunklen Hütte, während ihr Magen sich vor Entsetzen zusammenkrampfte.
Sie war schon ihr ganzes Leben lang von Visionen gequält worden. Es sei ein Symptom der Schattenmagie, sagte Val, weshalb sie ihre Gedanken immerzu hüten musste, selbst im Schlaf. Gedanken und Empfindungen anderer flogen durch die Luft wie Löwenzahnsamen und warteten nur darauf, sich in achtloseren Köpfen wie ihren einzunisten – oder von aufmerksameren wie denen von Val eingefangen zu werden. Bei Veronyka, der es schwerfiel, ihre Gedanken nachts zu blockieren, verwoben sich diese Gefühle zu seltsamen Träumen.
In Aura Nova, wo so viele Menschen in der Nähe gewesen waren, war es sehr viel häufiger passiert. In den Bergen war alles ruhiger gewesen, da sie nur Val zur Gesellschaft hatte – aber ihre Schwester hatte ihr erklärt, dass der Geist viele Höhlen hätte, in denen Gedanken und Erinnerungen für Jahre ausharren konnten, um dann irgendwann wieder aufzutauchen. Veronyka nahm an, dass sie deshalb in ihren Träumen dieselben Menschen manchmal wieder und wieder sah, als ob sie sich in ihr Bewusstsein gebohrt hätten und nicht wieder weggehen wollten.
Aber dieser Traum, wo immer er hergekommen sein mochte, ließ sie bis ins Mark frieren.
Val hatte oft über Gleichgewicht gesprochen. Ein Phönix konnte nicht aus dem Nichts geboren werden – entweder starb er, verwandelte seinen eigenen Leib in Asche, aus der er wiedergeboren werden konnte, oder er musste in der Asche anderer ausgebrütet werden. In der Wildnis waren Mütter gestorben, um ihren Jungen das Leben zu schenken, und sie legten nie mehr als ein Ei auf einmal. Die frühen Animagen auf dem Pyrmont hatten gelernt, wie man die Knochen von toten Menschen und Tieren verbrannte, um diese Wirkung zu erzielen, was die Phönixe länger leben und zahlreicher werden ließ als je zuvor.
Als Veronyka gefragt hatte, was passieren würde, wenn sie versuchten, ein Phönixei in einem normalen Feuer auszubrüten, ohne Knochen, die es nähren könnten, hatte Val eine schlichte Antwort gegeben: »Tod.«
Und plötzlich wusste Veronyka, warum aus dem zweiten Ei noch nichts geschlüpft war. Und schlimmer noch, Val wusste das auch. Sie hatten nicht genug Knochen für zwei Phönixe gesammelt, was bedeutete, dass Veronykas Verbündete Leben von anderswo hatte holen müssen … aus dem anderen Phönixei.
Mit vor Sorge verkrampftem Herzen versuchte Veronyka aufzustehen – und sah, dass Val über ihr stand, mit einer Axt in der linken Hand.
Dieser Anblick versetzte Veronyka zurück in die erste Nacht, nachdem sie, versteckt in einem Planwagen, das Imperium verlassen hatten. Sie hatten für die Nacht an einer Grenzschenke gehalten und Val und sie hatten im Holzschuppen schlafen müssen. Als ein Betrunkener aus dem Dorf hereingetorkelt war und grinsend über ihnen stand, hatte Val zu ihrer Verteidigung eine Axt gehoben.
Der Mann war zurückgetaumelt und hatte die Flucht ergreifen wollen, aber Val war ihm gefolgt.
Bei ihrer Rückkehr war es dunkel gewesen, aber Veronyka hatte gesehen, wie sie die Axt an einer Schürze abgewischt hatte, die an einem Nagel hing. Am nächsten Morgen waren Schürze und Axt verschwunden gewesen, und Veronyka hatte sich gefragt, ob sie sich das alles bloß eingebildet hatte – nur hatte Val ein funkelndes neues Taschenmesser und eine Handvoll Münzen, die sie am Vortag nicht gehabt hatte. Val hatte in der Schenke ein ausgiebiges Frühstück bezahlt, und dann hatten sie das neue Messer benutzt, um sich Holzperlen aus echten pyrenischen Bäumen zu schnitzen.
Später hatte Veronyka sich gefragt, woran diese Perlen wirklich erinnern sollten.
Die Axt, die Val jetzt in der Hand hielt, war eher ein Handbeil, aber die in der Dunkelheit funkelnde Schneide war so scharf wie die der Axt damals. Das Feuer in der Hütte war erloschen, und der Raum war so kalt und grau wie das zweite Ei, das noch immer in der Asche lag. Veronyka suchte nach etwas, das sie sagen könnte, aber Val hatte sich schon von ihr abgewandt. Ehe Veronyka begriff, was vor sich ging, zielte Val mit dem Beil auf das Ei und zerschlug es in zwei Teile.
Veronykas Luftschnappen wurde übertönt von dem Knirschen und Splittern und ihre Verbündete hob überrascht den Kopf.
Veronyka konnte nicht anders, sie musste trotz ihrer eiskalten Angst um Vals Beine herumlugen. Sie wusste nicht, mit welchem Anblick sie rechnen sollte – vielleicht den verkohlten Überresten eines Vogels? –, aber sie sah nur etwas Dichtes und Unauffälliges, wie die Innenseite eines geborstenen Steines. War das Ei denn jemals mehr gewesen als ein Stein?
Val stand nun wieder vor ihr. Sie wies mit dem Kinn auf den Phönix, der neben Veronyka lag, wollte ihn aber nicht ansehen.
»Du musst ihm einen Namen geben«, sagte sie.
»Es ist eine Sie, eine Phönice«, erklärte Veronyka. Sie wusste nicht, woher sie das plötzlich wusste, aber ihr Gefühl sagte ihr, dass es so war.
Der Phönix neben ihr zwitscherte leise und eine Flut aus Vorstellungen und Bildern brach über sie herein. Offenbar hatten sich die Gedanken des Phönix dank der Magie des Bündnisses über Nacht enorm vervielfacht und entwickelt. Die Gedanken des Phönix waren noch nicht die ausgeformten Vorstellungen eines menschlichen Geistes, aber sie waren auch nicht die kurzlebigen Eindrücke der meisten Tiere. Obwohl sich Animagen nur mit Phönixen verbünden konnten, hatten sie doch meistens auch Einfluss auf das Denken anderer Tiere, mit denen sie viel zu tun hatten. Pferde oder Arbeitstiere, die von Animagen angeleitet wurden, wurden oft klüger, so wie Menschen »klug« definierten, und waren leichter zu dressieren.
»Leuchtet ein«, sagte Val. »Weibliche Phönixe fühlen sich oft vom weiblichen Geist angezogen und umgekehrt. In der Regel entwickeln sie ihr Geschlecht während der Brutphase, abhängig von ihrem auserwählten Verbündeten.«
Veronyka nickte und streichelte mit dem Daumen den weichen Kopf der Phönice. »Ich glaube, ich werde sie Xephyra nennen.«
Val kniff die Augen zusammen. Sie starrte Veronyka lange an, ehe sie die Arme verschränkte und nachdenklich den Blick abwandte. »Pyr bedeutet auf Pyrenisch Feuer oder Flamme. Zusammen mit xe …«
»Süße Flamme«, sagte Veronyka und streichelte noch immer die seidenweichen Federn ihrer schläfrigen Verbündeten.
»Oder Schwester Flamme«, korrigierte Val, denn die Vorsilbe konnte auch »Bruder« oder »Schwester« bedeuten, es kam ganz auf den Namen an. Val hatte ihr alles über Sprache beigebracht, dazu Lesen und Schreiben, Sternenkunde, die Jahreszeiten und Geschichte.
Alles, was Veronyka wusste, verdankte sie Val.
Sie hielt für einen Moment den Atem an und fürchtete, diese Andeutung, der neue Eindringling könnte ihr so nahestehen wie eine Schwester, würde Vals Zorn erregen.
Endlich sagte Val: »Das ist ein Name, der einer pyrenischen Königin würdig ist.« Ihre Augen funkelten, als wäre das das höchste Lob.
Veronyka verspürte einen plötzlichen Stolz, weil ihre Schwester mit ihr zufrieden war, und doch hatte sie Angst, Val könne die Wahrheit gesagt haben und ihr selbst und ihrer Verbündeten stehe das gleiche Schicksal bevor wie den pyrenischen Königinnen: Feuer, Ruhm und – Tod.
Schließlich wünschten sich nicht alle die Rückkehr der Phönixreiter, auch wenn die Animagen überall im Tal und jenseits davon jubeln würden, wenn sie wieder flammende Phönixspuren über den Himmel zögen.
In Pyra wurde der Tod ebenso gefeiert wie das Leben. Nur durch ein Ende war ein Anfang möglich. Das war die Lehre des Phönix und es war die Lehre des Lebens überhaupt.
– Kapitel 3 –
Sev
Sev starrte die ganze Zeit auf seine Füße.
Es war eine Überlebensstrategie, ein Verteidigungsmechanismus – und eine Möglichkeit, um nicht schon wieder in einen dampfenden Haufen Lamakot zu treten.
Während der letzten sechs Monate hatte sich Sev nur schlecht in sein neues Leben als Soldat des Goldenen Imperiums hineinfinden können. Er hatte sich für diesen Weg schließlich nicht entschieden und ärgerte sich darüber, hier neben einer wilden Mischung aus Taschendieben, Mördern und armen Kindern ohne andere Möglichkeiten strammstehen zu müssen.
Sie erinnerten ihn daran, was er war: ein armer Dieb und Mörder.
Allerdings fand er es fast noch schlimmer, neben den Leibeigenen des Imperiums Dienst zu tun. Sie erinnerten ihn nicht nur an seine schlechtesten Seiten, sondern auch an seine besten – an den Teil von sich, den er zurückzulassen geschworen hatte. Den Teil, den er ersticken und unterdrücken musste, bis nur noch ein rauchender Docht übrig war. Sev mochte ein Animage sein, so wie sie, aber das bedeutete nicht, dass er wie einer leben musste – ein unbezahlter Knecht für den Rest seines Lebens.
Und er musste auch nicht wie einer sterben und Menschen hinterlassen, die ihn brauchten. Wie es seine Eltern ihm angetan hatten.
Natürlich brauchte niemand Sev. Dafür hatte er gesorgt. Als Kind, als seine Welt um ihn herum eingestürzt war, war ihm das als gute Idee erschienen. Niemanden lieben und sich von niemandem lieben lassen. Das tat nicht so weh. Er könnte morgen sterben und nicht eine Seele würde ihn vermissen.
Manchmal konnte er sich jedoch nur mit Mühe daran erinnern, wieso er es für eine gute Idee gehalten hatte.
Sev marschierte weiter, aber als die Füße vor ihm langsamer wurden, wagte er es doch, den Blick zu heben. Er und der Rest seiner Einheit – insgesamt zehn Soldaten, dazu fast ein Dutzend Leibeigener – begleiteten dreißig Lamas, die sie von einem Züchter im Hinterwald weiter unten am Pyrmont gekauft hatten, dem Berg, an dem die meisten Siedlungen von Pyra angelegt waren.
Es tat weh, wieder hier zu sein, so nah und doch so weit entfernt von zu Hause. Er hatte sich nach der Möglichkeit einer Rückkehr gesehnt, hatte das Imperium hinter sich zurücklassen wollen, hatte sich aber nicht vorgestellt, dass er auf diese Weise zurückkommen würde – als Soldat, der dem Imperium diente, das er doch hasste.
Es war diesem Imperium zu verdanken, dass Pyra nun ein verfluchtes Land mit verfluchten Menschen war. Der Kampf um Unabhängigkeit war mit Tausenden von Toten geendet – und dem Tod der Phönixreiter in ihrer ganzen feurigen Pracht. Dem Tod von Avalkyra Aschenfeuer, die ihre Königin hätte sein sollen, und der Schwester, die sie herausgefordert hatte.
Dem Tod von Sevs Mutter und Vater.
Jetzt lebten in Pyra Vertriebene und Leute, die im Blutkrieg gegen das Imperium gekämpft hatten, oder Animagen, die der Registrierung entgehen und sich ungestört ihrer Magie widmen wollten. Hier waren keine Gouverneure stationiert, es gab keine Gesetze oder Steuern oder auch nur Soldaten, um die Region zu verteidigen. In Grenznähe kam es häufig zu Überfällen, deshalb waren Sev und seine Kameraden in Lumpen gekleidet und trugen zusammengewürfelte Ausrüstungsgegenstände mit sich. Sie wollten nicht auffallen.
Sie waren ein Teil einer viel größeren Truppe, die ein ganzes Stück entfernt von der Pilgerstraße kampierte, der Hauptdurchgangsstraße durch Pyra. Sev und seine kleine Splittereinheit hatten ihre Wagen – die auf den steilen Nebenpfaden, die sie einschlagen wollten, unbrauchbar sein würden – gegen die trittsicheren Lamas eingetauscht, die gelehrige und sanfte Lasttiere waren, wenn man von den Unmengen an Kot absah. Die Einheit sollte vor Einbruch der Dunkelheit zum Regiment zurückkehren, was sie nur mit Mühe würden schaffen können.
Warum also hielten sie an?
Sev reckte den Hals und trat einen Schritt vor, aber ehe er sehen konnte, was anlag, versank sein Stiefelabsatz in einem warmen, glitschigen Haufen.
»Teyke«, murmelte er. Nur der Gott der Betrüger war imstande, ihnen immer wieder Kothaufen unter die Füße zu schieben.
Mit einem Gurgelgeräusch zog er seinen Fuß aus dem Haufen, dabei fiel sein Blick auf den neben ihm gehenden Leibeigenen, der seine Bemühungen stirnrunzelnd beobachtete. Der Leibeigene war ihm bekannt. Nicht, weil Sev ihn kannte, sondern weil er Sev immer zu beobachten schien – vor allem, wenn Sev eine Dummheit machte. Das passierte oft, deshalb beobachtete der Leibeigene ihn oft. Er war ungefähr in Sevs Alter, groß und breitschultrig, mit goldbrauner Haut und kurz geschorenen schwarzen Haaren. Er trug eine Kette um den Hals – das war für alle Leibeigenen vorgeschrieben –, an der ein schlichter Anhänger mit seinem Namen, seinem Verbrechen und der Dauer seiner Strafe hing.
Der Leibeigene wirkte eher neugierig als feindselig, als ob Sev ein Rätsel wäre, das er nicht so ganz durchschaute, aber immer, wenn Sev seinen Blick erwiderte, wurde seine Miene misstrauisch.
Im Militär war Hass auf Animagen seit dem Blutkrieg noch immer weitverbreitet. Es fing bei den Offizieren an, die Jahre gegen die Phönixreiter gekämpft hatten – was ihre grauenhaften Verletzungen und Brandnarben bewiesen –, und sickerte dann zu den unteren Rängen durch. Viele der jüngeren Soldaten hatten im Krieg ihre Eltern verloren oder als Kinder immer wieder gehört, wie ihre Eltern die rebellischen Animagen und die pyrenischen Separatisten verfluchten. Beides wurde oft in einen Topf geworfen: Nicht alle Animagen stammten aus Pyra, und nicht alle aus Pyra waren Animagen. Aber nach dem Krieg, als die Animagen feststellen mussten, dass ihre Magie verboten und ihr Leben in Gefahr war, flohen viele aus dem Imperium in die relative Sicherheit von Pyra.
Die meisten Soldaten behandelten die leibeigenen Animagen aus Rachsucht schlecht, fühlten sich über sie erhaben und erachteten sie als Sklaven. Wie Verbrecher. Schließlich waren sie ja Verbrecher, und egal, ob ihr Verbrechen nun darin bestand, dass sie im Blutkrieg Avalkyra Aschenfeuer gedient, dass sie sich der Registrierung entzogen oder dass sie insgeheim ihre Magie angewandt hatten, die Animagen waren im Imperium zusammengetrieben und entweder durch Steuern zur Armut verdammt oder, wenn sie nicht bezahlen konnten, gezwungen worden, als Leibeigene ihre Schulden abzudienen. Die Hälfte der Soldaten waren Kriminelle, aber ihre Verbrechen wurden ihnen beim Eintritt in die Armee vergeben. Wie es bei Sev der Fall gewesen war.
Natürlich beruhte der Hass auf Gegenseitigkeit. Animagen waren wie Verräter behandelt worden – auch wenn sie nichts mit Avalkyra Aschenfeuers Aufstand zu tun gehabt hatten –, und das Imperium hatte sie grausam gestraft.
Sev war irgendwo in der Mitte, da er mit den Leibeigenen ebenso viele Gemeinsamkeiten hatte wie mit den Soldaten.
Einerseits waren seine Eltern Phönixreiter gewesen und ihre Tiermagie strömte auch durch seine Adern. Die Drohungen des Imperiums hatten ihn fast sein Leben lang gezwungen, sich versteckt zu halten, und die Angst, dass die Soldaten sein Geheimnis entdecken könnten, verfolgte ihn bis in seine Träume. Sie wussten nicht, dass er ein verkappter Animage war, der nur versuchte, einen Tag nach dem anderen zu überleben.
Das wusste niemand. Und es durfte auch niemals jemand erfahren.
Wenn irgendwer dahintergekommen wäre, dass Sev ein Animage war, dann würde er ebenfalls eine Kette um den Hals tragen und angesichts seiner kriminellen Vergangenheit zu einer lebenslänglichen Strafe verurteilt werden.
Andererseits aber war Sev Soldat, obwohl er Soldaten gehasst und gefürchtet hatte, so lange er sich zurückerinnern konnte. Die Phönixreiter hatten seine Eltern gestohlen, sein Leben ruiniert und ihn als Waise in den Straßen von Aura Nova zurückgelassen. Ob er wollte oder nicht, er verabscheute sie ebenfalls.
Sev gehörte nirgendwohin, ein Schaf ohne Herde.
Er warf dem Leibeigenen ein bedauerndes Lächeln zu, dann starrte er wieder seine Stiefel an und versuchte, die Schweinerei an einem Grasbüschel abzuwischen. Der Leibeigene schüttelte den Kopf und sah zur Seite. Sev bemühte sich weiter, und der Leibeigene erwiderte schließlich wieder seinen Blick und tippte sich an den Gürtel, wie um Sev etwas zu zeigen. Sev runzelte verwirrt die Stirn und starrte den leeren Gürtel des Leibeigenen leicht verlegen an, dann ging ihm auf, dass er seinen eigenen ansehen sollte. Daran hing ein Wasserschlauch – perfekt, um damit Tierdung abzuwaschen. Mit hochrotem Kopf nickte Sev zum Dank, dann zog er den Stöpsel heraus und machte kurzen Prozess bei der Säuberungsaktion.
Als er fertig war, schaute er aus zusammengekniffenen Augen zwischen den Bäumen hindurch. Die Soldaten hatten eine von der Sonne ausgedörrte Lichtung erreicht, in deren Mitte eine kleine Hütte mit einer blauen Tür stand.
Die Hütte war rund, hatte ein gewölbtes Dach, ein in Pyra beliebter Stil, und war vermutlich eine Jagdhütte oder die Behausung eines alten Einsiedlers, der sich hier mitten im Nirgendwo zurückgezogen hatte.
Hauptmann Belden hatte ihnen zwei Befehle erteilt, als sie an diesem Morgen das Lager verlassen hatten. Vor Sonnenuntergang zurück sein und nicht gesehen werden. Als Soldaten des Imperiums waren sie in Pyra nicht willkommen, und Sev glaubte nicht, dass ihre Wegelagererkostümierung einer genaueren Untersuchung standhalten würde. Außerdem würden die Einheimischen auch Wegelagerer nicht willkommen heißen.
Irgendwo weiter vorn gab es eine Bewegung und nun marschierten sie offenbar weiter. Sev nahm an, dass sie um die Lichtung herumgehen würden für den Fall, dass sich in der Hütte jemand aufhielt. Sie sah leer aus, aber nicht verlassen. Brennholz war an der Rückwand gestapelt, der Weg zur Tür war von Gras und Unkraut befreit, gespenstische Rauchfäden kamen aus dem Schornstein.
»Junge!«, rief eine scharfe Stimme und ließ Sevs Aufmerksamkeit zu seiner unmittelbaren Umgebung zurückkehren. Vor ihm lief Ott an der Kolonne entlang. Klein und rund und vor Anstrengung keuchend erinnerte er Sev an den Narren aus den arborianischen Komödien. Sein Kittel mit den vielen Flicken verstärkte diesen Eindruck noch, er brauchte eigentlich nur noch einen spitzen Hut und Glöckchen an den Schuhen. Otts sonst fahle Haut war sonnenverbrannt, aus seinen schütteren Haaren lief Schweiß über seine Schläfen.
»Offizier«, sagte Sev, straffte sich, als Ott bei ihm ankam, und salutierte. Er bewegte sich ganz bewusst langsam – sprach oder lief nie besonders schnell. Durch solche Dinge fiel man schließlich auf, und das war das Letzte, was Sev wollte. Die meisten anderen Soldaten hielten Sev für so stumpf wie eine ungeschliffene Klinge, und er gab sich alle Mühe, diesen Eindruck zu verstärken. Er war gerade gut genug bei seiner Arbeit, um unbemerkt durchzukommen, und schlecht genug, um sich zu hohen Ansprüchen zu entziehen.