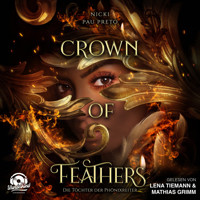12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Töchter der Phönixreiter-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Ein Mädchen geboren aus Asche und Feuer
Veronykas Wunsch wurde endlich erfüllt: Sie ist eine Phönixreiterin! Doch während sie eigentlich trainieren sollte, gilt ihr einziger Gedanke der Verteidigung gegen das Imperium. Tristan wiederum wurde zum Meisterreiter befördert, aber gerät durch seine modernen Ideen immer wieder mit seinem Vater, dem Kommandanten, aneinander. Währenddessen findet sich Sev im Imperium wieder, das er ausspionieren soll. Doch um seine Tarnung aufrechtzuerhalten, sieht er sich gezwungen, auf der falschen Seite des Krieges zu kämpfen. Und Veronykas Schwester, Val, setzt alles daran, das Reich, das sie verloren hat, zurückzuerobern – auch wenn das bedeutet, dass sie den Krieg selbst herbeiführen muss. Schließlich finden sich die vier in einem Kampf wieder, der das Imperium für immer verändern wird. Und jeder von ihnen muss entscheiden, wie weit er willens ist für seine Ziele zu gehen – und was er bereit ist, dafür zu opfern.
Die feurige Fortsetzung der fantastischen Reihe über Phönixreiter, das Band zweier Schwestern und die Macht der Liebe.
Alle Bände der »Die Töchter der Phönixreiter«-Reihe:
Crown of Feathers (Band 1)
Heart of Flames (Band 2)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1026
Ähnliche
Nicki Pau Preto
Die Töchter der Phönixreiter
Aus dem Englischen von Gabriele Haefs
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2024 cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
© 2020 by Nicki Pau Preto
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Heart of Flames«
bei Simon Pulse, an imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division, New York
Aus dem Englischen von Gabriele Haefs
Lektorat: Stefanie Rahnfeld
Covergestaltung: © Alexander Kopainski, www.kopainski.com,
unter Verwendung mehrerer Motive von © Shutterstock.com
(Eduard Muzhevskyi / hideto999 / kzww / Jingjing Yan / BCFC)
sh · Herstellung: UK
Satz & E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-31012-7V001
www.cbj-verlag.de
Für Derek,
der mich bedingungslos in allem unterstützt und mir freudigen Herzens in die Flammen folgen würde
Ein Phönix ruht geborgen in seiner Schale, er ruht auf einem Bett aus Flammen und Asche. Aber nicht dazu sind Feuervögel auf der Welt. Erhebe dich, Kind von Axura, und breite deine Schwingen aus.
»Schwingen«, aus »Ein Buch der Lieder und Gedichte« von Hector, berühmter Dichter und Dramatiker, veröffentlicht 119NI.
Das Goldene Imperium
Kapitel 1 - Veronyka
Meine liebste Tochter,
ich möchte dir eine Geschichte erzählen.
– Kapitel 1 – Veronyka
V eronyka trat, so hart sie konnte, nach Tristans Gesicht.
Sie befanden sich auf dem Trainingshof, die Abendsonne warf lila Schatten über die Mauern der Festung und ließ die goldene Phönixstatue oben auf dem Tempel strahlend auflodern.
Die Glocke hatte schon zum Abendessen geläutet und für die anderen Lehrlinge und Meister war das Training für diesen Tag beendet. Sie packten zusammen, räumten Übungswaffen weg oder sahen einfach zu, wie Veronyka und Tristan einander umkreisten.
Sie trainierten Abwehrkampf, und obwohl Veronyka die Aufmerksamkeit der anderen hasste, würden sie und Tristan erst aufhören, wenn sie ihn wenigstens einmal besiegt hätte. Bisher stand es null zu fünf für ihn und sie wurde allmählich müde.
Tristan wich ihrem Tritt so leicht aus wie den vorherigen und sprang außer Reichweite, als Veronyka ihm folgte. »Können wir nicht morgen weitermachen?«, fragte er leicht keuchend. Aber nur leicht. Veronyka dagegen war ein schwitzendes, um Atem ringendes Häufchen Elend.
Sie hätte gern geantwortet – nein, sie konnten nicht erst morgen weitermachen. Während der vergangenen Wochen waren die letzten Einzelheiten über den Angriff auf den Adlerhorst bekannt geworden, hatten den Toten, den Verwüstungen und … den Vermissten Namen und Zahlen gegeben.
Und das war erst der Anfang.
Es würde alles noch viel schlimmer werden, ehe es besser werden konnte; das Imperium würde sie nach einer solch knappen Niederlage nicht vergessen … deshalb musste sie bereit sein. Sie hatte so hart trainiert, wie sie nur konnte, hatte sich beim Fliegen und bei den Waffen und ja, beim Kampf, bis zum Äußersten angetrieben. Im Kampf war sie am schwächsten, deshalb waren dort die meiste Mühe und die größte Aufmerksamkeit gefordert.
Veronyka musste sichergehen, dass sie, wenn das Imperium zurückkehrte – wenn die nächste Schlacht ausgefochten wurde –, nicht im Hintergrund bleiben müsste. Und das konnte sie nur, wenn sie Meisterreiterin wurde. Wenn sie genau die Prüfungen bestand, mit denen Tristan einige Wochen zuvor gekämpft hatte – und für die er monatelang trainiert hatte.
Trotz ihrer Fähigkeiten beim Fliegen und ihrer mächtigen Tiermagie war sie beim Kämpfen so weit im Rückstand, war so sehr nicht in ihrem Element, dass sie nicht mehr schaffte, als sich auf den Füßen zu halten.
Aber sie würde nicht aufgeben. Konnte nicht aufgeben.
Als Antwort auf Tristans Angebot, für diesen Tag Schluss zu machen, verstärkte sie ihre mentalen Mauern und trat wieder zu.
Denn es war nicht nur die Disziplin Kampf, mit der sie sich abmühte. Sie konnte gegen Tristan nicht kämpfen wie gegen die anderen. Ihre Schattenmagie, die sich sonst nach Gedanken und Herzen ausstreckte, war bei Tristan wie Wasser, das in einen Sog gezogen wird. Sie musste aktiv gegen diesen Sog kämpfen, weil jede Berührung, jeder noch so kleine Blickkontakt, sie beide weit aufreißen könnte. Es war, wie gegen zwei Gegner gleichzeitig anzutreten.
Tristan schüttelte mit leichtem Grinsen den Kopf und sprang mühelos außer Reichweite.
Veronyka schluckte, ihre Kehle war so trocken wie der Sand unter ihren Füßen. Sie versuchte, sich zu konzentrieren.
Seit Wochen waren diese Kampflektionen für sie das Schlimmste, das, wovor ihr am allermeisten grauste. Es gab niemanden, mit dem sie sich hätte messen können, niemanden von ihrer Größe und mit ihren Fertigkeiten. Deshalb wurde sie immer wieder besiegt. Ihre einzigen Vorteile waren ihre Schnelligkeit und die Tatsache, dass sie aufgrund ihrer geringen Körpergröße schwer zu treffen war.
Außerdem war sie unberechenbar. Nicht weil sie das so wollte, sondern aus Mangel an Erfahrung. Bisweilen wirkte sich das zu ihren Gunsten aus und konnte ihre Widersacher überraschen.
Alle, nur nicht Tristan. Wenn sie mit ihm kämpfte, kam es ihr manchmal vor, als wäre er derjenige mit der Schattenmagie. Er sah ihre Bewegungen so problemlos voraus, konnte so fehlerfrei reagieren und sich fast augenblicklich allem anpassen, was sie versuchte.
Natürlich, wenn sie wirklich gewinnen wollte, könnte sie ihre Gedanken für ihn öffnen und alle seine Überlegungen und Bewegungen voraussehen. So, wie sie es bei dem Angriff auf den Adlerhorst getan hatte. Da war ihre Verbindung berauschend und mächtig gewesen, aber sie hatten ja auch zusammengearbeitet, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Zudem hatte sie das Bewusstsein verloren, als sie am Tag davor zugelassen hatte, dass ihre Verbindung ihr außerhalb des Brutgeheges entglitt. Es war zu gefährlich, und außerdem war es genau was, was ihre Schwester Val tun würde.
Veronyka schüttelte den Kopf. Je mehr sie sich für Tristan öffnete, umso mehr öffnete sie sich auch für Val – und das war das Letzte, was sie jetzt brauchen konnte.
Sie brauchte für diesen Tag nur einen einzigen Sieg, einen Sieg, um hocherhobenen Hauptes zum Abendessen gehen zu können.
Die meisten Kämpfe endeten damit, dass jemand mit einem Stoß oder Schlag getroffen wurde, zu stark verletzt zum Weitermachen war oder aus dem Ring gestoßen wurde. Bisher hatte Tristan sie dreimal überwältigen können und sie die beiden anderen Male aus dem Kreidekreis geschlagen.
Als er auf der anderen Seite des Rings zurück ins Gleichgewicht fand, musterte Veronyka ihn.
Unter dem Schutzpanzer trug er seine übliche Trainingskluft, die maßgeschneiderte Tunika und das abgenutzte Leder, die so sehr zu ihm gehörten wie seine braunen Locken und seine Grübchen. Etwas jedoch war jetzt anders bei ihm, ein Gefühl der Sicherheit, das vorher nicht da gewesen war. Die Schlacht um den Adlerhorst hatte ihn verändert – hatte sie alle verändert –, und er schien jetzt mehr Selbstvertrauen zu haben, auch wenn der einzige äußerliche Unterschied ein rot gefärbter Lederriemen war, den er sich um den Oberarm gewickelt hatte, um seine Stellung als Patrouillenführer zu kennzeichnen. Dazu kam eine schmale weiße Narbe, die seine Unterlippe zerteilte – ein Andenken an den Überfall.
»Na los, Tristan«, rief Anders vom Ringrand her und grinste breit. »Zeig dieser Anfängerin, wo ihr Platz ist!«
Die anderen lachten und johlten und Tristan biss die Zähne zusammen. Er hatte mit Spott noch nie gut umgehen können, und da sich der von Anders gegen sie richtete, nahm er ihn noch übler auf als sonst.
Veronyka wusste, dass Anders es nicht ernst meinte. Er und Tristan hatten ihre Lehrlingszeit schließlich selbst gerade erst beendet. Aber es gab andere, von denen sie vermutete, dass sie mit größerer Bosheit zuhörten. Latham, ein weiterer zum Meisterreiter avancierter Lehrling, feixte hinter Anders schadenfroh, ein kaltes, belustigtes Funkeln in den Augen, und Fallons Stellvertreter Darius flüsterte hinter vorgehaltener Hand etwas in das Ohr seines Patrouillenführers. Viele von ihnen waren ihr gegenüber auf Distanz gegangen, seit sie enthüllt hatte, dass sie Veronyka war, nicht Nyk, und sie merkte, dass ihr vertrauter Umgang mit Tristan Misstrauen erregte. Auch jetzt … die Meister trainierten nur selten zusammen mit den Lehrlingen, schon gar nicht so, im Einzelkampf, aber Tristan half ihr, weil sie ihn darum gebeten hatte. Den anderen erschien das als Bevorzugung, als Sonderbehandlung. Vielleicht sogar als noch mehr.
»Klappe, Anders.« Tristan knurrte fast und schleuderte sich wütend die schweißnassen Haare aus der Stirn.
»Oder schieb es dir beim Essen rein«, stimmte Veronyka ein, um die Situation zu entschärfen. Anders lachte schallend, ging aber nicht. Niemand ging.
Veronyka und Tristan waren schon oft gegeneinander angetreten und kannten die jeweiligen Gewohnheiten und Neigungen des Gegenübers vermutlich besser als ihre eigenen. Tristan war ein umsichtiger Kämpfer, aufmerksam und bedächtig; er studierte die Gegenseite, ehe er eine Bewegung machte. Aber er konnte gereizt werden. Das hatte Anders soeben bewiesen.
Wenn Tristan dazu gebracht werden konnte, einen Fehler zu machen, konnte Veronyka vielleicht doch noch einen Sieg einholen.
Aber sie zögerte noch immer. Während Tristan ruhig und diszipliniert war, war sie ungestüm und ungeduldig – und das wusste er. Fast immer war es ihr Fehler, dass sie verlor: Tristan sah nur zu und wartete darauf, dass ihr ein Patzer unterlief, dann nutzte er jegliche Öffnung oder Schwäche bei ihr. Aber um ihn aus der Reserve zu locken, musste sie eine Bewegung machen.
Weil sie so klein war, waren ihr Tritte lieber als Schläge, ihre Beine reichten weiter als ihre Arme. Sie tänzelte um Tristan herum und brachte sich in Position für einen Tritt mit dem linken Fuß, der seine Rippen treffen sollte. Dabei wich sie seinen Blicken aus – denn Blickkontakt war die sicherste Methode, eine Schattenmagieverbindung zu öffnen, und starrte stattdessen seinen Oberkörper an, die Linie seiner Schultern, die Position seiner locker an den Seiten herabhängenden Hände.
Sowie sich ihre Knie beugten und ihr Fuß den Boden verließ, spannten sich Tristans Muskeln an – sein rechter Arm hob sich ein wenig, um den Tritt abzuwehren, während sich seine Schultern drehten und seinen Körper von ihr abwandten.
Aber Veronyka trat eben nicht. Jedenfalls nicht aus dem Stand. Sie ging in letzter Sekunde in die Hocke und holte mit dem Fuß aus, wobei der Tritt Tristans Beine treffen sollte, nicht seinen Rumpf.
Sie schaute gerade rechtzeitig auf, um zu sehen, wie seine Augen groß wurden und sich sein Körper drehte, um sich der neuen Lage anzupassen.
Ihr Fuß traf Tristans Wade, und die Umstehenden riefen »Uuuuh …«, als ihm das Bein weggerissen wurde.
Aber statt rückwärts aus dem Kreis zu fallen – was ihr Ziel gewesen war – oder auf die Seite zu kippen, fiel Tristan nach vorn.
In ihre Richtung.
Sie hatte nur sein eines Bein treffen können, als er versucht hatte, über ihren Tritt hinwegzuspringen, und nun stolperte Tristan auf sie zu, und ihr blieb nichts anderes übrig, als zur Seite zu rollen.
Sie konnte seinem Sturz um wenige Fingerbreit entgehen, war aber wehrlos, als sie nun versuchte, sich zurückzuziehen.
Tristan sprang auf ihren schutzlosen Rücken und schlang die Arme um ihre Taille und ihre Brust. Mit verschränkten Händen riss er sie mit sich rückwärts in den Sand. Im Handumdrehen hatte er ihren Angriff in einen Vorteil für sich selbst verwandelt. Als er auf dem Rücken lag und Veronyka gegen seine Brust gepresst wurde, war er nur einen Herzschlag davon entfernt, seinen Unterarm in einem Würgegriff auf ihre Luftröhre zu drücken. Sie konnte sich zur Seite drehen, was den Winkel schwieriger machte, aber Tristan nutzte die neue Gelegenheit, indem er sein Bein über ihren Körper warf und sich auf sie wälzte.
Veronyka zappelte, trat um sich und trommelte verzweifelte Schläge auf seinen Kopf, weshalb er den immer wieder zurückziehen musste, aber trotzdem schaffte er es, seine Oberschenkel zu beiden Seiten gegen ihre Hüften zu pressen, als er rittlings auf ihr landete.
Diese Nähe ließ Veronykas mentale Sperren erzittern. Ihre Magie wollte ihn, streckte sich nach ihm aus, suchte jeglichen Vorwand, um ihre Verbindung zu stärken. Es gab gewisse Auslöser – Blickkontakt, Berührungen und Sinneseindrücke wie Geruch und Klang –, die in ihren Mauern einen Stein nach dem anderen schwächten. Alles zusammengenommen war es ein Angriff auf ihren Geist, dem sie nichts entgegensetzen konnte.
Tristan senkte den Kopf zu ihrer Brust und machte es ihr durch dieses Eindringen in ihre mentale Schutzzone unmöglich, nach ihm zu schlagen. Er festigte seine Position, behielt das Gleichgewicht, sodass ihre wild strampelnden Beine ihn nicht mehr ins Wanken bringen konnten.
Sein schwerer Atem hallte in ihren Ohren, seine Brust hob und senkte sich und drückte gegen ihre eigene. Seine feuchte Tunika und seine schweißnassen Locken rochen nach Seife und Salz und Sonne – rochen nach Tristan –, und Veronyka gab sich alle Mühe, ihm auszuweichen. Aber er hielt sie fest, und als sie den Kopf drehte und ihr Blick seinem begegnete, stürzten die Steine aus ihren mentalen Mauern zu Boden.
Die Verbindung zwischen ihnen brach ebenfalls, so schnell und zielstrebig wie Wasser, das durch einen Damm sprudelt. Ihre Magie kam an die Oberfläche, und ihr Geist füllte sich mit seinen Gedanken, so laut und klar, dass ihre eigenen darin ertranken.
Er war sich ihrer ebenso bewusst wie sie sich seiner. Ihr Geruch, ihre Berührung – das alles versetzte Tristan in höchste Alarmbereitschaft, aber nicht aus demselben Grund, aus dem seine Nähe sie erschütterte. Zumindest nicht ausschließlich. Es war nicht nur Schattenmagie, wogegen sie sich wehrte, nicht nur die mentale Verbindung, vor der sie sich fürchtete.
Ohne an die Konsequenzen zu denken, drückte sie gegen Tristans Brust, zappelte und strampelte voller Panik, verzweifelt nach einer Fluchtmöglichkeit suchend.
Aber ihr Leichtsinn machte sie verletzlich, was sie gewusst hatte. Frustriert ging ihr auf, dass sie sich für eine Armblockade geradezu anbot, und sie hielt den Atem an, als sie darauf wartete, dass Tristan diese Gelegenheit nutzte. Er brauchte nur sein Gewicht zu verlagern, sich in eine andere Position zu bringen, sodass sie einander senkrecht gegenübersäßen, dann könnte er ihr Handgelenk packen und an seine Brust ziehen, um dabei ihren Ellbogen auszukugeln. Eine einfache Bewegung, in einer Sekunde geschehen.
Aber das tat er nicht.
Tristan war erstarrt. Veronyka musterte ihn einen Moment lang mit gerunzelter Stirn, dann bewegte sie die Hüften, brachte ihn aus dem Gleichgewicht und ließ ihn zur Seite rutschen. Sie schob sich unter ihm hervor und drehte sich um, während er langsam auf die Füße kam.
Stille hatte sich über den Trainingshof gesenkt, gemischt mit tiefer Verwirrung. Tristan hatte sie losgelassen, hatte die Chance, sie festzusetzen, nicht genutzt. Er hatte sogar zugelassen, dass sie wieder auf die Beine kam.
Er keuchte jetzt; der Schweiß, der seine Unterarme und Beine überzog, war mit Sand vermischt.
Wieder begegneten sich ihre Blicke, aber sie brauchte die mentale Verbindung zu ihm nicht, um ihren Verdacht zu bestätigen.
Er hatte sie davor bewahren wollen, vor aller Augen gedemütigt zu werden.
Er hatte sie beschützen wollen.
Das erinnerte sie daran, wie er versucht hatte, sie beim Angriff auf den Adlerhorst aus den Kampfhandlungen herauszuhalten; es erinnerte sie daran, wie Kommandant Cassian die Reiter eingeschlossen hatte, um sie in Sicherheit zu bringen, während um sie herum die Welt in Stücke fiel. Das Schlimmste aber war, dass es sie an Val erinnerte, die immer vorgegeben hatte, sie zu »beschützen«, so gründlich und so heftig, dass Val sie am Ende viel schlimmer verletzt hatte, als hätte sie sie einfach die Wahrheit erfahren lassen, als hätte sie sie als gleichberechtigt behandelt.
Anders und die Übrigen beobachteten sie und konnten Tristans Zögern nicht übersehen haben. Tristan hatte es ihr leicht gemacht und alle wussten das.
Mit einer Art Fauchen schlug Veronyka auf ihn ein, sodass Tristan nichts anders übrig blieb, als zu kämpfen. Er hatte keine Möglichkeit, auszuweichen.
Er fing ihren Angriff auf und setzte ihre Schwungkraft gegen sie ein. Indem er seinen und damit auch ihren Oberkörper verdrehte, warf er sie über seine Hüfte und schleuderte sie rückwärts in den Sand.
Der Atem wurde ihr aus der Lunge geschlagen, und als sie sich aufzusetzen versuchte, sah sie unter sich den Kreidestrich.
Sie war aus dem Ring geworfen worden. Veronyka ließ den Kopf zurück auf den Boden sinken und schloss die Augen.
Null zu sechs.
Später ließ Veronyka ihrer Frustration im Sattel freien Lauf. Das machte sie in den meisten Nächten, wenn sie nicht schlafen konnte.
Eigentlich musste sie im Quartier der Lehrlinge schlafen und Xephyra im Adlerhorst. Die Trennung gehörte zum Training der Reiter und sollte die Bindung über die Entfernung stärken, aber Veronyka hasste diese Vorschrift. Dicht an Xephyra geschmiegt schlief sie immer viel besser, und sie hatte mehr als einmal versucht, im Adlerhorst zu übernachten, war aber meistens von Ersken verjagt worden, der spätabends und frühmorgens seine Runden drehte. Veronyka und Tristan saßen oft auf der Galerie vor seinem Zimmer, reinigten Rüstungen oder waren einfach mit den anderen Lehrlingen zusammen. Einmal war Veronyka dort eingeschlafen, nachdem Tristan schon in seine Kammer gegangen war, und nicht Ersken hatte sie entdeckt, sondern der Kommandant selbst. Seine misstrauische Miene – und sein neugieriger Blick zur verschlossenen Tür seines Sohnes – hatte ihr klargemacht, dass sie besser ganz schnell verschwinden und in Zukunft solche Begegnungen vermeiden sollte. Sie und Tristan ernteten schon genügend seltsame Blicke wegen ihrer engen Freundschaft, die begonnen hatte, als sie noch ein Stalljunge gewesen war, und nun darin gipfelte, dass sie ein Mädchen war, ein Lehrling mit einem ausgewachsenen Phönix und dazu Tristans Schützling. Das Gerücht, dass sie wie ein liebeskranker Hundewelpe vor seiner Tür schlief, musste sie da wirklich nicht auch noch haben.
Seither hatte Veronyka immer im Lehrlingsquartier übernachtet und sich darauf konzentriert, ihre Bindung zu Xephyra zu stärken, vor allem ihre Fähigkeit, miteinander zu kommunizieren. Sie testeten nicht nur dauernd ihre Reichweite, Veronyka trieb ihren Phönix außerdem dazu an, auf verbaler Ebene zu kommunizieren, nicht nur Gedanken und Empfindungen auszutauschen. Einerseits sollte die Verbindung dadurch stark und sicher bleiben, wenn sie getrennt waren, andererseits ging es um das, was nach Xephyras Tod mit Val passiert war. Veronyka wurde schlecht, wenn sie daran dachte, dass Val nicht nur ihre Verbindung zu ihrer Verbündeten manipuliert hatte, um Xephyra zu kontrollieren, sondern dass sie selbst Xephyras Rückkehr nicht gespürt hatte, weil sie alle Gedanken an ihren Phönix blockiert hatte, um ihren Schmerz zu lindern. Wenn sie offen gewesen wäre, wenn ihre Bindung stärker gewesen wäre und ihre Kommunikationsfähigkeit feiner abgestimmt, hätte sie vielleicht früher begriffen, dass Xephyra auferstanden war.
Sie arbeiteten den ganzen Tag an ihrer Bindung, sandten einander Wörter, wann immer sie getrennt waren – wenn sie aßen, schliefen oder durch andere Dinge abgelenkt waren –, aber der beste Test dieser Übung kam immer dann, wenn sie gemeinsam auf dem Platz trainierten. Herausforderungen wie die Hindernisrennbahn, die Tristan bezwungen hatte, um seine Lehrlingszeit zu beenden, waren ein Beispiel, aber Veronyka war noch nicht so weit. Außerdem zogen sie und Xephyra das Fliegen vor.
Veronyka winkte den Wachen und dem patrouillierenden Reiter zu – derzeit Beryk –, aber inzwischen hatten sich alle an ihre spätabendlichen Flüge gewöhnt. Sie und Xephyra hatten ihr Ziel schnell erreicht, ein Übungsgelände, das Soths Zorn genannt wurde. Es bestand aus einer Reihe von Höhlen mit etlichen schmalen, engen Passagen, die die Manövrierfähigkeit der Reiterin bei hohem Tempo auf die Probe stellten. Zudem waren überall Zielscheiben aufgestellt, als Herausforderung für alle Möchtegernkrieger, sie mit Pfeil oder Speer zu treffen.
Veronyka liebte Soths Zorn, und sie und Xephyra wurden immer besser in der Kunst, sich in den dunkelsten Tiefen dort zurechtzufinden.
Bereit?, fragte Veronyka, als sie sich dem Höhleneingang näherten.
Xephyra antwortete nicht, sondern ließ einen Ausbruch aus Erregung und Adrenalin spüren. Ein klares Ja, aber Veronyka trieb sie zu einer präziseren Aussage an.
Wörter, Xephyra, drängte sie.
Xephyra schnaubte unter ihr. Aeti, sagte sie schließlich.
Veronyka verdrehte die Augen und unterdrückte ein Grinsen. Wenn Xephyra ihr ewiges Drängen satthatte, begehrte sie auf. Jetzt zum Beispiel, indem sie auf Alt-Pyrenisch antwortete und nicht in der gebräuchlicheren Händlersprache.
Du findest das wohl komisch?, fragte Veronyka und versuchte, streng zu klingen, allerdings ohne allzu großen Erfolg. Der eigenen Verbündeten ließen sich die Empfindungen eben nicht verheimlichen.
Sia, erwiderte Xephyra selbstzufrieden. Das war ein nord-arborianischer Dialekt. Sie hatte ihn wohl von Anders aufgeschnappt, der den Reitern oft alte arborianische Lieder vorsang und für alle übersetzte, die zuhören mochten. Die meisten mochten nicht, Xephyra aber offenbar schon.
Bist du so weit?, fragte Veronyka noch einmal, während der klaffende Höhlenschlund immer näher kam.
Verro. Das war … Ferronesisch, vielleicht? Veronyka hatte keine Ahnung, wo Xephyra das gehört haben mochte. Sie konnte nicht dagegen an, sie musste lachen, während sie in die Dunkelheit flogen.
Veronyka hatte die Höhlen schon oft durchquert und fühlte sich trotz der dumpfen Echos und der flüchtigen Schatten, die alles ein bisschen gespenstisch wirken ließen, wohl dort. Die Zielscheiben waren an unterschiedlichen Stellen angebracht und boten einer Reiterin eine reiche Auswahl an Übungsmöglichkeiten. Sie waren aus Metall und reflektierten deshalb das Licht – oder das Phönixfeuer –, aber sie waren trotzdem schwer zu entdecken, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass manche eher für einen Speerwurf oder sogar für ein Kurzschwert oder einen Dolch geeignet waren, wenn man es wagte, dicht genug heranzufliegen.
Was Veronyka tat.
Ihr Lieblingsteil der Strecke war eine Abfolge von Zielscheiben, die man teils vom Phönixrücken aus und teils nur zu Fuß treffen konnte, weil sie von Felsnasen verborgen oder in einem unmöglichen Winkel aufgehängt waren. Um sie zu erreichen, musste sie vom Phönixrücken springen, über unwegsames Gelände rennen, um das Ziel zu berühren, sich dann wieder in den Sattel schwingen, ihren Bogen packen und zur nächsten Zielscheibe weiterreiten. Es war fast unmöglich und verlangte glasklare Präzision und perfekte Kommunikation.
Veronyka packte die Zügel, als sie durch die enge Öffnung jagten. Es waren keine echten Zügel – sie führten nicht zu Riemen und Trense wie bei einem Pferd, sondern sollten Haltegriffe sein und unerfahrenen Reitern dabei helfen, im Flug sicher auf ihrem Reittier sitzen zu bleiben. Erfahreneren Reitern ermöglichten diese Zügel es, aufzustehen oder eine andere Position einzunehmen. Veronyka hatte gesehen, wie Fallon, der Anführer der zweiten Patrouille, kopfunter geflogen war, wobei er seine Zügel benutzt hatte, um sich eng an seinen Phönix zu schmiegen und der Schwerkraft zu trotzen.
Veronyka war während des Trainings keine draufgängerische Reiterin, aber nach ihrem Versagen heute im Ring war sie fest entschlossen, alles zu geben und ihr Glück mit einigen akrobatischen Kunststücken zu versuchen.
Sie flogen in hohem Tempo durch die labyrinthischen Höhlen, die Felswände schlossen sich immer enger um sie. Die Wände waren glatt und hoch, wie Säulen aus tropfendem Wachs, während sich vom Boden spitze Stalagmiten erhoben, einige so hoch, dass sie ihnen im Vorüberjagen ausweichen mussten. Die Schatten um sie herum wurden dicht und kalt, während in der Ferne sickerndes Wasser zu hören war, die Überreste eines Flussdurchbruchs aus lang vergangener Zeit.
Veronyka spannte ihren Bogen und machte Xephyra in Gedanken klar, welche Ziele sie in welcher Reihenfolge treffen wollte, dann gab sie einen Pfeil nach dem anderen auf das Schwarze in den metallischen Zielscheiben ab. Da es in den Höhlen stockfinster war, strahlte Xephyra ein vages Licht aus, um den Weg zu zeigen.
Soths Zorn war in drei Abschnitte mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden unterteilt, und obwohl Veronyka wusste, dass es töricht war, hatte sie die herausforderndste Route gewählt.
Der Anfang war gar nicht so schwer, aber dann wurde das Gelände mit jedem Ziel, das sie passierten, schwieriger. Vor ihnen lag jetzt die Strecke der verborgenen Ziele. Veronyka machte sich bereit.
Sie bat Xephyra, etwas langsamer zu werden, griff die Zügel fester und zog vorsichtig die Füße aus den Steigbügeln, bis sie auf Xephyras Rücken hockte. Ihr Phönix bewegte die Flügel so wenig wie möglich und flog ruhig weiter, aber Veronyka schwankte trotzdem und kämpfte um ihr Gleichgewicht.
Das erste verborgene Ziel tauchte auf; es war über einem schmalen Felssims in einem Spalt angebracht und steckte hinter einem Stalagmiten, der vom Boden aufragte. Veronyka holte tief Luft.
Jetzt, sagte sie und sprang nach rechts, während Xephyra nach links flog, wobei sie die Stalagmite nur um Haaresbreite verfehlte. Veronyka rutschte und taumelte bei dem Versuch, wieder festen Boden unter den Füßen zu finden, aber sie konnte nicht langsamer werden – nur die Schwungkraft gab ihr hier überhaupt noch Halt. Sie wurde nach vorn geschleudert, riss einen Dolch hervor und traf das Ziel mit lautem Widerhall, dann schoss sie daran vorbei und sprang hinaus in die leere Luft der Höhle.
Doch dann war Xephyra da, so wie sie es ihr gesagt hatte. Veronyka knallte auf den Sattel, aber nicht einmal der Schmerz konnte das Triumphgefühl schmälern, das durch ihre Adern jagte.
Xephyra schaute sich zu ihr um und in ihren dunklen Augen tanzte feuriges Vergnügen.
Gut?, fragte sie, blickte wieder nach vorn und flog mit eleganten Schwüngen zwischen den Felsspitzen hindurch.
Aeti, antwortete Veronyka, und Xephyra summte zufrieden.
Danach saßen sie auf ihrem steinernen Lieblingsplatz und sahen zu, wie in der Ferne die Sonne aufging.
Veronyka lehnte sich an Xephyra, ihr Körper war erschöpft, und ihre Gedanken waren zum Stillstand gekommen; endlich fand sie den Frieden, den sie nachts allein sonst vergeblich suchte. Nach einer Weile rührte sich etwas ganz hinten in ihren Gedanken, und sie wusste, dass Tristan wach war.
Und sofort zerbrach ihr Frieden in tausend Stücke.
Jeder einzelne Aspekt ihrer Bindung an Xephyra gab Veronyka ein gutes Gefühl, sie fühlte sich dadurch stärker, lebendiger. Und so war es auch mit ihrer Bindung an Tristan. Aber das durfte sie nicht zulassen. Eine Bindung an einen anderen Menschen war gefährlich … Veronyka hatte diese Lektion auf harte Weise gelernt. Sie vergaß das immer wieder, hoffte, alles werde sich von selbst lösen oder in den Hintergrund sinken. Tristan hatte es verdient zu wissen, dass zwischen ihnen eine magische Verbindung bestand, die ihr Einblick in seine Gedanken und Gefühle erlaubte, aber es wäre schwer, ihm das ohne irgendein Wort des Trostes oder der Beruhigung sagen zu müssen.
Also, ja, Tristan, ich kann deine Gedanken hören und deine Gefühle spüren – und nein, ich weiß absolut nicht, wie ich das verhindern könnte. Macht dir das Angst? Mir auch.
Veronyka hatte keine Ahnung von Schattenmagie und wusste nur sehr wenig darüber, wie man deren Kraft verstärkte oder abschwächte. Der einzige Mensch, der die Antworten kannte, die sie suchte, war Val, und Val zu erreichen wäre ein Risiko, das sie nicht eingehen durfte.
Sie warf einen Blick auf ihr Handgelenk mit dem geflochtenen Armband. Es bestand aus ihren eigenen Haaren, die sie vor Wochen abgeschnitten hatte, schwarz und glänzend, mit einer dicken Schicht Pyraflora-Harz, dazu ein einzelner Strang von Vals lebhaftem Rot. Zwischen diesen Strängen saßen Perlen und kleine Dinge, die sie in ihrer Kindheit gesammelt hatte, dazu ein schwerer goldener Ring.
Er gehörte Val – oder genauer gesagt Avalkyra Aschenfeuer, der kühnen Kriegerkönigin, die vor fast zwei Jahrzehnten gestorben und nun wiederauferstanden war als das Mädchen, das Veronyka bis vor Kurzem für ihre Schwester gehalten hatte.
Der Ring war so mit den Strängen verflochten, dass nur der schlichte Goldreif zu sehen war, während sich die Oberseite mit Avalkyra Aschenfeuers Siegel den Blicken entzog.
Die Erkenntnis, dass ihre Schwester Val gar nicht ihre Schwester war, hatte Veronyka den Boden unter den Füßen weggerissen, hatte ihr das Gefühl gegeben, restlos verloren und orientierungslos zu sein. Familie war für sie immer ein wirres Konstrukt gewesen – wie hätte es anders sein können mit einer Schwester wie Val? –, aber immerhin hatte sie gewusst, wohin sie gehörte und wer sie war, egal, wie unbedeutend sie auch sein mochte. Jetzt, da sie entdeckt hatte, dass ihre Maiora, die sie aufgezogen hatte, in Wirklichkeit Ilithya Schattenherz war, Avalkyra Aschenfeuers Spionführerin, und dass Val wirklich die mit Federn gekrönte Königin persönlich war, stellte Veronyka alles infrage, was man ihr ein Leben lang erzählt hatte. Und die dringlichste Frage von allen: Wenn Val Avalkyra Aschenfeuer war – wer war dann Veronyka?
Niemand außer Val wusste das mit Sicherheit, und sie war nicht nur ausweichend und auf ihr eigenes Wohl bedacht – sie war gefährlich. Veronyka hatte mit eigenen Augen gesehen, wozu Val Schattenmagie einsetzen konnte, und sie hatte Angst davor, sich ihrer ehemaligen Schwester zu öffnen. Was, wenn Val ihr nur weitere Lügen auftischte? Was, wenn sie ihr noch mehr schlimme Träume und Erinnerungen schickte? Was, wenn sie gar nichts tat und Veronyka nie, niemals die ganze Wahrheit erfuhr?
Und was, wenn Val noch einmal versuchte, Xephyra unter ihre Kontrolle zu bringen? Veronyka wusste, dass das passieren könnte, und sie war sich des komplizierten Netzes, das Schatten- und Bindungsmagie zwischen ihr und denen knüpfte, die ihr wichtig waren, nur zu bewusst.
Zwischen ihr und Xephyra. Zwischen ihr und Tristan.
Veronyka wusste, dass sie sich selbst schützen musste, aber noch mehr musste sie die beiden schützen.
Und das ging am besten – und nach allem, was sie wusste, nicht anders als so –, indem sie Val vollständig blockierte. Indem sie Schattenmagie vollständig blockierte.
Indem sie vorgab, dass nichts davon existierte.
Aber als sie in den Sattel stieg und zum Adlerhorst zurückkehrte – Tristans Nähe ein warmes Leuchten in ihren Gedanken und ihrem Herzen und Val ein kalter Schatten, der ihr auf Schritt und Tritt folgte –, wusste sie, dass sie mit der Schattenmagie auch die Tiermagie blockieren würde, sie würde Xephyra blockieren, und das konnte sie einfach nicht tun.
Soths Zorn ist ein System von Höhlen, so benannt von der alten pyrenischen Bevölkerung, die glaubte, der Südwind – Soth genannt – sei ein tückischer und rachsüchtiger Gott, der aus dem Tal Stürme und Chaos ins Gebirge hochblies. Nur Soth könnte solche tiefen, zerstörerischen Schneisen durch die Berge schlagen und schattige Orte schaffen, die Axuras Licht niemals streifte.
Soth war mehr ein Aberglaube als ein richtiger Gott, jedenfalls für die Menschen von Pyra; ein Produkt der Dörfer weiter unten am Bergsaum, die sich eher mit den Zivilisationen im Tal und deren vielgestaltiger, weitreichender Göttergalerie mischten.
Das Wort selbst ist ebenfalls unbekannten Ursprungs. Die meisten Gelehrten vertreten die Ansicht, der Gott sei vielleicht von der geheimnisvollen Tieflandzivilisation übernommen worden, die später, nachdem die Tiefländer versucht hatten, in Pyra einzudringen, von Lyra der Verteidigerin ausgelöscht worden war.
Der Brauch, Naturgöttern Namen zu geben, ist bei den Arborianern beliebt und könnte eine gemeinsame Herkunft mit der Tieflandzivilisation andeuten. Die Menschen in Arborien beten zum Beispiel noch heute zu Nors, dem gütigen Nordwind, um gutes Wetter und sicheres Geleit.
»Wetter- und Naturgottheiten« aus: Obskure Götter und Göttinnen des Goldenen Imperiums, von Nala, Priesterin des Mori, veröffentlicht 84 VI.
Kapitel 2 - Avalkyra
Einst wurde ein Mädchen geboren aus einem Erbe aus Asche und Feuer. Allerdings hatte sie von beidem nichts. Wie grausam, solche Vorfahren, einen solchen Namen zu haben und doch keinen Anspruch darauf erheben zu können.
– Kapitel 2 – Avalkyra
Avalkyra starrte auf die Überreste ihres Feuers.
Sie hätte es nutzen können, um sich Essen zu kochen oder die Hände daran zu wärmen. Um etwas Sinnvolles zu tun. Stattdessen hatte sie versucht, damit noch ein Phönixei auszubrüten … und aus diesem Phönixei war nichts geschlüpft. Auch aus diesem nicht. Nun war es nur ein kalter, toter Stein in der Asche, wie so viele vor ihm.
Es war das Ei, das sie aus dem Adlerhorst gestohlen hatte, aus dem Tornister des Soldaten. Sie hatte es für diesen Ort aufbewahrt, für die Ruinen von Aura. In der Hoffnung, dass das vielleicht einen Unterschied machen würde. Dass etwas oder sogar jemand ihr helfen würde. Aber nein. Sie musste alles selbst machen. So war es immer schon gewesen.
Avalkyra stand in einer riesigen widerhallenden Kammer eines zerfallenden Tempels. Säulen aus verziertem Marmor ragten empor, die wie Bäume in einem arborianischen Wald standen, ihre großen, breiten Stämme verschwanden hoch über ihr, und das Deckengewölbe war unberührt vom Licht ihres kleinen Feuers. Früher war das vielleicht einmal eine heilige Stätte gewesen, aber jetzt, wie alles in Aura, kam es ihr eher vor wie eine Gruft. Es gab kein Entkommen vor diesem Gefühl, egal, ob sie in einer Bäckerei oder einem Badehaus stand – jedes Gebäude war geprägt von diesem gespenstischen, ausgehöhlten Gefühl.
Draußen war es sogar noch schlimmer.
Obwohl Avalkyra nicht zum Aberglauben neigte, heulte der Wind doch gerade jetzt besonders laut durch die Gebäude, ließ ihr die Haare im Nacken zu Berge stehen und verursachte seltsame Echos und Seufzer. Trockene Blätter raschelten, wisperten auf dem Boden, und in der Luft hing noch immer der Geruch von Asche und Rauch und Zerstörung.
Avalkyra füllte ihre Lunge mit Luft. Dann trat sie zu, traf das Ei und feuerte es in die Schatten, wo es von der nächststehenden Säule abprallte und dann eine kurze Treppe hinunterkullerte.
Es machte einen wunderbaren Lärm, der die endlose unheimliche Stille zerriss, aber sie spürte keine Genugtuung. Sie fühlte nur einen Schmerz im Fuß.
Sie spitzte die Lippen und starrte abermals die Überreste des Feuers an. Dann versetzte sie auch der Asche, den Knochen und der schwelenden Glut einen Tritt, bedeckte sich selbst mit Ruß und verteilte die letzten Hinweise auf ihre Stunden voller harter Arbeit – und auf ihr Versagen.
Sie richtete sich auf. Jetzt fühlte sie sich besser.
Avalkyra verließ die geheiligte Stätte und trat hinaus in die dunklen, gespenstischen Ruinen. Über ihr erhob sich ein Bogen, einer von Hunderten, an dem silberne und goldene Ranken funkelten und der mindestens doppelt so hoch war wie sie und zehnmal so breit. Diese Bögen kennzeichneten die Wege, die zum wichtigsten Marktplatz der Stadt führten, mit seinen Säulengängen und aus dem Fels des Berghangs gemeißelten, reich verzierten Fassaden, die in ihrer rauen, scharfkantigen Umgebung wie Edelsteine wirkten.
Anders als allgemein angenommen, war Aura durchaus zu Fuß zu erreichen. Nicht alle im alten Pyra hatten einen Phönix gehabt, und die frühen Siedler waren schon hier gewesen, als sie noch längst keine flammenden Feuervögel gekannt hatten. Die Landschaft war steil und gefährlich, und deshalb hatten die alten Pyrener ihre Straßen in den Berg gebaut. Überall am Pyrmont gab es endlose Tunnel, von den höchsten Gipfeln bis hinab ins Vorgebirge – Avalkyra hatte sie während des Blutkrieges entdeckt. Nicht alle Tunnel waren miteinander verbunden, zumindest heute nicht mehr, nach Jahrhunderten der Vernachlässigung und der Einstürze. Einige waren über Höhlen oder Bergwerksgänge zu erreichen, andere durch zerfallene Torbögen oder Türen wie die, von denen die Sekveia übersät war. Das Imperium hatte jahrelang nach Avalkyras geheimen Schlupfwinkeln gesucht, hatte zum Himmel hochgestarrt und war nicht auf die Idee gekommen, zu seinen Füßen nachzusehen. Ihre Stützpunkte waren nie entdeckt, ihre Bollwerke niemals zerstört worden.
Jedenfalls nicht von Soldaten. Eine einzige Person hatte es geschafft, sie zu finden … aber das war keine Kriegerin gewesen.
Die Pfade im Berginneren waren dunkel und trügerisch gewesen, aber Avalkyra hatte alte Karten zur Orientierung und Seile zum Klettern bei sich gehabt. Sie hatte Wochen gebraucht, aber nun war sie hier und stand zwischen diesen sagenumwobenen Ruinen.
Überall, wohin sie schaute, gab es Phönixstatuen, wurden Federn und Feuer geehrt, und alles war mit Gold durchsetzt. Mit dieser Pracht konnten sich nicht einmal die Marmorzeile und der Götterplatz in Aura Nova messen, und doch … in die Pracht mischte sich auch Trauer. Verzweiflung.
Alles war still und leer und ruhig. Nichts Weiches und Formbares war noch vorhanden. Keine wogenden Banner mit dem Aschenfeuer-Siegel oder in offenen Fenstern herunterbrennende Talgkerzen. Es gab keine Rufe und kein Lachen, kein Knistern eines Küchenfeuers. Sogar der Duft von Leben fehlte – von Brot im Backofen oder frischen Feuerblüten. Nichts wuchs in dieser felsigen Landschaft und alle Blumenkästen und öffentlichen Gärten waren verödet.
Es war eine leere Stadt, ein Mausoleum.
Es war ein Friedhof.
Avalkyra hatte überall nach den berühmten Aschenfeuer-Kronen gesucht – die angeblich die Grabsteine der toten Königinnen schmückten –, aber sie wollten sich ihr nicht offenbaren. Es berührte sie auf eine seltsame Weise tief in ihrem Innern, so als versteckten ihre Ahninnen nicht nur ihre irdischen Hinterlassenschaften, sondern auch ihre Geheimnisse vor ihr. Aber in einem ganzen Jahrtausend musste doch wenigstens eine von ihnen mit ihrer Tiermagie und ihrem Platz in der Welt gerungen haben?
Im Mittelpunkt der Ruinen befand sich die Ewige Flamme – oder genauer gesagt die kalte, leere Grube, die deren einziger Überrest war, das überzeugendste Mahnmal des Todes, das Avalkyra jemals gesehen hatte. Sie ging nun darauf zu, angezogen auf eine Weise, die sie nicht erklären konnte. Vielleicht lag es an dieser Zerstörung, an der Aura von etwas Totem und Verwüstetem, das trotz allem noch da war. Etwas, das sich weigerte, ganz und gar zu vergehen.
Auch die Grube der Flamme war umgeben von Bogengängen, die größer und prachtvoller waren als die anderen.
Zuerst hatte sie gedacht, sie seien alle gleich, wieder und wieder aus einer uralten Form entstanden. Aber nun, da sie seit mehreren Wochen die Ruinen durchwanderte, entdeckte sie kleine, aber deutliche Unterschiede. Der Phönix gerade über ihr hatte eine gewaltige Schwingenspreite, aber sie hatte auch schon kleinere gesehen. Die Höhe des Kammes, die Länge der Federn, belanglose Details vielleicht, aber Avalkyra hegte inzwischen den Verdacht, dass diese Torbogen bestimmten Phönixen gewidmet waren, die gekommen und gegangen waren. Ihre Theorie erwies sich als zutreffend, als sie außerhalb des Tempels einen Bogen mit unversehrter Inschrift fand:
Hier flog Xauriel, Verbündete von Friya. Möge ihre ewige Flamme lichtvoll lodern.
Es gab dreizehn Torbogen, die die Ewige Flamme umgaben, und Avalkyra war sicher, dass sie an die Ersten Reiterinnen und ihre Phönixe erinnern sollten. Ignix. Cirix. Roxana. Es hätten vierzehn sein müssen, aber eine offene Stelle verriet ihr, dass aller Wahrscheinlichkeit nach ein Bogen eingestürzt war. Die Inschriften waren verschwunden, abgeschliffen von Jahren voller Wind und Sonne und Regen. So hoch hier am Gipfel des Pyrmont fiel manchmal sogar Schnee. Und diese Säulen waren Jahrtausende alt.
Avalkyra hasste sie. Sie hasste die alten Reiterinnen und ihre treuen Reittiere, hasste die in jede erdenkliche Oberfläche eingemeißelten Phönixe. Aura war eine Wüste aus zerfallenden Tempeln, gewaltigen Skulpturen und weiten, aufsteigenden Galerien – und das alles bedeutete eine ständige Erinnerung an alles, was sie nicht hatte. Was sie niemals wieder haben würde, so wie es aussah.
Sie hatte einmal einen Phönix gehabt: Nyx. Feurig und zuverlässig. Avalkyra hatte keine romantischen Vorstellungen von der Bindung, so wie Veronyka – Nyx war eine nützliche Verbündete gewesen. Ein Mittel zum Zweck. Aber sie war stark und ausdauernd gewesen. Und, ja, treu. Bis zum Ende.
Aber das Ende war gar nicht das Ende gewesen, oder? Und während sie sich verzweifelt ans Leben geklammert hatte, hatte Nyx sie allein gelassen.
In solchen Augenblicken sehnte sie sich nach Veronyka mit ihrer endlosen Hoffnung. Oder war es Pheronias Gesellschaft, die ihr fehlte? Manchmal war das schwer zu sagen. Die beiden waren sich so ähnlich.
Und doch … sie hatte Pheronia verloren, sogar schon vor deren Tod. Sie hatte ihrer Schwester zu viel zugemutet, als sie deren Mutter ermordet hatte, diese Ränkeschmiedin, und da hatte Pheronia den Kontakt endgültig abgebrochen. Unbeantwortete Briefe. Nicht unterzeichnete Abkommen. Avalkyra hatte versucht, alles wiedergutzumachen, ihre zerbrochene Beziehung zu kitten – wegen Veronyka, wie sie jetzt wusste, was damals nicht der Fall gewesen war –, aber es war zu spät. In mancher Hinsicht war Veronyka die Friedensstifterin. Das Band, das Pheronia und Avalkyra noch jetzt miteinander verknüpfte. Wenn Pheronia nicht schwanger gewesen wäre … wenn es kein Kind gegeben hätte … dann wären sie beide in diesem Krieg ums Leben gekommen, und es würde in der Welt keine Aschenfeuer mehr geben.
Veronyka die Friedensstifterin, wie einst Königin Elysia.
Avalkyra schnaubte.
Sie hatte Veronyka noch nicht verloren. Sie hatte der Kleinen Raum gelassen, aber solange es zwischen ihnen Schattenmagie gab, war Trennung eine Illusion. Keine Entfernung war zu groß. Sie würde dafür sorgen, dass Veronyka wieder ihr gehörte.
Sie hatte Zeit gehabt, darüber nachzudenken – zu viel Zeit –, und sie war sicher, ihren Fehler endlich begriffen zu haben. Sie war immer davon ausgegangen, dass Pheronia wusste, was getan werden musste, dass sie ein wichtiger Teil der Zukunft war, die Avalkyra für sich selbst gesehen hatte – für sie beide. Und doch hatte sie ihre Schwester niemals offen gefragt. Sie hatte die Worte niemals gesagt, weil sie geglaubt hatte, dass sie nicht gesagt zu werden brauchten. Aber vielleicht war das doch der Fall.
Du und ich sind dazu bestimmt, zusammen zu herrschen. Schließ dich mir an, Schwester. Die Welt gehört uns.
Als sie einander nach Jahren des Kampfes und der Trennung wieder von Angesicht zu Angesicht gegenüberstanden, war es jedoch zu spät gewesen. Diese Träume waren zerschmettert worden.
Aber diesmal … Veronyka war anders. Alles war anders.
Sie war immerhin eine Schattenmage und eine Phönixreiterin. Sie war mehr, als Pheronia jemals hätte sein können, und zusammen würde nichts sie aufhalten.
Aber dieselbe Magie, die Veronyka stark machte, hatte Avalkyra auch davon überzeugt, dass Worte nicht ausgesprochen werden mussten – dass sie einander aufgrund ihrer Bindung verstanden. Und deshalb hatte sie den gleichen Fehler gemacht wie mit Pheronia. Obwohl Veronyka Pheronia in so vielen Dingen überlegen war, war sie nicht mit dem Wissen aufgewachsen, wer und was sie war. Sie begriff nicht, dass sie und Avalkyra auserwählt waren, zum Herrschen bestimmt.
Sie wusste es noch immer nicht.
Es war ein zu großes Risiko gewesen, als sie jung gewesen war und ihre Schattenmagie wild und unberechenbar. Und jetzt? Avalkyra hatte Veronyka Teile dessen gegeben, was sie brauchte, aber nicht das ganze Bild. Bis sie einen Plan hatte, würde es die Sache nur komplizierter machen, wenn sie Veronyka ihr wahres Erbe enthüllte.
Avalkyra hatte geglaubt, einen Plan zu haben: einen Phönix ausbrüten, ihn aufziehen, bis er groß genug zum Fliegen wäre, dann ihre Verbündeten zusammenrufen und den Marsch auf die Hauptstadt beginnen. Das war über Jahre hinweg ihr Plan gewesen. Ihr Leben lang. Und er war mehrmals fehlgeschlagen, grandios fehlgeschlagen, wieder und wieder.
Sie brauchte einen neuen Plan, aber egal, wie sie die Sache auch betrachtete, sie brauchte einen Phönix. Was für eine Aschenfeuer-Königin wäre sie denn ohne? Sie wäre wie die arme, ohnmächtige Pheronia.
Nein. Sie brauchte einen Phönix, um darauf ins Gefecht zu reiten, einen feurigen Leuchtstrahl, der die Nacht erhellte und dem Imperium ihre Wiederkehr kundtat. Ohne Phönix wäre sie nur ein Schatten ihres früheren Selbst. Ein fahles Abbild.
Was sie vielleicht ja bereits war.
Während ihre Schattenmagie so stark war wie eh und je, in zwei Leben verfeinert und geschärft, kam ihre Tiermagie ihr geschwächt vor. Hauchdünn. Was immer sie an Schatten gewonnen hatte, hatte sie in ihrem verzweifelten Handel um ein neues Leben verloren. Sie konnte diesen Phönixen nicht geben, was sie suchten. Egal, wie viel Leben sie ihnen gab, egal, welche Mengen von Knochen und weiß glühenden Scheiterhaufen sie auftürmte, sie weigerten sich, zum Vorschein zu kommen.
Auf einmal, wie durch Gedankenkraft allein hervorgerufen, wurde die endlose gespenstische Stille durch das Geräusch einer dumpfen, gleichmäßigen Bewegung in der Ferne durchbrochen.
Flügelschläge.
Für einen wilden Moment dachte Avalkyra, es sei Nyx – ein dummer, törichter Gedanke. Nyx war nicht zurückgekehrt. Die Bindung war von Dauer – Veronyka und ihr Phönix hatten das bewiesen. Wenn Nyx noch am Leben wäre, würde sie es spüren.
Nein, dieser Phönix war größer als Nyx. Älter. Ein Weibchen. Ihre langen lila Federn zeigten ihre hundert Jahre – vielleicht auch vielmal hundert, so dunkel war ihr Gefieder –, und ihr Schnabel war schmaler, ihr Hals länger. Und die Krone auf ihrem Haupt – nun, mit der konnte sich Avalkyras Federkrone absolut nicht messen.
In ihrem Magen brodelte Zorn hoch. Sie könnte eine neue Krone herstellen und die Federn vom Leichnam dieses Phönix nehmen, wenn sie das wollte. Sie war Avalkyra Aschenfeuer. Sie war eine Königin. Keine würde heller leuchten oder heißer brennen als sie.
Avalkyra starrte den Phönix finster an, als er vor ihr gelandet war: Noch immer kochte Wut in ihrem Magen und krallte sich ihre Kehle hoch.
Obwohl diese Phönice beeindruckend war, was Alter und Größe anging, wirkte sie nicht … stabil. Etwas Zerbrochenes, Zersplittertes zeigte sich in ihren Augen, ihren zuckenden, unsicheren Bewegungen. Sie legte immer wieder den Kopf schief und ließ ihren Blick hin und her jagen … als ob sie etwas suchte, und dieses Etwas war nicht Avalkyra.
Anders als die meisten Phönixe, die Licht, Wärme und Energie ausstrahlten, wirkte dieses Wesen düster, kalt und misstrauisch.
»Wer bist du?«, fragte Avalkyra. Minuten vergingen, und als sich die Stille immer länger zog, setzte Avalkyra ihre Magie ein. Sag mir, wer du bist!, verlangte sie, aber das Denken der Phönice setzte sich gegen ihren Zugriff zur Wehr. Sie besaß eine beeindruckende Kraft, aber es gab auch Schwachstellen in den Mauern um ihren Geist … Risse und Spalte. Sie waren jedoch nicht Unfähigkeit oder Mangel an Erfahrung geschuldet. Nein, die Schwäche in der Verteidigung dieser Phönice entsprang einem Trauma.
Einem Jahrhunderte währenden Trauma.
Und in Avalkyras tiefstem Herzen entstand das Wissen, dass der Leib vielleicht alles ertragen oder neu erstehen könnte, dass der Geist jedoch so viele Leben nicht unverletzt überstand.
»Was willst du?«, fragte sie deshalb, obwohl sie nicht wusste, warum. Was konnte es sie kümmern, was dieses alte Gerippe wollte? »Ich bin deine Königin, Phönix, und hier in meinem Reich wirst du mir antworten.«
Diese Worte erregten die Aufmerksamkeit der Phönice. Ihr Blick, der zur Seite gewandert war, sprang mit geschärfter Konzentration zurück zu Avalkyra.
Aschenfeuer, sagte sie. Keine Frage.
»Ja«, erwiderte Avalkyra leise. In ihren Gedanken dagegen war dieses Wort laut ertönt, klar und mit Widerhall, wie eine massive Bronzeglocke.
Mehr Asche als Feuer, sagte die Phönice und sah sie mit ihrem ausdruckslosen Blick an, dann bewegte sie die Flügel und schaute sich abermals um.
Avalkyra starrte sie an. Sie hatte noch nie einen Phönix so sprechen gehört, mit Wortspielen und Andeutungen, wie ein Mensch es tun würde. Und doch hatte auch die Stimme dieses Wesens etwas aus einer anderen Welt. Sie war kalt – distanziert auf eine Weise, die sich wie Hass anfühlte, und mit Hass kannte Avalkyra sich aus.
Dann fügte die Phönice hinzu, fast als sei ihr das gerade erst eingefallen: Kein Wunder, dass du versagst.
Wusste sie …? Hatte die Phönice ihren letzten Versuch gesehen, ein Ei auszubrüten? Zorn wogte durch Avalkyras Körper, und sie schlug zu, schickte einen brennenden Impuls aus Schattenmagie los, der auf die brüchigen Mauern des Vogels auftraf und sie durchbrach.
Die Phönice bäumte sich auf, schüttelte den Kopf und stieß einen lauten Schrei aus.
Avalkyra genoss diesen Klang.
»Ich bin Asche und Feuer, und Nefyras Blut strömt durch meine Adern, Feuervogel. Vergiss nicht, mit wem du sprichst.«
Eine Weile blieb alles still und die Phönice wirkte fast … bestürzt.
Nefyra, sagte sie dann vorsichtig, als ob sie dieses Wort aufs Neue lernen müsste. Sie schüttelte wieder langsam den Kopf, dann heftiger, ehe sie mit einem plötzlichen Schrei und wütendem Flügelschlagen davonflog.
Avalkyra sah ihr hinterher und fragte sich, wie viele zerbrochene Dinge sie wohl in Aura noch finden würde. Ihr wurde schlecht bei der Erkenntnis, dass sie auch eins war.
Ein Teil von ihr hatte damit gerechnet, in den Ruinen Dutzende von Phönixen zu finden, die hier zurückgezogen von der Welt lebten. Aber wenn es noch andere gab, dann hielten sie sich weiterhin versteckt.
Wie Feiglinge.
Wie sie.
Was machte sie hier oben überhaupt? Hier war kein Glück zu finden, keine magische Hilfe für ihre Unfähigkeit, ein Ei auszubrüten und eine Verbündete zu erlangen. Stattdessen war hier nur diese hinfällige alte Phönice und machte sich über sie lustig. Zeigte ihr, was sie niemals wieder haben konnte.
Sie dachte zurück an die kalte Asche von Xephyras Auferstehungsfeuer, als es ihr gelungen war, die Verbindung zwischen Veronyka und ihrem Phönix für sich zu nutzen.
Damals hatte sie eine Möglichkeit gefunden, Kontrolle über Xephyra zu gewinnen, obwohl sie selbst keine Bindung zu ihr hatte; es war ihr gelungen, obgleich ihre Tiermagie versagt hatte.
Warum sollte ihr das kein zweites Mal glücken?
Natürlich war das erste Mal anders gewesen. Sie hatte sich Veronykas Bindung an Xephyra und ihre eigene Bindung an Veronyka, die sie alle auf eine ganz eigene Weise miteinander verknüpfte, zunutze gemacht. Soweit sie wusste, hatte das Wesen, dem sie soeben begegnet war, keine Reiterin und keinen Reiter, und selbst wenn, dann hätte Avalkyra ja keine Verbindung zu ihnen.
Aber es gab andere Möglichkeiten der Kontrolle … Möglichkeiten, bei denen Schattenmagie eine Rolle spielte. Schattenmagie gehörte eigentlich ins Reich der menschlichen Gedanken, aber sie hatte schließlich eben erst die mentalen Mauern der Phönice durchbrochen, oder nicht? Und das hatte sie nicht mit Tiermagie getan, sondern mit Schattenmagie.
Während die Magie des Lebenden das Reich von Licht und Leben und Bindungen war, schuf die Magie der Schatten eine andere Art von Band. Eine Fessel. Eine einseitige Verbindung, eher eine Forderung als eine Vereinigung. Und während sie den Bindenden weniger kostete als eine echte Verbindung – da er im Gegenzug keinen Zugang zu seinem eigenen Geist erlauben musste –, waren die Ergebnisse für Avalkyras Zwecke ausreichend.
Sie starrte der in der Ferne noch immer zu sehenden Phönice hinterher. Der Feuervogel zeichnete sich als vage Silhouette vor den Sternen ab – ein Flimmern voller Potenzial und Möglichkeiten.
»Komm zurück«, sagte Avalkyra. Sie hatte es leise gesagt, und obwohl es keine unmittelbare Reaktion gab – und die Phönice sie über diese Entfernung bestimmt nicht hören konnte –, war sie sicher, dass sie zurückkehren würde. Ihre Wege würden sich wieder kreuzen, und sie würde dafür sorgen, dass das zu ihrem Vorteil wäre.
Eine ruhige Gewissheit erfüllte sie.
Was hatte sie ihr Leben lang getan, als die Welt sich weigerte, ihr zu geben, was sie brauchte? Was sie verdiente?
Sie hatte es sich genommen.
Vielleicht waren ihre Ziele doch nicht so unerreichbar: zuerst ein Phönix, dann Veronyka, dann … das Imperium.
Vielleicht wurde es nun doch Zeit, Veronyka die Wahrheit zu sagen.
Vielleicht würde Veronyka mit dem Wissen, wer sie war, endlich ihren Platz an Avalkyras Seite einnehmen. Dann würde sie diese sogenannten Phönixreiter verlassen – würde den Adlerhorst und ihre Schutzmauern verlassen –, und zusammen würden sie das vollenden, was Avalkyra und Pheronia vor einem Lebensalter begonnen hatten.
Sie würde jedoch einen Beweis brauchen … Sie hatte ihren Siegelring und eine sorgfältig ausgeklügelte Wahrheit gebraucht, um Veronyka ihre eigene Wahrheit darzulegen, sie würde also mehr brauchen als nur Wörter. Zwischen ihnen lagen zu viele Jahre und zu viele Lügen, um Veronyka etwas glauben zu lassen, das sie sagte.
Ja, sie würde einen Beweis brauchen.
Und sie wusste genau, wo der zu finden war.
Kapitel 3 - Sev
Unerwünscht wurde sie genannt. Gewöhnlich. Ohnmächtig.
Und sie glaubte diesem Gerede, glaubte die Lügen, die ihr über sie selbst erzählt wurden.
– Kapitel 3 – Sev
Sev saß allein in der Kleinen Kammer. Eigentlich war sie überhaupt nicht klein – tatsächlich bestand sie aus einem Schlaf- und einem Wohnbereich und einem eigenen Waschraum –, aber alle nannten sie die Kleine Kammer, da es sich um den kleinsten von einem halben Dutzend Räumen für längere Pflege im Krankenflügel des Palasts von Freiherrn Rolan handelte, dem Gouverneur von Ferro.
Sev schüttelte den Kopf und versuchte zu begreifen, wie er hierhingeraten war.
Als er die Phönixreiter verlassen hatte, war seine Zuversicht, sein Versprechen erfüllen zu können, mit jedem Schritt mehr ins Wanken geraten. Er kehrte aus freien Stücken ins Imperium zurück, in seine Position als Soldat, aus der er sich doch gerade erst befreit hatte. Es war schwer zu glauben, dass er sich wirklich freiwillig dazu gemeldet hatte.
So schwer es zu glauben war, dass er sich mit Trix eingelassen hatte, Spionführerin der Königin mit der Federkrone, und ihrer albernen Rebellion. Dieser Gedanke brachte ein reuiges Lächeln in Sevs Gesicht. Es war die beste Entscheidung seines Lebens gewesen und seine Schritte waren danach ein wenig leichter geworden.
Ehe er den Adlerhorst verlassen hatte, hatte Kommandant Cassian ihm geholfen, einen Plan zu schmieden und eine Reiseroute aufzustellen, auf der er die Patrouillenflüge der Phönixreiter nicht kreuzen würde. Gemeinsam hatten sie entschieden, dass er zu den Vesperäischen Höhlen zurückkehren würde – dahin, wo sich sein Regiment vor dem Angriff versammelt hatte –, um dort Proviant zu erbetteln und nach möglichen Überlebenden zu suchen.
»Wir können dir nichts geben«, hatte der Kommandant ihn gewarnt, »und du darfst bei deiner Rückkehr auch nicht zu gut versorgt aussehen. Wir haben von deiner alten Kleidung gerettet, was wir konnten, aber bei der Tunika war nichts mehr zu machen. Du musst behaupten, du hättest sie einem Leichnam abgenommen oder einem Wanderer gestohlen.«
Sev hatte geseufzt und allmählich begriffen, worauf er sich da eingelassen hatte.
»Und deine Schulter wird Verdacht erregen«, hatte der Kommandant hinzugefügt, ohne Sevs Widerwillen gegenüber dem, was vor ihm lag, zu bemerken. Vielleicht kümmerte er ihn auch einfach nicht.
»Glaubwürdiger könnte die doch gar nicht sein«, widersprach Sev und schaute auf seine verbundene Schulter hinunter, die steif war und wehtat, obwohl die knochentiefe Hitze, die sie ausstrahlte, nun ein wenig nachließ. »Das beweist doch, dass ich beim Angriff dabei war und kein Überläufer oder Deserteur bin.«
»Ja, und überaus kenntnisreich versorgt wurde deine Wunde von Greta, einer Priesterin der Hael, einer Heilerin, wie du sie nirgendwo in Pyra finden könntest, und selbst wenn, könntest du sie dir nicht leisten.«
In Sevs Bauch stieg nun eine bange Ahnung auf. »Ich könnte sagen, ich hätte in einem Dorf einen Heiler gefunden oder wäre in der Nähe der Grenze in einen Tempel gegangen …«
»Und wenn du bei den Höhlen auf einen deiner Regimentskameraden stößt und keine Möglichkeit mehr dazu hast?«, fragte der Kommandant und schüttelte den Kopf. »Ich habe mit Greta gesprochen. Deine Wunde entwickelt sich zum Guten, und sie meint, dass sie so weit verheilt ist, dass du keine schwere Infektion mehr riskierst, wenn du den Verband ablegst und durch ein paar Leinenlappen ersetzt. Und ab und zu musst du diese Salbe benutzen.« Er nahm den Deckel von einem kleinen Tontiegel. Der Geruch, der ihm entströmte, war durchaus angenehm, blumig und süß. »Sie ist aus Efeu und Tränenden Herzen hergestellt. Trag sie nur auf die Oberfläche der Wunde auf. Die Haut wird dann rot werden und anschwellen und die Wunde wird sich während deiner Reise nicht schließen. Du musst die Salbe loswerden, ehe du die Grenze zum Imperium überschreitest. Es wird dich mehrere Wochen zurückwerfen, aber es ist unsere beste Möglichkeit, keinen Verdacht zu erregen.«
Sev nahm die Salbe und fürchtete sich schon jetzt vor dem Schmerz, der sich zweifellos einstellen würde.
»Du wirst ihnen sagen, dass der Pfeilschaft von einem Heiler aus dem Imperium entfernt wurde, der dann im Kampf ums Leben kam. Bei jedem Regiment war eine Handvoll Heiler im Einsatz – wir haben bei der Wendeltreppe und unten am Steilufer mehrere Leichen gefunden. Wir haben uns eine von ihren Taschen geholt, obwohl sie schrecklich schlecht ausgerüstet waren. Verbandszeug, Nadel und Faden, um Wunden zu nähen, und eine Mohntinktur, um Schmerzen zu betäuben. Du wirst diese Tasche als Beweisstück mitnehmen.«
Danach hatte Sev seine zerlöcherte, blutbefleckte Kleidung angelegt und sein Gesicht mit Schmutz eingerieben. Und ehe er sich’s versah, war er auch schon den Berg hinuntergewandert.
Nun lag er in einem Himmelbett, unter sich eine üppige, mit Daunen gefüllte Matratze, über sich drei weiche Wolldecken. Diese Zimmer waren eigentlich nur für die Palastbewohner gedacht und boten jeglichen Komfort, den eine Gouverneursfamilie erwarten konnte, falls sie Wochen in der Obhut einer Heilerin oder eines Heilers verbringen müsste.
Ein Krug voll Minze-Zitrone-Wasser stand auf seinem Nachttisch und Sev war gewaschen, gefüttert und frisch verbunden worden. Seit seinem Eintreffen war er gut behandelt worden, zuvorkommend geradezu, wie ein aus dem Krieg heimgekehrter Held. Aufgrund der Schwere seiner Verletzung war ihm diese private Kammer zugewiesen worden, zweimal pro Tag schaute eine Heilerin nach ihm, und mit einer Schelle konnte er Dienstboten herbeirufen.
Sev wusste, dass er besser behandelt wurde als die meisten anderen Soldaten, die aus dem Kampf zurückkehrten, egal, wie schwer verletzt sie waren, und das beunruhigte ihn sehr – er kam sich vor wie ein Stück Vieh, das gemästet wird, ehe der Schlachter es sich holt.
Aber heute würde er endlich Freiherrn Rolan begegnen. Als Sev hier angekommen war, hatte der Gouverneur in der Hauptstadt geweilt, aber er hatte offenbar die Weisung hinterlassen, aus Pyra zurückkehrende Soldaten so gut wie nur möglich zu behandeln. Sev hatte inzwischen in Erfahrung gebracht, dass es vor ihm etliche Überlebende gegeben hatte, die bereits befragt und auf ihre neuen Posten gesandt worden waren, ganz zu schweigen von dem, mit dem er angekommen war.
Als Sev zu den Vesperäischen Höhlen zurückgekehrt war, waren sie verlassen gewesen. Das hatte er jedenfalls geglaubt. Die Reiter hatten die Leichen bereits verbrannt und die verdorbenen Lebensmittel vernichtet, auch die Lamas waren verschwunden – wobei er nicht sicher war, ob sie ausgebrochen waren und jetzt durch den Pyrmont streiften oder ob sie von überlebenden Soldaten oder Reitern eingefangen worden waren. Ein Teil von ihm hatte auf irgendwelche Spuren von Kade gehofft, auf einen Hinweis oder die Möglichkeit, dass er entkommen war, aber er hatte nichts gefunden. Er hatte sogar in der Asche des Scheiterhaufens nach Kades Abzeichen gesucht, voller Angst davor, was er finden würde. Als seine Suche rein gar nichts ergab, hatte er einen zitternden Seufzer der Erleichterung ausgestoßen.
Er hatte gerade mit dem Gedanken gespielt, diese Nacht in den Höhlen zu verbringen, als eine Stimme in der tiefer werdenden Dämmerung erschollen war.
Sev war herumgefahren – Schmerzen durchloderten seine frisch aktivierte Wunde – und hatte sich einem ihm unbekannten Mann gegenüber gesehen, der mit wilden roten Brandwunden übersät war und ein kurzes Schwert in der Hand hielt. Sev wollte nach seiner eigenen Waffe greifen, aber das war nicht nötig gewesen. Der Mann erwies sich als Soldat, ebenso wie Sev, und hatte zu den Verstärkungstruppen gehört, die in der Nacht des fehlgeschlagenen Vergiftungsversuchs eingetroffen waren. Er hatte einen Blick auf Sevs Wunde geworfen, mit Wolfsgrinsen gesagt, »Besser kalter Stahl als heißes Feuer«, dann hatten sie sich zu zweit auf den Rest des Weges zurück ins Imperium gemacht.
An den folgenden Tagen hatte Sev oft an Trix und Kade gedacht. Die düsteren Erinnerungen ließen seinen Atem stocken und seine Kehle schmerzen, doch dann kam ihm auch immer etwas in den Sinn, bei dem er lachen oder lächeln musste. Trix’ scharfe Zunge und Kades gelassener Humor. Er erinnerte sich daran, warum das alles hier gerade geschah, und dann konnte er ein bisschen leichter einschlafen.
Nach Jahren der Angst und Feigheit, Jahren, in denen er sich unter denen versteckt hatte, die doch seine Feinde hätten sein sollen, hatte sein Leben jetzt Sinn und Ziel. Es war entsetzlich gewesen, Trix und Kade zu verlieren, und das Einzige, was er tun konnte, um diesen Schmerz zu lindern, war, das zu vollenden, was die beiden begonnen hatten: die letzten Relikte der Phönixreiter zu beschützen – den Orden, für den seine Eltern im Kampf gefallen waren – und Männer wie Freiherrn Rolan zu entmachten.
Rolan war es gewesen, der geheime Truppen nach Pyra geschickt hatte, mit dem Befehl, die Phönixreiter niederzumetzeln, und Generäle wie er hatten Schwärme von Soldaten ausgesandt, um Sevs Eltern zu töten.
Wenn Sev der einzige Überlebende wäre, müsste sein Leben doch einen Sinn haben. Das müsste es einfach. Wie könnte er es sonst verdienen zu leben, wenn Menschen wie seine Eltern, wie Kade und Trix, das nicht taten?
Trotz ihrer Wunden und ihrer mageren Vorräte waren Sev und der Soldat gut vorangekommen und hatten schon drei Wochen nach Ende der Kampfhandlungen die Tore zum Besitz des Gouverneurs im Zentrum von Orro durchschritten. Der andere Soldat war in viel besserer Verfassung gewesen als Sev, und nach einer kurzen Untersuchung durch Hestia, der Heilerin, war er mit einer Salbe eingerieben und wieder an die Front geschickt worden. Sevs Verletzung verlangte eine gründlichere Behandlung. Selbst nachdem Hestia getan hatte, was sie konnte, um die Rötung und die Schwellung zu mindern, konnte Sev die Schulter nur sehr begrenzt bewegen. Dazu kam ein andauernder strahlender Schmerz, der die Muskeln an seinem Hals und in seinem Rücken dazu brachte, vor Spannung zu verkrampfen. Hestia hatte ihm einen Blick zugeworfen, der ihm klarmachte, dass er niemals wirklich geheilt werden könnte, doch sie kam trotzdem jeden Tag, um Umschläge anzulegen und Salben aufzutragen und ihm beim Bewegen des steifen Gelenks zu helfen.
Nach einer besonders schmerzhaften Behandlung, nach der Sev schweißnass und benommen war, verabreichte Hestia ihm ein starkes Beruhigungsmittel und ließ ihn mit der wachsenden Angst zurück, dass er für Rolan ohne seinen Arm wertlos wäre. Dass er entlassen oder für die restlichen Jahre, die er dem Imperium schuldig war, in den Kerker gesperrt werden würde.