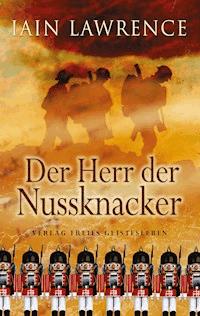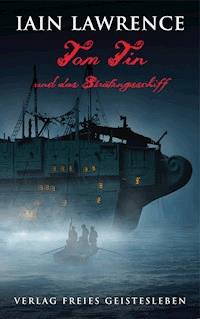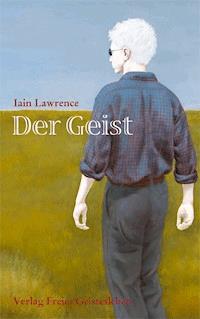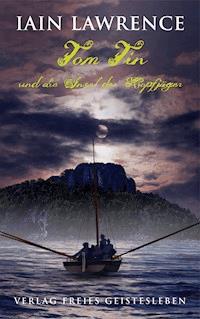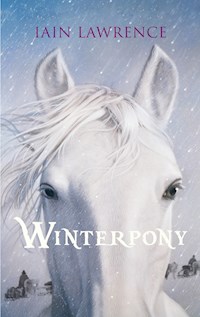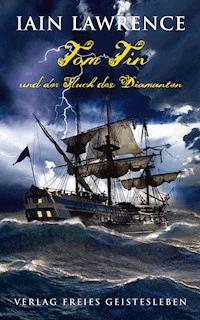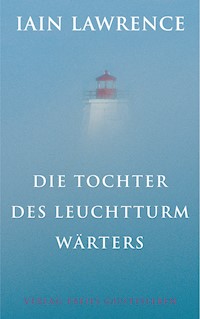
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Freies Geistesleben
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Krabbe und ihr Bruder Alastair wachsen unter extremen Bedingungen auf. Paradiesisch schön, aber höllisch einsam ist es auf Lizzie Island, nur zusammen mit den Eltern, ohne wirklichen Kontakt nach außen. Die Situation spitzt sich verhängnisvoll zu, als beide aus der Kindheit heraustreten. - Einige Jahre später kehrt Krabbe als junge Frau auf die Insel zurück. Nicht nur für sie bedeutet ihre Rückkehr eine Reise in die Vergangenheit und eine Suche nach dem Sinn des Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Iain Lawrence
Die Tochter des Leuchtturmwärters
Aus dem Englischen von Christoph Renfer
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Danksagung
Für Sheila. Sie hat mich von allem Anfang an ermutigt und die Karte gezeichnet, die mir den Weg nach Lucy Island zeigte.
1. Kapitel
Im Bug des Schiffs, hoch über dem Meer, steht ein siebzehnjähriges Mädchen – wie eine Galionsfigur aus Holz, die Arme regungslos, das Haar fein geschnitzt und golden bemalt.
Das Schiff trägt das Mädchen mit dem Wind nach Norden, in scheinbar immerwährender Ruhe. Die Flaggen hängen, zu Stofffetzen verknotet, schlaff vom Mast, der Rauch steigt wie eine graue Säule aus dem Schornstein. Das Meer, nicht das Schiff, scheint sich fortzubewegen. Es bricht sich am Bug und tost schäumend den Rumpf entlang. Es spült Seetangreste und auf den Wellen tanzendes Treibholz mit sich. Möwen und Alken flattern davon, doch die junge Frau blickt starr geradeaus.
Neben ihr kauert, ganz in Rot, ihre Tochter. Sie ist zu klein, um über die Reling zu blicken. Sie guckt durch die ovale Trossenklüse, die kleinen Hände am Metall festgeklammert. Wie eine Katze auf der Fensterbank starrt sie zwischen beiden Händen hindurch aufs Meer hinaus und zwischen den Knien hat sie ein rotes Plastiktäschchen eingeklemmt, dessen Lasche über einer Barbiepuppe zugeknöpft ist. Auf der einen Seite ragt ein Wuschelkopf, auf der anderen Seite ein rosa Beinpaar heraus.
Das Meer fegt vorbei, hämmert gegen den Bug und versprüht feine Gischttröpfchen, die wie Käfer über das Wasser huschen. Die Wassermassen branden in die Höhe, fast bis zu dem immer noch regungslos dastehenden Mädchen empor, um sich gleich wieder in die Tiefe zu stürzen, als das Schiff von einem Brecher hochgestemmt wird und dann den Wellenkamm durchschneidet. Ganz weit vorne am Horizont taucht jetzt eine winzige leuchtende Kappe auf. Ein einzelnes weißes Auge blinzelt ihr über Meilen von Wasser hinweg zu.
Und schon ist es wieder verschwunden, versunken in den Wogen, während das Schiff vom Wellenberg in die See hinabtaucht und die am Bug aufschäumende Gischt bis zu ihr hinaufsprüht. Doch sie blickt unentwegt geradeaus, bis sie wieder auftauchen, die kleine rote Kappe und das aufblitzende Licht. Seit die Darby vor einer Stunde bei den Kinahan Inseln den Kurs wechselte, hat sie danach Ausschau gehalten. Jetzt regt sie sich erstmals. Sie legt eine Hand auf den Mund.
Die Insel erhebt sich wie ein auftauchender Wal aus dem Meer. Hinter einem silbernen Schleier aus Gischt und Dunst zeichnen sich Bäume und Felsen ab. Unter der roten Kappe nimmt ein Turm Gestalt an, zuerst so klein und weiß, dass er sie an einen Grabstein erinnert. Dann tauchen Gebäude auf, rote Dächer und weiße Mauern. Grüne Rasenquadrate. Dunkle Streifen von Salalbüschen.
Jeder neue Mosaikstein erfüllt sie mit einem neuen Gefühl, mit einem Bild aus ihrer Erinnerung, einem Geruch oder einem Klang. Sie ist auf dieser Insel geboren. Sie ist die Tochter des Leuchtturmwärters. Sie heißt Elizabeth McCrae, doch seit sie auf der Welt ist, wird sie Krabbe genannt.
«Tatiana, schau», sagt sie. «Da vorne ist Lizzie Island.»
Die Tochter antwortet nicht. Sie spricht selten. Ihre kleinen Schultern sind gebeugt, ihr Kopf ist nach vorne gereckt. Winzig und zerbrechlich sieht sie aus, eher zwei als drei Jahre alt. Krabbe lässt sich neben ihr auf dem grauen Stahl des Decks nieder. Sie hält Tatiana fest, als habe sie Angst, das Kind würde durch das Loch ins Meer verschwinden.
Tatiana blickt auf, ihre Augen sind unstet, ihr Grinsen entblößt alle ihre Zähne.
«Alles in Ordnung?», fragt Krabbe.
Tatiana nickt.
«Gleich sind wir da. Du wirst deine Oma und deinen Opa kennen lernen. Sie haben ein Boot mit einem Glasboden und einen Traktor mit einem Anhänger, auf dem du spazieren fahren kannst.»
Krabbe will ihr von allem erzählen: von Old Glory, dem kleinen geflügelten Pferd, von Gomorrha und der Klagemauer; von Alastairs Flöte und dem Gesang der Wale. Doch Tatiana hört nicht zu. Das Kind blickt schon wieder durch die Trossenklüse auf das am Schiff vorbeirauschende Wasser.
Auf der Insel geht ein frischer Wind. Er peitscht die Wellen gegen das Ufer und zerstäubt sie zu einem feinen Sprühnebel. Er weht böig über die Felsen und den durchnässten Rasen, auf dem in khakifarbenen Shorts Murray McCrae, der Leuchtturmwärter, steht.
«Die Darby kommt rein», sagt er, als wäre es ihm gleichgültig, als hätte er nicht seit Tagesanbruch nach dem Schiff Ausschau gehalten. In den Händen hält er Dinge, die das Meer an den Strand gespült hat: Algenstränge, Borkenstücke und Äste, die wie die warzigen Finger alter Männer mit Seepocken gespickt sind.
Zwei Meter hinter ihm blickt Hannah zum Himmel auf und wendet ihr Gesicht der Sonne zu. So spät im September steht sie schon tief im Süden. Sie glitzert auf den Wellen und den gischtnassen Felsen. Hannah blinzelt, legt die Hände über ihr Gesicht und schaut durch den herzförmigen Tunnel, den sie mit ihren Fingern gebildet hat, auf die See hinaus.
Die Darby ist weit draußen. Eine braune Rauchfahne, der Rumpf ein roter Fleck. Dort draußen ist ihre Tochter, eine Stunde von ihr entfernt.
Murray geht mit den Holzstecken bis an den Rand des Rasens und wirft sie dorthin zurück, wo sie hergekommen sind, über die Klippe ins Meer hinab. Er klatscht in die Hände und zieht seine Shorts hoch. «Volle Kraft voraus», sagt er. «Hab ’ne Menge zu tun. Sand holen.»
Einen Augenblick später ist er weg, ein viel zu großer Zirkusbär auf seinem kleinen Traktor. Ein rostiger Anhänger klappert und quietscht hinter ihm her, während er über den Plankenweg in den Wald hineinrattert.
Hannah geht in die andere Richtung über die Brücke in den Turm, hinauf bis zur Rundplattform. Seit bald einer Woche ist ein einsamer Buckelwal im seichten Uferwasser auf Futtersuche. Nun hält sie nach ihm Ausschau, so wie man von einer Veranda aus nach einem Freund Ausschau hält. Das lange, dunkle Kleid der Frau des Leuchtturmwärters und ihr purpurroter, um den Kopf geschlungener Schal flattern im Wind.
Früher einmal war das ihr liebster Platz, hoch über den Häusern und dem smaragdgrünen Rasenfleck. Vom Geländer umgeben brauchte sie keine Angst vor der Höhe zu haben, selbst wenn sie so hoch über dem Meer stand, dass die Vögel tiefer waren als sie und die Brandung weit draußen am Riff von Devil Rock weiß glitzernd aufschäumte. Früher war der Herbst ihre liebste Jahreszeit, das Ende des Sommers, wenn die Wale und die Vögel auf ihrem Zug in den Süden hier Halt machten. Doch jetzt ist die Insel ein Gefängnis, das Meer eine unüberwindliche Mauer. Der Herbst ist der Vorbote des Winters und des Totengräbers. Selbst der Wind macht ihr Angst.
Jetzt weiß sie, dass er eine Stimme hat. Sie hat ihn oft genug gehört in den letzten drei Jahren, als Atemzug im hohen Sommergras, als Flüstern in den moosbärtigen Bäumen. Er hat ihren Namen gerufen in den Stürmen, die von Süden kommen, wenn die Möwen wie Papierfetzen durch die Luft geschleudert werden. Sie hat Murray nichts davon erzählt, doch die Stimme im Wind ist die Stimme ihres Sohnes.
Gestern war er hier. Als der Sturm seinen Höhepunkt erreichte und das Haus durchschüttelte, als die kanadische Flagge in rote und weiße Fetzen gerissen wurde, blickte sie hinaus und sah ihn im aufblitzenden Licht. Dann wurde es wieder dunkel, und er war weg. Mit einem Mal weg. Armer Alastair, seit vier Jahren ertrunken, im Sturm vom Meer an die Oberfläche gespült.
Ein Schaudern geht durch Hannah, als sie daran denkt, dass er ihr erschienen ist. Sie weicht vom Geländer zurück und lehnt sich gegen das Glas. Obwohl das Wasser fünfundzwanzig Meter tiefer liegt, ist die Scheibe mit Salzkrusten überzogen. Der Sturm der vergangenen Nacht hat seine Spuren hinterlassen. Hannah reibt über die Salzflecken, erst mit der Hand, dann mit dem Schal. Sowie sie ihn vom Kopf nimmt, wehen die Strähnen ihres Haars im Wind. Alle fünf Sekunden blitzt das Leuchtfeuer in der Kuppel auf.
Heutzutage ist es ein armseliges Ding, dieses Leuchtfeuer, eine Halbkugel aus Plastik auf einer jämmerlichen Stange. Die alte Lampe hat längst ausgedient, die alte Lampe in ihrem Quecksilberbad, die sich drehte und drehte und eine Leuchtkraft hatte, die stärker war als das Sonnenlicht.
«Sie dürfen nicht direkt hineinblicken», sagte Murray, als er sie zum ersten Mal mit auf den Turm nahm. «Das Licht kann Ihnen die Augen verbrennen», sagte er. Noch eine ganze Woche lang ging sie mit zusammengekniffenen Augen über den Rasen, bis ihr Murray lachend sagte, dass das Leuchtfeuer weit oben über sie hinausstrahlte. Dennoch warf es ihren Schatten auf das Gras, einen grauen Umriss, der beim Gehen neben ihr her hüpfte. Es leuchtete durch die Fenster und verfolgte sie bis in den Wald hinein. Es war wie ein kolossales Auge, das sie von hoch oben ständig beobachtete. Und sie war froh, als die neue Lampe kam, während Murray von allem Anfang an nur Verachtung für sie übrig hatte.
«Schau dir diese mickrigen Funzeln an», sagte er. Er hob die Plastikkuppe und deutete auf ein halbes Dutzend Lampen, die in einer Vorrichtung aus Metall und Plastik steckten. Sie waren nicht größer als Christbaumkerzen.
«Das ist der Anfang vom Ende», sagte Murray. «Als Nächstes werden sie die Wärter entlassen – du wirst es schon sehen.» Dann streckte er eine Hand aus und schraubte an einer Lampe. Sofort setzte sich die ganze Vorrichtung in Bewegung. Die alte Lampe wurde nach unten gekippt, und eine neue schob sich surrend und klickend an ihre Stelle. Hannah hörte ein leises Knistern, als der Glühfaden hell zu leuchten begann.
«Du wirst sehen, spätestens in einem Jahr schicken sie uns den blauen Brief», sagte Murray.
Seither sind viele Jahre vergangen, und der blaue Brief ist noch immer nicht gekommen. Murray erwartet ihn mit panischer Angst, für Hannah kann er nicht früh genug kommen.
Sie reibt über das Salz, und als der Buckelwal ausatmet, bebt das Glas unter ihrer Hand. Sie nimmt den Laut als metallischen Schlag wahr, und sie schafft es gerade noch rechtzeitig, ihren Kopf zu drehen, um die in der Sonne glitzernde Gischtfontäne zu sehen, eine Wolke, so weiß wie aus einem Wasserkessel austretender Dampf. Ein Dutzend Möwen flattern zu der Stelle, an der das Wasser dunkel und aufgewirbelt ist. Hannahs Augen suchen die Felsen ab, die Fahrrinne, wo das Wasser vom Sand golden und silbern schimmert. Ihr Blick schweift gegen Süden, doch sie kann den Wal nicht entdecken.
Nur die Darby ist dort draußen und bringt ihr, wie der in der Wüste erscheinende Yahwe, ihre Tochter in einer Rauchsäule. Schäumendes Wasser spritzt beiderseits des Bugs in die Höhe, wie weiße Blüten, als fahre das Schiff durch ein Feld von Pusteblumen. Für einen Augenblick wünscht sich Hannah das Fernglas. Es hängt an einem Haken bei der Tür, unmittelbar neben einem kleinen braunen Umschlag, den Murray dorthin geklebt hat, um seine Linsenreiniger aufzubewahren. Doch der Wunsch verschwindet sogleich wieder. Das große Fernglas stamme von einem deutschen U-Boot, hatte ihr Murray gesagt. Irgendwie hat sie Angst vor ihm, Angst, dass sie die Dinge sehen würde, die das Fernglas gesehen hatte, allein schon, wenn sie es einfach so in den Händen halten würde. Nein, sagt sie zu sich, nein, es wäre falsch, durch Gläser, die das Ertrinken von Menschen beobachtet hatten, nach ihrer Tochter Ausschau zu halten.
Unter ihr, auf der anderen Seite der Brücke und des Rasens, tuckert Murrays Traktor wieder über den Weg zurück. Der Motor schnauft und keucht. Seit drei Tagen ist Murray jetzt schon dabei, Sand herbeizuschaffen, zwei Eimer auf einmal.
Am ersten Tag fragte sie ihn: «Wieso kann das Mädchen nicht einfach am Strand spielen?»
«Weil sie ihren Sand lieber im Kasten haben», sagte er. «Katzen und Kinder.» Mit den Schultern zuckend fügte er hinzu: «Och, die sind sich sowieso ziemlich ähnlich.»
Er hat nie eine Katze besessen, und Tatiana hat er noch nie gesehen.
«Schau mal!», sagte er. «Ich habe ein paar Spielsachen gebastelt für die Kleine.»
Die Spielsachen sind hübsch, aus klobigem Holz, rot und gelb bemalt. Ein Schiff wie die Darby, mit einem Hebekran für all die kleinen Kisten, die auf Deck stehen. Ein Segelschiff und ein Frachter und eine flache Fähre mit drei komisch aussehenden Autos, die über bewegliche Rampen an Bord rollen.
«Was sind das für Autos?», fragte sie.
«Och, weiß ich gar nicht», sagte er. «Vielleicht DeSotos.»
Hannah lächelt vor sich hin. Murray hat schon seit beinahe fünfundzwanzig Jahren kein Auto mehr gesehen.
Von ihrer hohen Warte aus beobachtet sie, wie er Eimer für Eimer vom Anhänger nimmt und in den Sandkasten kippt. Auf einem Knie kauernd verteilt er den Sand, sortiert Muschelreste, Steine und Glasscherben aus und sammelt sie, um sie wieder an den Strand zurückzubringen. Seine Hand harkt mit offenen Fingern durch den Sand, und Hannah hört die aussortierten Sachen erst im Eimer aufprallen, wenn seine Hand längst wieder durch den Sand siebt. Dann blickt er auf, am kleinen Schuppen vorbei, den er um den Sandkasten herum gebaut hat, und steht mit den Eimern in den Händen da.
Es entgeht Hannah nicht, dass er bei der ganzen Arbeit die Darby im Auge behält, auch wenn er Gleichgültigkeit vortäuscht. Er trägt die Eimer zum Traktor zurück und blickt nach Süden. Er stellt sie in den Anhänger und schaut wieder. Dann geht er in das große Haus, um aus dem Fester zu gucken, denkt sie. Und natürlich taucht er erst wieder auf, als das Schiff Kurs auf die Fahrrinne nimmt.
Der Rauch aus dem Schornstein treibt jetzt seitwärts über das Wasser, und der weiße Schaumstreifen am Bug wird zu einem dünnen Strich, als die Darby immer langsamer landwärts gleitet. Hannah winkt heftig mit beiden Armen hin und her, in ihren Fingern flattert der lange Schal.
Nun heult die Sirene auf. Zwei grelle Stöße.
Hannah folgt dem Schiff um den Turm, lächelnd und weinend. Aus der Nähe ist es riesengroß, gar hässlich jetzt, mit Rostspuren an der Seite. Der warme und ölige Rauch hüllt sie ein.
Sie zerrt an der Tür ganz oben im Turm. Der Wind stemmt sich dagegen und knallt sie zu, nachdem Hannah durch den Spalt geschlüpft ist. Sie klappert die Treppe hinunter und aus dem Turm hinaus über die Brücke, vom Felsen auf die Insel und den Fußweg hinab, den Murray angelegt hatte, damit der Rasen frei von Fußabdrücken bleibt.
Er dreht schon an der Winde, als sie neben ihm steht. Der Kran ist ausgefahren, der Haken baumelt über dem Meer. Er blickt von der Plattform auf die Darby hinab. Männer in orangefarbenen Schwimmwesten laufen über Deck, setzen das Beiboot aus, stapeln an der Reling Kisten auf.
Und da ist Krabbe! Sie ist so groß, so schön, wie sie in der Relinglücke steht, an den kleinen bemalten Kettenzaun gelehnt. Hannah erschrickt fast darüber, ihre Tochter als Frau zu sehen. Sie hatte das Mädchen erwartet, das sie zum letzten Mal in einem kleinen Haus in Prince Rupert gesehen hatte. Aber Tatiana! Hannah runzelt die Stirn: Oh, was mag Krabbe wohl denken? In ihren steifen roten Kleidern sieht die Kleine aus wie eine Figur aus einem von Murrays Windspielen.
«Och, schau dir die beiden an», sagt Murray. «Wie alt ist Tatiana jetzt?»
«Mach dir keine Sorgen», sagt Hannah. «Sie ist noch nicht zu alt, um im Sand zu spielen.»
Murray wirkt nervös. Er kratzt sich am Arm, dann hebt er ein Knie und kratzt sich am Bein. Unter dem Saum seiner Shorts hat die Sonne seine Haut hellrosa gefärbt. Murrays Körper ist von Kopf bis Fuß mit Sommersprossen übersät und von einem dünnen, hellen Glanz kupferfarbener Haare bedeckt.
«Ich hätte lange Hosen anziehen sollen», sagt er.
«Das ist schon in Ordnung so», sagt Hannah.
So ist Krabbe noch nie auf die Insel gekommen. Sie hat sie niemals vom hohen Deck der Darby aus gesehen. Lizzie Island wirkt kleiner als in ihrer Erinnerung, die Bäume scharen sich um die Häuser und den Rasen. Der Turm ist geschrumpft. Die Inselchen und Riffe, die bis zum Horizont gereicht hatten, liegen dicht gedrängt vor ihr.
«Krabbe?» Ein Matrose tippt sie am Arm an. Er steht breitbeinig über Tatiana, als wäre das Kind gar nicht da. «Geht nach achtern», sagt er. «Wir müssen an die Taue.»
Er ist alt, denkt sie. Vielleicht vierzig. Sein Haar ist weiß gesprenkelt, wie eine Wandtafel mit Kreidekritzeleien. Falls sie ihn einmal gekannt haben sollte, kann sie sich nicht mehr an ihn erinnern. «Okay», sagt sie. «Klar.» Doch sie bleibt im Bug, während die Darby am Turm vorbeigleitet, bis sie weit oben ihre Mutter sieht, die wie eine Verrückte mit einem roten Schal winkt, der ebenso lang ist wie der Windsack. Als sie einen der Männer lachen hört, wird sie verlegen und blickt zu ihrer Tochter hinab. «Komm Tat. Wir müssen nach hinten.»
Tatiana steht auf, nestelt an ihrem Täschchen herum, rückt die Barbiepuppe zurecht. Ihre kleinen Finger sind ungeschickt. Sie runzelt die Stirn.
Krabbe steht über ihr und wartet, bis sie aufblickt. «Bereit?», sagt sie. Tatiana nickt. Krabbe nimmt sie an der Hand und steigt mir ihr über die Ankerkette und um die Winde herum zur Lücke in der Reling mit den durchhängenden Ketten.
Die Männer beschäftigen sich mit dem Beiboot und den Waren für den Leuchtturm. Ein Möwenschwarm kreist über ihnen, doch Krabbe hat nur Augen für die Insel, sieht die Felsen vorbeiziehen und dann die Betonstufen, die vom Meer hinaufführen. Ganz unten sind sie schwarz, voller Seetang und herabhängender Algen, dann steigen sie auf und werden immer heller, von der Sonne weiß getüncht, nur einmal drehen sie ab, um ganz oben zur Plattform zu gelangen, wo ihr Vater den Kran ausfährt. In seinen weißen Shorts und seinem feuerroten Haarschopf wirkt er irgendwie fehl am Platz. Bei seinem bloßen Anblick verspürt Krabbe den Wunsch, zu lachen und zu weinen, zu ihm hin- und von ihm wegzulaufen.
Sie hält Tatiana fest und sagt: «Du bleibst bei mir.»
Tatiana starrt auf das Wasser. Sie greift zwischen den Ketten hindurch, streckt die Arme aus, spreizt die Finger. Krabbe verstärkt ihren Griff und blickt über die Reling. Ein Algenstrang gleitet am Schiff vorbei. «Das sind nur Algen», sagt sie.
«Er kommt», flüstert Tatiana.
«Wer?»
«Höre ihn», sagt sie.
«Wen?», fragt Krabbe nach. Dann hängt Tatianas ganzes Gewicht plötzlich an ihrer Hand. Das Mädchen greift nach dem Wasser, will ihm näher kommen, versucht, zwischen den zwei Ketten hindurchzuklettern. Der Stoff ihres kleinen roten T-Shirts spannt sich in Krabbes Hand.
«Tat!»
Und jetzt taucht der Wal aus dem Meer auf. Er ist gewaltig und dunkel, umschäumt von einer weißen Kaskade. Wasser strömt aus seinem Maul, von den Barten über braun gesprenkelte Fleischfetzen. Und er steigt im Bogen immer höher über sie, ein Auge, ein Hals und eine lange, gebogene Finne, über ihre ganze Länge mit Seepocken übersät.
Sein Atem fällt in einer Wolke, in einem nach altem, verfaultem Fisch stinkenden Regen über sie herab. Sein Auge dreht sich, und der Wal scheint einfach in der Luft zu schweben, ein ganzes Stück über dem Deck. Dann dreht er sich mit unmöglich anmutender Langsamkeit auf den Rücken und platscht ins Meer.
«Oh Mann!», flüstert Krabbe vor sich hin.
Lange Zeit bewegt sich niemand. Die Matrosen der Küstenwache stehen regungslos an den Winden, Tauen und Steuerpulten. Im Wasser, das sich kräuselt, bilden sich kleine Wirbel. Die Möwen stürzen sich kreischend hinab. Und Tatiana steht mit geschlossenen Augen da und zittert am ganzen Körper.
Hannah sieht den Wal durch das seichte Wasser kommen, ein kolossaler schwarzer Schatten auf Silber und Gold. Sie sieht, wie Tatiana sich gegen die Kette wirft, wie das Meer aufbricht, wie der Wal aufsteigt und das Mädchen verdeckt. Seine Brustflossen sind lang und schlank, groß wie Flügel. Sie kräuseln und verdrehen sich, während der Wal sich auf die Seite legt und wieder abtaucht.
Eine Welle bricht los und brandet gegen den Felsen. Sie wälzt sich über den schmalen Sandstreifen, erklimmt zwei – dann drei – Betonstufen. Der Buckelwal spritzt in der Fahrrinne eine weitere Fontäne in die Höhe, und dann nochmals weiter draußen bei der Felsbank. Dann ist er weg, und die Möwen ziehen mit ihm. Immer wenn er auftaucht, schießen sie auf der Futtersuche in seinen Sog hinab. Und jetzt ist Ruhe. Alle stehen sie stumm und still da.
Murray blickt mit Tränen in den Augen auf das Meer hinab. Hannah sieht, dass er weint, und wendet sich ab; sie kann sich vorstellen, was in ihm vorgeht. Seit Alastairs Tod hatte sich kein Wal mehr im seichten Wasser der Fahrrinne gezeigt.
«Unglaublich», sagt er.
Dieses eine Wort wirft sie um zwanzig Jahre zurück, in ihren ersten Herbst auf der Insel. Sie erinnert sich, wie sie und Murray auf der Turmplattform saßen und den Buckelwalen zugeschaut hatten. Sie schwammen bei Sonnenuntergang in einem blutroten Meer, sie tauchten gemeinsam auf, atmeten zusammen, und ihre Fontänen verbanden sich zu einer gemeinsamen Wolke.
«Buckelwale singen», sagte Murray. «Hast du das gewusst?»
Sie schüttelte den Kopf.
«Jedes Jahr singt einer ein neues Lied. Die anderen nehmen es auf und verändern es.» Er sprach mit sanfter Stimme, wie er das immer tat, blickte auf das Meer hinaus, nicht auf sie. «Bis Mitte Sommer beherrschen alle das Lied. Dann singen sie es über Hunderte von Meilen im Chor.»
Sie lehnte den Kopf an seine Schulter. Sie spürte, wie er atmete, und sie versuchte, es den Walen gleichzutun und gleichzeitig mit ihm zu atmen.
«Man weiß erst seit dem Krieg davon», sagte er. «Damals tauchte jemand ein Mikrofon ins Wasser, in der Hoffnung, Unterseeboote hören zu können. Stattdessen hörte er diesen Gesang und hatte natürlich keine Ahnung, worum es sich handelte.»
Sie schmiegte sich an ihn. Sie zitterte, doch er merkte es nicht.
«Ich kann es nicht verstehen.»
«Das Lied?», fragte sie.
Er schüttelte den Kopf. «Och, das Lied werden wir nie verstehen. Ich meine, dass Menschen diese Tiere töten können.»
«Ich auch nicht», sagte sie.
Seufzend sagte er: «Sie sind wunderbar, die Wale. Einfach unglaublich.»
2. Kapitel
Die Waren werden ausgeladen und im Beiboot ans Ufer gebracht. Kisten mit Lebensmitteln, Fässer mit Treibstoff, Bibliotheksbücher und Büchsen mit weißer Farbe werden den Felsen entlang auf den Anleger gehievt. Murray schichtet die Kisten zu Pyramiden und die Farbbüchsen zu perfekten Säulen auf.
Er ruft von der Plattform hinunter: «Haben wir jetzt alles?» Eine Stimme hallt zurück: «Ja, jetzt fehlen nur noch die Mädchen, Mr. McCrae.»
Er besteht darauf, dass die Küstenwache ihn so nennt. Selbst Hannah hatte ihn bei ihrer ersten Begegnung so genannt, als er – splitternackt – vor ihr davonlief und im völlig schief zugeknöpften Hemd zurückkam. «Ich heiße Hannah», sagte sie mit ausgestreckter Hand. «Ich bin Mr. McCrae», antwortete er. Für sie klang das nach Würde der alten Schule aus der alten Welt, doch jetzt weiß sie, dass er damit Anspruch auf die Insel erhebt. Es freut ihn, wenn sich ein uniformierter Mann ihm gegenüber unterwürfig zeigen muss. Am liebsten, sagt sie sich, hätte er allen gesagt: «Mein Name ist Lord McCrae.»
«Ich glaube, wir sollten jetzt runtergehen», sagt sie.
«Ja», sagt er. «Ich komme gleich. Ich muss nur noch schnell die Winde wegräumen.»
Heute Morgen nervt er sie mit seiner Pedanterie. Am liebsten würde sie alleine gehen, aber sie kann nicht. Das Beiboot wird Krabbe an den Fuß der Betontreppe bringen, doch Hannah will nicht alleine hinuntergehen. Sie kann diese Stufen nicht leiden, die sich über den Felsen hinab ins Wasser stürzen und in einem grünblauen Schummer verschwinden. Als Kind saß Krabbe auf der untersten Stufe mit den Füßen in der Brandung und plapperte unermüdlich davon, wie gerne sie bis an das Ende der Stufen hinabsteigen und mit angehaltenem Atem zwischen Seesternen und Krabben herumspazieren würde. Aber Hannah hält sich von der Treppe fern, geht nach Einbruch der Dunkelheit nicht in ihre Nähe. Sie hat Angst, dass etwas vom Meer her die Treppe hochsteigen könnte: ein ertrunkener Junge, vom Wasser aufgedunsen und weiß, durch die Algen platschend.
«Murray!»
«Komme schon.» Er schwingt den Kran hinein. Er lässt den Haken hinunter, verbindet ihn mit der Kabeltrommel und strafft das Kabel. Er stellt die Bedienungsknöpfe genau in die Mitte, überprüft jeden dreimal. «Gut», sagt er. «Gut, lass uns gehen.» Er bückt sich nochmals, um einen Karton geringfügig nach links zu verschieben und ihn genau nach dem darunter liegenden auszurichten.
Die Treppe hat kein Geländer. Hannah geht genau in der Mitte, direkt hinter Murray, auf dem untersten Treppenabsatz warten sie gemeinsam nebeneinander. Aus irgendeinem Grund muss Krabbe von drei Männern ans Ufer geleitet werden. Sie stehen steif wie Admirale da, jeder trägt ein hellblaues Hemd und dunkle Hosen mit Bügelfalten. Der Bugmann fährt mit einem Bootshaken scharrend und klirrend über den Beton. Das Boot prallt gegen die Stufen, gerät in Schräglage und wird zurückgespült.
«Vorsicht!», ruft Hannah. Unten sind die Betonstufen glitschig, die Kanten vom Treibholz abgeschlagen. Hannah hat Angst, dass Krabbe ausrutschen und Tatiana mit sich reißen könnte. Sie klammert sich an Murray, den robusten, furchtlosen Murray.
Krabbe ist wunderschön – rosig und sonnengebräunt. Die betriebsamen Bootsmänner umgeben Krabbe, während sie Tatiana zum Treppenabsatz hinüberreicht. Sie beugen sich mit ihr nach vorne, strecken ihre Arme aus, als das Wasser Krabbes Schuhe umspült, und lassen schließlich die Arme fallen, als Krabbe über die Stufen nach oben eilt. Sie hebt den Kopf und blickt auf. Hannah sieht Enttäuschung in ihren Augen. Nur für einen Augenblick wird sie sichtbar, bevor sie einem Lächeln Platz macht. Doch sie entgeht ihr nicht, und Hannah ist nicht einmal überrascht.
Murray ist jetzt zweiundsechzig und setzt dort Fett an, wo er immer schlank war. Seine Beine sind fleischig und rosa. Sonne und Wind haben Murrays Haut geglättet, doch an Hannah haben sie gemeißelt und ihr tiefe Falten ins Gesicht gegraben. Sie und Murray sehen älter aus, als sie sollten.
Als alle zusammenstehen, kommt plötzlich Verlegenheit auf, und Hannah fürchtet, dass es für Murray am schwierigsten ist. Krabbe hat sich so stark verändert, ist so sehr Frau und keine Spur von Tochter mehr. Sie geht einen Schritt auf ihn zu, um gleich wieder zurückzuweichen. Und dann bewegt sich niemand, bis sich alle bewegen und wie Bäume in einem Sturm verheddern, bis sie alle – schwer atmend – wieder auseinander gehen.
Krabbe greift hinter sich nach Tatiana. Sie schiebt das Kind vor sich hin und sagt: «Sag deiner Großmutter und deinem Großvater guten Tag.»
Murray kauert nieder, sodass seine rosa Beine anschwellen. «Hallo Tatiana», sagt er.
Das Kind läuft krebsrot an und steckt seine Finger in den Mund.
«Wir haben den Wal gesehen», sagt Murray. «Hat es dir Angst gemacht, das große Ungeheuerchen?»
Tatiana setzt sich hin. Sie schwingt ihr Täschchen in den Schoß und öffnet es.
«Was hast du denn da Schönes?», fragt Murray.
Krabbe sagt mit einem Singsang in der Stimme: «Das hier ist ihre Barbiepuppe.»
Murray streckt die Hand nach ihr aus, doch Tatiana zieht die Puppe zurück. «So», sagt er. «Das ist aber eine süße Barneypuppe.» Dann steht er verlegen und verwirrt wieder auf.
Unter ihnen legen die Boote vom Treppenabsatz ab. Die Männer starren nach oben. Sie rufen Krabbe – nur ihr – zu: «Mach’s gut», sagt einer. «Bis in einem Monat», ein anderer. Und Hannah sieht den Blick, den Krabbe ihnen zuwirft.
«Ein Monat?», sagt Murray.
«Ja, ich bleibe einen Monat», sagt Krabbe.
«Nur einen Monat?»
«Können wir nicht ein anderes Mal darüber reden?» Sie bückt sich, ergreift Tatianas Hand und steigt die Stufen hoch.
«Sie sind glitschig», sagt Hannah. «Und es gibt kein Geländer.» Das Herz klopft ihr bis zum Hals. Wenn das Kind ausrutscht, schlägt es sich den Schädel auf. «Langsam, um Himmels willen!»
Krabbe dreht sich um und lacht auf eine Weise, die Hannah missfällt. Dafür, dass sie so hübsch ist, hat Krabbe ein hässliches Lachen, findet sie.
Murray steigt langsam die Treppe hoch, indem er bei jeder Stufe die Hände gegen die Oberschenkel stemmt. Früher wäre er gerannt, Krabbe im einen, Alastair im anderen Arm, oben hätte er die vor Freude quiekenden Kinder herumgewirbelt und haarscharf über die Anlegerkante baumeln lassen. Hannah ist froh, dass diese Tage vorbei sind.
Aber Krabbe ist ungeduldig. «Ich laufe voraus», sagt sie. «Ich zeige Tat mein altes Zimmer.»
Und schon ist sie mit Tatiana an der Hand weg. Sie hüpft die Stufen hoch und verschwindet, als sie auf ebener Erde ankommt.
Murray beugt sich vor und beschleunigt seinen Gang ein bisschen. Hannah sieht seinen Blick und weiß, was er denkt. Er macht sich Sorgen um sein frisch gesätes Gras, oben, am Ende der Treppe, ist die Erde beinahe kahl. Ganz egal, was er sagen mag, alle gehen sie immer über den Rasen. Und so steigert er sein Tempo über eine Stufe und eine zweite, um gleich wieder langsamer zu werden.
«Och», sagt er. «Ich kann nicht mithalten.»
Hannah will vorausgehen, um Krabbe zu sagen, sie solle zurückkommen. Sie hätten doch alle zusammen gehen können, sagt sie sich. Doch Murray wirkt gequält, und sie will ihn nicht allein zurücklassen. Sie würde ihn gerne trösten, doch sie weiß nicht, was sie ihm sagen soll. Sie könnte ihm sagen, dass Wiedersehen schwierig sind und dass sich alles einrenken wird, sobald sich Krabbe einmal niedergelassen hat.
Aber sie ist gar nicht so sicher, ob das stimmt.
An Pfosten und Pflöcken, gegen Baumstämme genagelt, flattern und schwirren Murrays Windspiele. Krabbe eilt an ihnen vorbei. Eine Frau aus Holz stemmt ihr ganzes Gewicht gegen eine Pumpe, um sich dann auf dem Pumpenschwengel auszuruhen; zwei Männchen ziehen langsam schaukelnd eine Säge hin und her; ein Löwenbändiger hält seine Peitsche über zwei gelblich verblassten Goldlöwen in die Höhe.
Früher konnte Krabbe stundenlang daliegen und diesen Dingen zuschauen. Pferde flogen endlos um die Wette. Segelschiffe kreuzten Meile um Meile auf einem rostigen und quietschenden Scharniergelenk über das Meer. Zusammen mit Alastair stellte sie sich vor, hinter dem Steuerknüppel des kleinen Flugzeugs zu sitzen, den Propeller anzuwerfen, die Flügel zu bewegen und an Orte zu fliegen, die sie noch nie gesehen hatten.
Fast zerrt sie Tatiana hinter sich her, vorbei am Haus des Leuchtturmwärters, über einen Kies- und Muschelweg, vorbei an der Sonnenuhr, vorbei am flachen, durch die Lüfte galoppierenden Holzpferd.
Auf Lizzie Island stehen nur zwei Häuser. Das zweite Haus ist kleiner und so blendend weiß, dass der Blumenkasten wie das Nordlicht auf der Wand flimmert. Es war für einen Stellvertreter gebaut worden, doch keiner hielt es länger als eine Woche auf der Insel aus. Als Krabbe noch ein kleines Kind war, gaben sie sich die Klinke in die Hand – einsame junge Männer, die Murrays hohen Ansprüchen nie genügen konnten. Sie kamen mit einem Boot und gingen mit dem nächsten, oft hatten sie nicht einmal ihre Koffer ausgepackt. Dann stand das Haus leer, bis zuerst Alastair – und ein Jahr später Krabbe – ihren zwölften Geburtstag damit feierten, dass sie in das Haus hinüberzogen, das sie Gomorrha nannten.
«Ich liebe diesen Namen», sagte Alastair. Er sprach ihn laut aus, wie einen Kampfschrei. «Gomorrha!», rief er nochmals. «Dort ließen sich die Patriarchen nieder, wenn sie mehr Platz brauchten. Es war ein Ort, den sie allein für sich hatten.»
Er war ein Genie, der arme Alastair. Ständig las er, immer hatte er ein Buch in der Hand. Er konnte über Könige und Königinnen reden, als hätte er sie persönlich gekannt, über Geschichte, als hätte er sie selbst erlebt. Und was er gelesen hatte, vergaß er nie. «Du hast so viel in deinem Kopf», sagte ihm Krabbe einmal, «dass es dir zum Mund herausläuft.»
Das Schild hängt immer noch über der Tür, an den Rahmen genagelt, dieser schreckliche Name in Schwarz auf einem gebleichten Holzbrett. Er bemalte es am Tag, an dem er einzog, seinen Kopf so dicht über das Holz gebeugt, dass er mit der Hand immer wieder seine Nase anstieß.
«Ich bin myopisch», sagte er ihr. «Vermutlich werde ich erblinden, bevor ich dreißig bin.»
Vor kurzem erst hatte er eine Brille bekommen, nachdem er jahrelang in die Welt geblinzelt hatte. Murray wollte nie etwas von einer Brille wissen. «Kein McCrae hat je eine Brille getragen», hatte er gesagt. «Das Meer, die Sonne, die Luft – das ist besser als der beste Arzt.»
Krabbe seufzt und öffnet die Tür. Der Knauf lässt sich so gut drehen, dass sie sofort weiß, dass ihr Vater das Schloss regelmäßig ölt. Sie betritt einen geräumigen Wohnraum, der noch genau so ist wie früher. Ihr gelber Regenmantel hängt an seinem Haken, jener von Alastair daneben. Ihre Stiefel stehen darunter. Ihre Stühle stehen an einem Tisch mit ordentlich aufgestapelten Büchern und den Muscheln, die Krabbe für ihre Mutter zu einer Halskette aufgezogen hatte.
«Das war Alastairs Stuhl», sagt Krabbe. «Der unter der Lampe.» Sie lässt Tatianas Hand los und schließt die Tür hinter ihr. «Er erhielt den besten Stuhl und das beste Zimmer, weil er als Erster einzog.»
Das Jahr, das sie getrennt verbrachten, war das schlimmste Jahr, das Krabbe je verbracht hatte. Obwohl sie fast so oft zusammen waren wie vorher, fühlte sie sich einsam und isoliert. Jeden Abend strich sie einen Tag in ihrem Kalender ab und ging weinend ins Bett.
«Ihr beide seid wie siamesische Zwillinge», sagte Murray zu ihr. «Überall zusammengewachsen, außer an der Zeit.» Er saß auf ihrem Bett, blickte die Wand an und sagte: «Du hast keine Ahnung, wie kurz ein Jahr ist. Das ist doch nur ein Klacks.»
Doch das Jahr dauerte eine Ewigkeit. Und dann, an ihrem zwölften Geburtstag, half ihr Alastair, ihre Sachen hinüberzutragen. Viermal gingen sie hin und her, wie Ameisen, hinunter und wieder hinauf, einmal mit einem Tisch und einem Stuhl, dann jeder mit einer Schachtel und dann nochmals mit einer Schachtel und schließlich mit je einem Bündel Kleider. Alastair kochte Tee und sagte, seine Tasse gegen ihre anstoßend: «Willkommen in Gomorrha.» Nachdem sie ausgetrunken hatten, steckte er seine Nase beinahe in die Tassen hinein, um die Muster der Teeblätter zu betrachten.
Er sagte: «Dein Teesatz sieht aus wie eine Tänzerin. Eine glückliche, lachende Tänzerin. Das passt zu dir. Und schau, meiner sieht einem Kajak ähnlich.»
«Ach, du siehst nur, was du sehen willst», sagte Krabbe.
«Könnte sein», sagte er lachend. «Aber schau, mein Kajak ist gekentert.»
Er war vierzehn, als er starb, um ein Jahr und einen Tag älter als Krabbe. Seine Flöte klang durch die Bäume in jener Novembernacht, und sie ging von ihrem Bett zum Fenster, als wollte sie die Noten, die er spielte, durch die Dunkelheit huschen sehen. Sie konnte die Brandung hören. Die Wellen wuchteten gegen die Insel, obwohl kein Lüftchen sie anzutreiben schien. Sie dachte an ihn, dort draußen in seinem Kajak, allein in der Nacht, wie so oft. Sie stellte sich vor, wie seine Paddel grün phosphoreszierten. Sie schloss die Augen und lauschte.
Es war eine seltsame Musik – ein Pfeifen und Kreischen. Es waren keine Lieder. Er spielte nie Lieder. In einer solch geheimnisvollen, stillen Nacht klang seine Flöte wie das Heulen des Winds.
Es war Walmusik. Er spielte mit den Walen oder für die Wale. Schon damals war sich Krabbe nicht ganz sicher. Aber Alastair glaubte, mit den Walen zu sprechen, die Sprache ihres Gesangs zu verstehen. Und so spielte er, dann hörte er zu und schrieb in einem lädierten Notizbuch voller Wasserflecken auf, was er aus diesem Gesang der Wale herausgehört hatte.
In jener Nacht spielte er ununterbrochen. In jener Nacht verschwanden die Buckelwale, gesättigt und gestärkt für ihre lange Reise nach Hawaii. Alastairs seltsames Geträller klang zuerst fröhlich und schnell, doch dann wurde es elend traurig. Und Krabbe presste ihre Finger gegen die Fensterscheibe und glaubte endlich zu verstehen. Er erzählte ihr seine eigene Geschichte in der Sprache der Wale, und sie hörte, wie er von Gelächter, Traurigkeit und Träumen erzählte.
Am Morgen trieb sein Kajak in der Fahrrinne nördlich des Leuchtturms. Es war gekentert und wurde von der ansteigenden Flut durch die Felsengruppe gegen das Ufer gespült. Es wirbelte um ein Inselchen, um ein Riff und durch die Felslücke in die kleine Lagune, in der die Sonne das Wasser in Diamanten verwandelte.
Das Haus erscheint ihr jetzt leer und kalt. Aber für Krabbe gehören die Stimmen ebenso zu ihm wie die abgewetzten Stellen an den Sessellehnen und die abgeschabte Farbe auf dem unteren Treppenabsatz. Wo auch immer sie hinblickt, hört sie sie. Sie sieht sich ausgestreckt auf der Fensterbank des großen Mansardenfensters liegen. Alastair steht neben ihr.
«Ich beginne zu verstehen, wie es funktioniert», sagte er. Er redete von den Walen. «Sie sprechen nicht eigentlich mit Worten. Eher mit Gedanken. Wie Klangbilder. Manchmal, wenn sie sprechen, kann ich sehen, was sie sagen. Ich kann es sehen, Krabbe.» Er legte die Hände über seine armen, schwachen Augen. «Ich sehe Wasser, in dem sich das Sonnenlicht bricht, herumschwimmendes Plankton. Ich sehe überall Wale, die mich umgeben. Es ist, als würde ich dazugehören, mit ihnen reisen, Krabbe. Ich habe Lachse gesehen, hell glänzende Lachse. Ich habe Eisberge gesehen. Und jetzt höre gut zu: Ich habe mich gesehen.»
«Jetzt bist du völlig durchgeknallt», sagte sie.
«Nein, es stimmt.» Er nahm die Hände vom Gesicht, und sie sah, wie seine Augen verschleiert und weiß wurden. «Sie schwammen singend unter mir vorbei, und ich konnte mich sehen – das Kajak – dieses Ding, das sich schimmernd vom Licht der Wasseroberfläche abhob. Ich bewegte das Paddel. Auch das konnte ich sehen.»
«Bestimmt. Und sonst noch was?» Krabbe starrte aus dem Fenster nach Norden über die Inselchen hinweg in ein wolkiges Grau. Sie hörte das seltsame Geräusch, das Alastair machte, wenn er verbittert war: Er stieß pfeifend und rasselnd Luft durch die Nase aus. Er sagte: «Kennst du das Geräusch, das ein Faxgerät macht?»
«Wir haben kein Fax», sagte Krabbe.
«Aber du hast es bestimmt schon gehört. Über Funk. Es pfeift und piepst; eine Tonfolge, die von einem Computer in Bilder umgesetzt wird. Wenn du es verstehen könntest, würdest du den Computer gar nicht brauchen; dann könntest du es selbst sehen.»
Sie sagte: «Dann schaff dir einen Computer an.»
«Das versuch ich ja!», sagte er mit schmerzerfüllter Stimme. «Ich habe es Papa gesagt. Ich brauche Computer und Spektrografen und Schnittpulte. Wenn ich das hätte, könnte ich es tun. Wir könnten mit den Walen reden.