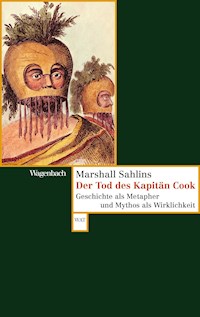Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fröhliche Wissenschaft
- Sprache: Deutsch
Mit diesem kurzen Text, der in den 1970er-Jahren als erstes Kapitel eines ganzen Bandes zu den Stone Age Economics erschien und erstmals in deutscher Übersetzung vorliegt, bricht Marshall Sahlins mit dem vorherrschenden ökonomischen Paradigma, dass mehr Arbeit auch mehr Wohlstand bringt. Denn bis heute wird es weltweit täglich Lügen gestraft, was der Annahme von der ursprünglichen Wohlstandgesellschaft die Brisanz verleiht, die sie noch immer hat: Was wäre, wenn wir immer schon reich gewesen sind? Und was verschiebt sich, wenn wir Armut nicht als eine geringe Menge an Gütern im Besitz Einzelner begreifen, sondern als ein Verhältnis zwischen den Menschen? Was der weltberühmte Anthropologe anhand empirischer Beispiele entwirft, stellt einen radikalen theoretischen Bruch mit dem Höher-Schneller-Weiter dar, das die westliche Konsumgesellschaft vorantreibt. Wenn es neben der Befriedigung von Bedürfnissen durch immer größere Produktion noch einen anderen Weg gibt, dann sollten wir ihn gerade angesichts der Vernutzung unseres Planeten und der Ungleichheit in der Verteilung von Teilhabe wieder in Betracht ziehen: dass Reichtum auch darin bestehen kann, weniger zu begehren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die ursprüngliche Wohlstandsgesellschaft
Fröhliche Wissenschaft 241
Marshall Sahlins
Die ursprüngliche Wohlstandsgesellschaft
Aus dem Amerikanischen von Heide Lutosch
Herausgegeben und mit einem Vorwort von Andreas Gehrlach
Inhalt
Vorwort
Die ursprüngliche Wohlstandsgesellschaft
Anmerkung der Übersetzerin
Anmerkungen
»Wozu etwas pflanzen, wenn doch die Welt voller Mongongo-Nüsse ist?«
von Andreas Gehrlach
Können Sozialisten glücklich sein?
In den 1940er-Jahren arbeitete George Orwell an 1984, seinem berühmten dystopischen Roman über absolute Überwachung, Kriegswirtschaft und medial verzerrte Wahrheit. Nebenher schrieb Orwell in dieser Zeit einen kurzen Essay über die Frage: »Can Socialists be Happy?«,1 und seine Antwort ist, kurz gefasst: Nein. Ein ernst gemeinter Sozialismus, so Orwell, kann niemals Glück versprechen, sondern nur eine streng solidarische, aufrechte Gemeinschaft aller Menschen, die sich selbst beschränken, die aufeinander Rücksicht nehmen und die in allen ihren Entscheidungen skrupulös selbstkritisch sind. Sozialist:innen können Orwell zufolge nie ein heiteres Leben versprechen, sondern nur einen ewigen Prozess mühevoller Gerechtigkeit.
Wahrscheinlich ist es der Kern von Marshall Sahlins’ Lebensprojekt, dieser sozialistischen Biederkeit und Langeweile zu widersprechen. Sahlins war ein entschieden antiautoritärer Linker, ein unablässiger Kapitalismuskritiker, der Erfinder der Teach-ins und er war neben Claude Lévi-Strauss und Marcel Mauss einer der wichtigsten Ethnologen und Anthropologen des letzten Jahrhunderts. Alle seine Texte sind von einem Feingefühl für wissenschaftlich-kleinteilige Fragen und von einer tief humanistischen menschlichen Heiterkeit durchströmt, die man schelmisch oder gewitzt nennen kann, die aber immer darauf zielt, Machtformationen, Großtuerei und skurrile, unnütze Ausbeutung infrage zu stellen. Sahlins starb im April 2021, und alle Nachrufe betonen, was für ein streitbarer Wissenschaftler der berühmte Ethnologe war. Er schätzte klar geführte Diskussionen und er schreckte vor akademischen Kontroversen nicht zurück. Aber die Nachrufe betonen auch, dass Sahlins einen großen Sinn für Humor hatte. Sein Bruder Bernie, mit dem er lebenslang eng verbunden war, war der Gründer des berühmten Second City Comedy Club in Chicago, und auch Marshall hatte ein Talent zum Comedian. Am besten kann man seinem Humor in einem Band mit dem Titel What the Foucault? nachspüren,2 in dem die etwas nerdigen, aber durchaus lustigen Witze aus Sahlins’ Stand-up-Comedy-Programm versammelt sind, das er bei den sonst recht ernsten Treffen der Association of SocialAnthropologists aufführte. Man darf Sahlins aber nicht auf einen Witzeerzähler reduzieren, denn sein Lebenswerk, das ihn 1973 als Professor an die University of Chicago führte, hat ihn zu einem der meistzitierten Anthropologen, Geschichtstheoretiker und Kulturkritiker der letzten fünfzig Jahre gemacht. Aber sein Gespür für pointierte, überraschende Thesen, für ein präzises sprachliches Timing und dafür, komplexe wissenschaftliche Gedankengänge auf eine unterhaltsame und prägnante Weise zu vermitteln, ist in jedem seiner Texte und auch in der Ursprünglichen Wohlstandsgesellschaft erlebbar.
Wie reich waren die ursprünglichen Wohlstandsgesellschaften?
Sahlins’ hier von Heide Lutosch zum ersten Mal ins Deutsche übersetzter Text und die an ihn anschließenden Debatten stellten immer wieder die Frage: Wie gut ging es den Gesellschaften der Steinzeit und wie ertragreich ist die Wirtschaftsform der noch existierenden hunter-gatherer-Kulturen? Diese Frage ist im Grunde einfach zu beantworten, denn nach streng wirtschaftswissenschaftlichen Parametern betrachtet, sind die ursprünglichen Wohlstandsgesellschaften arm. Versuche, ökonomisch zu berechnen, welcher Geldwert von ihnen produziert wird, kamen auf etwa 1,10 US-Dollar pro Person und Tag. Das ist deutlich unterhalb der Armutsgrenze und würde heute kaum mehr irgendwo auf der Welt ausreichen, um zu überleben: Ein Dollar pro Tag bedeutet in kapitalistischen Gesellschaften absolute und bittere Armut.
Diese Zahl stammt aus einem 2018 veröffentlichten Onlineartikel von David Graeber, einem der prominentesten Doktoranden von Marshall Sahlins, in dem er zusammen mit seinem Kollegen David Wengrow zeigt, dass in den Gesellschaften von paläolithischen Sammler- und Jäger:innen der Wert von ebenjenen 1,10 US-Dollar pro Tag und Person erwirtschaftet wurde. Aber sie machen auch deutlich: Dieser Vergleich funktioniert nicht. Denn um ein gutes Leben zu leben, muss in modernen Gesellschaften zwar viel mehr Geld zur Verfügung stehen, aber die Menschen des Paläolithikums hatten einerseits geringere Bedürfnisse und andererseits hatten sie in anderen Bereichen einen Lebensstandard, der heute nur sehr wohlhabenden Menschen zukommt.
Wenn wir einen Vergleich mit den heutigen täglichen Einkommen ziehen, müssen wir auch all die anderen Dinge einberechnen, die die paläolithischen Sammler umsonst bekommen haben, die wir selber aber teuer bezahlen müssten: Sicherheit war umsonst, Konfliktlösung, Grundausbildung, Seniorenpflege und medizinische Behandlung waren umsonst. Und da sind auch die Kosten für Unterhaltung noch nicht einberechnet: Was ist mit Musik, Geschichtenerzählen, religiösen Dienstleistungen? Und wenn es zur Nahrung kommt, müssen wir die Qualität mitbedenken: Letztlich sprechen wir dabei nämlich von 100 Prozent biologischen Freilandprodukten, heruntergespült mit dem klarsten natürlichen Quellwasser. Wir geben einen großen Teil der gegenwärtigen Einkommen für Hypotheken und Miete aus. Dagegen stehen die Campinggebühren auf den besten steinzeitlichen Zeltplätzen entlang der Dordogne und der Vézère, und man darf auch nicht die allerbesten Abendkurse in naturalistischer Felsmalerei und Elfenbeinschnitzerei vergessen – und all die Pelzmäntel! Ganz bestimmt kostete das sehr viel mehr als 1,10 US-Dollar pro Tag, sogar dann, wenn man den Wert des Dollars von 1990 zugrunde legt. Nicht umsonst hat Marshall Sahlins von den Sammlern als den ursprünglichen Wohlstandsgesellschaften gesprochen. So ein Leben wäre heute alles andere als günstig.3
Keine Miete, keine Steuern, gegenseitiger Schutz, freie Bildung, Volkshochschulkurse in Felsmalerei und Pelzmäntel aus Bären- und Hermelinfellen, und all das in einer solidarischen Ökonomie. Was Graeber und Wengrow hier mit einem guten Schuss Ironie beschreiben, ist nicht nur im Tonfall deutlich von Sahlins beeinflusst, sondern zeigt auch, dass der Umgang mit harten Daten zur Ökonomie von gegenwärtigen und untergegangenen Sammler:innengesellschaften einerseits nicht leicht ist und andererseits auch nicht im Zentrum der Argumentation steht. In der langen Debatte, die sich an die Veröffentlichung der Ursprünglichen Wohlstandsgesellschaft anschloss und deren Argumente und Gegenargumente ein ganzes Buch füllen könnten, wurde die Frage nach der Verlässlichkeit der angeführten Daten immer wieder ins Zentrum gerückt. In keinem Aufsatz geschah dies so scharf wie in David Kaplans »The Darker Side of the Original Affluent Society«,4 in dem die Zuverlässigkeit der von Sahlins benutzten Daten grundsätzlich infrage gestellt wurde. Dennoch hat sich die Anthropologie in den letzten Jahrzehnten letztlich auf Sahlins’ Seite geschlagen. Der einen guten Forschungsüberblick gebende Aufsatz der Kulturanthropologin Nurit Bird-David »Beyond ›The Original Affluent Society‹: A Culturalist Reformulation« stellt ebenfalls die mangelhafte Strenge der Sahlins’schen Argumentation fest, betont und bestätigt die dahinterliegende Logik aber ebenso wie die elf zwar teils kritischen, aber grundsätzlich übereinstimmenden Kommentare, die mit ihm veröffentlicht wurden.5 Die in der Forschung meistdiskutierte Frage war, wie viele Stunden die Jäger:innen und Sammler:innen denn nun wirklich zu arbeiten hatten, und viele Berechnungen kamen auf mehr als die drei bis fünf Stunden pro Tag, die Sahlins ursprünglich veranschlagt hatte. Aber auch die höchsten Einschätzungen blieben meist unter der durchschnittlichen Arbeitszeit von acht oder neun Stunden, die Arbeiter:innen und Angestellte in Industriegesellschaften heute täglich ableisten müssen.
Die wahrscheinlich härteste Kritik lehnt aber schlicht die Prämisse als sozialromantische Fantasie ab: Der beschriebene Zustand ist dieser Haltung zufolge eine naive und gefährliche Anknüpfung an die Fantastereien eines Schlaraffenlandes, das mit keinen politischen Mitteln zu erreichen und mit keinem durchführbaren politischen Programm verbunden ist. Diese Haltung ist in sich stimmig, aber die Argumentation wird dadurch verschoben: Damit befindet man sich plötzlich in einer politischen und nicht mehr in einer wissenschaftlich-anthropologischen Debatte, und genau da stoßen Kritiker:innen und Verfechter:innen der modernen Wohlstandsgesellschaft aufeinander. Der Kern des Arguments von Sahlins’ Text ist inzwischen in der Ethnologie und Anthropologie zum wissenschaftlichem Konsens geworden: Das Leben als Jägerin oder als Sammler in Südfrankreich vor 50 000 Jahren oder als !Kung im Kalahari-Becken ist auf eine seltsame Weise hoch attraktiv. Dort wird ein angenehmes Leben in einer auf Vertrauen gegründeten Gesellschaft geschildert, die in einem kooperativen Verhältnis zur Natur steht. Sie führt keinen Kampf gegen die Natur, sondern betrachtet sich als Teil einer Art kosmischen Zusammenhangs mit ihr. Die Haltung gegenüber der natürlichen Umwelt und ihren tierischen und geisterhaften Bewohner:innen ist nicht extraktiv, im Gegenteil, beide sind etwas, das nicht grundsätzlich von den Menschen getrennt ist, womit auf Augenhöhe kooperiert wird, sodass eine Situation des Austauschs und ein Verhältnis der Zusammenarbeit und des Vertrauens zwischen allen Wesen entsteht.6 Die Jäger:innen der Altsteinzeit erwirtschafteten durch die Hasenjagd und das Wurzelsammeln keinen Überfluss, und ihr Überleben war auf gutes Pflanzenwachstum und auf unberechenbaren Jagderfolg angewiesen. Auch das ewige Umherziehen in kleinen Gemeinschaften, die harten Winter in Zelten und ein dauernder niedrigschwelliger und verhandlungsaufwändiger Konflikt mit anderen Gruppen führten gewiss nicht zu einem Leben in der Campingidylle, die Graeber und Wengrow beschreiben.
Die Entscheidung, die These von der ursprünglichen Wohlstandsgesellschaft anzuerkennen oder abzulehnen, ist vor allem in der Haltung der Wissenschaftler:in zur modernen Industriegesellschaft begründet, die als unumgänglich oder als Fehlentwicklung wahrgenommen wird. Für Sahlins und seine Verteidiger:innen – zu denen auch ich gehöre – ist klar: Wir leben heute ebenfalls keineswegs in einer Idylle. Wir leben in einem wild gewordenen Kapitalismus, der nicht nur die Menschen ausbeutet und auslaugt, sondern der das Leben auf der ganzen Erde gefährdet. Reich wurden die Jäger und Sammler:innen nicht, aber reich zu werden ist auch im 21. Jahrhundert mit seinen riesigen staatlichen Konzernrettungen, Kriegen, Pandemien und mit einer künstlich angetriebenen Inflation nicht mehr möglich. Diese ökonomische Misere wird ergänzt durch Staaten, die immer rigider gegen die Proteste ihrer Bevölkerungen vorgehen, Parlamente mit immer größeren nationalistischen und rechtsextremen Fraktionen und eine blinde Grausamkeit gegen Menschen, die aus den Gegenden flüchten mussten, in denen die Staaten endgültig autoritär werden oder die Ökonomie und das Klima zusammenbrechen. Das Leben im 21. Jahrhundert ist das Leben in einer andauernden, brüllenden Katastrophe. Dagegen wirkt ein Leben, in dem man mit Freunden in der frischen Luft einer unberührten Natur jagen geht, Beeren sammelt und abends im Pelzmantel am Lagerfeuer sitzen kann, sehr attraktiv, insbesondere wenn die Alternative das ist, was wir alle kennen: Ein Leben lang jeden Morgen nach dem Weckerklingeln mit einem Kaffeebecher in der Hand aus der Mietwohnung eilen, um im Stau oder in einer überfüllten U-Bahn in ein Büro zu kommen, wo man sich in einem bullshit job7 den Rücken auf einem Drehstuhl und die Augen vor dem Computerbildschirm kaputt macht. Und dieser ununterbrochene hustle dient dazu, sich abends eine Pizza, ein Bier und ein Netflix-Abo leisten zu können, und vielleicht eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio, die man auch nur braucht, weil man nicht mehr Jagen oder Beerensammeln geht. Und im Sommer macht man ein paar Tage Camping- oder Wanderurlaub, der das Leben als Jäger:in und Sammler simuliert. Gleichzeitig zählen solche Schreibtischjobs im Neoliberalismus noch zu den privilegiertesten aller Arbeitsformen: Viele, sehr viele Menschen arbeiten heute in wirtschaftlichen Bereichen, die noch entfremdeter sind, die die Körper langfristig noch mehr belasten und die ökonomisch noch ausbeutender sind. Gewiss: All das ist pointiert argumentiert und es kann mit einem Stirnrunzeln als sozialromantische Träumerei beiseite gewischt werden, aber in dem Gedanken, dass es eine ganz andere, attraktive Lebensform gibt, liegt so viel Wucht und Wahrheit, dass Sahlins’ kurzer Text zu einem Geheimtipp wurde, der die Perspektive vieler Menschen auf unsere Zivilisation grundlegend verändert hat.
Der größte Fehler der Menschheitsgeschichte
Sahlins beschäftigte sich vor allem mit dem Leben der Jäger:innen und Sammler:innen. Ab den 1980er-Jahren wurden Forschungen unternommen, die herauszufinden versuchten, wie das Leben in den ersten Städten aussah, die entstanden, als die nomadische Lebensform aufgegeben und mit Landwirtschaft und Viehzucht begonnen wurde. Die Archäologie und die Frühgeschichte trugen dabei Datenmaterial zusammen, das immer wieder bestätigt, dass es rückblickend ein großer Fehler gewesen sein mag, die Lebensweise des Jagens und Sammelns aufzugeben und stattdessen in Dörfern und Städten von der Landwirtschaft zu leben.
Die Neolithische Revolution, mit der vor etwa 10 000 Jahren die sesshafte Landwirtschaft begann, war zunächst keineswegs eine Erfolgsgeschichte. Von Jared Diamond wurde sie sogar als »The Worst Mistake in the History of the Human Race« bezeichnet.8 Ackerbau und der Bezug fester Dörfer aus Lehm und Stein bedeutete für ihre Bewohner:innen einen deutlichen Einbruch in der Lebensqualität: Plötzlich lebten sie in Städten mit Mauern und in engen Häusern, und die Erträge ihrer Arbeit wurden von Herrscher- und Priesterfiguren abgeschöpft, die es vorher nicht in dieser Form gab. Allein diese Überwachung und Ausbeutung bedeutete schon eine Verschlechterung, aber Ausgrabungen offenbarten, dass insbesondere die Körper der Menschen zu leiden hatten. Vor allem veränderte sich mit der Neolithischen Revolution nämlich die Nahrung der Menschen: Die Ernährung nomadischer Gruppen war so abwechslungsreich wie das von ihnen durchwanderte Land; sie konnten auf Dutzende Sorten Beeren, Obst, Körner, Schalenfrüchte, Wurzeln, Pilze und verschiedenste Proteinquellen – Fische, Groß- und Kleinwild – zurückgreifen. Sesshaftlandwirtschaftliche Gruppen ernährten sich dagegen einseitig von ihrem angebauten Getreide, das zu Brot, Brei und Bier weiterverarbeitet wurde. Andere Nahrungsressourcen im Umkreis der Städte und Dörfer waren schnell erschöpft.
Der Getreideanbau veränderte auch die Art der Arbeit: Getreide brauchte eine intensive tägliche und eintönige Arbeit auf dem Acker, die mehr Zeit in Anspruch nahm, als das zu sammeln, was die Natur gerade anbot. Darüber hinaus war der Getreideanbau auf ein gleichbleibendes und berechenbares Klima und ebenso auf politische Stabilität angewiesen; sesshafte Populationen konnten bei wiederholten Missernten, beim Aufmarsch eines feindlichen Heeres oder wenn ein Herrscher zu hohe Steuern erhob nicht mehr so leicht in andere Gegenden ausweichen, wo die klimatischen Verhältnisse günstiger waren, wo der Boden noch nicht ausgelaugt war oder wo Frieden herrschte. Die Städte waren von Klimaveränderungen und politischen Krisen viel unmittelbarer und existenzieller bedroht als die fluiden nomadischen Gemeinschaften, die sich jeder Ausbeutung oder Kargheit entziehen konnten – und das auch taten, indem sie sich in die Gebirge, Wälder, Sümpfe und generell ins Hinterland zurückzogen. Von dort aus bedeuteten diese nomadischen Banden, die nicht immer friedliebend waren, eine weitere Bedrohung für die Getreidespeicher und Viehherden, schlicht weil es ziemlich einfach war, sich an den Viehherden zu bedienen, die in der Nähe der Städte und Dörfer auf den Weiden standen.
Das mag nach historischer Spekulation klingen, weil es auf paradigmatische Weise die Politik und Ökonomie der nomadisch-sammelnden Lebensweise der sesshaft-landwirtschaftlichen Lebensform entgegenstellt. Dieses normative Argument, das bei Graeber und Wengrow und auch bei Sahlins mit einem gewissen Augenzwinkern vorgebracht wird, ist jedoch von der Archäologie im Großen und Ganzen empirisch bestätigt worden. Messungen an Skelettfunden zeigen die extremen Veränderungen, die die Bevölkerungen der ersten Städte durchmachten: Die durchschnittliche Lebenserwartung sank im Verlauf der Neolithischen Revolution von 26 auf 19 Jahre ab.9 Während die Körpergröße nomadisch lebender Gruppen für Frauen bei etwa 167 Zentimetern lag, sank sie in den Städten auf 152 Zentimeter ab, bei Männern von 180 auf 162 Zentimeter.10