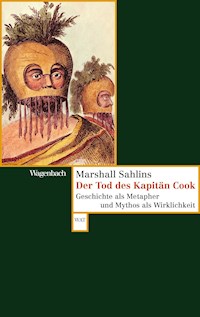Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Was, wenn wir nicht nur niemals modern gewesen sind, sondern Geisterwesen, Ahnen und Götter nach wie vor unter uns leben? Dann würde es sich bezahlt machen, von jenen zu lernen, die ihre Existenz immer schon anerkannt haben: immanentistische Gesellschaften. Mit diesem Begriff bezeichnet Marshall Sahlins Gesellschaften, die sowohl historisch als auch geografisch den größeren Teil der Menschheit ausmachen – und die Geister als reale Personen betrachten, als Metamenschen, die mit den Menschen in einer kosmischen Gemeinschaft leben, mit ihnen interagieren und ihr Schicksal beeinflussen. Marshall Sahlins liest ältere und neuere Ethnografien und nimmt uns so mit auf eine Reise um die Welt, von den Inuit am Polarkreis bis zu den Dinka in Ostafrika, von den Arawete-Schwemmgärtnern in Amazonien bis zu den Gartenbauern auf den Trobriand-Inseln. Und er zeigt, dass in den meisten Kulturen auch heute noch die Menschen nur ein kleiner Teil eines verwunschenen Universums sind, das durch die transzendenten Kategorien der »Religion« missverstanden wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Neue Wissenschaft
MARSHALL SAHLINS
Neue Wissenschaft des verwunschenen Universums
Eine Anthropologie fast der gesamten Menschheit
Aus dem amerikanischen Englisch von Heide Lutosch
Inhalt
Vorwort
Einleitung: Eine kulturelle Revolution von welthistorischem Maßstab
KAPITEL 1Menschliche Endlichkeit
KAPITEL 2Immanenz
KAPITEL 3Metapersonen
KAPITEL 4Das kosmische Gemeinwesen
Nachwort
Danksagungen
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Damit das Kanu des damaligen Häuptlings von Tikopia (namens Ariki Kafika) repariert werden konnte, mussten die Götter daraus entfernt werden. Der Häuptling wollte jedoch, dass eine dieser Gottheiten, der tote Sohn seiner Schwester, anwesend blieb, und dieser fuhr deshalb einem gerade anwesenden Medium in den Leib. Der neuseeländische Anthropologe Raymond Firth betont, dass solche Ereignisse zum Alltag gehörten und von den Anwesenden ohne sonderliches Interesse zur Kenntnis genommen wurden. Dann stellt er fest: »Es ist tatsächlich schwierig, auch nur irgendeine Handlung zu finden, die sich als rein technisch oder rein ökonomisch bezeichnen ließe«.1 So rief der Handwerker, so versiert er war, sofort die Götter des Kanus herbei, als Bohrkäfer im Rumpf entdeckt wurden: »Seht her auf das Kanu, an dem ich gerade arbeite.« Bohrkäfer könnten »nicht nur mit technischen Mitteln, sondern auch mit der Kraft [Mana] der Götter entfernt werden«.2 Was das Mana anging, so musste nun von einem anderen Häuptling eine berühmte Krummaxt göttlichen Ursprungs ausgeliehen werden, die für die Arbeit an Kanus besonders hilfreich war, weil sie einen bestimmten Gott in seiner Erscheinungsform als Graue Muräne verkörperte, die für ihre scharfen Zähne und ihre Wildheit bekannt war. Immer wenn ein Handwerker sein Beil benutzte, rief er deshalb den Gott der Muränen an: gegen »Fäulnis und Bohrkäfer. Er frisst sie auf der Stelle, sie verschwinden, und das Insekt stirbt«.3 So auch in diesem Fall: Als die Reparaturen erfolgreich beendet waren, brachte man die Götter ins Kanu zurück.
Dort wurden sie nicht nur für das halbjährlich stattfindende »Götterwirken« gebraucht, bei dem die Kanus der Häuptlinge neu geweiht wurden, sondern auch für die Aufrechterhaltung der Fischversorgung: Für beides war es wichtig, den ersten Fang jedes Kanus den großen Clan-Göttern zu opfern – was aber keineswegs heißt, dass die jeweiligen Besatzungen selbst für ihren Fang verantwortlich gewesen wären. Der oft wiederholten Bitte an die Götter, Fisch im Überfluss zu schenken – manchmal rief man sie sogar explizit an, doch bitte für das ihnen zustehende Erstfangopfer zu sorgen –, wurde vielmehr dadurch entsprochen, dass man die Hauptgottheit des Kanus ganz wesentlich am Fischfang beteiligte. Dieser Gott, der außen am Boot, an der Steuerbordseite (also nicht am Ausleger), seinen Platz hat, zieht mit einer Axt oder einem Stab hinaus, um »den Fisch zu erlegen, den er begehrt, und ihn zum Kanu zurückzubringen«.4 Es wird nicht das letzte Mal sein, dass beim Fischfang (wie auch bei anderen Subsistenztätigkeiten) die Menschen als Mittel zum Zweck des Unterhalts der Götter auftreten, die ihrerseits den Fisch selbst gefangen haben, der ihnen als Opfer dargebracht wird. Da hier wie anderswo die herrschenden Geister-Mächte für die Bereitstellung von Nahrung und Opfergaben selbst verantwortlich sind, bestätigt diese Art von Selbstbedienung das Argument des britischen Sozialanthropologen Edmund Leach, dass nämlich der Gott, der das Tieropfer genauso gut selbst hätte töten können, von dem Opfernden im Wesentlichen etwas anderes erhält: Ehrerbietung und Gehorsam.5
Einleitung: Eine kulturelle Revolution von welthistorischem Maßstab
Am Anfang der christlichen Missionsarbeit auf den Fidschi-Inseln sagte einmal ein Häuptling voller Bewunderung zu einem englischen Missionar: »Eure Schiffe sind echt, eure Kanonen sind echt, also muss auch euer Gott echt sein.« Anders als ein typischer Sozialwissenschaftler unserer Zeit denken würde, meinte er damit nicht, dass Vorstellungen wie »Gott« und »Religion« letztendlich ein Spiegel der existierenden politischen Ordnung sind, also das Resultat einer Ideologie, die erfunden wurde, um den jeweiligen Herrschern Legitimität zu verleihen. In diesem Fall wäre die Anerkennung der Existenz des englischen Gottes ein die Form religiöser Bildlichkeit annehmender Ausdruck für die handgreifliche Macht der Kanonen und Schiffe. Der Häuptling meinte es aber genau umgekehrt: Für ihn waren die englischen Schiffe und Kanonen ein materieller Ausdruck der göttlichen Macht (auf Fidschi: Mana) – zu der die Ausländer ganz offensichtlich privilegierten Zugang hatten. »Echt« (dina) ist in der Sprache der Fidschianer eine Eigenschaft von Mana, wie an der bei rituellen Ansprachen üblicherweise gesprochenen Schlussformel deutlich wird: »Mana, es ist echt.« Der Häuptling sagte also, dass die englischen Schiffe und Kanonen, weil sie auf so beeindruckende Weise mit Mana ausgestattet waren, Verkörperungen der Macht des englischen Gottes sein mussten.
Diese Begebenheit ist eine Art Sinnbild für den größeren Zusammenhang, in dem die vorliegende Arbeit steht, und für das weitergehende Erkenntnisinteresse, von dem sie motiviert ist: Es geht um die radikale Transformation der kulturellen Ordnung, die vor etwa 2500 Jahren – in der von dem Psychiater und Philosophen Karl Jaspers so genannten »Achsenzeit« – begann und global betrachtet bis heute anhält.1 Die verschiedenen, unverwechselbaren Kulturen, die sich, ausgehend von ihren Ursprüngen in Griechenland, dem Nahen Osten, Norditalien und China, zwischen dem 8. und 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung immer weiter ausbreiteten, leiteten eine noch immer anhaltende kulturelle Revolution welthistorischen Maßstabs ein. Die wesentliche Veränderung bestand in der Verschiebung des Göttlichen von einer dem menschlichen Handeln immanenten Präsenz in eine transzendentale »andere Welt« mit einer ganz eigenen Realität: Die Erde ist daraufhin den Menschen allein überlassen. Sie können sie seitdem mit ihren eigenen Mitteln und Überzeugungen entsprechend frei gestalten.
Bis sie durch die kolonialen Ideologien der Achsenzeit – insbesondere durch das Christentum – von Grund auf verändert werden, sind die verschiedenen Völker (also ein Großteil der Menschheit) von unzähligen Geisterwesen umgeben – Göttern, Vorfahren, den Seelen der Pflanzen und Tiere und so weiter. Im Grunde sind es diese kleineren und größeren Götter, die die menschliche Kultur erst erschaffen; sie gehören zuinnerst zur menschlichen Existenz und bestimmen im Guten wie im Schlechten über das Schicksal von Menschen – sogar über Leben und Tod. Obwohl sie im Allgemeinen »Geister« genannt werden, sind diese Wesen mit den typischen Attributen von Personen ausgestattet, einem Kernbestand der entsprechenden mentalen Fähigkeiten, charakterlichen Eigenschaften und Willenskräfte. Folglich werden sie auf diesen Seiten häufig als »Metapersonen« oder »Metamenschen« bezeichnet, und wenn alternativ mit dem Begriff »Geister« auf sie Bezug genommen wird, geschieht das aufgrund ihrer Eigenschaft als nichtmenschliche Personen stets in expliziten oder impliziten Anführungszeichen. (Ähnlich dazu ist das Wort »Religion« immer dort unpassend, wo solche metamenschlichen Wesen und Kräfte nicht die Form transzendenter Anhängsel haben, sondern dem menschlichen Tun immanent sind beziehungsweise es überhaupt erst ermöglichen.) Vermittels ebendieser Eigenschaften bilden die Metapersonen im Zusammenspiel mit den menschlichen Personen eine große kosmische Gesellschaft – in der die Menschen eine untergeordnete und abhängige Rolle spielen.
In weiten Teilen der menschlichen Geschichte und in den allermeisten Gesellschaften bestand das Menschsein in genau dieser abhängigen Stellung in einem Universum voller wesentlich mächtigerer metamenschlicher Wesen. Die gesamte Welt vor und außerhalb der Achsen-Zivilisationen war eine Zone der Immanenz. Hier waren die unzähligen metamenschlichen Kräfte nicht in der Form menschlichen Erlebens präsent, sondern als reale, ausschlaggebende Akteure über menschliches Freud und Leid – als die Verursacher von Erfolg und Misserfolg in allen auch nur vorstellbaren Unternehmungen, vom Ackerbau bis zur Jagd, von der Fortpflanzung bis zum politischen Streben. Der Historiker Alan Strathern, der sich mit dem Thema der frühmodernen Religionskämpfe beschäftigt, drückt es in einer sehr erhellenden, kürzlich erschienenen Arbeit über die spezifische Transformation, die in den Sozialwissenschaften üblicherweise als Übergang vom »Immanentismus« zum »Transzendentalismus« bezeichnet wird, so aus: »Die wesentliche immanentistische Annahme besteht darin, dass das Erreichen jedes erstrebenswerten Ziels von der Zustimmung und dem Eingreifen übernatürlicher Kräfte oder Metapersonen abhängt. Sie sind die Kräfte hinter den basalen Fähigkeiten, Nahrung zu produzieren, Krankheiten zu überstehen, reich zu werden, Kinder zu gebären und Kriege zu führen«.2 Langsam dämmert uns, was durch die Kluft zwischen immanentistisch und transzendentalistisch alles auf dem Spiel steht. So leid es mir für all die Geisteswissenschaftler, Marxisten, Durkheimerianer und alle anderen tut, die implizit von einer transzendentalistischen Welt ausgehen: Die immanentistischen Kulturen waren »determiniert durch die religiöse Basis« – jedenfalls so lange, bis sich das Göttliche aus einer immanenten Infrastruktur in eine transzendente Superstruktur wandelte.
Wahrscheinlich versteht es sich von selbst, aber ich möchte es dennoch kurz erwähnen: Die Frage, die hier gestellt wird, lautet, wie immanentistische Gesellschaften real, also ihrem eigenen Kulturverständnis nach organisiert sind und funktionieren, nicht, wie die Dinge (unserer Vorstellung von »indigen« entsprechend) »eigentlich« sind. Es wird sich zeigen, wie sehr unsere eigenen transzendentalistischen Vorstellungen, insofern sie sich im typischen ethnografischen Vokabular niedergeschlagen haben, die immanentistischen Kulturen, die sie lediglich zu beschreiben vorgeben, entstellt haben. Nehmen wir zum Beispiel die etablierte Unterscheidung von »spirituell« und »materiell«: In Gesellschaften, für die alle möglichen sogenannten Dinge – manchmal sogar alles Existierende überhaupt – von innewohnenden Geisterpersonen belebt sind, ist diese Unterscheidung irrelevant. Dass der Unterschied zwischen immanent und transzendent in Bezug auf die kulturelle Ordnung ein fundamentaler ist, ist der wesentliche Punkt dieses Buches. Was man im Allgemeinen »Ökonomie« oder »Politik« nennt, hat in einem verwunschenen Universum eine radikal andere Bedeutung als in einer Welt, in der Götter weit weg und nie direkt involviert sind und wo die Menschen ihre Begriffe und Kunstgriffe frei anwenden können. In immanentistischen Ordnungen ist die rituelle Anrufung von Geisterwesen und ihrer jeweiligen Mächte eine ganz normale Voraussetzung für jede Art von kultureller Praxis. Vermischt mit den menschlichen Techniken der Lebenserhaltung, der Fortpflanzung, der sozialen Ordnung und der politischen Herrschaft als der notwendigen Voraussetzung zur Entfaltung ihrer Wirksamkeit bilden die vielen verschiedenen kosmischen Wesen und Kräfte gleichsam den allgemeinen Nährboden für jegliche menschliche Handlung. Eine Vielzahl von Geisterpersonen ist jeweils mit einer ganz bestimmten sozialen Handlung verbunden wie das Element einer chemischen Verbindung mit einem anderen oder wie ein gebundenes Morphem in einer natürlichen Sprache. Beziehungsweise, wie Lévy-Bruhl über bestimmte ethnische Gruppen in Neuguinea schreibt: »[Es] wird niemals ein Unternehmen ohne die Hilfe der unsichtbaren Mächte gelingen«.3
Max Webers berühmte Charakterisierung der Moderne als Entzauberung der Welt ist ein späteres Echo auf den von Karl Jaspers unter dem Begriff »Achsenzeit« entwickelten Transzendentalismus und die massenhaften gelehrten Kommentare, die er nach sich zog. Was der Sinologe Benjamin Schwartz schon früh auf den Punkt brachte, ist auch heute noch Konsens: »Wenn es trotz allem in all diesen ›Achsen‹-Momenten einen gemeinsamen unterschwelligen Impuls gibt, dann könnte man ihn den Hang zur Transzendenz nennen«.4 Die Auseinandersetzung des niederländischen Orientalisten Henri Frankfort mit dem »nüchternen Transzendentalismus« des alten hebräischen Gottes kommt einer idealtypischen Beschreibung nahe: »Die absolute Transzendenz Gottes ist die Grundlage des hebräischen religiösen Denkens.« Er ist »unaussprechlich, transzendiert jedes Phänomen«.5 Nach dem Verschwinden der Geister blieb dem Menschen das Erbe einer Welt, die zur subjektlosen »Natur« geworden war. Die Folge war eine handfeste Kulturrevolution; oder eher, wie der israelische Soziologe Shmuel Noah Eisenstadt schreibt, eine Serie von Revolutionen, die »mit dem Auftreten, der Konzeptualisierung und Institutionalisierung einer grundlegenden Spannung zwischen der transzendentalen und der weltlichen Ordnung zu tun« hatten.6
Das Konzept eines wiederkehrenden Prozesses passt besser zu der Tatsache, dass in all diesen transzendentalen Regimen immanente Elemente in ganz unterschiedlichen Formen fortleben: vom »Volksglauben« in abgeschiedenen Gegenden über das göttliche Herabsteigen vom Himmel auf die Erde in Heiligenerscheinungen und Wundern bis hin zum menschlichen Aufsteigen von der Erde in den Himmel in schamanistischen Sitzungen und Prophezeiungen. Der Transzendentalismus hatte es durchaus schwer, sein immanentistisches Erbe abzuschütteln, wie zum Beispiel in den Bekenntnissen des Augustinus, des berühmten Theologen aus dem 4. Jahrhundert, am Ende der Achsenzeit deutlich wird.
Der gute Bischof bewahrte sich nämlich in seiner von Gott verlassenen Welt einen mehr oder weniger unbewussten, aber überaus vielseitigen Animismus. Obwohl Augustinus darauf beharrte, dass Gott die irdische Welt aus dem Nichts erschaffen hat, konnte er die Erde und den Ozean, die »Reptilien, die da leben«, »die wehenden Winde«, »die Lüfte und alles, was in ihnen lebt«, den Himmel, die Sonne, den Mond und die Sterne, in einer überaus interessanten Unterredung fragen, ob sie Gott seien. Und sie antworteten, dass sie nicht Er seien. Die Reptilien sagten: »Wir sind nicht dein Gott. Suche weiter oben!« Auch die Himmelskörper sagten, sie seien »nicht der Gott, den du suchst«. Augustinus reagiert darauf folgendermaßen: »Und ich sagte zu all diesen Dingen, die vor den Türen meiner Sinne stehen: ›Sagt mir etwas von dem Gott, der ihr nicht seid, sagt mir etwas über ihn!‹ Und sie riefen mit mächtiger Stimme: ›Er hat uns gemacht!‹«.7 Augustinus suchte also letzten Endes vergeblich nach einem transzendenten Gott in einem Universum, das von Personen bevölkert war, die den Dingen immanent sind.
Es gibt noch immer Wunderheiler und Hexen unter uns – und sogar ein paar waschechte Animisten wie Augustinus. Vor Abschluss dieses Einleitungskapitels berichtete die New York Times mit Rückgriff auf eine Umfrage des Pew Research Center von 2017, dass »60 Prozent der Amerikaner an mindestens einen oder mehrere Punkte auf der folgenden Liste glauben: Hellseher, Astrologie, die Präsenz von geistiger Energie in unbelebten Objekten (wie Bergen oder Bäumen), Wiedergeburt«.8 Doch abgesehen von diesen widerständigen Nachhut-Scharmützeln des Immanentismus hat die Evakuierung der Hochgötter aus dem Irdischen erfolgreich dafür gesorgt, dass die Kultur unter menschliche Kontrolle kam. Entscheidende Sektoren wie die Ökonomie und die Politik sind auf jeden Fall frei vom Göttlichen (auch wenn, wie wir sehen werden, die immanentistische Sprache beseelter Metapersonen noch immer allgegenwärtig ist). Die moderne »freie Marktwirtschaft« zum Beispiel: Insofern sie sich durch Angebot und Nachfrage selbst reguliert, wird sie grundsätzlich von den ökonomischen Verhaltensweisen ihrer individuellen menschlichen Akteure am Laufen gehalten. Und wer in der Politik das Sagen hat, zeigt sich immer dann, wenn amerikanische Präsidenten die fromme Formel »Gott segne die Vereinigten Staaten von Amerika« aufsagen, nachdem sie der Gottheit mitgeteilt haben, was sie zu tun gedenken. Melanesische Anführer, polynesische Häuptlinge und Inka-Kaiser müssten das vorher tun – weil Gott als Akteur, der Handlungsmacht verleiht, die Bedingung der Möglichkeit des Politischen ist.
Auf genau diese Weise führte die durch die Eroberung der Kultur durch den Menschen in Gang gesetzte Revolution zu einer vollständigen Neuordnung des immanentistischen Universums, wodurch nach und nach die voneinander getrennten und transzendenten Sphären der »Religion«, »Politik«, »Wissenschaft« und »Ökonomie« entstanden. Diese abstrakten Kategorien traten im Laufe der frühen Moderne in Erscheinung, zwischen Mittelalter und Aufklärung. In einer Art zweiter Achsenzeit schuf die westliche Zivilisation transzendente Kategorien, jede von ihnen ein differenziertes Gebilde, ein autonomer Bereich, der mit den anderen sowohl funktional als auch diskurstechnisch verbunden war. Sogar die Kategorie der »Religion« selbst, deren Ursprung der Bibelwissenschaftler Jack Miles in der christlichen Bekehrung römischer Heiden ausmacht,9 wurde in dem von Luther und anderen während der Reformation angezettelten Konfessionsstreit entscheidend umgestaltet, ja wiedergeboren. In Machiavellis Der Fürst erschien »Politik« nun als abgespalten von der »Religion«;10 »Wissenschaft« nahm zusammen mit der »Natur« in einer ausdifferenzierten Reihe von Gesetzen Gestalt an, die die Bewegung im Himmel und auf der Erde erklärten.11 Das wissende »Subjekt« wurde nun radikal von einem äußeren »Objekt« unterschieden;12 der Begriff der »Ökonomie« (oder »politischen Ökonomie«) tauchte im Werk von Adam Smith13 und später bei Thomas Malthus14 und David Ricardo15 auf. Die Ausdehnung Europas und das Zusammentreffen mit immanentistischen Gesellschaften in der Zeit der frühen Moderne trugen schließlich dazu bei, »Kultur« als eigene autonome Sphäre zu konstituieren. Das Genie von Giambattista Vico, dem Autor der Prinzipien einer neuen Wissenschaft über die gemeinsame Natur der Völker zeigte sich darin, dass er in transzendenter Manier eine immanentistische Perspektive darstellte, wodurch es, wie unvollständig auch immer, möglich wurde, eine Wissenschaft der »Kulturen« in ihren eigenen Begriffen zu schreiben.16
Es ist wichtig zu beachten, dass Religion – anders als die Kulturen der Immanenz – seit dem 16. Jahrhundert von einer Infrastruktur zu einer Superstruktur geworden ist, wodurch es möglich wurde, dass das Narrativ der »Determinierung durch die ökonomische Basis« sowohl im traditionellen historischen Materialismus als auch bei neoliberalen Ökonomen (ganz zu schweigen von allen weiteren Disziplinen) zum wissenschaftlichen Allgemeinplatz wurde. Die westliche Feld-Wald-und-Wiesen-Anthropologie kennt kaum etwas anderes. Mit Feld-Wald-und-Wiesen-Anthropologie meine ich das von der transzendentalen Revolution hervorgebrachte Alltagsdenken, das sich unter Kultur eine geschichtete Torte vorstellt: mit der Wirtschaft als Boden, der mit perfekt zu ihm passenden sozialen Beziehungen bestrichen ist. Standfestigkeit bekommt das Ganze durch ein politisches System, und ganz oben findet sich ein religiöser oder ideologischer Guss, der das ganze Gebilde bestätigt und legitimiert. Diese Idee von »Kultur« ist das Gegenteil einer immanentistischen Struktur, in der die Götter sowohl die Schöpfer der Kultur als auch die Quelle jener Mächte sind, die sie konkret ins Werk setzen – wodurch Karl Marx, Émile Durkheim, Milton Friedman und all die anderen mit einem Schlag von den Füßen auf den Kopf katapultiert werden.
Ebenfalls spezifisch transzendental und ebenso pseudoselbstverständlich sind die vertrauten binären Gegensätze, die eine vermeintlich ontologische Dimension haben: nicht nur der zwischen dem Spirituellen und dem Materiellen (bzw. dem Spirituellen und Säkularen), sondern auch der zwischen natürlich und übernatürlich und zwischen Menschen und Geistern. In immanenten Ordnungen sind dagegen alle bedeutsamen materiellen »Dinge« insofern beseelt, als diese Dinge Verkörperungen der treibenden, mit Eigenschaften von Personen ausgestatteten Mächte sind. Aus diesem Grund ist in Kulturen der Immanenz das sogenannte Überirdische nicht von dem zu unterscheiden, was wir das »Natürliche« nennen, gerade so, wie eben auch Personen Geister sind.
Es ist durchaus nicht so, dass die Literatur über die Achsenkultur sehr viel Erhellendes zu der Frage zu sagen hätte, welche Folgen der Übergang vom Immanentismus zum Transzendentalismus real nach sich zieht. Einige Achsenzeit-Forscher lassen sich sogar hinreißen, a priori vorauszusetzen, dass die Prä- und Nichtachsenzeit-Gesellschaften durch das genaue Gegenteil dessen charakterisiert sind, was sie jeweils als hervorstechendes Merkmal der Achsenkulturen bestimmen. Wenn also beispielsweise die Religionen der Achsenzeit besonderen Wert auf das ethische Verhalten und das Leben nach dem Tod des Individuums legen – und damit eine Art soteriologischen, erlösungsgetriebenen Individualismus verkörpern –, dann müssen umgekehrt die immanentistischen Gesellschaften explizit »sozial« sein und – im Gegensatz zur individuellen Erlösung in einer kommenden Welt – das irdische Wohlergehen der Gruppe ins Zentrum stellen.17 Selbst wenn man ignoriert, wie viele Berichte es über Individuen gibt, die zum Beispiel unter melanesischen Anführern oder bei südostasiatischen Bergvölkern miteinander um den Status innerhalb der Gruppe konkurrieren, und wie gut die das ganze weitere Leben eines Jugendlichen bestimmende Schutzgeistsuche der nordamerikanischen Ureinwohner erforscht ist, dann gibt es immer noch die universelle Praktik, dass einzelne Individuen die Kräfte herrschender Metapersonen heraufbeschwören – für Erfolg bei der Jagd, beim Ackerbau, in der Liebe, im Krieg, beim Heilen, Gebären, Tauschen sowie beim Erwerb und der Anwendung esoterischen Wissens oder was man sich sonst noch Lebenspendendes wünschen kann. (Die Reis anbauenden Iban auf Borneo jedenfalls konkurrieren »nicht nur, um ihre Ebenbürtigkeit geltend zu machen – um zu beweisen, dass sie anderen gleichgestellt sind –, sondern sie streben auch danach, sich, wenn möglich, hervorzutun und auf diese Weise andere in Bezug auf materiellen Reichtum, Macht und Ansehen zu übertrumpfen«.)18 Für diese Art Verbindung zum »Göttlichen« kann man sich wohl kaum ein unpassenderes Etikett vorstellen als den für die Prä-Achsenzeit von so vielen Forschern favorisierten Begriff »weltlich«. Sie haben ganz offensichtlich einen Gegensatz zwischen Himmel und Erde im Kopf und ignorieren, dass dieser auch einen Gegensatz zwischen spirituell und säkular nach sich zieht – was die »weltlichen« immanentistischen Völker ebenjener mächtigen Metapersonen berauben würde, auf denen ihre gesamte Existenz beruht. Für Menschen, die in einer immanentistischen Ordnung leben, in der nichts ohne Zauberei unternommen wird, ist das Leben alles andere als weltlich.
Zusätzlich zu Alan Stratherns jüngster Veröffentlichung zu diesem Thema19 hat es einige vorbildliche Würdigungen des Übergangs von der Immanenz zur Transzendenz gegeben, wenn auch nicht von Historikern oder Soziologen aus dem Mainstream der Achsenzeit-Forschung. Hier fällt vor allem der Politologe Benedict Anderson ins Auge, der unabhängig von der Achsenzeit-Literatur untersucht, auf welche Weise die traditionellen javanischen Kosmologien durch den Islam verändert wurden. Anderson betont explizit und beschreibt eindrucksvoll, wie dominant eine immanentistische Weltsicht selbst noch unter den präislamischen altindischen Königreichen von Mataram, Kedhiri und Majapahit war. »Weil die javanische Kosmologie nicht scharf zwischen der irdischen und der transzendenten Welt trennte«, schreibt er, »gab es keinen außerweltlichen Bezugspunkt, von welchem aus die menschlichen Handlungen beurteilt werden konnten«.20 Es handelte sich um ein System, in dem »das Göttliche der Welt immanent war«,21 um eine »Macht«, die als Quelle von »Fruchtbarkeit, Wohlstand, Stabilität und Ruhm« im menschlichen Lebensraum beheimatet war.22 Diese Macht »manifestierte sich in jedem Aspekt der natürlichen Welt« und war anwesend in »Steinen, Bäumen, Wolken und Feuer, jedoch vor allem im zentralen Geheimnis des Lebens, dem Prozess der Zeugung und Fortpflanzung«. Insofern stellte sie eine »grundlegende Verbindung zwischen dem Animismus der javanischen Dörfer und dem hochgradig metaphysischen Pantheismus der urbanen Zentren« her.23
Doch dann betritt eine »moderne islamische Kosmologie« die Bühne und reduziert den immanentistischen Sinn für eine das ganze Universum erfüllende Macht auf eine »Göttlichkeit, die scharf von dem abgegrenzt ist, was sie erschaffen hat. Zwischen Gott und Mensch besteht eine unermessliche Distanz. […] In gewisser Weise ist also Macht aus der Welt abgezogen worden, da sie ja bei Gott liegt, der nicht von dieser Welt ist, sondern über ihr steht und ihre Voraussetzung ist. Zudem werden, da ja die Kluft zwischen Gott und Mensch gewaltig und Gottes Macht absolut ist, alle Menschen im Angesicht seiner Erhabenheit als gleich bedeutungslos betrachtet«.24 Im immanentistischen Zustand dagegen können die Menschen sich der Göttlichkeit nähern und sie sich sogar zu eigen machen – in Akten der Hybris, die, wie im Folgenden deutlich werden wird, eine Gesellschaft konstituieren, in der die Menschen nicht von einer unerreichbaren Gottheit bis zur Bedeutungslosigkeit reduziert werden, sondern durch ihre unterschiedlichen Beziehungen zu den ganz und gar auf sie bezogenen göttlichen Wesen handlungsfähig werden.
Die Anfänge der Befreiung des Menschen von göttlicher Autorität ist auch in einem bemerkenswerten Aufsatz über die transzendentale Revolution des Spätantike-Historikers Peter Brown Thema, der umso bemerkenswerter ist, als er nicht etwa die Anfänge der Achsenzeit untersucht, sondern die Entwicklung des westlichen Christentums im Hochmittelalter im 11. und 12. Jahrhundert.25
In diesem Setting wird vor allem die ungleiche Entwicklung des Transzendentalismus deutlich: Ein transzendenter Gott wohnt über einer menschlichen Bevölkerung, die mit Heiligen, Gespenstern, Hexen und »Naturgeistern« auf vertrautem Fuß lebt, ebenso wie mit Mönchen, die technisch gesehen ebenfalls nicht menschlich sind, da sie ja wie Engel leben. Im Blick auf Engel illustriert Peter Brown »die Vertrautheit und nachbarschaftliche Nähe des Heiligen« im frühen Mittelalter durch die Vorschrift, dass Priester, die während ihres Altardienstes ausspucken mussten, nur zur Seite oder nach hinten spucken durften, »weil am Altar ja die Engel standen«. Die Präsenz des »Nichtmenschlichen in der Mitte der Gesellschaft«, kommentiert Brown, »steht jedem zur Verfügung, für alle Zwecke«.26
In der Kathedrale von Canterbury war es noch im Jahr 1050 möglich, in demselben Wasserbecken am selben Tag einen Säugling zu taufen und in einem Rechtsfall ein Gottesurteil an einem Erwachsenen zu vollstrecken. Beginnend mit der Feststellung, dass es damals, »wenn überhaupt jemals, einen ganz bestimmten Bereich gab, in dem das Heilige in die Spalten des Weltlichen eindrang und umgekehrt, nämlich das Gottesurteil«,27 liest Brown die darauffolgende Entwicklung des Gottesurteils als emblematisch für die Verdrängung des Göttlichen aus der irdischen Stadt des lateinischen Christentums. Das Laterankonzil höhlte das Gottesurteil im Jahr 1205 zunächst nur aus, indem es die spezielle gottesdienstliche Segnung verbot, die ursprünglich den Frevel der »Versuchung Gottes« genehmigt hatte. Es wurde schließlich ganz abgeschafft, nachdem Theologen es zunehmend harsch als altertümlichen, vulgären Brauch der Unterschicht kritisiert hatten, der jahrhundertelang als »Zugeständnis der Kirche an die harten Herzen der germanischen Barbaren« toleriert worden sei.28
Die tiefgreifenden demografischen und institutionellen Veränderungen, die Westeuropa vom 11. Jahrhundert an erlebte, sind häufig beschrieben worden und reichen von massivem Bevölkerungszuwachs und enormen Steigerungen in der Produktivität der Landwirtschaft bis hin zu neuen Formen der Gemeinschaft, der Wiederbelebung des römischen Rechts, dem Zuwachs königlicher Autorität, der Entstehung des Rittertums und landessprachlicher Literaturen, dem Wachstum der Städte und so weiter. Nicht zu vergessen das von Arabisten und Erforschern der griechischen Antike beigesteuerte neue Wissen, vor allem das Werk des Aristoteles, das von Arabisten über das muslimische Spanien und Sizilien nach Europa gebracht wurde.
Das Ergebnis war eine philosophische Umwälzung, die eine ganze Reihe von institutionellen Feldern betraf. »Die Methoden der logischen Ordnung und Analyse, und vor allem jene Denktraditionen, die ihren Ursprung im Studium der Logik hatten, nahmen Einfluss auf die wissenschaftliche Untersuchung des Rechts, der Politik, der Grammatik und der Rhetorik, um nur einige Gebiete zu nennen«.29 Der Einfluss, den die Kategorien des Aristoteles möglicherweise auf die frühmittelalterliche Welt hatten, in der das Göttliche für das Menschengeschlecht in unterschiedlichsten Formen noch präsent und verfügbar war, ist für die hier verhandelte Frage von besonderem Interesse. Wie uns der englische Mediävist Richard William Southern berichtet, wurden im 10. und 11. Jahrhundert die Kategorien tatsächlich mit außergewöhnlicher Faszination zur Kenntnis genommen. Im Prinzip hatten nämlich neun aristotelische Kategorien das Potenzial, die mittelalterliche Ontologie komplett umzugestalten, insofern als Quantität, Qualität, Relation, Zustand, Ort, Zeit, Haben, Wirken, Leiden »so gedacht waren, dass sie die verschiedenen Arten der Betrachtung eines bestimmten Objekts vollständig erschöpfen«.30 Man beachte jedoch, dass eine fundamentale Kategorie der vorangegangen Ära im aristotelischen Schema dessen, was über ein Objekt ausgesagt werden kann, fehlt, nämlich das Personensein, also die Seele oder Person, die aus sich heraus einem jeden solcher Objekte Leben einhaucht. Das neue Zeitalter des 11. und 12. Jahrhunderts erlebte, wie Brown bemerkt, »die Entstehung einer grundlegend neuen Haltung dem Universum gegenüber. Diese Haltung unterschied sich zwar fundamental von einer modernen Blickweise, war aber insofern ›modern‹, als sie kaum noch menschliche Bezüge aufwies. Davor war ein Gewitter entweder die Manifestation göttlichen Zorns oder neidischer Dämonen, jedoch immer an menschliche Wesen« gerichtet.31
Die Studie von Peter Brown erhält hier vergleichsweise viel Raum, weil seine Analyse des Übergangs zur Transzendenz in der Nachachsenzeit so überaus brillant die Schlüsseleigenschaften des immanentistischen Zustands herausarbeitet – angefangen mit dem Thema von Subjekt und Objekt. Wenn man – wie im frühen Mittelalter – materiellen Dingen ein nichtmenschliches Personsein zuspricht, kommt es seiner Beobachtung nach zu einer Vermischung von Sakralem und Profanem, die dazu führt, dass an allen Ecken und Enden die Grenzen zwischen Objektivem und Subjektivem verwischt sind. »Es war eine seltsam subjektive Objektivität«.32 Statt in der Beziehung von Personen zu Dingen bestand das menschliche Verhältnis zur Welt überwiegend in einer Beziehung von Person zu Person. Man könnte auch sagen: Die Beziehung zur Welt war kein Sinn für Objektivität, sondern vielmehr ein Zustand der Intersubjektivität. Entsprechend veränderten die strukturellen Umbrüche des 12. Jahrhunderts die Beziehung zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven dramatisch. Diese Veränderung beschreibt Brown so, dass die Befreiung des menschlichen Handelns von seinen subjekthaften, übernatürlichen Quellen dazu führte, dass Bereiche wie das Denken, die Gesetzgebung oder die Nutzung der Natur »etwas Undurchsichtiges bekommen, eine unpersönliche Objektivität und einen Eigenwert, der ihnen in den vorangegangenen Jahrhunderten gefehlt hat«.33
Dieser Aspekt wäre sogar dann nachvollziehbar, wenn es sich dabei nur um den Anfang einer erst noch zu vollendenden Veränderung handeln würde. Er beleuchtet zugleich ein entscheidendes Element der transzendentalen Revolution: Sobald das Göttliche in eine außerweltliche Realität verschoben wird, entstehen vermenschlichte Institutionen. Die menschliche Ordnung wird zu einer Selbstinszenierung. »Politische Macht wurde zunehmend ohne religiöse Unterfütterung ausgeübt. Die Regierung war das, was die Regierung tat: Herrscher […] ließen sich nieder, um die reale Macht, die sie besaßen, auch auszuüben«.34 Natürlich war diese Entwicklung im Verlauf des 12. Jahrhunderts noch nicht komplett abgeschlossen, aber Peter Browns besonderer Blick auf sie ermöglichte es ihm, die Ursprünge und Antriebe eines Transzendentalismus aufzudecken, der sich erst in der Frühmoderne vollenden und die politische Praxis revolutionieren sollte – unter anderen durch Machiavelli, der den Staat als autonomen Bereich legitimierte und dadurch den transzendentalistischen Bruch verteidigte.
Zuletzt ein Wort über anthropologische Methoden. Es sollte deutlich geworden sein, dass ich, wenn auch nicht immer erfolgreich, versuche, die zur Debatte stehenden Kulturen entsprechend ihrer eigenen immanentistischen Voraussetzungen zu erläutern – früher nannte man das »die indigene Perspektive«, heute heißt es manchmal »umgekehrte Anthropologie«.35 Ich versuche also, die kulturellen Praktiken der Völker mittels ihrer eigenen Onto-Logik zu entfalten. Implizit darin enthalten ist die Kritik der anerkannten Ethnografie für ihren irreführenden Begriffsapparat, der beinahe zu gleichen Teilen aus transzendentalistischer Doppeldeutigkeit und kolonialistischer Herablassung besteht. Die Folge ist eine Anthropologie, die sowohl ihr eigenes Fach als auch die so beschriebene Kultur herabsetzt, indem sie indigene Mentalitäten als unangebrachte Realitätswahrnehmungen verleumdet. Nicht, dass unsere Feldforscher böswillig wären. Im Gegenteil, die große Mehrheit von ihnen ist dem Wohlergehen der Menschen verpflichtet, die sie erforschen – das ist so etwas wie eine Berufung und gehört zu diesem intellektuellen Terrain einfach dazu. Doch noch die besten Arbeiten reduzieren die sinnhaften Beziehungen der jeweiligen Kultur der Immanenz auf den Status zweckmäßiger Fantasien über die objektive Realität – über eine Welt, in der es solche Götter in Wirklichkeit nicht gibt –, wodurch ihre Kultur zu einer fiktiven Inszenierung unserer eigenen wird.
Nehmen wir beispielsweise den bedeutenden neuseeländischen Anthropologen Sir Raymond Firth, wie er von seinem beinahe ebenso bedeutenden Kollegen Edmund Leach beschrieben wird: »Der außergewöhnliche Detailreichtum von Firths ethnografischem Material«, schreibt er, »ist eine beständige Aufforderung an seine Leser, die von ihm angebotenen Erklärungen ›nachzudenken‹«.36 Firths Werk, das in den späten 1920er-Jahren auf der polynesischen Insel Tikopia begonnen wurde, gehört zu den größten Leistungen der Anthropologie überhaupt. Doch durch seine expliziten Äußerungen über die tikopianischen Illusionen bezüglich der Präsenz von Göttern in Menschen, Kanus, Tempeln, Waffen und Werkzeugen – unter anderem bezeichnet er sie als die Verkörperungen (fakatino) oder Gefäße (waka) des Gottes – ist Firths Arbeit auch insofern bemerkenswert, als er die Kultur der Inselbewohner als das enthüllt, was sie wirklich ist – aus unserer Perspektive. Die Folge ist, dass eine immanentistische Welt in eine transzendentalistische Ontologie aufgelöst wird.
Betrachten wir zum Beispiel die Widersprüche in Firths Beschreibung eines wichtigen Rituals, das mit dem Fischen zusammenhängt: »Und hier kam nun der Symbolismus ins Spiel, der für die tikopiansche Religion so charakteristisch ist, die Fiktion, bestimmte Personen wären in diesem Moment leibhaftige Gottheiten«.37 Der sogenannte Symbolismus betraf zwei Frauen, deren Rolle darin bestand, die Körbe zu tragen, die die Meeresgaben enthielten, die für zwei wichtige Göttinnen namens Pufine Ma gedacht waren. Firth fährt fort: »Bei Einbruch der Dunkelheit nahmen zwei Frauen die Körbe und gingen damit zum Strand, wo sie als personifizierte Göttinnen die Gabe in Empfang nahmen, die ihnen die Fischer schuldeten.«38 Zu dieser charakteristischen »Fiktion« zitiert er daraufhin einen Tikopianer: »Sie, die dort mit ihren Körben gingen, sie sind Pufine Ma geworden.«39 Auf ähnliche Weise »glaubten« die Tikopianer von einer Gruppe von Frauen, die während der halbjährlichen Erneuerungsriten einen heiligen Ofen vorbereiteten, »dass diese Frauen, während sie die heilige Handlung vollführten, unter dem Schutz von Te Atua Fafine standen, der weiblichen Gottheit, die der Schutzgeist der Frauen ist«.40 Doch dann rückt Firth in gewisser Weise von »glaubten« und »unter dem Schutz« der Göttin ab, indem er schreibt: »Eigentlich werden sie ganz real mit ihr gleichgesetzt«, und zitiert zur Bestätigung einen Tikopianer, der erklärt: »Die dort unten arbeiten, das ist sie«.41 Bei anderen wichtigen rituellen Gelegenheiten hörte Firth dies direkt aus dem Mund Gottes. So wurde Firths Beschreibung zufolge der oberste tikopianische Häuptling »für Gott in Person gehalten«, und ebendieser Häuptling erklärt ihm: »Ich, der ich dort saß, bin er [der Gott]. […] Ich dort bin der Gott; er ist gekommen, um sich in mir niederzulassen«.42 All die identitätsschmälernden Ausdrücke – man »hielt« sie für die Göttinnen; er sei das »Symbol«, die »Repräsentation« des Gottes, »unter dem Schutz« des Gottes und Ähnliches: All dies sind letztendlich transzendentale Ausflüchte, um nicht einfach »der Gott« zu sagen – »ich, der ich dort sitze, bin er«.43
Wir brauchen also eine umfangreiche Korrektur ethnografischer Begriffe. »Glauben« gehört zu den wichtigsten von ihnen. Wyatt MacGaffey erinnert an Jean Pouillons Bonmot, »es ist lediglich der Nicht-Gläubige, der glaubt, dass der Gläubige glaubt«.44 Der ethnografische Begriff »Glaube« ist häufig eher so etwas wie ein ethnozentrischer Realitätscheck bezüglich der Frage, was die Leute tatsächlich wissen. So bemerkte der wegweisende sudanesische Anthropologe Ian Cunnison vor vielen Jahrzehnten über die Bewohner der ostafrikanischen Provinz Luapula: »Aber das Wichtigste ist, dass das, was die Luapula-Völker in diesem Moment über die Vergangenheit aussagen, das ist, von dem sie wissen, dass es in der Vergangenheit geschehen ist. Einfach zu sagen, dass sie glauben, es geschah in der Vergangenheit, ist zu schwach, weil sie es nicht bezweifeln«.45 Anthropologen sind anfällig dafür, das Verb »glauben« – in dem Sinne, dass Menschen an etwas »glauben« – nur dann zu benutzen, wenn sie es selbst nicht glauben. So sagen sie zum Beispiel nicht: »Diese Leute glauben, dass Pfeilgift Affen tötet«, aber sie sagen: »Diese Leute glauben, dass der Vater des Jagdwilds dafür sorgt, dass Affen gejagt werden können«. Anthropologen sagen nicht: »Diese Leute glauben, dass Regen nötig ist, damit die Feldfrüchte wachsen«, aber sie sagen: »Die Leute glauben, dass die Götter den Regen machen« – in Neuguinea zum Beispiel auf die Weise, dass sie auf die Menschen urinieren.
Ein weiterer Kandidat für die Mottenkiste ist der Ausdruck »Mythos«, der sich auf Erzählungen bezieht, die von Menschen als heilige Wahrheit betrachtet werden, durch diesen Ausdruck aber in den tonangebenden europäischen Sprachen als Fiktion abgewertet werden. So wird in dem häufig zitierten »mythischen Freibrief« des in Polen geborenen, für seine anthropologische Pionierarbeit bekannten Ethnografen Bronisław Malinowski das, was dem Clan oder Stamm als konstitutioneller Grundsatz gilt, erfolgreich für unglaubwürdig erklärt.46 Und dann gibt es da noch die ebenfalls abzuschaffende »Vervolkung« der Indigenen: ihre »Volksmedizin«, ihre »Volkskunst«, ihre »Volksbiologie« – wobei die Volksbiologie zur Biologie in etwa so steht wie Marschmusik zur Musik. Von »Volksmusik« ganz zu schweigen.
Die Herablassung ist unangebracht. Sosehr wir uns auch selbst als Teil einer natürlichen Umwelt zu betrachten vorgeben, so sehr sind wir doch mit demselben existenziellen Dilemma konfrontiert wie diejenigen, die es lösen, indem ihnen die Welt als Ansammlung einer bestimmten Anzahl Mächtiger ihrer eigenen Gattung bekannt ist, mit denen sie über ihr Schicksal verhandeln dürfen. Die Menschen sind nicht die Regisseure ihres eigenen Lebens und Todes, nicht die Kräfte hinter ihrer Fortpflanzung, ihrem Wachstum und Niedergang, ihrer Krankheit und ihrer Gesundheit, und auch nicht die Kräfte hinter den Pflanzen und Tieren, von denen sie leben, oder hinter der Witterung, von der ihr Wohlergehen abhängt. Wären die Menschen selbst Götter, hätten sie keine Bedürfnisse und könnten nicht krank werden, und sie würden niemals sterben. Das Dilemma ist die menschliche Endlichkeit – von der das nächste Kapitel handeln wird.
Dieses Buch soll jedoch nicht als Kulturvergleichsübung missverstanden werden. Es ist vielmehr der mehr oder weniger disziplinierte Versuch einer Verallgemeinerung. Edmund Leach war möglicherweise der Erste, der zwischen Vergleich und Verallgemeinerung unterschieden hat, indem er Ersteres kühn als »Schmetterlingssammelei« abtat und es dem inspirierten Spekulieren gegenüberstellte, das in wenigen, unterschiedlichen sozialen Systemen ähnliche Beziehungsmuster erkennt und auf dieser Grundlage eine denkbare universelle These formuliert.47 Fairerweise muss man jedoch sagen, dass der verschiedene Kulturen umfassende Vergleich, den Leach kritisiert, bei Weitem nicht der einzig mögliche ist, obwohl er in der britischen Sozialanthropologie der 1960er-Jahre vor allem bei den Kollegen aus Cambridge so überaus beliebt war. Das Ziel dieser Anthropologen bestand letztendlich darin, exakt die von ihnen selbst a priori festgelegten – von Leach als »ethnozentrisch« bezeichneten – analytischen Kategorien der Sozialstruktur (»unilineare Abstammung«, »komplementäre Abstammung«, »segmentäre Abstammung« und so weiter) in unterschiedlichen Gesellschaften ausfindig zu machen. Vor allem in afrikanischen Gesellschaften, doch auch im Hochland von Neuguinea, wo der australische Anthropologe John Arundel Barnes hartnäckig immer wieder zu dem Ergebnis kam, dass so etwas wie eine afrikanische Form der Abstammungsordnung nicht existierte.48 Genau das ist es, was Leach kritisiert. Diese Art Vergleiche können am Ende nur zu einem Katalog von Varianten führen, einer endlosen Typologie. Sobald man aber den realen Gegebenheiten Aufmerksamkeit schenkt, so Leachs Argument, also den Verhältnissen der Korrespondenz und des Gegensatzes und so weiter, und zwar egal in welchem System von Verwandtschaft und Heirat, ja in welchem System überhaupt, kann sofort ein eindeutiges Muster bestimmt werden: »Es gibt einen fundamentalen weltanschaulichen Gegensatz zwischen den Beziehungsformen, die das Individuum mit der Zugehörigkeit in einer wie auch immer gearteten ›Wir-Gruppe‹ versehen (Einbindungsbeziehungen), und jenen anderen Beziehungen, die ›unsere Gruppe‹ mit anderen ähnlich gearteten Gruppen ins Verhältnis setzen (Allianzbeziehungen). Und in dieser Dichotomie werden die Einbindungsbeziehungen als Beziehungen von substanzieller Allgemeinheit symbolisch von den Allianzbeziehungen unterschieden, die als mystisch geprägt gelten«.49
Es ist bemerkenswert, dass sich Leachs Befund gerade einmal auf eine Handvoll Gesellschaften stützte, die zudem sowohl ihrer Kultur als auch ihrer Struktur nach extrem unterschiedlich waren, namentlich die der Trobriand-Insulaner, der Tallensi und Kachin sowie der Tikopianer und der Achanti. Und doch haben sich Leachs Ergebnisse im Großen und Ganzen bewahrheitet, zumindest was die »mystische Prägung« der Heiratsallianzen angeht, deren Muster jedoch, wie in einem der folgenden Kapitel dargestellt werden soll, meist komplexer sind, und zwar sowohl in sachlicher als auch in spiritueller Hinsicht. Was aber in diesem Buch vorbehaltlos übernommen wird, ist Leachs Methode der Verallgemeinerung: »Verallgemeinerung ist induktiv; sie geht so vor, dass sie in besonderen Fällen mögliche allgemeine Gesetze ausmacht; sie ist Spekulation, ein Glücksspiel, man kann falsch- oder richtigliegen, aber wenn man richtigliegt, erfährt man etwas vollkommen Neues«.50
In bewusster Einbeziehung dieser von Leach beschriebenen Gefahr behandelt das vorliegende Buch Konfigurationen der Immanenz in extrem unterschiedlichen Gesellschaften, die, trotz all ihrer Berührungspunkte mit Achsen-Gesellschaften, im Kern Kulturen der Immanenz geblieben sind – was wiederum sehr viel über das Menschsein aussagt.
KAPITEL 1
Menschliche Endlichkeit
Von den Alten und den Vätern aus uralter Zeit ist in mythischer Form den Späteren überliefert, dass die Gestirne Götter sind und das Göttliche die ganze Natur umfasst.
– Aristoteles, Metaphysik1
Der Meister sprach: Wie herrlich sind doch die Geisteskräfte der Götter und Ahnen! Man schaut nach ihnen und sieht sie nicht; man horcht nach ihnen und hört sie nicht. Und doch gestalten sie die Dinge, und keines kann ihrer entbehren. Sie bewirken, dass die Menschen auf Erden fasten und sich reinigen und Feiergewänder anlegen, um ihnen Opfer darzubringen. Wie Rauschen großer Wasser (ist ihr Wesen), als wären sie zu Häupten, als wären sie zur Rechten und Linken. In den Liedern steht […]: »Der Götter Nahen / lässt sich nicht ermessen. /Wie dürfte man sie missachten!«
– Konfuzius, Das Buch der Riten, Sitten und Gebräuche2
FOLGENDES PROBLEM: EINE GRUNDÜBERZEUGUNG der traditionellen Anthropologie lautet, dass Menschen immer dann die Hilfe von Geistern anrufen, wenn eines ihrer Vorhaben von Risiken und Ungewissheiten begleitet ist. Religion komme also ins Spiel, wenn Gefahr im Verzug sei – zum Beispiel während eines Krieges. Oder beim Ackerbau, wo ungünstige Witterungsverhältnisse oder Schädlinge die Ernte vernichten können. Dagegen hat der Ethnograf Simon Harrison bei den Manambu in Neuguinea beobachtet, dass es gerade der Erfolg und nicht der Misserfolg ist, der die Geister ins Gedächtnis und auf den Plan ruft: Obwohl alle erwachsenen Männer und Frauen wissen, wie, wann und wo die Kultivierung von Nutzpflanzen am besten gelingt, tragen manche Gärten nun einmal mehr Früchte als andere – was daran liegt, dass die Menschen, die diese Gärten bewirtschaften, von den Vorfahren in ihrer Rolle als Totems, die die Feldfrüchte von ihren entfernten Dörfern aus »herausgeben«, völlig ohne Grund bevorzugt werden.3 Ähnliches hat der französische Anthropologe Philippe Descola von den Achuar im nordwestlichen Amazonas berichtet: Ausgerechnet die Gärtnerinnen und Gärtner, die sich am meisten auf ihre Fähigkeiten verlassen können und so etwas wie schlechte Ernten nicht kennen, sind diejenigen, die in jedem einzelnen Stadium des gärtnerischen Prozesses am gewissenhaftesten die Göttin anrufen.4 Die Frage ist also: Wodurch entsteht Religion? – Oder vielleicht eher: Wodurch nicht?
Die Vorstellung, dass Menschen religiös werden, wenn der Ausgang eines Vorhabens ungewiss ist und sie keinen Einfluss auf ihr Schicksal haben, stammt vornehmlich aus einer präanthropologischen und vormodernen Zeit. In diesem Zusammenhang wird oft Diodorus Siculus zitiert, ein Geschichtsschreiber der griechischen Antike – unter anderem von dem schottischen Aufklärungsphilosophen David Hume in seiner bemerkenswerten Abhandlung Die Naturgeschichte der Religion: »Das Schicksal hat den Menschen niemals […] ein ungetrübtes Glück beschert, sondern hat mit all seinen Geschenken immer einige verhängnisvolle Umstände verbunden, um die Menschen so zur Ehrfurcht vor den Göttern zu zwingen, die sie bei anhaltendem Wohlergehen zu leugnen und zu vergessen geneigt sind.«5 Dieser Gedanke taucht bei Hume tatsächlich immer wieder auf, wobei in diesem Fall besonders interessant ist, dass der Essay über die Religion in seinem durch und durch aufklärerischen Duktus selbst Teil der transzendentalen Revolution geworden ist.
In Abgrenzung zu den zeitgenössischen, aus dem logischen Denken abgeleiteten Argumenten für die Existenz Gottes versucht Hume zu beweisen, dass Religion menschengemacht ist – eine Reaktion der menschlichen Natur auf schwierige Zeiten. Man könne nicht annehmen, dass auf die frühen Menschen in ihrem barbarischen und unwissenden Zustand andere Leidenschaften eingewirkt hätten »als die gewöhnlichen Gemütsbewegungen des menschlichen Lebens: die ängstliche Sorge um Glück, die Furcht vor künftigem Elend, der Schrecken des Todes, der Durst nach Rache, der Hunger und andere Bedürfnisse. Derart von Hoffnung und Furcht, besonders der Letzteren, getrieben, untersuchen die Menschen mit banger Neugier den Lauf künftiger Ursachen und erforschen die vielfältigen und einander entgegengesetzten Ereignisse des menschlichen Lebens. Und in diesem verwirrenden Schauspiel erblicken sie mit noch verwirrteren und erstaunteren Blicken die ersten dunklen Spuren einer Gottheit.«6 Doch in Humes Argumentation gibt es ein unterschwelliges Thema, das schon in den Ausdrücken »Hoffnung« und »Furcht« anklingt: dass die Menschen nämlich, indem sie weder über das eine noch über das andere Kontrolle haben, dem Glück und dem Unglück gleichermaßen unterworfen sind. Es gibt also vermutlich gute Gründe, auch im Blick auf die eigenen Erfolge religiös zu werden. Das ist genau der Punkt, auf den es mir hier ankommt und der sich bei Hume so anhört: »Wir sind in diese Welt gesetzt wie in ein großes Theater, wo uns die wahren Quellen und Ursachen jedes Ereignisses vollkommen verborgen bleiben.«7 In diesem Fall wäre das Göttliche genauso zwingend an den potenziellen Leistungen von Menschen beteiligt wie an ihrem möglichen Scheitern.
In aller Regel jedoch ist den Anthropologen der Witz an der Sache vollständig entgangen. Basierend auf seiner Forschung auf den Trobriand-Inseln wurde zum Beispiel der strukturalistisch-funktionalistische Ethnograf Bronisław Malinowski zu einem einflussreichen Fürsprecher der Vorstellung, dass die Geister beginnen, wo die menschliche Kontrolle endet. (Er nannte das »Magie«, aber da dem allgemeinen Verständnis nach zur Magie unbedingt auch metapersonale Wesen und Kräfte gehören, werde ich diesen Begriff hier nicht verwenden.) Die okkulten Kräfte beruhten jedoch nicht einfach auf Beschwörungsformeln oder ganz bestimmten Handlungen von Gläubigen oder auf den möglicherweise dabei benutzten Objekten. Insbesondere jene von Ritualexperten – sogenannten Gartenzauberern, oft hohen Häuptlingen oder ganz bestimmten nahen Verwandten – angewandten Zaubersprüche, die den Erfolg des Süßkartoffelanbaus sicherstellten (der Malinowski als wichtigstes Beispiel dient), beschworen nämlich vielmehr vor allem die Kräfte der Ahnengeister des Clans herauf. Trotz ihres Wissensschatzes und ihrer harten Arbeit galt den Einwohnern der Trobriand-Inseln das Eingreifen der Ahnen, das mehrere mit den besonderen Stadien des Anbauprozesses zusammenhängende Rituale zur Voraussetzung hatte, also als absolut unverzichtbar für eine reiche Ernte. Was passieren würde, wenn man die Rituale nicht durchführte, konnten die Leute nicht sagen, weil sie es noch nie ausprobiert hatten. Dass jedoch abhängig von Regen und Sonnenschein sowie dem Auftauchen oder Nichtauftauchen von Pinselohrschweinen und Heuschrecken die Gärten in einigen Jahren besser gediehen, in anderen schlechter, wussten sie durchaus aus Erfahrung. Malinowski zufolge wurde wegen dieser Unsicherheit – und nur ihretwegen – »Magie« angewandt.8
Der Gartenbau sei in dieser Hinsicht keine Ausnahme: Alles erfordere Magie. »Was über Pflanzungen gesagt worden ist, gilt entsprechend für die anderen Tätigkeiten, bei denen Arbeit und Magie nebeneinander herlaufen, ohne sich je zu vermischen«.9 Die Menschen wüssten zwar alles über den Bau von Kanus und über das Segeln, aber in ihren zerbrechlichen Booten »sind sie doch den Gefahren von unberechenbaren Strömungen, plötzlichen Stürmen zur Zeit der Monsune und unbekannten Riffen ausgesetzt. Und hier kommt ihre Magie ins Spiel«10 – ganz zu schweigen von all der »Magie«, die sie in den berühmten Kula-Überseehandel investieren, um ihre Handelspartner dazu zu bewegen, die richtigen Wertgegenstände mit nach Hause zu nehmen. Und dann sei da natürlich noch der Kampf, in dem zwar Kraft und Mut eine entscheidende Rolle spielten, der Einfluss von »Zufall und Glück« jedoch bestehen bleibe – und somit die Notwendigkeit, auch hier Magie zum Einsatz zu bringen.11 Darüber hinaus gebe es alle möglichen Zaubersprüche für unkontrollierbare Ereignisse wie Krankheit, Alter und Tod. Am Ende ist die einzige Tätigkeit, die Malinowski vollständig dem Bereich der eigenen Fähigkeiten der Trobriand-Insulaner zuweist und die insofern frei vom Eingreifen metamenschlicher Kräfte ist, das Fischen in den ruhigen Gewässern der Lagunen – im Unterschied zum gefährlichen Fischfang auf dem Ozean.12 (Angesichts anderer ozeanischer Gemeinschaften, die während der Saison die Geister anrufen, damit ihre Netze halten und sie massenweise Fisch einholen können, habe ich hier jedoch meine Zweifel.) Jedenfalls hat vor Kurzem der australische Anthropologe Mark Mosko berichtet, dass bei den Bewohnern der Trobriand-Inseln die Ahnen (Baloma) »als handelnde Akteure all jener magischen Praktiken wahrgenommen werden, die man in beinahe allen Kontexten lebender Menschen sowie im vorgestellten [sic] Zusammenleben der Geister zum Einsatz bringt: Fortpflanzung, Verwandtschaft, Stammeswesen, Heiratsbeziehungen, Mythologie, Kosmologie, Häuptlingshierarchien und -ränge, rituelle Handlungen (zum Beispiel religiöse Opfer, Beerdigungen, Kula, das Milamala-Erntefest, Zauberei und Hexenkraft, die Einhaltung von Tabus etc.)«.13 Wie sich also zeigt, sind die Ahnen unentbehrliche Akteure in sämtlichen denkbaren menschlichen Handlungen, seien sie nun riskant oder nicht. Die Abhängigkeit des Menschen ist umfassender.
Philippe Descolas Erfahrung zufolge wird im Blick auf die Achuar im Amazonasbecken die übliche funktionalistische These, dass die Geister immer dann ins Spiel kommen, wenn Menschen keine ausreichende technische Kontrolle haben – er zitiert hier die Version des amerikanischen Anthropologen Leslie White14 –, gleich doppelt widerlegt: Erstens, weil die Risiken, die die Gärtnerinnen und Gärtner dazu veranlassen, Nunkui, die Göttin des Ackerbaus, anzurufen nur »vorgestellt« sind, und weil entsprechend, zweitens, ihre Gärten, die Descola zufolge perfekte Beispiele für die Raffinesse bestimmter Brandrodungskulturen im Amazonasgebiet darstellen, einfach immer Früchte tragen: Sie sind ungeheuer ertragreich, machen wenig Arbeit und werfen neben dem Grundnahrungsmittel Maniok noch eine Vielzahl anderer Früchte ab, die »perfekt an die unterschiedlichen Boden- und Klimaverhältnisse angepasst sind«.15 Echte Schadensmöglichkeiten gibt es in dieser Art von Landwirtschaft nicht. Denn mithilfe der geheimen rituellen Lieder (Anent), die die Ackerbäuerinnen für Nunkui anstimmen, die Mutter der Kulturpflanzen, gelingt es ihnen, nicht nur die Göttin, sondern auch sich selbst als Personen zu betrachten, für die die Maniokpflanzen eigene Kinder sind, die sie hegen und pflegen.
Bei den Achuar jedenfalls erzielen jene Frauen, die die besten Zaubersprüche zur Anrufung von Nunkui kennen, auch die besten Resultate.16 Entsprechend werden diejenigen, die die Göttin beleidigen, anfällig für »Nunkuis Fluch«, die Drohung nämlich, dass sie die Speisepflanzen insgesamt wieder an sich nimmt, wie sie es zu Urzeiten schon einmal getan hat, um eine törichte Frau zu bestrafen.17 Dazu kommen die Gefahren, die von neidischen Frauen ausgehen. Sie belegen ertragreiche Gärten mit einem bösen Zauber, indem sie dafür sorgen, dass sich ihre in bösen rituellen Gesängen verborgenen Seelenkräfte auf die Seelen der Pflanzen-Personen auswirken.18 Und wieder zeigt sich im Widerspruch zu traditionellen anthropologischen Glaubenssätzen, dass die Gärten nicht von Geistern regiert werden, weil sie das Risiko in sich tragen, nicht zu gedeihen, sondern vielmehr in Gefahr sind, nicht zu gedeihen, weil sie von Geistern regiert werden. Ob es nun um Erfolg geht oder um Scheitern: Die Geister sind für beides verantwortlich.
Ergänzt werden muss aber, dass die Anrufung von metamenschlichen Kräften zur Ermächtigung der Menschen genauso wenig wie bei den Bewohnern der Trobriand-Inseln auf das Gebiet des Gartenbaus beschränkt ist. Erinnern wir uns, dass die Achuar für jede Art von Unternehmung passende Zaubersprüche (Anent) zur Hand haben, die dazu dienen, eine ganze Bandbreite jeweils passender Geister auf den Plan zu rufen: für die Jagd, den Krieg, den Fischfang, den Handel, das Liebesspiel, die Heilung von Krankheiten, die Nahrungszubereitung und so weiter. Als Voraussetzung für jede Art menschlichen Handelns wird der Einsatz metamenschlicher Kräfte zur allgemeinen kulturellen Praxis, das heißt: Das Einbeziehen spiritueller Kräfte ist die Bedingung der Möglichkeit jeglichen sozialen Handelns von Menschen überhaupt.
Simon Harrison hat zwar für die Manambu im nördlichen Papua-Neuguinea auf ähnliche Weise beschrieben, wie der relative Erfolg bestimmter Ackerbauern im Vergleich zu anderen auf die Ahnen zurückzuführen ist, doch er bietet gleichzeitig noch einen tieferen Einblick in diese Art von umfassender Einbindung metamenschlicher Kräfte in alltägliche Kulturpraktiken. So ist der Süßkartoffelanbau politisch besonders bedeutsam, weil hier die entsprechenden Fruchtbarkeitsrituale von einer wichtigen, aus zwei Clans bestehenden Gemeinschaft kontrolliert werden. Wie andere Kultur- und Wildpflanzen, die als Nahrungsmittel genutzt werden, wachsen Süßkartoffeln, wie Harrison sagt, nämlich nicht durch die Arbeit des Ackerbaus, sondern sie werden (aufgrund geheimer, durch ganz bestimmte Clanchefs ausgeführter Beschwörungen) von den totemistischen Ahnen aus ihren weit entfernten Dörfern »freigegeben«: Die Menschen produzieren ihre Lebensmittel nicht; sie empfangen sie vielmehr aus den Händen ihrer Vorfahren.19
Nicht, dass ihnen selbst das Wissen oder die Fähigkeiten fehlten: Alle in der Gemeinschaft aufgewachsenen Menschen – Männer wie Frauen – verfügen über die entsprechenden technischen Kenntnisse. Doch die Menschen wissen lediglich, wie Süßkartoffeln erfolgreich angebaut werden, ihre »Religion«, wie Harrison es ausdrückt, »beantwortet dagegen eine vollkommen andere Frage, nämlich, warum die Süßkartoffeln letztendlich gewachsen sind – und wem dafür die soziale und politische Anerkennung gebührt«.20 Letzteres wird in diesem Buch noch ausführlich Thema sein, doch die Tatsache, dass die Anerkennung nicht etwa dem eigentlichen Gärtner, sondern dem rituell versierten Anführer gilt, mag schon jetzt den Schluss erlauben, dass die Entfremdung des Arbeiters von seinem Produkt keine Erfindung des Kapitalismus ist. Dass die Menschen die Ursachen von Ereignissen so gut wie gar nicht unter Kontrolle haben, zeigt sich nicht nur bei der Frage, warum Süßkartoffeln wachsen, sondern auch im Blick auf andere existenzielle Phänomene wie Witterung, Fortpflanzung, Verhaltensweisen von Tieren, Heranwachsen und Altwerden, Krankheit und Tod. Gerade die eingeschränkte menschliche Fähigkeit, Ursachen in die Welt zu bringen, selbst Ursache zu sein (anstatt sie bloß zu erkennen), wird so zum Zeichen für die Endlichkeit des menschlichen Lebens.
Die einschlägige Anthropologie der menschlichen Endlichkeit geht zurück auf den neapolitanischen Aufklärungsphilosophen Giambattista Vico (1668–1744). Seine Schrift Über die älteste Weisheit der Italier21, aber vor allem seine Abhandlung Die neue Wissenschaft22