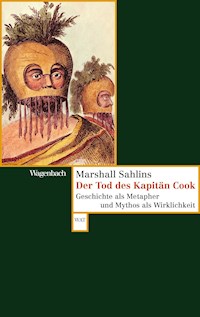Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Königtümer gelten als überkommene, allenfalls noch folkloristisch und touristisch bedeutsame Regierungsformen. Doch die Bindungs- und Herrschaftskraft von Königen sind immer noch erstaunlich, was sich besonders in Krisenzeiten erweist. Diese Essays von David Graeber und seinem akademischen Lehrer Marshall Sahlins untersuchen unter Sichtung weltweiter Beispiele aus Vergangenheit und Gegenwart die historische und anthropologische Wirkmacht der Monarchien. Mit Witz und Brillanz zeigen sie, dass sich im Königtum nicht nur menschliche Grundfragen des Verhältnisses zu Göttlichkeit, Fremdheit und Gruppenzugehörigkeit spiegeln. In ihm verbirgt sich auch eine Ordnungsform, die sich in den demokratischen Staaten noch erhalten hat und unser Denken fundamental bestimmt. Die scharfe Analyse einer faszinierenden und allgegenwärtigen politischen Figur – und wie wir uns von ihr lossagen könnten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über Könige erschien 2022 als Band 93 in der Reihe
KLEINE KULTURWISSENSCHAFTLICHE BIBLIOTHEK.
Die hier veröffentlichten Aufsätze sind eine Auswahl aus dem umfangreicheren Band On Kings, erschienen 2017
bei HAU Books in Chicago.
KLEINE
KULTURWISSENSCHAFTLICHE
BIBLIOTHEK
wurde 1988 in Referenz an Aby Warburg gegründet.
E-Book-Ausgabe 2022
© 2017 HAU Books, Chicago
© 2022 für die deutsche Ausgabe:
Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin
Covergestaltung nach einem Konzept von GROOTHUIS Gesellschaft der Ideen und Passionen mbH.
Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 978 3 8031 4360 0
Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 5193 3
www.wagenbach.de
Thesen über das Königtum
David Graeber und Marshall Sahlins
Strukturen
Allgemeine Betrachtungen über das Königtum
Das Königtum gehört zu den beständigsten Regierungsformen der Menschheit. Zwar kennen wir seine genauen historischen und geografischen Ursprünge nicht, doch ist es praktisch für alle Zeitalter und Kontinente bezeugt – wobei es die meiste Zeit in der Menschheitsgeschichte eher in Ausbreitung begriffen war, als dass es an Einfluss verlor.
Und haben sich Könige erst einmal etabliert, wird man sie auch erstaunlich schwer wieder los. Es bedurfte außerordentlicher Rechtsakrobatik, um Karl I. und Ludwig XVI. hinrichten zu können; und beseitigt man, wie bei den Zaren geschehen, die ganze Königsfamilie, bekommt man es dafür (scheinbar endlos) mit Ersatzzaren zu tun. Schließlich ist es auch heute wohl kein Zufall, dass die einzigen Regime, denen die Revolten des Arabischen Frühlings 2011 kaum etwas anhaben konnten, alteingesessene Monarchien waren. Selbst wenn Könige gestürzt werden, besteht das rechtliche und politische Gerüst der Monarchie oft fort. So sind alle modernen Staaten auf das eigentümliche und widersprüchliche Prinzip der »Volkssouveränität« gegründet; die Macht, die einst dem König zukam, existiert weiter, nur dass sie jetzt auf eine Entität namens »Volk« übertragen wurde.
Der Zusammenbruch der europäischen Kolonialreiche hatte den unerwarteten Nebeneffekt, dass die Idee der Souveränität überall zur Grundlage der Verfassungsordnung avanciert ist – mit wenigen Ausnahmen wie Nepal oder Saudi-Arabien, wo es bereits eigene Monarchien gab.
Daraus folgt, dass eine Theorie des politischen Lebens, die dem nicht Rechnung trägt oder Königtum als randständiges, nebensächliches, gar Ausnahmephänomen behandelt, wenig taugt.
In diesem Band tragen wir einige Elemente für eine Theorie des Königtums zusammen. Als Ausgangspunkt unserer Argumentation dienten Felder, die wir beide bereits erkundet haben: einerseits in den klassischen Essays über den Fremden-König (Stranger King), andererseits in denen über das Gottkönigtum der Schilluk. Im Fokus dieser Aufsatzsammlung steht, was als »Gott-« oder »Sakralkönigtum« bezeichnet worden ist. Allerdings geschieht dies in der Annahme, dass eine gründliche Betrachtung seiner allgemeinen Merkmale die Tiefenstrukturen jeglicher Monarchie und damit jeglicher Politik offenlegen kann.
Die kosmische Staatsordnung
Menschliche Gesellschaften sind – typischerweise oberhalb, unterhalb und auf der Erde – hierarchisch eingebunden in eine kosmische Staatsordnung voller Wesen mit menschlichen Eigenschaften und übermenschlichen Kräften, die über ihr Schicksal bestimmen. Diese Überpersonen in Gestalt von Göttern, Ahnen, Geistern, Dämonen, Herren der Spezies und der in den Geschöpfen und Naturphänomenen verkörperten animistischen Wesen sind mit weitreichender Macht über Leben und Tod ausgestattet, was sie, in Verbindung mit ihrer Verfügung über die Verhältnisse des Kosmos, zu umfassenden Gebietern über Wohl und Wehe der Menschheit macht. Selbst viele nur lose strukturierte Jäger- und Sammlervölker sind in dieser Weise gottartigen Wesen untergeordnet, die über große Territorien und die Gesamtheit der menschlichen Bevölkerung herrschen. Selbst wo auf Erden keine Oberhäupter existieren, gibt es königliche Wesen im Himmel.
Daraus folgt, dass die Natur des Naturzustands eine staatliche ist. Angesichts der Tatsache, dass die menschliche Gesellschaft durch eine Überpersonen-Obrigkeit mit ultimativer Macht über Leben und Tod regiert wird, stellt so etwas wie der Staat offenbar eine allgemeine Conditio humana dar.
Es folgt daraus auch, dass Könige die Nachahmung von Göttern sind, und nicht umgekehrt – entgegen der konventionellen Annahme, dass das Göttliche ein Spiegel der Gesellschaft sei. Im Verlauf der Menschheitsgeschichte war vielmehr königliche Macht von göttlicher Macht abgeleitet und abhängig. Tatsächlich ahmen menschliche Autoritäten in staatenlosen Gesellschaften nicht weniger als in großen Königreichen die herrschenden kosmischen Mächte nach – wenn auch in eingeschränkterer Form. Schamanen besitzen die wundersamen Kräfte der Geister, mit denen sie außerdem interagieren. Initiierte Stammesälteste oder Clan-Oberhäupter verkörpern, möglicherweise maskiert, den Gott und walten so über das Gedeihen von Mensch und Natur. Chiefs werden gegrüßt und behandelt wie Götter. Könige kontrollieren die Natur selbst. Was gewöhnlich als Vergöttlichung menschlicher Herrscher aufgefasst wird, lässt sich historisch besser als Vermenschlichung des Gottes beschreiben.
Daraus ergibt sich, dass von einer säkularen Obrigkeit schlechterdings nicht die Rede sein kann: Menschliche Macht ist spirituelle Macht, wie pragmatisch sie auch zustande kommt. Verfügungsgewalt über andere kann durch überlegene Stärke, Erbamt, materielle Freigiebigkeit oder andere Mittel erlangt werden; doch die eigentliche Macht, als Autorität zu handeln oder diese zu sein, wird Ahnen, Göttern oder anderen äußeren Überpersonen zugeschrieben, auf die das Leben und Sterben der Menschen zurückgeht. In diesem kulturellen Rahmen gilt eine privilegierte Beziehung zu den überpersonalen Herrschern über das menschliche Schicksal als Rechtfertigung irdisch-gesellschaftlicher Macht. Eine privilegierte Beziehung zu diesen Mächten kann, wie sich etwa bei Erfolg und großen Taten auf Erden beobachten lässt, auch zur Selbstunterwerfung derjenigen führen, die nicht unmittelbar vom Wirken der Machthaber betroffen sind. Es handelt sich hier um »Charisma« im ursprünglichen gott-durchdrungenen Sinne.
In ebendiesem gott-durchdrungenen Sinne sagen die Schilluk, dass der König Juok (der Gott) ist, aber Juok ist nicht der König. Dessen Göttlichkeit entspricht einer Art intersubjektivem Animismus. In einer Spielart des »Eins-über-Viele« (One over Many) kann die Gottheit als personifizierte Form einer Klasse von Dingen verstanden werden, die daher Instanzen/Instanziierungen der Gottheit darstellen – was zugleich bedeutet, dass der Gott als teilbare Person den Geschöpfen und Erscheinungen seines Reichs innewohnt. Hawaiianer sehen in symbolisch bedeutsamen Pflanzen, Tieren und Personen jeweils »Körper« (kino lau) des Gottes. In diesem Sinne war Captain Cook bekanntlich der Gott Lono, aber Lono war nicht Captain Cook. Solche intersubjektiven Animismen sind keineswegs selten: Schutzgeister ergreifen von Schamanen, Hexen ergreifen von ihren Opfern Besitz. Auch Idolatrie und Verwandtschaft sind Formen einer weitgefassten Metaphysik intersubjektiven Seins.
Verglichen mit der Art kosmischer Staatsordnung, wie sie bei Wildbeutern und vielen anderen existiert, bedeuten sterbliche Könige eine Begrenzung der Staatsmacht. Wie hochtrabend seine Ambitionen und wie umfassend der ihm unterstellte gesellschaftliche Apparat auch sein mögen, kein Sterblicher könnte jemals über solche Macht verfügen wie ein Gott. Und trotz ihres Absolutheitsanspruchs versuchen dies die meisten Könige nicht einmal ernsthaft.
Der einen Hälfte der Menschheit versetzte die Entstehung menschlichen Königtums jedoch einen schweren Schlag. Denn Könige sind in praktisch allen Fällen archetypisch männlich. Die heutige Wissenschaft tut paläolithische oder neolithische Bilder mächtiger Frauenfiguren gewöhnlich als bloß »mythologische« Darstellungen ab, die keinerlei politische Bedeutung gehabt hätten, doch in den kosmischen Staatsordnungen, die damals existierten, kann das keineswegs der Fall gewesen sein. Demnach bedeutete die Fixierung göttlicher politischer Macht im männlichen Oberhaupt einer königlichen Familie in zweierlei Hinsicht einen Vorstoß des Patriarchats: Nicht nur, dass die primäre menschliche Manifestation göttlicher Macht nun männlichen Geschlechts war, es wurde auch zum Hauptzweck des idealen Hausstands, mächtige Männer zu produzieren.
Die genaue historische Entwicklung, in deren Verlauf göttliche Macht – oder eigentlich Souveränität – von übermenschlichen Wesen auf wirkliche Menschen übergegangen ist, dürfte zahlreiche unerwartete Wendungen genommen haben und wird schwerlich jemals zu rekonstruieren sein. Zum Beispiel wissen wir von Gesellschaften (bei Ureinwohnern Kaliforniens und Tierra del Fuegos), in denen willkürliche Befehle nur im Rahmen von Ritualen vorkommen, bei denen Menschen Götter personifizieren. Doch nicht die Götter geben die Befehle, sondern Clowns, die anscheinend das Wesen göttlicher Macht repräsentieren; in verwandten Gesellschaften (z. B. bei den Kwakiutl) entwickelt sich daraus eine Clown-Polizei, die während einer gesamten rituellen Saison die Kontrolle übernimmt, in wieder anderen eine periodische Polizeimacht in direkterem Sinne. Souveränität ist in diesen Fällen zeitlich begrenzt: Außerhalb des spezifischen rituellen oder saisonalen Rahmens herrscht Dezentralisierung vor; diejenigen, die während der rituellen Zeit mit souveräner Macht ausgestattet sind, unterscheiden sich dann nicht mehr von anderen Mitgliedern der Gesellschaft und haben nicht mehr zu sagen als diese. Sakralkönigtum hingegen scheint vor allem ein Mittel zur räumlichen Einhegung souveräner Macht zu sein. In fast allen Fällen gilt, dass der König absolute Macht über Leben und Besitztümer seiner Untertanen hat, aber nur, wenn er auch persönlich anwesend ist. Infolgedessen werden unterschiedlichste Strategien eingesetzt, um seine Bewegungsfreiheit einzuschränken. Zugleich gibt es eine beidseitig konstitutive Beziehung zwischen der Einhegung des Königs und seiner Macht: Die Tabus, die ihn fesseln, machen ihn auch zu einem transzendenten Überwesen.
Fremden-König-Formationen
Fremden-Königreiche sind überall auf der Welt die dominante Form vormoderner Staaten, vielleicht bilden sie auch ihre ursprüngliche Form. Die über sie herrschenden Könige sind nach Herkunft und Identität Fremde. Die Dynastie beginnt typischerweise mit einem heroischen Fürsten eines größeren Reichs, das, ob nah oder fern, mythisch oder zeitgenössisch, himmlisch oder irdisch, jedenfalls außerhalb liegt. Oder alternativ dazu übernehmen einheimische Herrscher die Identität und Souveränität verherrlichter Könige von anderswo und werden so – wie in den indischen Königreichen Südostasiens – Fremde, statt dass Fremde zu einheimischen Herrschern avancieren. In jedem Fall ist die politische Ordnung dual: aufgeteilt zwischen Herrschern, die ihrer Natur nach Fremde sind – eine dauerhaft notwendige Bedingung ihrer Autorität –, und dem untergebenen autochthonen Volk, dem »Besitzer« des Landes. Diese duale Verfasstheit wird zudem ständig noch in Erzählung und Ritual reproduziert, obgleich sie schon in den unterschiedlich auf herrschende Aristokratie und einheimisches Volk verteilten Funktionen, Fähigkeiten und Befugnissen unablässig ins Werk gesetzt wird.
Das Königreich ist weder ein endogenes Gebilde noch entwickelt es sich isoliert: Es entsteht aus dem Beziehungsgeflecht eines hierarchisch gegliederten zwischengesellschaftlichen historischen Feldes. Die Überlegenheit der herrschenden Aristokratie ist nicht aus dem Prozess der Staatsbildung hervorgegangen, vielmehr der Staat aus der Apriori-Überlegenheit einer – von der Natur mit einer gewissen libido dominandi ausgestatteten – auswärtigen Aristokratie. Zuerst existiert die herrschende Klasse, und diese erschafft eine unterworfene Klasse.
Der Gründer einer Dynastie ist oft berüchtigt für Inzest, Brudermord, Vatermord oder andere auf seinem Weg zum eigenen Königreich begangene Verbrechen gegen die Verwandtschaft und die allgemeinen Sitten; er mag auch berühmt sein für die Überwindung gefährlicher Naturgewalten oder menschlicher Feinde. Der Held offenbart sein jenseitiges Wesen, größer und höher als das Volk, über das zu herrschen er bestimmt ist – daher auch seine Macht, genau dies zu tun. Wie gehemmt und sublimiert das monströse und gewaltsame Wesen des Königs im einmal etablierten Königreich auch auftritt, es bleibt eine wesentliche Bedingung seiner Souveränität. Als Zeichen der übermenschlichen Quellen der königlichen Macht kann seine Stärke, die sich insbesondere im Sieg beweist, in der Tat sowohl politisch als positive Anziehungskraft wirken als auch als physisches Herrschaftsmittel dienen.
Trotz aller grenzüberschreitenden Gewalt des Gründers wird das Königreich doch häufig auf friedliche Weise errichtet. Eroberung wird als Ursprung der »Staatenbildung« überbewertet. Unter den jeweiligen Umständen – darunter die inneren und äußeren Konflikte des historischen Felds – haben die Einheimischen oft ihre eigenen Gründe, zu fordern, »dass uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe« (1. Samuel 8,20). Selbst im Falle großer Königreiche wie Benin oder der Mexica konnte die Initiative tatsächlich von den Einheimischen ausgehen, die den Fürsten eines mächtigen Reichs von außerhalb um Führung baten. Was traditionell oder in der wissenschaftlichen Literatur als »Eroberung« gilt, ist manchmal die Usurpation des vorherigen Regimes und nicht Gewalt gegen die einheimische Bevölkerung.
Während sich in vielen Fällen keine Eroberungstradition findet, gibt es doch immer eine Vertragstradition, insbesondere in Form einer Ehe zwischen dem fremden Fürsten und einer einheimischen Frau von herausgehobener Stellung – meist einer Tochter des einheimischen Anführers. Souveränität wird verkörpert und übertragen durch die Einheimische, die den Bund zwischen den fremden Eindringlingen und der lokalen Bevölkerung begründet. Der Nachkomme dieser ursprünglichen Verbindung – der oft als traditioneller Gründerheros der Dynastie gefeiert wird – verknüpft und umfasst dadurch die wesentlichen Komponenten des Königreichs, die einheimische und die fremde, in seiner Person. Zum einen Landesvater, wovon auch seine polygynen und sexuellen Aktivitäten zeugen, ist der König zum anderen auch das Kind-Oberhaupt des einheimischen Volks, von dem es mütterlicherseits abstammt.
Selbst wo es zu einer Eroberung kommt, ist diese kraft des ursprünglichen Vertrags reziprok: die gegenseitige Einschließung des autochthonen Volks durch den fremden König und des Königs durch das autochthone Volk. Die Einsetzungsriten des Königs stellen für gewöhnlich die Domestizierung des unbändigen Fremden nach: Er stirbt, wird neu geboren und durch einheimische Anführer aufgezogen und zur Reife geführt. Seine wilde oder gewaltsame Natur wird ihm nicht so sehr ausgetrieben als vielmehr sublimiert und prinzipiell zum Nutzen der Allgemeinheit verwandt: intern als die Durchsetzung von Gerechtigkeit und Ordnung und extern zum Schutz des Reichs vor Natur und Feinden. Doch während man den König domestiziert, wird die Bevölkerung zivilisiert: Das Königtum ist eine Zivilisationsmission. Der fremde König, so heißt es immer wieder, erhebt die einheimische Bevölkerung aus einem niederen Zustand, denn er bringt ihr Landwirtschaft, Viehzucht, Werkzeuge, Waffen, Metalle – sogar Feuer und das Kochen, und damit eine Transformation von Natur zu Kultur (im Sinne Lévi-Strauss'). Wie man in afrikanischen Gesellschaften sagt: Ohne König keine Zivilisation.
Wie es die ursprüngliche Verbindung versinnbildlicht, schafft die Synthese der fremden und autochthonen Mächte – von männlich und weiblich, himmlisch und irdisch, gewaltsam und friedlich, mobil und verwurzelt, fremd und einheimisch etc. – ein sozial funktionstüchtiges kosmisches System. Oft kommt es zu einem Arrangement, in dem der Zugriff des autochthonen Volks auf die spirituellen Quellen der Fruchtbarkeit der Erde potenziert wird durch die vom König übermittelten befruchtenden Kräfte, also etwa Regen und Sonne, die die Erde ergiebig machen. Für sich genommen jeweils unvollständig, bilden das einheimische Volk und der fremde Herrscher zusammen eine funktionierende Ganzheit. Das trägt dazu bei, dass das Königreich überdauert, trotz seiner Spannungen durch die ethnischen Unterschiede, die zugleich Klassenunterschiede sind.
Obwohl die Einheimischen die Herrschaft einem fremden König übertragen haben, bleibt ihnen eine Restsouveränität. Dank ihrer einzigartigen Beziehung zu den Kräften der Erde fungieren die Nachkommen der ehemaligen einheimischen Herrscher als die Hohepriester des neuen Regimes. Ihre Kontrolle über die Nachfolge des Königs, einschließlich der königlichen Einsetzungsrituale, ist der Garant für die Legitimität des fremdstämmigen Herrschers. In der Regel haben die einheimischen Anführer auch zeitweilig Macht als Berater des fremden Königs und stellen manchmal den »obersten Minister«. Das Prinzip, dass die Souveränität des Königs durch das Volk delegiert wird, dem sie ursprünglich und rechtmäßig zukommt, ist weitgehend schon in Fremden-König-Formationen integriert und daher bereits vor und unabhängig von seinen frühmodernen europäischen Ausdrucksformen gut bekannt.
Trotz der Überlegenheit der ethnisch fremd bleibenden Aristokratie ist diese sprachlich und kulturell meist nicht dominant, sondern wird in dieser Hinsicht von der einheimischen Bevölkerung assimiliert. Demgemäß entspricht die Identität des Königreichs gewöhnlich der des einheimischen Volks.
Die europäische Kolonisation kann in wichtigen Aspekten oft als eine historisch späte Form einheimischer Traditionen des Fremden-Königtums verstanden werden: Beispiele sind Captain Cook, Raja Brooke und Hernando Cortés.
Politik des Königtums
Allgemeine Charakteristika
Der politische Kampf um die Macht des Königs nimmt im Allgemeinen die Form eines Streits zwischen zwei Prinzipien an: dem Gottkönigtum und dem Sakralkönigtum. In der Praxis ist Gottkönigtum das Wesen der Souveränität: Es bedeutet, handeln zu können, als wäre man ein Gott, aus den Grenzen des Menschlichen herauszutreten und willkürlich und frei von Strafe Gnade oder Zerstörung walten zu lassen. Diese Macht kann von der Vorstellung flankiert sein, der König beweise durch dieses Handeln, dass er ein bereits existierendes übermenschliches Wesen real verkörperte. Doch dem muss nicht so sein; ebenso gut ist möglich, dass der König dadurch selbst zu einem übermenschlichen Wesen wird. Japanische Shogune (zumindest einige von ihnen), römische Kaiser und kabaka bei den Ganda konnten selbst Götter werden. Im Gegensatz dazu bedeutet »sakral«, abgetrennt zu sein, eingehegt durch Bräuche und Tabus. Die Restriktionen, mit denen sakralisierte Könige belegt werden – »die Erde nicht berühren, die Sonne nicht sehen« in James George Frazers berühmtem Diktum –, bedeuten nicht nur die Anerkennung der Präsenz einer nicht rechenschaftspflichtigen göttlichen Macht, sondern auch und gerade eine Form, sie einzuhegen, zu kontrollieren und zu begrenzen. Diese zwei Prinzipien lassen sich als Widerspiegelung zweier Momente der Fremden-Königs-Erzählung verstehen: Im ersten scheint die schreckliche Macht des Königs bei seiner Ankunft auf; im zweiten seine Einschließung und Überwindung durch die Untertanen. Doch in diesem umfassenderen Sinne sind immer beide gleichzeitig gegenwärtig.
Alle klassischen Themen des Gottkönigtums – die Zurschaustellung willkürlicher Macht, der König als Sündenbock, Königsmord (im Zweikampf oder als Opferung), die Verwendung von Bildnissen (Effigies) des Königs, die Orakelfunktion toter Monarchen – lassen sich am besten als verschiedene Züge in einem fortdauernden Schachspiel zwischen König und Volk verstehen, in dem der König und seine Parteigänger die Göttlichkeit des Königs zu stärken versuchen, die das Volk vertretenden Gruppen hingegen seine Sakralisierung. Das Fremden-Königtum liefert die tiefenstrukturellen Grundlagen für eine Politik von unten, in der Vertreter der Menschheit (oft buchstäblich) mit ihren Göttern kämpften – und manchmal siegreich daraus hervorgingen.
Die Hauptwaffe in den Händen derer, die sich einer Ausweitung königlicher Macht widersetzten, könnte man als »Gegensakralisierung« bezeichnen. Den übermenschlichen Status des Monarchen anzuerkennen, d. h. »den König göttlich [zu] erhalten« (Richards 1968), erfordert einen elaborierten Apparat, der jene Aspekte seines Wesens, die als Ausweis seiner sterblichen Natur erscheinen, verbirgt, einhegt oder tilgt und ihn so praktisch zu einer Abstraktion macht. Könige werden unsichtbar, immateriell, vom Kontakt mit ihren Untertanen oder dem Stoff und Material der Welt abgeschnitten und folglich oft in ihre Paläste gebannt, wo sie außerstande sind, willkürliche (oder überhaupt irgendeine) Macht wirksam auszuüben. Dabei ist der Königsmord nur die äußerste Form der Gegensakralisierung.
Wenn Volkskräfte obsiegen, kann das Resultat ein Sakralkönigtum im Sinne Frazers sein oder die Reduktion des Monarchen auf eine zeremonielle Symbolfigur wie die späten Zhou-Kaiser oder die englische Königin heute.
Wenn Könige den Sieg davontragen (indem sie sich beispielsweise mit einer neu entstehenden Zivil- oder Militärbürokratie verbünden), hat das verschiedenste Konflikte vor allem zwischen den Lebenden und den Toten zur Folge. Nach Überwindung der räumlichen Grenzen versuchen Könige in der Regel, auch die Grenzen der Zeit zu überwinden und ihren übermenschlichen Status in irgendeine Form echter Unsterblichkeit zu übersetzen. Soweit sie damit Erfolg haben, stellen sie ihre Nachfolger vor einige Probleme, denn deren Legitimität hängt von den Vorfahren ab, die aber nun zugleich notwendig in Rivalität zu ihnen treten.
Der abnehmende Status in der königlichen Nachfolge ist ein altes Thema der Anthropologie. Mit der Zeit wird die zunehmende Distanz jüngerer Nachkommen und Familienzweige zur Hauptlinie der Thronfolge zu einer verbreiteten Konfliktquelle in Königsgeschlechtern und führt oft zu Brudermorden, besonders zwischen väterlichen Halbbrüdern, die jeweils von ihren Verwandten mütterlicherseits gestützt werden (vgl. Geertz/Geertz 1975). Die Chancen jüngerer Prinzen auf die Thronfolge werden mit jeder Generation geringer, es sei denn, sie reißen mit Gewalt und Arglist die Königswürde an sich, auf die sie dem Recht nach immer weniger Anspruch haben. Neben der Gewalt eines Interregnums bringt dies häufig mit sich, dass sich Angehörige der Königsfamilie – die sich zurückziehen oder unterliegen – an die äußeren Grenzen des Reichs oder darüber hinaus verstreuen, wo sie in einem kleineren eigenen Reich die Macht übernehmen. Dieser Vorgang ist ein wichtiger Ursprung von Fremden-König-Strukturen und regionalen Konstellationen von Kern-Peripherie-Beziehungen (galaktische Staatsordnungen, s. u.). Er könnte auch bei der Entstehung sogenannter Reiche eine Rolle spielen.
Dieses Problem wird noch verwickelter durch einen zentralen Widerspruch zwischen zwei Formen des abnehmenden Status: der horizontalen und der vertikalen. Einerseits sinkt jede Nebenlinie, die sich vom dynastischen Zentrum abspaltet, mit der Entstehung neuer Nebenlinien immer weiter im Status, wenn nicht irgendwelche radikalen Mittel der Selbstbeförderung zumindest zeitweilig den Niedergang umkehren. Andererseits nimmt gewöhnlich auch der Status der Hauptlinie immer weiter ab, da sich jede Generation weiter vom Gründungshelden, Gott oder Fremden-König entfernt. Folglich ist der Zweig der königlichen Abstammungslinie, der mit dem höchstrangigen (ältesten) Vorfahren identifiziert wird, auch ihre niedrigstrangige Abzweigung.
Das zwangsläufige Absinken des Status über die Zeit führt zu dem Problem, wie mit königlichen Toten umgegangen werden soll. Verstorbene Mitglieder der Dynastie sind in vielen Fällen durch Schreine, Mumien, Relikte, Grabmale oder sogar Paläste im politischen Leben gegenwärtig, um ihren Willen und ihre Sicht durch Medien, Orakel oder ähnliche Mittel zu kommunizieren. Das Paradox des horizontal und vertikal abnehmenden Status – dass ältere Vorfahren aus demselben Grund höher rangieren, aus dem ihre Nachfahren einen niedrigeren Rang haben – spitzt sich umso mehr zu, je aktiver die Rolle der Toten in der zeitgenössischen Politik wird. Und diese Rolle kann sehr aktiv sein: Mumien von Inkakönigen besaßen weiterhin den Palast, die Ländereien und den Tross an Gefolgsleuten, über die sie im Leben verfügt hatten, so dass jeder neue Herrscher neues Territorium erobern musste, um seinen Hof zu unterhalten. In allen solchen Systemen, wenn sie lange genug intakt blieben, wurden lebende Könige irgendwann von zahllosen Toten verdrängt und überwältigt. Daher mussten die Toten kontrolliert, beschränkt, eingehegt und sogar ausgelöscht werden. Wie lebende Könige mussten sie sakraler gemacht, durch Einschränkung ihrer Macht stärker begrenzt werden, selbst wenn diese Einschränkungen letztlich ihre Macht erst konstituierten.
Ein allgemeines soziologisches Prinzip besagt, dass Vorfahren desto eher als Machtquelle angesehen werden, je mehr sie als fremde Wesen gelten; und desto eher als Rivalen und Hemmnis, je ähnlicher sie den lebenden Sterblichen erscheinen. Die Erinnerung an einen Totem-Killerwal-Vorfahren oder eine Witchetty-Made bürdet den Lebenden keinerlei Last auf; das Gedenken an einen von seinen vielen Nachkommen erinnerten und verehrten Mann hingegen bedeutet, dass sich seine Nachfahren in Rivalität zu ihm finden und es zu ihrem Lebensprojekt machen, genau dasselbe zu erreichen wie er. Die Zahl derer aber, die zu berühmten Ahnen werden können, ist begrenzt. In jedem Fall stellt sich ein Gleichgewicht ein: Werden die Vorfahren völlig ausgelöscht, verlieren auch ihre Nachfahren allen Status; haben sie dagegen zu viel Macht, ersticken sie die Verwirklichungsmöglichkeiten der Lebenden. Das Ergebnis ist oft eine Variante der Politik der rituellen Täuschung, die so typisch für den Umgang mit lebensspendenden Göttern ist: Sie müssen eingehegt, vertrieben oder sogar zerstört werden, und all das aus dem vorgeblichen Grund, sie zu ehren.
Gewöhnliche Sterbliche mögen vor diesem Problem stehen oder nicht (es hängt davon ab, wie sie sich in Zeit und Geschichte einordnen), doch Könige, deren Legitimität mindestens zum Teil auf der Abstammung von anderen Königen beruht, sind immer damit konfrontiert. Ihrer angestammten Domäne zu entfliehen und sich anderswo als fremder König zu installieren, ist tatsächlich eine Möglichkeit, dem Würgegriff der Toten zu entkommen. Doch die Nachkommen des Fremden-Königs stehen wieder vor demselben Problem, das sich mit jeder Generation nur noch weiter verschärft.
Ein guter Teil des extravaganten Verhaltens der Herrscher mächtiger Königreiche oder »früher Staaten« kann als Versuch angesehen werden, sich aus dieser Umklammerung zu befreien, das heißt als Form der Konkurrenz mit den Toten. Man kann versuchen, die Toten auszulöschen oder auch selbst zu den Toten zu werden, doch das ist selten auf ganzer Linie erfolgreich. Man kann sich in Konkurrenz zu ihnen begeben durch den Bau zeitloser Monumente, durch Eroberungen oder durch die rituelle Opferung einer noch größeren Anzahl von Untertanen, um so noch größere willkürliche Macht zur Schau zu stellen. Man kann sogar, wie es manchmal geschieht, versuchen, den Gang der Geschichte umzukehren und einen Fortschrittsmythos zu erfinden. Alle diese Mittel bringen jedoch wieder neue Probleme hervor.
Das gewöhnliche Machtgleichgewicht zwischen König und Volk wird häufig durch intensive emotionale Bindungen aufrechterhalten: Liebe, Hass oder eine Kombination davon. Oft kommt es dabei zu paradoxen Verkehrungen der normalerweise zu erwartenden Folgen solcher Emotionen: Könige der Schilluk oder Swasi erhielten göttlichen Status in dem Moment, in dem sich das Volk in Hass gegen sie vereinte; die fürsorgliche Liebe der Merina gegenüber infantilisierten Herrschern kann alternieren zwischen Nachgiebigkeit bei Taten, die sonst als Gräuel angesehen werden könnten, und harscher Geißelung, wenn sie dagegen als Grenzüberschreitung angesehen werden.
Die Vollkommenheit des Königs, seines Hofs und Palasts, seiner Hauptstadt oder unmittelbaren Umgebung bildet nicht das wirkliche Universum ab; sie bildet das Universum in einem wiederhergestellten Zustand abstrakter platonischer Perfektion ab, die ihr im alltäglichen Erleben mangelt. Vielleicht befand es sich früher einmal in diesem Zustand. Vielleicht besteht die Vorstellung, dass es sich eines Tages wieder in diesem Zustand befinden wird. Die neu gegründete Königsstadt, die der materiellen Welt aufgeprägte Projektion einer einzigen menschlichen Vision, kann als Prototyp für alle zukünftigen Utopien angesehen werden: als Versuch, nicht nur der physischen Welt, sondern auch dem Leben aller sterblichen Menschen in ihr ein Bild der Vollkommenheit aufzuzwingen. Das ist letzten Endes natürlich unmöglich. Menschen lassen sich nicht auf platonische Ideale reduzieren, und die grundlegenden Konflikte des menschlichen Lebens, die sich vor allem um Fortpflanzung und Tod drehen, können nicht durch Gesetze aus der Welt geschafft werden. Solche Zustände transzendenter Vollkommenheit lassen sich vielleicht in Momenten des rituellen Handelns erreichen, doch niemand kann sein ganzes Leben lang oder auch nur für signifikante Zeiträume in solchen Zuständen verharren. In manchen Hauptstädten wird versucht, Geburt, Gebrechen und (natürlichen) Tod ganz aus der königlichen Niederlassung herauszuhalten. Selten wird es zu diesem Extrem getrieben, doch in gewissem Grad findet es sich immer. Zum Mindesten herrscht an Königshöfen eine elaborierte Etikette, durch die selbst alltägliche soziale Interaktionen von der Vorspiegelung geprägt sind, dass jene Facetten des Lebens nicht existieren. Diese Codes setzen Verhaltensstandards, die mit zunehmendem (sozialen oder räumlichen) Abstand vom Königshof immer unvollkommener umgesetzt werden.
Während Propheten die vollständige Auflösung der Widersprüche und Dilemmata des menschlichen Daseins für die Zukunft vorhersagen, verkörpern Könige ihre partielle Auflösung im Heute.
Die Willkür der Fremden-Könige ist, wie paradox auch immer, der Schlüssel zu ihrem Vermögen, sich als Inkarnation der Gerechtigkeit zu etablieren. Die Fähigkeit, alles Beliebige in Besitz zu nehmen oder zu zerstören, auch wenn sie nur ganz gelegentlich in Anspruch genommen wird, ähnelt strukturell dem Eigentum von allem; es handelt sich um eine undifferenzierte Beziehung zwischen dem Monarchen und allen und allem anderen. Diese Undifferenziertheit bedeutet auch Unparteilichkeit, da ein absoluter Monarch – zumindest dem Prinzip nach – kein partikulares Interesse hat, das ihn in seinem Urteil über Konflikte zwischen seinen Untertanen befangen sein ließe. Für ihn sind alle gleich. Aus diesem Grund reklamieren Könige für sich immer irgendeine Art absoluter despotischer Macht, selbst wenn alle um die praktische Beschränktheit solcher Ansprüche wissen – täten sie es nicht, wären sie keine Könige. Das Allumfassende dieser Prätentionen bedeutet zugleich, dass die königliche Macht potenziell das bestehende Gesellschaftsgefüge untergräbt. Während sich Könige im Allgemeinen als Verkörperung und Stütze aller bestehenden Hierarchien und Autoritätsstrukturen geben (indem der Monarch z. B. auf seiner Rolle als »Vater des Volks« beharrt, bekräftigt er vor allem die Macht wirklicher Väter über ihre Frauen, Kinder und andere von ihnen Abhängige), bedeutet der undifferenzierte Charakter ihrer Macht auch, dass alle Untertanen letztlich gleich, das heißt Gleiche sind. Der schottische Aufklärer Henry Home (Lord Kames) hat vermutlich als Erster darauf hingewiesen, dass der Unterschied zwischen absolutem Despotismus, bei dem mit Ausnahme von einem alle gleich sind, und absoluter Demokratie nur in einem einzigen Mann besteht. Es gibt also eine tiefe strukturelle Verwandtschaft zwischen der heutigen Idee, dass alle Bürger »vor dem Gesetz gleich« sind, und dem monarchischen Prinzip, dass sie gleich sind als potenzielle Opfer rein willkürlicher königlicher Verwüstung.
Die Spannung zwischen Hierarchie und Gleichheit kann unterschiedliche Formen im politischen Leben annehmen. Einfache Bürger können sich beim König über seine »bösen Ratgeber« beschweren. Könige oder Kaiser können sich als Verfechter des Volks gegen die Interessen der Aristokratie in Pose werfen. Auch ist möglich, dass sich alle, ungeachtet ihres sozialen Status, gegen den König vereinen.
Infolgedessen werden Könige, selbst nach ihrem Verschwinden – und selbst wenn sie durch Volksaufstände gestürzt wurden –, in Geistform genau als solches vereinendes Prinzip fortwesen. Das Wirken königlicher Geister als Medium in großen Teilen Afrikas und in Madagaskar sowie die moderne Idee der Volkssouveränität sind heutige Beispiele für dieses Prinzip.
Kern-Peripherie-Beziehungen (galaktische Staatsordnungen)
Die zentrifugale Ausbreitung wirkmächtiger politischer, ritueller und materieller Formen von einem zentralen Königreich aus hat häufig eine zentripetale Anziehung und Bewegung von Völkern aus dem Hinterland zur Folge. Periphere Gesellschaften werden als kulturell untergeordnet, aber immer noch politisch unabhängig definiert. Es lässt sich wohl behaupten, dass in der Politikwissenschaft das Gesetz gilt, dass alle großen Königreiche selbst einmal marginal waren. Ursprünglich von der Peripherie aus auf ein mächtiges Zentrum hin ausgerichtet, gelang es ihnen aufgrund einer Überlegenheit in irgendeinem Bereich – wie Handel oder Kriegsführung –, das ehemals übergeordnete Reich als Zentrum abzulösen.
In der Tat gibt es in diesen Kern-Peripherie-Konstellationen mit dominierenden Königreichen im Zentrum innere Impulse durch »aufstrebenden Adel« (upward nobility) auf jeder Ebene der zwischengesellschaftlichen Hierarchie. Die Königreiche an der Spitze stehen als Konkurrenten in einem umfassenderen geopolitischen Feld gegeneinander, das sie durch Universalisierung ihrer eigenen Machtansprüche zu beherrschen suchen. Einerseits betreiben sie eine utopische Politik, die man als »Realpolitik des Fantastischen« beschreiben könnte, indem sie ihre Herkunft bis zu welthistorischen Helden (wie Alexander dem Großen), legendären Gott-Königen (wie Quetzalcoatl), sagenumwobenen Städten (wie Troja oder Mekka), antiken oder zeitgenössischen Weltmächten (wie dem Römischen oder Chinesischen Kaiserreich) und/oder großen Göttern (wie Shiva) zurückverfolgen. Andererseits demonstrieren sie ihre Universalität mittels Aneignung – durch Tribute, Handel oder Plünderung – und Domestizierung der wilden, animistischen Mächte, die die exotischen Objekte des barbarischen Hinterlands beseelen.
Berühmt ist der von Edmund Leach (Leach 1954) ethnografisch beschriebene Fall der Chiefs des Bergvolks der Kachin im heutigen Myanmar, die in manchen Fällen »Shan wurden«, was bedeutet, sich mit Shan-Fürsten zu verbünden und ihren Lebensstil zu übernehmen. Shan-Fürsten übernehmen ihrerseits die politischen und rituellen Staatssymbole burmesischer oder chinesischer Könige, was teilweise bis auf die Bergvölker abfärbt. Dieses Phänomen der »galaktischen Mimesis«, bei der niedrigere Oberhäupter die politischen Formen der ihnen unmittelbar Übergeordneten übernehmen, ist eine verbreitete Dynamik in Kern-Peripherie-Systemen, die angetrieben wird von der inneren und gegenseitigen Konkurrenz verschiedener politischer Instanzen in der gesamten zwischengesellschaftlichen Hierarchie. Die Konkurrenz nimmt üblicherweise eine von zwei Formen an. Bei der »komplementären Schismogenese« versuchen Individuen, die um Führerschaft in einer gegebenen Gemeinschaft kämpfen, oder Gemeinschaften, die um Macht in einem größeren galaktischen Feld konkurrieren, ihre lokalen Widersacher durch Zusammenschluss mit einem höher stehenden Anführer zu übertrumpfen; sie erhöhen ihren eigenen Status innerhalb der regionalen Hierarchie. Oder umgekehrt versucht bei der »antagonistischen Akkulturation« eine niedriger stehende Gruppe, sich des Vordringens einer benachbarten Macht zu erwehren, indem sie deren politischen Apparat übernimmt und auf diese Weise eine Pattsituation herbeiführt – wie die Vietnamesen lange Zeit ihr eigenes Mandat des Himmels als »südliches Reich« auf Augenhöhe mit dem »nördlichen Reich« Chinas beanspruchten. Man bemerke, dass sich in beiden Fällen die Elemente des höheren politischen Status einschließlich des Königtums durch einen Prozess der Nachahmung auf Initiative der weniger mächtigen Völker hin über die Region ausbreiten.
Zusammen mit den akkulturativen Einflüssen, die von Kern-Königreichen ausstrahlen, bewirkt galaktische Mimesis die Entstehung von Hybrid-Gesellschaften, deren politische und kosmologische Formen weitgehend nicht aus ihrer eigenen Gestaltung hervorgehen und wirklich jede mögliche »Determination durch die ökonomische Basis« überschreiten. Angesichts der weltweiten Verbreitung von Kern-Peripherie-Beziehungen, sogar teilweise in der »tribalen Zone«, ist diese Art von Hybridstruktur oder ungleicher Entwicklung öfter die Norm als die Ausnahme in der soziokulturellen Ordnung. Der »Überbau« übersteigt den »Unterbau«.
Die politische Ökonomie des traditionellen Königtums
Die Eigentumsverhältnisse des Königtums sind komplex. Einerseits ist das Land in lokale Besitztümer aufgeteilt, als deren »wahre Besitzer« und Garanten der Fruchtbarkeit die Vorfahren der Bewohner oder aber die einheimischen Geister angesehen werden, mit denen die Vorfahren einen Pakt geschlossen haben. Entsprechend gelten auch die lokalen Untertanen, die über initiierte Älteste oder geistliche Anführer rituellen Zugang zu diesen Überpersonen-Mächten haben, selbst als die »Besitzer«, die »Erde«, das »Land« oder was sonst die Rechte des Gründers auf das Territorium gegenüber der herrschenden Aristokratie bezeichnet – besonders in Fremden-Königreichen, in denen Letztere nach Herkunft und ethnischer Identität auswärtig ist. Obwohl die Rechte der lokalen Bevölkerung gegenüber den Herrschern ihren Besitz garantieren, erlauben sie im Verhältnis zu den Geist-Bewohnern, deren Eigentümerstatus von den gegenwärtig dort Lebenden angemessen anerkannt werden muss, lediglich den Nießbrauch (dabei ist zu bemerken, dass diese Beziehungen zwischen der lokalen Bevölkerung und den autochthonen Geistern selbst zu den größeren Strukturen des Fremden-Königreichs analog sind). Andererseits können auch die herrschende Aristokratie und der König, die traditionell ursprünglich arm und landlos gewesen sein mögen, bis ihnen die angestammte Bevölkerung Land gewährte, »Eigentümer sein«; aber hier im Sinne der Herrschaft über riesige Ländereien und ihre Bewohner, die ihnen Tributrechte auf einen Teil des Produkts und der Arbeitskraft der unterworfenen Bevölkerung verschafft. Während das Verhältnis der Untertanen zu dem Prozess kraft ihrer Kontrolle über die primären Mittel ein produktives ist, ist das Verhältnis der Herrscher dazu kraft ihrer Herrschaft über die produzierende Bevölkerung ein extraktives. Wie die ostafrikanischen Nyoro sagen: »Der Mukama [der König] herrscht über das Volk; die Clans herrschen über das Land« (Beattie 1971, S. 167).
Dementsprechend hat die Ökonomie des Königreichs eine Doppelstruktur, die geprägt ist von dem fundamentalen Unterschied zwischen der oikos-Ökonomie der unterworfenen Bevölkerung und der spezifisch politischen Ökonomie des Palasts und der Aristokratie, die auf die materielle Subventionierung ihrer Macht zielt. Auf den gewöhnlichen Lebensunterhalt ausgerichtet, ist der primäre Sektor durch die Verwandtschafts- und Gemeinschaftsbeziehungen des Untertanenvolks organisiert. Die herrschende Klasse ist in erster Linie am fertigen Produkt der Arbeit der Bevölkerung interessiert, seien es Güter oder Leistungen, auf die sie Tribut erhebt. Mit diesem wird eine Elitensphäre der Reichtumsakkumulation finanziert, die besonders auf die politischen Zwecke der Stärkung und Ausweitung der Herrschaftsdomäne ausgerichtet ist. Arbeit in dieser Domäne wird in Form von Fronarbeit, Sklaverei und/oder Klientelbeziehungen organisiert. Neben dem Aufbau eines imposanten Palastkomplexes dient sie insbesondere zur Anhäufung von Reichtümern aus externen Quellen mittels Raubzügen, Handel und/oder Abgaben. Sie wird also eingesetzt in verschwenderischem Konsum, Monumentalbauten und strategischer Umverteilung sowie möglicherweise weiteren militärischen Unternehmungen – so hat dieser Reichtum unterwerfende Wirkung, sowohl direkt, insofern er den einen zugutekommt, als auch indirekt, insofern er andere beeindruckt. Der materielle Erfolg des Königs ist zudem das Zeichen seines Zugangs zu den göttlichen Quellen irdischen Wohlstands. Die politische Wirkung seines Reichtums verdoppelt sich derart durch den Beweis seiner göttlichen Kräfte.
Das Königtum zeichnet sich eher durch eine politische Ökonomie der sozialen Unterwerfung als des materiellen Zwangs aus. Königliche Macht beruht nicht so sehr auf der eigentumsförmigen Kontrolle über die materiellen Lebensgrundlagen des unterworfenen Volks, sondern auf den vorteilhaften oder ehrfurchtgebietenden Wirkungen königlicher Freigiebigkeit, Selbstdarstellung und Prosperität. Ziel dieser politischen Ökonomie ist es, die Anzahl und Loyalität der Untertanen zu erhöhen – im Unterschied zur kapitalistischen Unternehmung, der es um Erhöhung des Kapitalreichtums geht. Um eine Marx'sche Formel aufzugreifen, könnte man sagen, das wesentliche Projekt der Ökonomie des Königtums hat die Form B-R-B' – wobei die politische Kontrolle über eine Bevölkerung zu einer Akkumulation von Reichtum führt, der eine umfassendere Kontrolle über die Bevölkerung mit sich bringt – im Gegensatz zur klassischen Formel des Kapitals, R-B-R', wobei die eigentumsförmige Kontrolle über produktiven Reichtum (Kapital) Kontrolle über die Bevölkerung (die Arbeit) bedeutet, die zur Vermehrung produktiven Reichtums eingesetzt wird.
Es ließe sich geradezu behaupten, dass »Geister die Produktionsmittel besitzen«, nur dass diese sogenannten Geister bzw. Überpersonen in Form von Pflanzen, Tieren, bedeutenden Artefakten und sogar von Land vielmehr die Produktionsmittel sind. Da sie eigene Neigungen und Absichten haben, sind sie in der Tat eigenständige Personen und zusammen mit Gottheiten, Ahnen und anderen Überpersonen-Mächten bekanntlich für Erfolg oder Misserfolg menschlicher Arbeit verantwortlich. Entsprechend umfassen die »Produktionsmittel« typischerweise Riten, besonders Opferriten, als wesentlichen Teil der Arbeit – wie auf Tikopia die berühmte »Arbeit der Götter«.
Daraus folgt auch, dass der politische Nutzen materiellen Erfolgs – die Belohnung in Form von Status und Einfluss – den Schamanen, Priestern, Ältesten, Häuptern einer Abstammungslinie, großen Männern, Chiefs oder Königen zukommt, die aufgrund von Zuschreibung oder Leistung prioritären Zugang zu diesen übermenschlichen Quellen menschlichen Wohlstands haben – nicht notwendigerweise oder in geringerem Umfang hingegen den Jägern, Gärtnern oder den anderen, die die Arbeit machen. Die Entfremdung des Arbeiters von seinem Produkt war schon allgemein durchgesetzt, lange bevor sie im Kapitalismus traurige Berühmtheit erlangte. Soweit das soziale Prestige stattdessen an die herrschende politisch-religiöse Obrigkeit fällt, kann politische Macht auch eine »ökonomische Basis« haben – wenngleich die »ökonomische Basis« keine ökonomische ist.
Übrigens ist auch Kannibalismus selbst in Gesellschaften verbreitet, die vorgeben, ihn zu verabscheuen. Er ist eine Problematik der animistischen Jäger oder Gärtner, welche von Tieren oder Pflanzen leben, die wesentlich selbst Personen sind. Daher die Tabus und anderen rituellen Elemente, die diesen Spezies und ihren Überpersonen-Herren zugeschrieben werden – wiederum als notwendige Bedingung der »Produktion«.
Begriffe, deren Nutzen sich überlebt hat
»Kulturrelativismus«, in einem bestimmten Sinne verstanden, ist weiterhin ein nützliches Konzept. Nutzlos hingegen ist ein Vulgärrelativismus, der die Werte jeder Gesellschaft mit denen jeder anderen, einschließlich der unseren, als gleichwertig auffasst. Richtig verstandener Kulturrelativismus ist eine anthropologische Technik zum Verstehen kultureller Unterschiede, keine Form der wohltätigen Erteilung moralischer Absolution. Er beruht auf der vorübergehenden Zurückstellung unserer eigenen moralischen Urteile oder Bewertungen der Praktiken anderer Menschen, um sie als Positionswerte innerhalb des kulturellen und historischen Rahmens, der sie hervorgebracht hat, zu verorten. Die Frage ist, was diese Praktiken bedeuten, wie sie entstanden sind und welche Auswirkungen sie für die betroffenen Menschen haben, und nicht, was sie nach unseren Maßstäben sind oder wert sind.
In derselben relativistischen Hinsicht muss auch das ontologische System der lokalen Bevölkerung – ihre Idee davon, was ist – an und für sich betrachtet und darf nicht durch analytische Begriffe verzerrt werden, die ihnen unsere eigenen Gewissheiten über die »Wirklichkeit« unterschieben. Nehmen wir beispielsweise die Kategorie des »Mythos«. Wenn wir in unserer Sprache eine Aussage als »Mythos« kennzeichnen, sagen wir damit, dass sie nicht wahr ist. Wenn wir also über die »Mythen« anderer Menschen sprechen, drücken wir aus, dass das, was sie als heilige Wahrheit wissen und worauf sie ihr Dasein gründen, fiktional und unglaubhaft ist – für uns. Nachdem wir so die Grundlage ihrer Gesellschaft entzaubert haben – wie im ethnologischen Oxymoron »mythischer Vertrag« –, ist der Weg frei, sie als wesentlich unwirklich auch aus ihrer Sicht abzutun: als Epiphänomen und Mystifizierung ihrer wirklichen soziopolitischen Praxis. Was für das wissenschaftliche Projekt dann typischerweise noch übrig bleibt, ist eine mehr oder weniger nutzlose Suche nach dem »Kern der historischen Wahrheit« in einer von Fantasien durchsetzten Erzählung – wodurch gerade ignoriert wird, dass die so entwerteten Begriffe der wahre historische Gegenstand sind, um den es dabei geht. Denn indem der sogenannte Mythos von den betreffenden Menschen als wahrheitsgemäß genommen wird, ist er der wahre Organisator ihres historischen Handelns.
»Leben ist schließlich so sehr Nachahmung von Kunst wie umgekehrt.« Mit diesem Satz kommentierte Victor Turner (Turner 1957, S. 153) die Art und Weise, in der Dorfbewohner der zentralafrikanischen Ndembu Prinzipien, die sie als Kinder aus den Traditionen des Königreichs Lunda gelernt hatten, auf ihre eigenen sozialen Beziehungen anwandten. Und so unterfüttern und strukturieren wiederum hohe politische Anführer ihre eigenen öffentlichen Handlungen mit Erzählungen, die in den dynastischen Epen kodifiziert sind. Die Vergangenheit ist nicht nur Prolog, sondern, wie Turner sagt, auch »Paradigma«. Traditionen sind historische Ursachen ohne zeitliche oder räumliche Nähe zu ihren Wirkungen: Sie gehen in die Situation ein, aber sie gehören ihr nicht an. Durch Einbettung der Gegenwart in eine erinnerte Vergangenheit ist diese Art kulturell eingeführter Zeitlichkeit ein grundlegender Modus des Geschichtemachens und reicht von der Traumzeit der australischen Aborigines bis zur Staatspolitik des Königreichs Kongo. Was in einer gegebenen Situation geschieht, besteht dann aber immer auf Grundlage kultureller Bedeutungen, die die Parameter des Ereignisses transzendieren: Bobby Thomson schlug nicht nur den Ball links über den Zaun, sondern er gewann für seinen Club die National League. Der größere Teil der Geschichte ist unzeitlich und kulturell: nicht das, »was tatsächlich geschah«, sondern was es ist, das geschah.
Das bedeutet nicht, dass wir alles Beweismaterial über die Existenz der Nuer vor 1750 ignorieren müssen, nur weil sie steif und fest behaupten, alle von einem Mann namens »Nuer« abzustammen, der vor zehn Generationen gelebt habe. Es bedeutet aber, dass es uns nicht zusteht, überhaupt über »Nuer« zu sprechen, wenn uns nicht interessiert, was Nuer zu sein für die Nuer selbst bedeutet.
Veraltete ökonomische Begriffe
Nehmen wir zum Beispiel »Ding«. Die cartesische Unterscheidung zwischen res cogitans und res extensa, Subjekt und Objekt, liefert keine gute Beschreibung von ontologischen Systemen, die weitgehend auf menschlichen Attributen und Personalität basieren. In den Gesellschaften, um die es in diesem Band geht, besitzen, wie bereits mehrfach erwähnt, Naturphänomene, mit denen die Menschen maßgeblich interagieren, und sogar bedeutende wirkmächtige Artefakte die wesentlichen inneren Eigenschaften menschlicher Personen. Das konventionelle anthropologische Konzept der »psychischen Einheit der Menschheit« muss für viele oder die meisten dieser Gesellschaften auf das des subjektiv durchtränkten Universums ausgeweitet werden. Es war eine charakteristische jüdisch-christliche Täuschung, dass die Welt aus dem Nichts geschaffen wurde, dass Geist und Subjektivität ihr nicht immanent sind – und dass die Menschen, weil Adam einen Apfel aß, dazu verdammt wurden, sich an widerspenstiger Materie, Dornen und Disteln zu Tode zu arbeiten. Für den größten Teil der Welt umfasste ökonomische Praxis notwendig auch intersubjektive Beziehungen mit den Wesen, an (mit) denen Menschen arbeiten und die über die Resultate entscheiden. Die Pflanzen, die Achuar-Frauen im Amazonasgebiet ziehen, sind ihre Kinder, auch wenn der Erfolg ihrer Bemühungen der Göttin der Kultivierung zu verdanken ist. Das bedeutet nicht einfach, dass menschliches Können eine notwendige, aber unzureichende Ursache für ein erfolgreiches Ergebnis ist, sondern dass menschliches Können von Göttern gestiftete Kräfte anzeigt. Entgegen unserer eigenen provinziellen Wirtschaftswissenschaft einer cartesischen Welt gibt es in dieser Hinsicht nicht einfach nur »Dinge«: Die sogenannten Gegenstände menschlichen Interesses haben ihre eigenen Wünsche.
Ebenso »Produktion«: Die Idee eines heroischen Individuums, das passive Materie kreativ bearbeitet und sie durch eigene Anstrengung und nach seinem eigenen Plan in nützliche Dinge verwandelt, beschreibt nicht die intersubjektive Praxis, in der Überpersonen-Andere die primären Akteure des Prozesses sind (Descola 2011, S. 468 ff.).
Es ist angemessener zu sagen, dass Menschen die Früchte ihrer Bemühungen von diesen Quellen empfangen, als dass sie sie erschaffen (z. B. Harrison 1990, S. 47 ff.). Die Kräfte, durch die Gärten gedeihen, Tiere verfügbar, Frauen fruchtbar sind, Gefäße heil aus dem Brennofen und Werkzeuge aus der Esse kommen – Kräfte, die verschiedentlich als mana, semangat, hasina, nawalak, orenda etc. hypostasiert werden –, sind nicht menschlichen Ursprungs. Bei den zahlreichen Gesellschaften, die ontologisch in dieser Weise konstituiert sind, versagen konventionelle Ideen über die angeblich funktionalen Wirkungen der Produktionsverhältnisse auf die übrigen gesellschaftlichen Beziehungen.
Unsere Idee von »Produktion« stellt selbst die Säkularisierung eines theologischen Begriffs dar, entstammt aber einer sehr spezifischen Theologie, der zufolge ein allmächtiger Gott das Universum ex nihilo erschaffen hat (Descola 2011, S. 471 f.) – eine Vorstellung, die in unserer Kosmologie noch erhalten ist, selbst nachdem Gott dem Anschein nach daraus entfernt wurde. Doch was ist mit dem Jäger, dem Sammler oder Fischer? »Produzieren« sie irgendetwas? An welchem Punkt wird ein gefangener Fisch oder eine aus dem Boden gerissene Knolle von einem »natürlichen« Phänomen zu einem »gesellschaftlichen Produkt«? Wir sprechen hier von Handlungen wie Transformieren, Angreifen, Besänftigen, Sorgen, Töten, Zerlegen und Umformen. Doch dasselbe gilt letztlich auch für die Herstellung von Autos. Nur wenn man sich die Fabrik als Blackbox denkt, so wie sich jemand, der nicht viel über die Vorgänge einer Schwangerschaft weiß, vorstellen mag, dass die Gebärmutter einer Frau während der Wehen unter großer »Arbeit« etwas fix und fertig Geformtes »produziert« (etymologisch »hervorstößt«), kann man »Produktion« als wahre Grundlage menschlichen Lebens bezeichnen.
Veraltete Begriffe der soziokulturellen Ordnung
Wie sich aus der bisherigen – und mehr noch späteren – Diskussion ergibt, ist eine Reihe von Dichotomien, die in den Geisteswissenschaften weithin Anwendung finden, für eine Beschreibung der hier thematisierten Gesellschaften nicht zu gebrauchen, insofern sie selbst diese binären