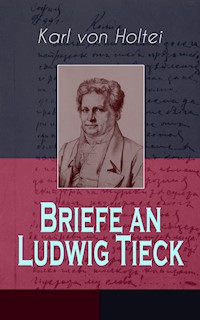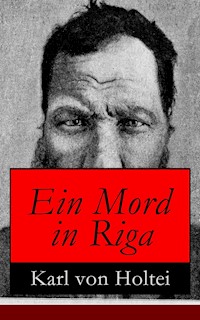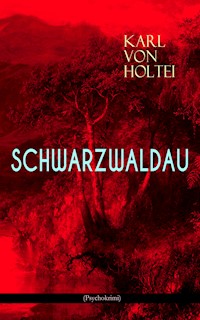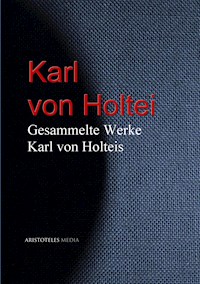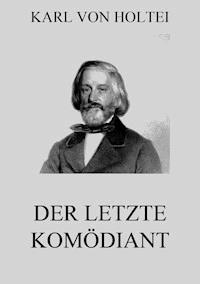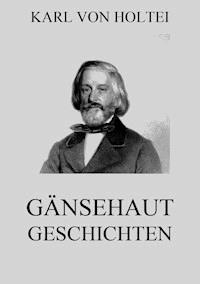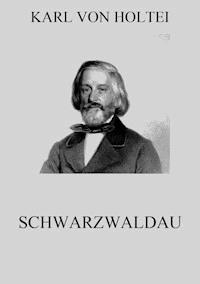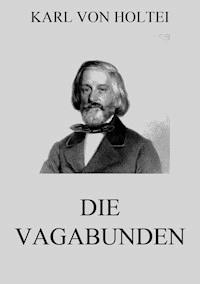
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman aus der Welt der Schausteller und Schauspieler. In vier Bänden wird die Geschichte des Anton Hahn erzählt, der sich schon in jungen Jahren dieser Vagabunden-Welt verschreibt und immer wieder an seine Grenzen gelangt. Einer der erfolgreichsten Romane von Holteis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1020
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Vagabunden
Karl von Holtei
Inhalt:
Karl von Holtei – Biografie und Bibliografie
Die Vagabunden
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
Fünfundzwanzigstes Kapitel
Sechsundzwanzigstes Kapitel
Siebenundzwanzigstes Kapitel
Achtundzwanzigstes Kapitel
Neunundzwanzigstes Kapitel
Dreißigstes Kapitel
Einunddreißigstes Kapitel
Zweiunddreißigstes Kapitel
Dreiunddreißigstes Kapitel
Vierunddreißigstes Kapitel
Fünfunddreißigstes Kapitel
Sechsunddreißigstes Kapitel
Siebenunddreißigstes Kapitel
Achtunddreißigstes Kapitel
Neununddreißigstes Kapitel
Vierzigstes Kapitel
Einundvierzigstes Kapitel
Zweiundvierzigstes Kapitel
Dreiundvierzigstes Kapitel
Vierundvierzigstes Kapitel
Fünfundvierzigstes Kapitel
Sechsundvierzigstes Kapitel
Siebenundvierzigstes Kapitel
Achtundvierzigstes Kapitel
Neunundvierzigstes Kapitel
Fünfzigstes Kapitel
Einundfünfzigstes Kapitel
Zweiundfünfzigstes Kapitel
Dreiundfünfzigstes Kapitel
Vierundfünfzigstes Kapitel
Fünfundfünfzigstes Kapitel
Sechsundfünfzigstes Kapitel
Siebenundfünfzigstes Kapitel
Achtundfünfzigstes Kapitel
Neunundfünfzigstes Kapitel
Sechzigstes Kapitel
Einundsechzigstes Kapitel
Zweiundsechzigstes Kapitel
Dreiundsechzigstes Kapitel
Vierundsechzigstes Kapitel
Fünfundsechzigstes Kapitel
Sechsundsechzigstes Kapitel
Siebenundsechzigstes Kapitel
Achtundsechzigstes Kapitel
Neunundsechzigstes Kapitel
Siebzigstes Kapitel
Einundsiebzigstes Kapitel
Zweiundsiebzigstes Kapitel
Dreiundsiebzigstes Kapitel
Vierundsiebzigstes Kapitel
Fünfundsiebzigstes Kapitel
Sechsundsiebzigstes Kapitel
Siebenundsiebzigstes Kapitel
Achtundsiebzigstes Kapitel
Neunundsiebzigstes Kapitel
Achtzigstes Kapitel
Einundachtzigstes Kapitel
Nachschrift des Verfassers
Die Vagabunden, Karl von Holtei
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849638566
www.jazzybee-verlag.de
Karl von Holtei – Biografie und Bibliografie
Dichter und Schriftsteller, geb. 24. Jan. 1798 in Breslau, gest. daselbst 12. Febr. 1880, besuchte das Magdalenen-Gymnasium seiner Vaterstadt, gab aus Neigung zum Theater die akademische Laufbahn, für die er sich vorbereiten wollte, auf und debütierte 1819 als Mortimer in Schillers »Maria Stuart« auf der Breslauer Bühne. Schon 1821 entsagte er nach einem in Dresden erlebten Unfall der ausübenden Kunst wieder, heiratete die Schauspielerin Luise Rogée und wurde Theatersekretär und Theaterdichter in Breslau. 1823 siedelte er nach Berlin über, wo seine Frau am Hoftheater ein Engagement erhielt. H. verfaßte hier die mit größtem Beifall aufgenommenen Liederspiele: »Die Wiener in Berlin« und »Die Berliner in Wien« und gab auch »Gedichte« (Berl. 1826; 5. Aufl., Bresl. 1861) heraus. Für die Königsstädtische Bühne, der er sich nach dem frühen Tode seiner Gattin anschloss, lieferte er eine große Anzahl von Stücken, darunter die allbekannten: »Der alte Feldherr« und »Lenore«, die teils in den von H. herausgegebenen Bänden 8–10 des »Jahrbuches deutscher Bühnenspiele«, teils in seinen »Beiträgen für das Königsstädter Theater« (Wiesb. 1832, 2 Bde.) gedruckt erschienen. Gleichzeitig gab er die Sammlung »Schlesische Gedichte« (Berl. 1830, 21. Aufl. 1899) in schlesischer Mundart heraus und trat öffentlich als Vorleser klassischer Dramen (besonders Shakespeares) auf. Mit seiner zweiten Frau, Julie Holzbecher (s. unten), nahm er ein Engagement in Darmstadt an, kehrte aber 1830 nach Berlin zurück, schrieb hier: »Das Trauerspiel in Berlin«, in dem er den Berliner Jargon zu tragischen Zwecken benutzte, dichtete den Text zu Gläsers längere Zeit beliebter Oper »Des Adlers Horst« und schrieb das Schauspiel »Der dumme Peter«. Auch betrat er 1833 selbst wieder die Bühne und machte mit seiner Gattin eine Kunstreise, für die er unter anderem die Dramen: »Lorbeerbaum und Bettelstab« und »Shakespeare in der Heimat« (beide Schleusingen 1840) schrieb. Seit 1837 führte er die Direktion des Rigaer Theaters, legte sie aber nach dem Tode seiner zweiten Gattin (1839) nieder und trat von neuem ein Wanderleben durch Norddeutschland an, bis er die Direktion des Theaters in Breslau übernahm. In dieser Zeit ließ er außer seinen »Briefen aus und nach Grafenort« (Altona 1841) und dem autobiographischen Werk »Vierzig Jahre« (Berl. 1843–50, 8 Bde.; 4. Aufl. von Max Grube, Bresl. 1898, 2 Bde.). dem sich später als Anhang »Noch ein Jahr in Schlesien« (Berl. 1864, 2 Bde.) anschloss, seine dramatischen Werke in einem Band als »Theater« (Bresl. 1845; Ausg. letzter Hand, das. 1867, 6 Bde.) erscheinen. Seit 1850 lebte er abwechselnd in verschiedenen deutschen Städten, längere Jahre in Graz, zuletzt wieder in Breslau, wo er im Kloster der Barmherzigen Brüder starb. Zwei Jahre nach seinem Tode wurde ihm auf der sogen. Ziegelbastion daselbst (jetzt Holteihöhe genannt) ein Denkmal errichtet, ein andres (bronzenes Relief) 1902 auf der »Holteihöhe« am Kirschberg bei Obornigk. Außer den genannten Schriften hat H. auch eine Reihe von Romanen geschrieben, wie: »Die Vagabunden« (Bresl. 1851, 4 Bde.; 8. Aufl. 1894), »Christian Lammfell« (das. 1853, 5 Bde.; 4. Aufl. 1878), »Die Eselsfresser« (das. 1860, 3 Bde.), »Noblesse oblige« (Prag 1857), »Ein Schneider« (Bresl. 1854, 3 Bde.; 2. Aufl. 1858), »Ein Mord in Riga« (Prag 1855), »Schwarzwaldau« (das. 1856), »Haus Treustein« (Bresl. 1866, 3 Tle.), »Der letzte Komödiant« (das. 1863) u. a., die sämtlich in seinen »Erzählenden Schriften« (das. 1861–66, 39 Bde.) gesammelt erschienen. Diese Romane entbehren nicht liebenswürdiger Züge, leiden aber an Lockerheit der Komposition und Flüchtigkeit der Darstellung. Dagegen gebührt H. das unbestreitbare Verdienst, das Vaudeville in Form des deutschen gemütlichen Liederspiels in Deutschland eingebürgert zu haben. Viele seiner Lieder, von denen er u. d. T.: »Deutsche Lieder« (Schleusing. 1834, 2. Aufl. 1836) eine Sammlung herausgab, sind volkstümlich geworden. Auch die »Schlesischen Gedichte«, deren Wert man erst in neuerer Zeit erkannte, müssen als eine der schönsten Gaben der Holteischen Muse betrachtet werden. Der Krieg 1870/71 begeisterte den greifen Dichter zu einer Sammlung seiner »Königslieder« (Berl. 1870, 3. Ausg. 1878). Außerdem nennen wir von seinen Veröffentlichungen der letzten Zeit: »Charpie« (Bresl. 1866, 2 Bde.); »Nachlese. Erzählungen und Plaudereien« (das. 1871, 3 Bde.); »An Grabes Rande. Blätter und Blumen« (2. Ausg. 1876) und »Fürstbischof und Vagabund« (das. 1882), worin H. sein Verhältnis zum Fürstbischof Förster schildert. Auch gab er in den letzten Jahren aus seinen Autographenschätzen mehrere Sammlungen von Briefen heraus. Zu seinem 100. Geburtstag veröffentlichte Nentwig aus der Schaffgotschschen Bibliothek Holteis 1818 geschriebene »Reise ins Riesengebirge« (Warmbr. 1898). Vgl. »Karl v. H., Biographie« (Prag 1857); Kurnik, Karl v. H., ein Lebensbild (Bresl. 1880); F. Wehl, Zeit u. Menschen (Altona 1889); O. Storch, Karl v. H. (Waldenb. 1898); Lindau, K. v. Holteis Romane (Leipz. 1904). – Holteis erste Gattin, Luise, geborene Rogée, geb. um 1800, betrat zuerst 1820 die Breslauer Bühne und starb als Mitglied des königlichen Theaters in Berlin 1825. Sie war in naiven und sentimentalen Rollen, besonders als Käthchen von Heilbronn, ausgezeichnet. H. feierte sie durch eine Sammlung von Gedichten: »Blumen auf das Grab der Schauspielerin H.« Seine zweite Gattin, Julie, geborene Holzbecher, geb. 1809 in Berlin, seit 1823 Mitglied des Königsstädter Theaters daselbst, 1830 des Theaters in Darmstadt, kehrte 1831 nach Berlin zurück und starb 1839 in Riga. Sie war im Lustspiel, namentlich in Berliner Lokalstücken, durch Keckheit und Anmut bezaubernd.
Die Vagabunden
Erstes Kapitel
Die Linden standen in voller Blüte. Vor der Tür ihrer kleinen Hütte saß auf einem zerbrochenen umgestürzten Korbe die alte Mutter Goksch zwischen zwei Misthaufen, vor sich ein Gärtchen voll blühender Blumen. Mit sichtlicher Vorliebe wendete sie einmal ums andere Mal ihren matten Blick dem Dünger zu; der Blumen achtete sie wenig, weil sie ihnen jenen Raum nicht gönnte, wo nach ihrer Meinung Kartoffeln wachsen sollten. Sieht man doch gleich, murmelte sie vor sich hin, daß der Junge eines Vornehmen Kind ist: Immer denkt er auf Putz und Schmuck, und die Großmutter mag zusehen, wo sie Futter hernimmt für ihn wie für sich selbst. Und wo er nun wieder bleibt? Die Sonne wird bald zur Rüste gehen, aber er treibt sich noch im Walde herum. Und wenn er kommt, kann ich nicht einmal mit ihm zanken, ob ich schon möchte, weil er so große dunkelblaue Augen hat wie seine verstorbene Mutter. Sobald er mich mit diesen Augen anschaut, stirbt mir jedes ernste Wort auf den Lippen. Er macht mit mir, was er will. Haben ihn doch auch alle Menschen gern: Der Baron, der alte Bär, und die Fräulein und der Pastor und der Schulmeister. Ganz Liebenau ist vernarrt in den Anton. Ihm sehen sie alles nach. Eh' sie ihre Körbe zum alten Korbmacher tragen, der gewiß ein gutes Stück Arbeit macht und rasch, bringen sie lieber ihren Kram hier ans Ende des Dorfes zu meinem Jungen und warten wochenlang geduldig, bis es ihm gefällig ist, daran zu gehen. Nu freilich, wohlerzogener ist er, als die dummen Dorflümmel. Seine Sprache schon ist nicht so rauh und grob, weil er von Kindheit an mich reden hörte, und mir klebt immer noch mein Stadtleben an; das kann mir niemand abstreiten. War ich doch auch einmal jung; jung – und schön, wie meine unglückliche Tochter!
Bei diesen Worten füllten sich die Augen der Mutter Goksch mit Tränen und ein leises Schluchzen erstickte den Lauf ihres Selbstgespräches. Beide Hände drückte sie fest vor ihr welkes Angesicht, um sich recht ungestört dem Grame hinzugeben. Doch nicht lange blieb sie ihm überlassen. Anton, der leise zu ihr hingeschlichen war, zog ihr die Hände vom Haupte und fragte freundlich: »Großmutterle, warum flennst du?« Da umschlang die gute Frau den schönen Jungen mit beiden Armen, und aus den Zähren einsamen Schmerzes wurden Tränen des liebevollsten Mitgefühls. Zärtlich schmeichelnd strich Anton mit seinen dünnen Fingern über Stirn und Wangen der Mutter Goksch. »Gewiß«, sprach er, »du bist noch immer eine hübsche Frau, Großmama, wenn man dir nur die Runzeln wegstreichelt und dein Gesicht ein wenig glatt macht. Auf den Sonntag werde ich dich mit Johanniswasser einsprengen, und hernach werde ich das kleine Plätteisen nehmen und dich gehörig ausbügeln; dann kannst du schmuck zur Kirche gehen und wirst unserm Herrn Pastor gegenüber sitzen, frisch und sauber, wie ein neu ausgeputztes Haus, wo sie daran geschrieben haben:renovatum anno Dominiso und so viel; drei rote Kreuze darunter. Wenn du nur um alles in der Welt nicht so viel weinen wolltest, wie ich den Rücken kehre; dann wär's noch besser; denn die Tränen haben dir schon Furchen gebissen in beide Wangen, gerade wie der Regen in unseren Dachgiebel, so gegen Abend steht. Sei doch vernünftig, Alte, und mach' mir nicht so viel Verdruß. Ich kann doch nicht den ganzen Tag bei dir sitzen, um acht zu geben auf dich und dir vorzusingen, wie einem kleinen Kinde! Mit sechzig bis siebzig Jahren könntest du schon genug Verstand haben, um manchmal ein Stündchen ohne Aufsicht zu bleiben! Und wenn du nicht gut tust, werde ich dir eine derbe Rute flechten, so wahr ich Anton heiße und ein berühmter Korbmacher in Liebenau bin.«
Da lachte die Mutter Goksch über sein albernes Geplauder, daß ihr beinahe wieder die Tränen über beide Backen gelaufen wären, und kichernd rief sie: »Ach, wenn deine Mutter dich so sehn könnte!« Aber kaum hatte sie's gesagt, als sie wirklich zu weinen anfing, diesmal jedoch so innig und sanft, daß der ehrliche Anton ein bißchen mitweinte; denn das geschah ihm jedesmal, wenn seiner Mutter gedacht wurde, deren er sich aus den ersten Monden seiner Kindheit zu erinnern wähnte, wie eines glänzenden Traums. Augenblicklich ließ er von seinen Scherzen ab. Mit feierlichem Ernst setzte er sich auf den Boden, der Großmutter zu Füßen, und sein tiefes Auge fest nach ihr gewendet fragte er in rührendem Tone: »Nicht wahr, ich sehe ihr gleich?«
»Nur allzusehr«, erwiderte die Großmutter.
Anton schwieg ein Weilchen, dann begann er: »Das ist wieder eines von den dunklen, unverständlichen Worten, wie sie dir oft entschlüpfen, Alte, gleichsam gegen deinen Willen. Sie ängstigen mich, diese Worte. Siehst du, das muß ein Ende nehmen. Ich will wissen, was es mit meiner seligen Mutter war; will wissen, wer mein Vater gewesen, was aus beiden geworden, und wie du in diese Hütte verschlagen worden bist! Ich habe ein Recht dazu, Großmutter! Ich bin kein Kind mehr. Am vorletzten Osterfeste schon hat mich unser Herr Pastor konfirmiert und hat mich samt der ganzen Gemeinde zum Tische des Herrn gehen lassen; – jetzt bin ich siebzehn vorbei; – und hat damals gesagt, ich wäre reifer und würdiger dazu, als alle Jungen im Dorfe, die um ein Jahr älter sind. Folglich kannst du mit mir reden, wie mit einem Erwachsenen. Das weißt du auch recht gut. Also könntest du billig ein Ende machen und mich heute wissen lassen, was ich über kurz oder lang doch erfahren muß.«
»Wie gescheit der Junge seine Reden setzt«, murmelte die Mutter Goksch, indem sie ihm die reichen Locken von der Stirn schob. Sie betrachtete ihn lange, wie wenn sie überlegte, ob sie seinen Wunsch erfüllen dürfe. Dann aber sprach sie plötzlich: »Nein, Anton, es geht nicht. Es kommen Dinge vor in dieser traurigen Geschichte, die für dich noch zu früh sind. Sage, was du willst, du bist ja doch nur ein Kind.«
»Meinst du, Großmutter«, wendete Anton dagegen ein, »meinst du wirklich? Ich weiß mehr, als du denken magst, vom Leben und von den Menschen. Wer, wie ich, auf eigene Hand aufgewachsen ist, immer unter dem Landvolk sich herumtrieb, alles hörte, alles beobachtete, schon als kleiner Knabe denken und vergleichen lernte, der ist in meinen Jahren ein Mann. Erzähle mir, was du willst, ich werde dich verstehen – und ich werde dazu schweigen, wenn es nötig ist.«
Unschlüssig staunte die Alte ihren Enkel an, den sie noch niemals so entschieden sprechen gehört, und zweifelnd schüttelte sie den Kopf, indem sie vor sich hinflüsterte: »Werden denn in dieser Zeit die Kinder schon so früh mündig?«
Da ertönte vom kleinen Kirchturme die Abendglocke. Wehmütig zitterten sanfte Klänge auf lauem Winde getragen über das bemooste Strohdach und verloren sich tief im kaum hörbaren Widerhall des Kiefernwaldes, der die letzten Häuslein dieses Dorfes fast berührte. Anton nahm seine Kappe ab. Die Alte lispelte ein frommes Verslein. Und als sie fertig war mit ihrem kurzen Gebet, sagte Anton: »Nun, Großmutter, beginne! Mir ist ums Herz, als hätten sie mit diesem Glockenzuge meine Mutter ins Grab gelegt. Laß mich wissen, wo der Hügel grünt, auf dem ich knien darf, wenn ich mit ihr sprechen will.«
Und die Mutter Goksch hub an:
Zweites Kapitel
»Dein Großvater, Anton, mein guter, seliger Mann, war Kantor und Schulrektor in N. Na, das weißt du. Davon hab' ich dir schon oft genug erzählt, von unserem hübschen, grünumlaubten Häuschen hinter der Kirche, und wie er mich heimführte als junge, schmucke Braut. Des Herrn Amtsdieners Tonel haben sie mich geheißen; denn mein Vater selig war Amtsdiener beim hohen Rat. Aber wie ich Hochzeit machte, war er schon lange tot, und meine Mutter folgte ihm bald nach meiner Verheiratung, so daß ich die Flitterwochen hindurch schwarz einhergehen mußte wie eine Amsel. Das hast du alles schon gehört, Anton, ich kann dir es aber jetzt nicht schenken, denn mein Kopf ist gar schwächlich, und wenn ich nicht die ganze Geschichte vom Anfang anfange, bring' ich sie gar nicht zustande. Aber wo blieb ich denn?« –
»Bei der Amsel, Großmutter!«
»Richtig. So schwarz wie eine Amsel mußt' ich einhergehen. Und samt meiner Trauerkleidung kam ich ins Wochenbett mit einem kleinen Anton. Der machte aber nicht lange, so war er hin. Der arme kleine Kerl konnte die Tränen nicht verwinden, die ich um meine Mutter so gern geweint hätte, die ich aber verschlucken mußte, weil dein Großvater zornig ward, wenn er mich weinen sah. Ich hab' das Kind meiner Mutter zu Füßen gelegt. Ich dachte in meiner Einfalt, damit sie gleich einen Engel als Boten bei der Hand haben sollte, wenn sie vielleicht einmal Luft hätte, mir einen Gruß zu schicken aus ihrem Grabe oder sonst etwas. Es hat sich jedoch nichts eingestellt. Mein zweites Kind – lange nachher – war ein Mädel. Das war deine Mutter, Anton! Antonie haben mir sie genannt. Das heißt dein Großvater rief sie Antoinette. Und da wurde zuletzt Nette daraus, und unsere Nachbarn meinten, der Name käme daher, daß sie so nett und sauber war. Denn sie wuchs auf in purer Schönheit, daß jeder stehen blieb und ihr nachstaunte, der ihr begegnete. Ich sah ihre Schönheit auch und ihre Klugheit und Anmut, o ja, ich sah alles, denn, mein Gott, wofür wäre ich denn ihre leibliche Mutter gewesen? Daneben jedoch sah ich auch ihre Fehler: Ihren leichten Sinn, ihre Eitelkeit! Dein Großvater wollte davon nichts spüren; der hob nur die Tugenden heraus. Und als sie gar zu singen anfing, und als sie sämtliche Schulkinder mit ihrer kräftigen, reinen Stimme besiegte, da war's gar aus, da kannte mein guter Mann nichts über seine Nette! Ja, wenn unser Herrgott die himmlischen Heerscharen herabgesendet hätte, daß sie vor meinem Manne musizieren müßten und singen, der hätte, glaube ich, geradezu gesagt: Sobald mein Nettel nicht mitsingt, will die ganze Musik nichts heißen. So war er. Freilich, himmlisch gesungen hat sie, das muß ich selbst eingestehen; mit vierzehn Jahren stand sie dir da, Anton, wie eine vollkommene Jungfrau, und wenn sie den kleinen Mund auftat und ihre Zähne wies, und die Stimme drang heraus, da ging es einem wohl durch alle Gliedmaßen. Ich fühlte es ebenso warm, wie dein Großvater; nur hätt' er's ihr nicht immer sagen sollen. Da wurde denn einmal ein großes Fest veranstaltet in G., was sie ein Musikfest nannten. Dazu haben sie von weit und breit aus dem ganzen Lande zusammenberufen, was streichen konnte und blasen und singen und schreien und Pauken schlagen. Wie die Ameisen sind die Musikusse über die Berge gekrochen, durch die Täler, aus allen Winkeln und Ecken, daß es nur so wimmelte! Natürlich war mein Mann auch dabei mit seiner Geige – und ohne Nette wär's ja durchaus nicht gegangen. Sie führten auf, wie die Welt geschaffen worden ist. Die Schöpfung nannten sie's. Das kam mir schon sündhaft vor. Noch sündhafter hielt ich es, daß dein Großvater als christlicher Schulmann, der er doch einmal sein sollte, sich nicht schämte, so viel Aufhebens zu machen von der Heidnischen Musik. Denn heidnisch war sie. Das hab' ich ihn und seine Musikfreunde sagen hören. Ein Heide, sagten sie, hätte das eben erst in der großen Wienstadt geschrieben. Da entblödeten sie sich nicht, in einem weg von göttlichen heidnischen Melodien zu sprechen. Schrecklich! Aber ich mußte wohl schweigen. Doch die Strafe blieb nicht aus. Von diesem gotteslästerlichen Musikfeste schreibt sich unser Elend her. Deine Mutter hatte die sündhafte Eva vorstellen müssen, so erzählte sie mir's, als sie zurückkehrten. Mitzuziehen hatte ich mich redlich gehütet. Ja, die Eva hat das unschuldige Mädchen vor aller Augen machen müssen, und gesungen hat sie Liebeslieder mit Adam, der niemand anders gewesen sein soll, als ein Opernsänger aus der Hauptstadt. Ob die Schlange auch vorgekommen sei, das hab' ich niemalen aus der Antoinette ihren Erzählungen herausbringen können. An anderem Vieh hat es nicht gefehlt. Zum Glück haben die Sänger wenigstens ihre Kleidung nicht ablegen dürfen. Sonst war alles wie beim Sündenfall. Ach, mein lieber Anton, hatte dein Großvater bisher mit seiner Nette Abgötterei getrieben, jetzt fand er gar keine Grenzen mehr. Die Lobsprüche, die sie von hoch und niedrig erhalten, hatte er eingesackt und sich völlig damit ausgepolstert, daß er selber aufgeblähter war wie ein welscher Hahn, den die Köchin mit gebratenen Kastanien stopfte. Einen güldenen Ring ließ er ihr machen für drei schwere Dukaten, und auf einem Plättchen stand eingegraben: »Eva«. Den Ring mußte sie tragen, als ob sie eine Dame wäre. Das gab ihr den letzten Gnadenstoß. Wenn ich ihr eine häusliche Arbeit auftrug, ließ sie nur ihren Ring im Lichte glitzern und setzte sich ans Klavizimbalo. O Anton, da war sie so lieblich und schüttelte mit den dunklen Locken herum, daß die allerhöchsten Noten herauspfiffen aus dem Perlenmunde, als ob's Wasserköpfen wären, die an der Sonne funkeln. Und da war die törichte Mutter wieder still, schaffte selbst im Hause und horchte auf ihres Kindes Gesang.
Unterdessen waren die Husaren, die sonst in G. gelegen, zu uns nach N. ins Quartier gekommen. Schon wie sie einrückten, und wie ihre Trompeten über den Platz schmetterten, daß es bis in unseren stillen Kirchhof drang, spürt' ich an Nettens Betragen, die Sachen wären nicht in der Ordnung. Sie war wie ausgetauscht, unruhig, niedergeschlagen, dann wieder auf einmal übermütig, wild, lustig. Der Alte gab nichts auf meine Mahnungen. So sind halt die Künstlernaturen, sprach er. Sie ist eine echte Künstlernatur! Was er damit sagen wollte, hab' ich nicht entdecken können. Mir war's zu hoch.
Da hatte denn deine Mutter Freundschaft geschlossen mit einem Mädel ihres Alters, der Tochter eines Steinmetzgers oder Bildhauers, wie er sich nannte, der unten am Fuße der hohen steinernen Brücke ein Häuschen bewohnte; ein dürftig hölzernes Ding von Gebäude. Ging unser Bergflüßchen nur ein bissel voll, so leckten die Wellen an des Mannes Besitztum, und wär' es nicht von Steinen, Grabkreuzen und plumpen Heiligen beschwert worden, mir scheint, das Gewässer hätt' es längst fortgeschwemmt. Mit der besagten Bildhauers Christel hatte unsere Antoinette Freundschaft geschlossen, und sie besuchten sich. Mir gefiel der Umgang nicht. Erstens wollte sich's doch nicht recht schicken, daß des Lutherschen Kantors Kind tagaus, tagein bei den katholischen Leuten steckte, die da lauter steinerne Götzenbilder um sich hatten. Und dann überhaupt war mir so weh, wie wenn mir Unheil schwante. Wie gesagt, so geschehn. Eines Abends komm' ich über die Brücke, von Neudorf herein, wo ich eine meinige Muhme besucht hatte, und mitten auf der Brücke, da sie sich am höchsten wölbt, und ich vom Steigen müde bin, rast' ich einen Augenblick aus, schau' mich um nach den grünen Bergen im Abendrot – fällt mein Blick hinab auf Bildhauers Häuschen – und siehst du, Anton, du magst mir's nun glauben oder nicht, jetzt noch, wo ich dir's beschreibe, fühl' ich den Stoß, den mir's damals ins Herz getan! – Ich schau' hinab und sehe einen Kornett von den Husaren, ein Bürschlein, nicht älter als du heute bist, schlank wie eine Tanne, aus Bildhauers Türe treten; der dreht sich fast den Kopf aus den Schultern und starrt empor nach der Brücke, wo ich stehe. Sowie er meiner ansichtig wird, macht er links um und husch ist er im Hause wieder drin. Mir brachen schier die Knie zusammen unter meines Leibes Last, und ich mußte das letzte Restchen Kraft aufbieten, um weiter zu gehn. Wird sie zu Hause sein? Das war der einzige Gedanke, den ich fassen konnte. Er kam mir auf die Zunge. Schritt vor Schritt sprach ich weiter nichts als: heiliger Gott, wird sie zu Hause sein? Denn war sie nicht daheim, dann war sie zu Bildhauers gegangen, und dann wußt' ich, woran ich war. So bieg' ich dir um die Ecke, ins kleine Gäßchen ein, das nach dem Kirchhofe führt, und eilig, wie ich bin in meiner Todesangst, renn' ich an ein Frauenzimmer an, das verblüfft vor mir stehen bleibt: es war meine Tochter! »Wohin so spät, Antoinette?« ruf' ich ihr heftig ins Gesicht; und sie, rot wie ein gekochter Krebs, stammelte nur: »dir entgegen, Mutter.« »Na, so komm'«, sprech' ich und reiße sie mit mir fort und halte sie so fest am Arme, als ob die ganze Schwadron am anderen Arme zöge! Der Vater war zu Biere gegangen. Ich hatte sie allein, nahm sie heftig ins Gebet. Doch sie hielt sich standhaft; sie leugnete mit Festigkeit – und ich ließ mich täuschen. Ließ mich täuschen, weil ich bei der schärfsten Aufmerksamkeit, von diesem Abend an zu rechnen, nichts mehr wahrnehmen konnte, was meinen Argwohn erneuert hätte. Im Herbst war ich vollkommen beruhigt; um so mehr, weil die Husaren schon wieder in andere Garnison gerückt waren. So, daß ich mich entschloß, wieder einmal die Neudorfer Muhme heimzusuchen; ich hatte das nicht getan, seitdem mir der Weg über die Brücke durch den Kornett im Bildhauerhäuschen verdorben ward. Nun denke dir meine Verwunderung, Anton, wie ich nach dem Häuschen suche und find' es nicht mehr, sondern an seiner Statt entdeck' ich ein neues, größeres, von Mauerziegeln fest errichtet, mit Schieferplatten eingedeckt; das war über Sommer emporgewachsen. Und wo hatte der hungrige Bildhauer das Geld dazu hergenommen? Du meinst, dies wär' seine Sache gewesen und hätt' ich nichts danach zu fragen gehabt. Gewissermaßen wohl. Doch aber meldete sich in meinem Herzen eine drohende Stimme, die mir den Besuch bei der Neudorfer Muhme wieder leid machte. Ich drehte auf dem Flecke um, ging nach Hause. Mir war, als wenn ein böser Geist mir zuraunte: Das Haus ist auf deiner Tochter Schande gebaut! – Zittre nicht, armer Junge, bald kommt's noch schlimmer! – Und wie ein böser Geist keinmal allein bleibt, trat alsogleich ein zweiter an mich heran: die Frau Torschreiberin nämlich; das war ein schlimmes Weib, Gott mög' ihr ewige Ruhe vergönnen. Die fing zu schnattern an, wie es ihr Brauch, redete vom Hundertsten ins Tausendste, von der Schule, von meinem kleinen Garnhandel, von der Musik, von den Husaren, und ob unsere Nettel sich denn getröstet habe über den Ausmarsch der Eskadron? Der Himmel gab mir Kraft, dem häßlichen Weibe nicht zu zeigen, wie scharf ihrer Zunge Stachel in mein wundes Herz drang. Ich hielt mich aufrecht und lachte ihr in die Nase, daß es fast lustig klang. Dann ging ich meiner Wege. Wie ich aber in unser Haus, wie ich in deiner Mutter Kammer geraten bin, das kann ich dir nicht beschreiben, Anton, denn ich weiß es nicht. Ich weiß nur, daß sie auf ihrem Bette saß und den Kopf hängen ließ. »Antonie«, schrie ich sie an, so laut als der Krampf, der mir die Kehle zuschnürte, mich schreien ließ, »was soll das heißen, daß fremde Weiber mich befragen nach deinem Schmerz über den Ausmarsch der Husaren? Und daß du seit acht Tagen vergehst und verkommst wie eine Blume ohne Regen? Und daß die vermaledeiten Bildhauersleute ein neues stolzes Haus auferbauen? Antonie, hast du das Sündengeld gezahlt? Ich frage dich, ich, deine Mutter.«
Da hättest du sie sehen müssen, Anton, wie sie sich emporrichtete und vor mir stand, um eine Hand höher wie gewöhnlich. »Schreie nicht, Mutter, du tust mir wehe«, sprach sie. »Du sollst die Wahrheit vernehmen, auch ohne daß du mir drohst. Länger hätte ich ohnedies nicht geschwiegen. Gehen wir hinab zum Vater! auch er muß wissen, wie es mit seinem einzigen Kinde steht.«
So schritt sie mir voran, ungebeugt und mächtig, das sechzehnjährige Mädchen, als ob sie die Anklägerin wäre, und ich folgte ihr bebend, wie wenn ich ein schlechtes Gewissen hätte. Sie war halt gar zu schön; man konnte sie nicht sehen ohne Entzücken.
Dein Großvater saß bei seiner Notenschrift. Sie winkte ihm die dicke Schwanenfeder aus der Hand, gleichsam als ob sie ihm befehlen wollte, zu hören. Und nun begann sie: Bei dem großen Musikfeste hatte sie den jungen Grafen zum erstenmal gesehen. Unsere Augen, so drückte sie sich aus, haben sich begegnet und unsere Herzen haben sich gefunden. Dann fuhr sie fort, zu schildern, wie sein Bild nicht mehr aus ihrem Gedächtnis wich. Später zogen die Truppen hier ein. Guido fand Gelegenheit, sie anzureden. Bei Bildhauers trafen sie sich. Nachdem ich jene unselige Entdeckung gemacht, daß der junge Mann dort verkehrte, wurden sie vorsichtiger. Sie mieden sich bei Tageslicht. Aber ach, die Nächte brachte sie jenseits der Brücke zu. Wenn der Vater und ich im tiefen Schlummer lagen, schlich die Verführte ins Haus der Kupplerfamilie.
Ich vermag dir nicht zu wiederholen, Anton, wie sie das alles vorbrachte. War es doch nicht anders, wie wenn sie in ihrem vollen Rechte wäre, und wir hatten das Zuhören. Endlich zog sie einen Brief hervor, den ihr Graf zum Abschied an sie geschrieben. Da stand es mit deutlichen Worten, daß er sie verehre, daß er sie lieben werde sein lebelang, daß er sie als Braut betrachte, und daß er nur der Eltern Einwilligung abschmeicheln wolle, um die Schönste heimzuführen auf seine Herrschaft und sie glücklich zu machen.
Wir hörten, wir lasen, wir standen da verdutzt und stumm. Ich war ja von jeher eine dumme, unerfahrene Person, und dein Großvater, die beste Seele von einem Manne, mußte nichts von falschen Menschen. Ja, wenn's falsche Noten gewesen mären! Kurzum, aus dem Jammer wurde ein Freudenfest: Wir weinten, wir versöhnten uns, wir umarmten die Braut mit feurigen Glückwünschen und gelobten uns, gegenseitig zu schweigen über die Sache und zu harren, bis es an der Zeit sei, unser Schweigen zu brechen und die Nettel Frau Gräfin zu nennen.
Aber du kannst mir's glauben, Anton, trotz meiner Dummheit war ich bei allem Jubel klug genug, einzusehen, daß deine Mutter sich nur glücklich stellte; daß sie versuchte, sich selbst zu täuschen, weil sie uns täuschen wollte. Sie glaubte nicht an ihre Zukunft. Mein Mann war von uns dreien der einzige, dem es rechter Ernst war mit seiner Hoffnung. Sonst gingen die Tage trüb und traurig hin, wie der finstre Spätherbst, in dem wir lebten. Nette sang wenig mehr. Sie sagte, es fiele ihr so schwer. Nur wenn ein Brieflein vom Herzallerliebsten eintraf, atmete sie freier auf. Dann sang sie beim Vater unten, und er schwur darauf, prächtiger, voller hätt' ihre Stimme niemals geklungen. Von der Einwilligung seiner Eltern jedoch schrieben der Herr Graf nimmermehr nichts oder doch nur wie von einer vorsichtig zu behandelnden Angelegenheit.
Gegen Weihnachten wurde Antonie immer stiller, einsilbiger, zurückgezogener. Auch ihre Kleidung vernachlässigte sie, die sonst immer flink und sauber einhergegangen, daß alles an ihr knackte, mit einer Taille zum umspannen. Ihr Umschlagetuch über ihr dürftiges Hauskleid, anders erblickten wir sie nicht mehr; der Sonntagsstaat hing im Kasten. Den Verkehr mit Bildhauers Christel hatte sie längst schon abgeschnitten. Das war mir recht. Doch auch sonst vergönnte sie keiner Schulfreundin das Wort. Sie schien wie tot für alles, was ihre Liebe nicht betraf.
Der heilige Weihnachtsabend rückte heran. Von einer Stunde zur anderen meinte ich, der Postbote müsse eintreten und müsse heimlich gesendete Gaben bringen, mit denen der junge Graf seine traurige Braut aus der Ferne bedenke. – Vergebens! Wir hatten einen Christbaum besorgt und ihn aus unserer Armut mit bescheidenen Geschenken aufgeputzt, so gut mir's vermochten.
Da stehen wir um die Dunkelstunde in Vaters Zimmer, er und ich, bei geschlossenen Läden, stecken kleine Wachskerzen auf die Zweige, hängen Naschwerk daran und hantieren so stumm nebeneinander her. Endlich fragt dein Großvater: »Wie's wohl heut übers Jahr hier aussehen wird, Alte?« Ich raffe mich zusammen und spreche dreist: »Wie wird's denn aussehen, Alter? Gut!« »Hm«, sagte er wieder, »ob der Graf und die Nettel dann schon ein Paar sind?« Und wie er das sagt, vernehm' ich einen schneidenden Angstschrei aus Antoniens Gemach herabdringen, der mir kurzweg die Sprache verlegt. Der Alte hatte nichts gehört, denn er war schon lange taub für alles, was nicht Musik heißt. Da ruf' ich ihm ins Ohr: »Nun mach' und zünde die Lichtlein an; ich gehe hinauf, die Nettel holen!« Und ich gehe hinauf, Anton – nein! nein, ich kann nicht weiter – ...«
– »Großmutter, ich bitte dich, fahre fort!« –
»Nun denn, nach einer Stunde saßen dein Großvater und ich vor deiner Mutter Bett, die bleich darin lag, ein schmerzvoll-süßes Lächeln um ihren Mund. Im Arme, mein lieber Anton, hielt sie dich. Aber du warst sehr klein und schriest, wie wenn du am Spieße stecken tätest. Solches geschah am vierundzwanzigsten Dezember ...!
Vor Mutter und Vater hatte das hartnäckige Mädel ihren Zustand zu verbergen gewußt. Was jetzt erfolgt war, konnte und durfte natürlich nicht verborgen bleiben. Dein Großvater mußte gebührende Anzeige machen. Da war denn der Stab über die Kantorfamilie gebrochen, die Fahne der Schmach ward uns aufs Dach gesteckt und wehte wie ein durchlöcherter, schmutziger Fetzen im kalten Schneewinde, indessen anderer Orten die Weihnachtsfeiertage fröhlich begangen wurden. Es währte auch nicht lange, so hatte der Pastor Primarius es oben durchgesetzt, daß dein Großvater vom Amte gejagt wurde, weil, wie der Bratensack behauptete, die Schulkinder nicht mehr von einem harthörigen Lehrer unterrichtet werden könnten, der für die Schande seiner eigenen Tochter taub und blind gewesen wäre. Wir mußten ausziehen. Aus unserem heimlichen, warmen, grünumwachsenen Häuschen hinaus! Zum Glück, daß die Bäume dürr waren und winterkahl! Um Ostern zogen wir hinaus. Wir hatten weiße Ostern. Es war noch grimmig kalt. Draußen in der Wiesenauer Vorstadt fanden wir eine kleine Wohnung. In einem Zimmer hausete ich mit meinem armen, niedergebeugten Alten. Im anderen trieb deine Mutter ihr Wesen mit dir. Ach, wie sie sang, wie sie dich in ihren Armen wiegte. Mit schöneren Liedern ist kein Kaisersohn in Schlaf gesungen worden. Und der Großvater fand ebensoviel Freude daran, wie der kleine hilflose Enkel. Ihr beide habt gelächelt, Anton; ich hab' geweint: denn die Stimme war ja doch unser Unglück; sie hatte uns doch eigentlich ins Unglück gebracht.
Deines Herrn Vaters Briefe wurden immer rarer, und wenn etwa wieder einmal einer geschlichen kam, war der letzte gewöhnlich um etliche Wörter kürzer, als der vorletzte. Nette schwieg. Der Alte fragte nach nichts. Ich weinte. Ein ganzes Jahr hab' ich verweint, daneben fleißig meinen Garnhandel betrieben, und davon haben wir gelebt; davon und von den paar Kreuzern, die der Alte mit Notenschreiben erwarb.
Am nächsten Weihnachtsabend konntest du schon laufen, Anton; langtest schon mit kräftigen Händchen nach den Kerzen am Weihnachtsbaum. Dein Vater ließ nichts weiter von sich hören. Antonie schrieb wohl einige Male; sie bekam keine Antwort mehr. Sie verging so langsam in dem Maße, wie du zunahmst. Du warst ein starkes, blühendes Kind.
Es lag dazumal ein tiefer Schnee in unserer Gegend. Im Februar brach plötzlich Tauwetter herein mit heißen Winden und lauem Regen. Man mochte keinen Fuß vor die Tür stellen. Pocht es eines Abends bei uns an. »So spät?« spricht der Alte. »Ein Brief!« ruft deine Mutter und stürzt hinaus. Es war so. Der Briefträger hatte wirklich einen gebracht. Des Grafen Siegel, nicht seine Handschrift. Deine Mutter las ihn ruhig durch, zwei-, dreimal. Dann sagte sie: »Ich muß ein Sprung zu Bildhauers machen; hab' eine notwendige Bestellung.« »Jetzt, in der Nacht, bei dem Wetter?« frag' ich. »Ich muß«, sagte sie, legte dich auf ihr Bett, gab dir einen Kuß und nahm ihren Mantel um. Dann reichte sie mir und meinem Alten die Hand. »Du nimmst ja ordentlich Abschied?« sprach der. »Vielleicht bleib' ich über Nacht aus«, war ihre Antwort; »pflegt den Jungen!« – Weg war sie!
»So wett' ich doch, was einer will«, sagt' ich zu deinem Großvater, »der Graf ist hier und bestellt sie zum Gespräch.« »Desto besser«, meinte der Alte, »vielleicht führt's zu gutem Ende.«
Nun ja, freilich wohl, zum Ende hat es geführt.
Du schliefst so ruhig an meiner Seite, Anton, du wußtest von nichts. Dein Großvater schnarchte mit dem Tauwind um die Wette, der im Schornstein heulte. Ich schlief nicht. Bis Mitternacht lauscht' ich immer, ob nicht die Türe gehen, ob Nette nicht heimkehren würde. Sie kam nicht. Dann überließ ich mein Haupt den traurigen Gedanken, die darin ihr Wesen treiben wollten. Und als ich endlich gegen Morgen einschlief, sah ich im Traume nichts als Wasser; dickes, gelbes, trübes Wasser, daß ich meinem Gott dankte, wie mich der Tag erweckte. Nun sprach ich den Morgensegen, bereitete das Frühstück, räumte auf und wartete der Dinge, die da kommen sollten, doch in steter Todesangst. Mein Mann dagegen schien voll freudiger Zuversicht, und als er sich zu seinem Notenpapiere setzte, sagt' er lächelnd: vielleicht hat er sie gleich mit sich genommen zu seinen Eltern?
»Aber ihr Kind?« rief ich, auf dich weisend.
Das macht' ihn stumm und nachdenklich. Doch durch diese Äußerung war mir der Brief wiederum in den Sinn gekommen und war mir eingefallen, daß sie ihn in ihren Schubkasten gelegt. Ich holte ihn alsogleich heraus, nahm meine Brille – denn ich brauchte schon dazumal eine Brille – und las, Anton. Ach, ich weiß ihn auswendig, den gottverfluchten Brief. Er war nicht von ihm, nicht von deinem jungen Vater; von seiner Mutter war er geschrieben, von der alten Gräfin:
Wenn das liederliche Weibsbild, schrieb sie, welches meinen Sohn, da er noch ein unmündiger Knabe gewesen, listig verführet hat, nicht aufhört, ihn und uns mit ihren frechen Briefen zu belästigen, so werd' ich sie samt ihren ruchlosen Eltern und die ganze schlechte Wirtschaft in N. den Behörden zur strengsten Bestrafung anzeigen. Für den Bankert wird kein Heller mehr gezahlt, nachdem das Gesindel meinem Sohne schon bedeutende Summen zum Aufbau von Häusern abzuschwindeln gewußt. Dies ist das letzte Wort in dieser schmutzigen Angelegenheit.
So lautete ungefähr der Frau Gräfin liebreiche Zuschrift. Nun wurde mir augenblicklich klar, was deine Mutter so spät am Abend noch bei Bildhauers gewollt. Sie, die auch nicht das geringste Geschenk von ihrem Liebhaber angenommen, war empört über solche ungerechte Vorwürfe; war empört über die Habsucht der Bildhauerleute, die gewiß falsches Spiel gespielt und in Nettens Namen dem jungen Grafen das Geld abgebettelt hatten, womit sie sich aus ihrer eigenen Not gerissen. Das war mit Händen zu greifen: Deine Mutter wollte sie zu einem Geständnis zwingen; deshalb der nächtliche Besuch. Aber warum kehrte sie nicht zurück? Das blieb mir ein Rätsel. Hielt das schlechte Volk sie vielleicht mit Gewalt? Hatte man sie vielleicht eingesperrt, um sie durch Drohungen zum Schweigen zu bewegen?
Es litt mich nicht. Deinem Großvater schärft' ich ein, auf dich acht zu haben, und in des Heilands Namen begab ich mich auf den Weg, trotz Wind und Wetter. Ich mußte durchs Städtchen gehen, um aus unserer Vorstadt nach der Brücke zu kommen. Auf dem Wege fand ich alles in Alarm. Weiber standen vor den Türen und erzählten sich mit jammervollen Gebärden; Männer, Jungen rannten mit langen Stangen, mit Haken, mit Äxten bewaffnet durch die Gassen. Auf meine ängstlichen Fragen, was es doch gäbe, vernahm ich nur einen Ruf: Das Wasser! Das Wasser!
Und als ich nun die Brücke erreichte – bis oben hinauf, schier bis an die hohe Wölbung drängte sich die Flut, so gelb, so trübe, wie ich sie im Traume gesehen. Unten war alles ein Meer. So schnell war es über Nacht gewachsen, daß die Bewohner der Hütten am unteren Ufer kaum Zeit gefunden, ihr Leben zu retten. Die hölzernen Häuser schwammen stückweise auf dem Strome fort. Bildhauers Neubau war zusammengestürzt, von den Seinigen niemand gerettet, weil dies Haus am tiefsten gelegen. Christinens Leichnam spülte das Wasser eine Meile weiter hinab auf eine Wiese. Die übrigen wurden nicht gefunden, auch deine Mutter nicht, lieber Anton.«
Hier brach die alte Goksch ihre Erzählung ab. Sie konnte vor Schluchzen nicht weiter sprechen.
Anton hatte keine Tränen. Schweigend erhob er sich vom Boden, wo er gesessen, fiel seiner Großmutter um den Hals, drückte einen langen Kuß auf ihre welken Lippen. Dann gingen sie miteinander ins Häuschen, und ohne eine Schnitte Brot zu berühren, legten sie sich auf ihr reinliches Lager, während die Vögel auf den Bäumen ringsumher ihnen ein Abendlied zwitscherten.
Drittes Kapitel
Als am nächsten Morgen die alte Frau erwachte, fand sie ein Blatt Papier mit Stecknadeln an ihre Bettdecke geheftet, worauf in großen Lettern zu lesen stand:
»Liebe Großmutter, Anton ist hinaus in den Wald gegangen und wird vor Abend nicht zurückkehren. Mach' dir keine Sorge um mich. Die Einsamkeit soll mir gut tun. Morgen bin ich wieder fleißig bei meinen Körben.«
Wer ihn gesehen hätte, den guten Anton, als er beim ersten Schimmer des Tages von seinem schlaflosen Nachtlager emporsprang und kaum angekleidet das Weite suchte, der würde wahrlich in ihm den heiteren, fröhlichen Knaben von gestern kaum wiedererkannt haben. Die Geschichte von seiner Geburt und von dem geheimnisvollen Ende seiner Mutter schien ihn völlig umzuwandeln. Auf seinem sonst so freundlichen Angesicht lag ein Ausdruck von Zorn und Wut, wie man nur bei recht verwilderten, bösartigen Menschen wahrzunehmen pflegt. Im Herzen des kräftigen Jungen kämpften sichtbar heftige Entschlüsse, deren Widerstreit sich bisweilen in tief ausgestoßenen Seufzern oder in einzelnen abgerissenen Worten kundgab. Seine Hände waren krampfhaft zusammengeballt. Von Zeit zu Zeit streckte er sie drohend gen Himmel. Als er heftigen Schrittes den sogenannten »Fuchswinkel« erreichte, einen düsteren, unzugänglichen Platz im großen Walde, warf er sich, wie wenn er jetzt erst sicher vor jeder Begegnung mit einem menschlichen Wesen und seinem Grame nun ungestört überlassen sei, laut heulend zu Boden und begann das bunte Waldmoos um seine Lagerstätte her auszurupfen und zu zerstören. Eine ganze Nacht hindurch hatte er seinem Schmerze Gewalt angetan und sich männlich beherrscht, um die Großmutter nicht zu beunruhigen. Jetzt wußte er sich jeder Fessel entbunden und durfte sich austoben. Rasende Flüche, gegen jenen gerichtet, der ihm das Dasein gegeben, schäumten von Antons Munde. Eine Verwünschung drängte die andere. »Rache, Rache für meine Mutter!« So lauteten die letzten Worte, die er abgemattet und erschöpft hervorbringen konnte. Dann sank er bewußtlos in dumpfen Schlaf, der anfänglich ihm finstere, blutige Bilder zeigte, später jedoch sanftere Träume vor ihm aufsteigen ließ, daß die Fieberqual entwich und ein ruhiger, stärkender Schlummer über ihn sich ausbreitete.
Stunde für Stunde zog der schönste Sommertag um den Schläfer hin, der ihn in seinem Innern fühlte und durchlebte. Balsamische Düfte senkten sich von den hohen Tannen herab, daß er sie einatme und seine von Jammergeschrei wunde Brust ausheile. Er wußte, daß er schlief. Er empfand, daß der Schlaf ihn segnend abtrennte von den Leiden des Lebens. Deshalb gab er sich willig der süßen Lockung hin, die sommerlau auf ihm lag. Und da kam auch die Mutter. Sie neigte das Angesicht über ihn – aber es glänzte, daß er ihre Züge nicht sehen konnte – und lispelte ihm wie singend ins Ohr: »Habe Friede, mein Sohn!« Es war kein Traum mehr. Zu erwachen wähnte der Ärmste. Ihre langen Locken berührten seine Augenlider. Sehnsüchtig schlang er die Arme, sie zu umfangen – doch als er die Augen geöffnet, als er wirklich erwachte, leuchtete ein fremder Feuerblick ihm entgegen und an seiner Seite kniete ein in schlechte Lumpen gehüllter Bettler. Der schwarze Wolfgang war es, in der ganzen Gegend allzusehr bekannt und übel verschrien als Taugenichts und Umhertreiber.
»Was willst du von mir?« rief Anton dem Wolfgang zu. »Was verfolgst du mich hierher, wo ich Einsamkeit suchte? Soll man auch im dicken Walde keine Ruhe finden vor den Menschen.«
»Was haben dir denn die Menschen zuleide getan?« sagte Wolfgang. »Dir, der bei seiner Großmutter lebt im wohnlichen Hause; der sein Bett hat und seine Suppe? Im Winter seine warme Kleidung? Der sich redlich ernährt mit seiner Hände Arbeit? Was haben sie dir getan?«
»Hast du danach zu fragen?« erwiderte Anton mürrisch. »Geh' deiner Wege und laß mich hier liegen.«
»Ich will nicht!« war Wolfgangs trotzige Antwort. »Bei dir zu sein, bin ich dir nachgeschlichen und kauere an deiner Seite, so lange du schläfst, um dir die Bremsen zu verjagen, die dich stechen und deinen Schlaf stören wollten. Alle Menschen möcht' ich vergiften; lebendig schinden könnt' ich sie, wenn ich die Macht dazu hätte. Nur dich hab' ich lieb, Korbmacherjunge.«
»Wie komm' ich zu der Ausnahme?« fragte mit fast spöttischem Lächeln unser Anton, während er seinen Oberkörper zur Hälfte von dem bemoosten Erdboden auflichtete und, auf den linken Arm das Haupt gestützt, dieses dem schwarzen Wolfgang zuwandte.
»Das weißt du nicht mehr? Ich weiß es desto besser und will's dir wohl sagen. Vor einem Jahr, oder ist's noch länger, gingst du einmal mit den Töchtern eures rotnasigen, versoffenen Barons und mit des Pastors Söhnen ums Dorf herum gegen Abendzeit. Ich saß hinter einer Schlehdornhecke und sah euch kommen. Ich war voll von Bosheit und Hunger. Beim Pastor wie beim Gutsherrn hatten sie mich von der Tür gewiesen, und die älteste von den Schloßfräulein, die ihrem Vater so ähnlich sieht, schrie mir nach: »Hab' ich dir's nicht oft genug gesagt, nichtsnutziger Schlingel, du darfst die Woche nur einmal betteln!« Dumme Gans! Wenn sie mich überall auf Sonnabend bestellen nach ihrem armseligen, verschimmelten Stück Brot, wovon soll ich denn die andern Tage leben? Soll ich das verdorrte Zeug, woran sich jeder rechtschaffene Kettenhund die Zähne ausbeißt, auch noch lange mit herumschleppen? Wie gesagt, ich war voll von Bosheit, und wie ihr so bei den Hecken vorbeistricht und das häßliche Weibsbild seine Schnauze nach der Seite drehte, wo ich saß, da könnt' ich's nicht lassen, ich mußt' ihr einen Stein ins Gesicht werfen. Und der flog ihr so hübsch zwischen Nase und Maul, daß sie einen Satz machte wie eine Krähe, die angeschossen ist, und Zeter brüllte aus ihrem blutigen Schnabel. Ich wollte ausreißen, aber die Pastorjungen hatten mich entdeckt, holten mich ein und fielen über mich her; zwei über einen. Sie schlugen mich auf den Kopf und wo sie hintrafen mit ihren Knütteln, die, sie Schuljungenstöcke heißen oder Ziegenhainer. Da warfst du dich zwischen sie und mich, bedecktest mich mit deinem Leibe und batest, nun möcht' es genug sein; und wie sie immer wieder auf mich eindrangen, fingst du an, mit ihnen zu kämpfen, hieltest beide zurück, daß ich unterdessen entfliehen konnte. Seitdem lieb' ich dich, Anton, dich allein, wie ich sonst alle hasse.«
»Ich besinne mich jetzt«, sagte Anton; »es ist gerade ein Jahr her. Es war der letzte Spaziergang, zu dem sie mich abriefen. – Du bist in meinem Alter?«
»Ich glaube. Gewiß weiß ich's nicht.«
»Du weißt nicht? Kannst du nicht deine Eltern befragen?«
»Ich habe keine Eltern.«
»Auch nicht? Armer schwarzer Wolfgang! Aber doch Verwandte?«
»Niemand. Meine Mutter ist im Zuchthause gestorben, eh' ich sechs Jahre alt wurde. Mein Vater ward in Böhmen gehenkt.«
»Gott erbarm' sich, das ist ja schrecklich.«
»Warum denn schrecklich? Lustig ist's. Sie wissen nirgend, was sie mit mir anfangen sollen, weil ich nirgend eine Heimat habe. Ich bin hinterm Zaune auf die Welt gekommen, wie eine Katze. Neulich hat mich der Landdragoner festgenommen, hat mich an seines Pferdes Schwanz gebunden und hinein aufs Amt geliefert. Der Landrat lachte, wie er mich erkannte, und sprach: ›Was soll ich mit dem anfangen? Wohin ich ihn mit dem Schub schicke, wird er mir ewig wieder zurückgestellt; sie behalten ihn an keinem Orte, weil er an keinem Orte zu Hause ist. Es ist einmal unser Vagabunden laßt ihn laufen!‹ – ha, so lauf' ich nu!«
»Ach, wie unglücklich mußt du sein!« rief Anton, der seine teilnehmende Rührung kaum zurückdrängen konnte.
»Unglücklich? Daß ich nicht wüßte. Ich kenn's ja nicht anders. War's doch von jeher so mit mir beschaffen. Früher, eh' ich dich lieb hatte, war mir wohl manchmal, als ob ich's nicht aushielte. Seitdem du dich für mich hast prügeln lassen, weiß ich doch einen Menschen auf der Welt, an den ich denken mag, ohne daß mir die Lust in den Gliedern zuckt, ihm wehe zu tun oder einen Possen zu spielen. Bis dahin spürt' ich immer nur Haß, und das zehrt einem förmlich am Leben. Jetzt ist mir manchmal zumute, als ob ich auch ein Gefühl haben könnte, wie andere Leute. Und vorhin, wie du hier lagst und schliefst, und ich mich über dich bog und sah dich im Schlafe mit den Lippen zucken, als wolltest du lachen, da war mir eben, wie wenn ich weinen müßte. Aber es war mir gut dabei. So weich und gut, inwendig, verstehst du mich, ums Herz herum; siehst du, hier auf der Stelle.«
Bei diesen Worten ließ der Landstreicher sein grobes, sackleinenes Hemd von der sonnverbrannten Brust und zeigte dem staunenden Anton jenen Fleck, wo man des Herzens stürmischen Schlag wild gegen die Brust pochen sah, daß sie hoch emporbebte.
»Du mußt krank sein, Wolfgang«, rief Anton mitleidig aus, »so wütend hämmert keines gesunden Menschen Pulsschlag.«
»Den Teufel, mag ich nicht krank sein? Freilich bin ich krank. Ich komme aus dem Fieber gar nicht heraus. Aber wenn ich einen tüchtigen Schluck Kornbranntwein hinuntergießen kann, wird mir gleich wieder besser; dann bin ich stark wie der Gesündeste und nehm' es mit jedem auf. Jetzt sollten die Verfluchten Pastorjungen nur über mich herfallen, ich wollte sie zusammenhauen samt ihren Ziegenhainern!«
»Hast du Schnaps getrunken?« fragte Anton errötend; »heute, zum Sonntag?«
»Freilich, hab' ich, sonst wär' ich nicht so rüstig, und meine Augen täten nicht so brennen. Ein fremder Herr, der während der Kirche mit einer Kutsche in euer Dorf einfuhr, Postpferde vor den Wagen gespannt, hat mir einen Groschen zugeworfen. ›Nicht mehr?‹ schrie ich, nachdem ich die Münze aufgelesen, steckte dem geizigen Kerl die Zunge heraus, schickte ihm ein paar herzhafte Schimpfwörter auf den Weg nach und bin saufen gegangen.«
»Aber Wolfgang«, flüsterte Anton, »da bist du ja wirklich ein schlechter Mensch.«
»Das will ich ja sein«, rief jener trotzig. »Und wenn ich nur nicht immer krank wäre und nicht immer das ewige Fieber hätte, da wollt' ich schon noch viel schlechter sein! Soll ich etwa auch nicht? Weshalb sollt' ich's mit den Menschen gut meinen? Sind sie gut gegen mich? Von meiner Mutter hab' ich nichts als Fußtritte gehabt; meine Nahrung mußt' ich mir selbst zusammenbetteln oder stehlen; und dann nahm sie mir fort, was mir gehörte. Der Vater trieb sich mit Dirnen herum; sobald ich ihn um etwas bat, schlug er nach mir, gleichviel ob mit der Faust oder mit einem Stück Holz. Als sie ihn drüben aufgehenkt hatten, weil er einen Landjuden totgestochen und beraubt, bin ich von Tür zu Tür gekrochen und hab' gebeten, sie möchten mich aufnehmen, mir Brot geben; ich wollte für sie arbeiten. Zuerst, wenn sie mich neugierig betrachtet, zischelten sie untereinander: das ist ein schöner Junge! Wenn sie mich aber nach meiner Herkunft fragten, und ich sagte ihnen die Wahrheit, da schrien sie auf: ›Was? den Lohn eines Mörders ins Haus nehmen? Geh' an den Galgen zu deinem Herrn Papa!‹ Und sie hetzten mich mit Hunden. Damals wollt' ich gut tun: die Menschen wollten's nicht haben. Jetzt will ich nicht.«
»Du wirst dich aber zugrunde richten mit deinem häßlichen Saufen, du wirst immer kränker werden und in den schönsten Jugendjahren sterben«, sagte Anton.
»Weiß ich's nicht?« antwortete der Wolfgang, »begehr' ich denn was anderes? Auf dem Miste werd' ich sterben, am Feldwege, im nassen Graben. Desto besser! Wer jung stirbt, braucht alt nicht zu hängen wie mein Alter. Hu – – ich seh' ihn noch baumeln! Halb war ich ohnmächtig vor Grauen, und halb war ich lustig vor Freude, daß er mich nicht mehr prügeln würde. Schrecklich war's doch, und ich möchte nicht hängen! Blieb ich aber am Leben, so käm' ich in jedem Falle an den Galgen oder aufs Rad; das spür' ich. Also wie gesagt: besser, ich sterbe auf meine eigene Hand und durch mich allein. Das hab' ich dir jetzt gesagt, Anton: ich hab' dir gesagt, daß du der einzige bist, den ich nicht hasse, gegen den ich keine Wut fühle. Nun mußt du mir dafür versprechen, daß du mir die Augen zudrücken willst, wenn's aus mit mir wird. Willst du?
»Tust du doch«, sprach Anton gerührt, »als wüßtest du im voraus, wann dein Stündlein schlagen soll?«
»Beinah' weiß ich's auch. Und ich werde dich rufen, wenn es Zeit ist.«
»Mich rufen? Wenn du im Sterben lägest? Wie wolltest du das anfangen?«
»Das laß meine Sorge sein. Ich bin ein halber Zigeuner; kann ein bissel hexen. Du wirst gerufen werden – und damit gut. Jetzt leb' wohl. Ich geh' allein aus dem Walde, damit dich niemand mit mir reden sieht. Will dir die Schande nicht antun. Auf dem Schlosse möchten sie dir den Umgang mit mir übel anrechnen. Leb' wohl – bis zum Tode!«
Ehe noch Anton ein Wort der Entgegnung gefunden auf diesen gewaltsamen Abschied, war Wolfgang schon im dichten Gebüsch verschwunden. Unser junger Freund blieb sich und seinem Nachdenken überlassen. Er verglich sein Schicksal mit dem des unseligen Landstreichers und mußte zugeben, daß es, gegen jenes gehalten, ein beneidenswertes sei. Doch dann verglich er ihre Väter: »Wolfgangs Vater war ein roher, rauher Kerl, das ist richtig«, sagte er zu sich selbst. »Doch wird er es auch wohl von Kindheit auf nicht anders gesehen haben und gelernt, so wenig als sein armer Sohn. Folglich darf man von ihm nichts Besonderes verlangen. Mein Vater jedoch ist vornehmer Leute Kind und reich und ein gebildeter junger Herr gewesen und hat meine Mutter dennoch betrogen, im Stiche gelassen, in Tod und Verderben gestürzt. Wer ist nun schlechter? Der gemeine Herumtreiber, der den Sohn mißhandelt, wenn dieser ihm ungelegen kommt, oder mein eigener Vater, der niemals nach seinem Sohne fragt, so daß dieser sich nicht einmal rühmen darf, auch nur einen Schlag von der väterlichen Hand empfangen zu haben?«
Der Vergleich fiel nicht zu Graf Guidos Gunsten aus. Ja, wir wollen es eingestehen, Anton verirrte sich, von liebendem Bedauern für seine Mutter und von inniger Dankbarkeit für die Großmutter angetrieben, so weit in rachsüchtigem Grolle gegen den, der ihm das Dasein gegeben, daß er ihn im Geiste an den nächsten hohen Baum aufknüpfte und eine Minute hindurch mit schauerlichem Behagen den passendsten Platz für seinen armen Sünder aufsuchte. Doch hielt diese Verwilderung eines ursprünglich zarten Gemütes nicht lange an. »Weh' über mich«, rief er aus, »was sind das für schändliche Bilder? Wer weiß, wie oft der junge Mann doch an mich gedacht hat? Vielleicht konnte er damals nicht anders, in der Klemme zwischen Liebe und kindlichem Gehorsam? Und später hat er mich vergessen. Das ist natürlich. Er hält mich für tot, wie meine Mutter. Gewiß hat sie ihm sterbend verziehen. Ich will es lebend. Ich will ihm verzeihen – und tot sein für ihn. Nein, er soll nicht dort oben hängen an dem schönen, alten Baum!«
Während Anton diese versöhnenden Worte dem Walde kundgab, erblickte er auf einem Aste der mächtigen Eiche, dicht an einer spaltigen Öffnung des Stammes, mehrere wilde Turteltauben, die da drinnen nisteten. Es schienen die Eltern und ein paar Junge zu sein. Eins der letzteren war offenbar der Liebling der Alten, denn es empfing volle Nahrung von beiden, während das andere, sobald es sich nähern wollte, unsanft zurückgestoßen wurde und. sogar Bisse von den Schnäbeln ihres Vaters und ihrer Mutter erhielt. Einer dieser Stöße war zu stark für das kleine Tier; es wankte, verlor den Halt, und noch nicht völlig flügge, fiel es – ohne sich Schaden zu tun – halb schwebend vor Antons Füße.
Der Eindruck, den das einfache Ereignis auf unseren Helden hervorbrachte, ist nicht zu beschreiben. Er gab sich ihm kindlich hin. Sorgsam ergriff er die kleine Ausgestoßene, bedeckte sie mit Küssen und Tränen, verhieß ihr freundliche Pflege. Seins Liebkosungen taten ihr wohl; sie ruhte friedlich in seinen Händen.
Mittlerweile wurden die ungerechten Eltern doch besorgt um ihr verlorenes Kind, stießen allerlei rufende Töne aus und schwangen sich dem Platze, wo Anton lag, immer näher. Er aber, schnell emporspringend, verscheuchte sie. »Nicht mehr euer Kind!« rief er laut, daß es im Walde nachhallte. »Sie ist mein! Ich erziehe sie!«
Mit diesem heroischen Ausruf erhob er sich, um den Wald zu verlassen und zu seiner Großmutter heimzukehren.
Viertes Kapitel
Es wird Zeit, daß wir den geneigten Leser in Antons frühere Lebensjahre, sowie in die Verhältnisse seines heimatlichen Dorfes ein wenig einführen. Deshalb werden wir einen Rückschritt machen müssen; doch soll der Fortschritt unserer Erzählung dadurch nicht lange aufgehalten werden.
Der alte Baron Kannabich, der Liebenau, den ersten Schauplatz dieses schlichten Romans, von seinem Vater (dieser wieder von dem seinigen und so weiter hinauf) ererbt hatte, war auch einmal jung gewesen, wie das bei vielen alten Baronen der Fall zu sein pflegt. Und als er jung, war er ein wilder, nichtsnutziger, liederlicher junger Herr gewesen, wie das bei vielen jungen Baronen der Fall zu sein pflegt. Deshalb hatte er denn auch in seine älteren Tage nicht viel mehr herübergebracht, als drei Töchter, deren Mutter bei der Geburt der jüngsten starb – dreimal soviel Schulden, als schon bei seines Vaters Lebzeiten auf Liebenau gehaftet –, einen unversiegbaren und unbesieglichen Durst (doch nicht nach Wasser) – und endlich eine drei mal drei, folglich neunmal größere Nase, als Freiherrn, Ritter und Grafen im gewöhnlichen Lauf der Dinge zu tragen belieben. Diese Nase gab unserem Anton, der ihr blaurotes Farbenspiel von Kindheit auf mit besonderer Andacht observieret, erwünschte Gelegenheit, den gestrengen Gutsherrn mit dem Beinamen: »Onkel Nasus« zu belehnen; eine Benennung, die anfänglich kaum durchdringen wollte, da des Pastors Söhne vorher eine andere geschaffen. Sie behaupteten, der Freiherr schreibe sich nicht Kannabich, sondern von Rechts wegen »Kannenpich«, weil er lieber aus großen »Kannen«, denn aus kleinen Gläsern »pichle«. Und sie hießen ihn Onkel »Kannenpichler«. In seiner Art war das nicht übel, jedoch zu kompliziert, um ins Volk überzugehen. Onkel Nasus war anschaulicher, einfacher, wurde deshalb allgemein beliebt und schlich sich endlich bis ins Schloß, wo es dann durch Diener und Mägde bis zur sogenannten Kammerjungfer und durch solche wieder bis zu den »Schloßfräulen« selbst gelangte, die naiv genug waren, es auch zu akzeptieren und in guter Laune ihren oft in sehr übler Laune polternden ungnädigen Papa »Onkel Nasus« zu schelten, obschon dieser keines Menschen Onkel oder Ohm war, denn er hatte niemals Bruder noch Schwester besessen; er war ein einziges Kind.
»Onkel Nasus ist heute wieder mit dem linken Fuß zuerst aus dem Bett gestiegen! Onkel Nasus hat heute wieder einmal zu tief in Glas geguckt! – Mit Onkel Nasus ist seit acht Tagen nichts anzufangen!« – Das waren Äußerungen, die nicht selten in den jungfräulichen Gemächern der drei Schwestern von Kannabich beim Aus- und Ankleiden vernommen wurden. Wenn auch »Linz« als älteste mancherlei dagegen einzuwenden wußte, sie wurde überstimmt, da »Miez«, die zweite, in dieser Sache mit »Tieletunke«, der dritten, über einstimmte; und was Tieletunke betrifft, so gestand selbige mit der ihr eigenen Unbefangenheit eine ausgesprochene Vorliebe für Anton, den Korbmacherjungen, den Gespielen früherer Zeit, den Schöpfer des »Onkel Nasus«, immer gern ein.
Damit nun aber keiner meiner Leser wähne, jene soeben genannten Namen der drei Schwestern seien denselben ursprünglicherweise am Taufsteine zuteil geworden, versäume ich nicht, beizufügen, wie »Linz, Miez und Tieletunke« nur Umbildungen von Karoline, Emilie und Ottilie sind; Transkriptionen, die wir der freien Phantasie der beiden Pastorsöhne verdanken, aus deren hosenloser Kindheit sie sich unvermerkt in die Gymnasialzeit geschlichen und, wie so mancher Mißbrauch auf Erden, durch Verjährung geheiligt haben. Gleiches Schicksal traf übrigens die kühnen Täter, denn an beiden, Julius und Robert geheißen, blieben die vertraulichen Kindernamen: »Pastor-Puschel und Rubs« fest haften, während Anton allein, nur in minder vertrauten Umgang gezogen, solcher Ehre verlustig ging. Er war und blieb schlechthin Anton, an längeren Sommertagen, wo man mit der Zeit nicht zu geizen braucht: der Korbmacherjunge. Linz und Mieze standen ihm fern, auch bei ihren Kinderspielen, die beide, in gleichem Alter mit Puschel und Rubs, folglich als Mädchen schon reifer wie Knaben, nur aus Herablassung mitmachten. Tieletunke aber, fast um ein Jahr jünger als Anton, fand dessen Namen zu hübsch, als daß sie ihn hätte umstülpen sollen. Sie rief ihn folglich: Anton, und wenn sie gut aufgelegt war, wurde manchmal Toni daraus; was wohl eigentlich keine Verzerrung, vielmehr eine verkürzende Übertragung des lateinischenAntoniusins Deutsche ist; nach welcher ihr, wie sie zu äußern liebte, bloß Kopf und Schwanz, nämlich:Anundusübrig blieb. Und mitAn-uswisse sie nichts weiter anzufangen. Denn der Pastorsöhne Vorschlag,asinusdaraus zu machen, gab sie zornig zurück, sobald ihr der Herr Pastor die Bedeutung dieses Wortes beigebracht.
Der Pastor nun hatte Schloßfräulein und eigene Söhne vorbereitend unterrichtet, so gut und so schlecht er dies bei redlichem Willen imstande gewesen. Anton, der nur als halbgeduldeter Freiwilliger an jenen Lehrstunden naschen durfte, hatte das Beste davon in sich aufgenommen und das Meiste, weil er von allen der Begabteste gewesen. Das entging der feinfühlenden Tieletunke nicht. Und wie sie scheinbar den adeligsten Stolz gegen den jungen Burschen an den Tag legte, war sie ihm innerlich am herzlichsten zugetan. Die Neckereien ihrer Schwestern hatten es jedoch dahin gebracht, daß sie später ihre wahren Empfindungen in sich verbarg, wie eine Schnecke sich mit bedrohten oder gar betasteten Fühlhörnern ins Innere des Hauses zurückzieht. Linz und Mieze, minder fein organisiert und ihrem väterlichen Großnasenträger ebenso nahe verwandt, als Ottilie der durch sie und ihr Geborenwerden entseelten zarteren Mutter, machten aus ihrer Vorliebe für Puschel und Rubs gar kein Geheimnis. Diese drei Verhältnisse wuchsen mit den drei Paaren heran, wie es eben nur in solchen ländlichen Zuständen möglich ist. Es war eine werdende Dorfgeschichte – nach altem Zuschnitt.
Jetzt sind Puschel und Rubs als wohlbestandene Gymnasiasten in der Hauptstadt und kommen während der Schulferien, im Sommer auch oft über Sonnabend und Sonntag, nach Liebenau zum Besuche. Sie bereiten sich fleißig vor auf ihre Prüfungen für den großen Schritt zur hohen Schule, den man damals noch nicht so zeitig tat wie später; es war noch nicht die Epoche frühreifer Weisheit und Gelehrsamkeit.
Anton, weniger unterrichtet, aber klüger als sie, flicht seine Körbe und in diese samt den Weidenruten gar manchen besonderen, eigentümlichen Gedanken, auf den die jungen Herren Gelehrten schwerlich geraten dürften. Ihr Schulwissen hat sie geistig fast abgetötet, und so sicher sie sich durchs Examen winden werden, so gewiß sind sie flache, nüchterne, wenn schon gutmütige Gesellen.