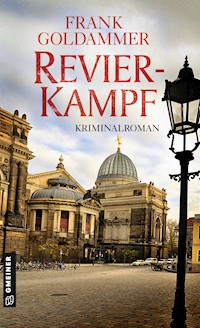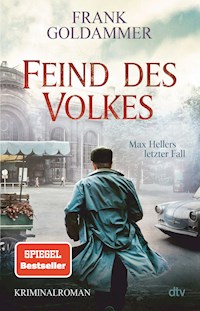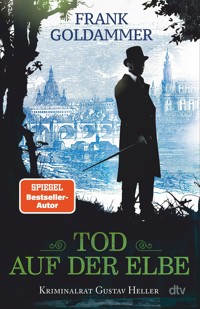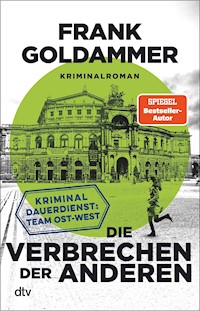
9,99 €
Mehr erfahren.
»Mord bleibt Mord. Egal unter welcher Regierung, oder?« Im kalt-stürmischen Februar 1990 wird in Dresden ein junger Mann, ein ehemaliger Grenzsoldat, als vermisst gemeldet. Zeitgleich ermittelt das KDD-Team um Tobias Falck, Edgar Schmidt und Stefanie Bach in einem Fall von Kunstraub. In der Dresdner Galerie der Alten Meister ist ein wertvolles Gemälde durch eine Fälschung ersetzt worden. Kurz darauf wird der Fälscher ermordet. Handelt es sich womöglich um alte Stasi-Machenschaften? Die westdeutsche Ex-Kommissarin Sybille Suderberg, die inzwischen Privatdetektivin im Osten ist, spielt dabei eine undurchsichtige Rolle. Ihretwegen kommen die Dresdner Polizisten zu einer Dienstreise in den unbekannten Westen, die sie in das karnevalstrunkene Köln, aber auch in eine gefährliche Falle führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Frank Goldammer
Die Verbrechen der anderen
Kriminalroman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
»Und das soll nun der Westen sein? Sieht ja auch nicht besser aus als die Dresdner Neustadt.« Tobias Falck, seines Zeichens Leutnant der Volkspolizei der DDR, Abteilung Kriminaldauerdienst Dresden, sah sich skeptisch um.
»Das ist Kreuzberg!«, erklärte seine Kollegin, Leutnant der VP Stefanie Bach, die mit forschem Schritt neben ihm lief, was ihr in der bitteren Februarkälte trotzdem nichts nutzte. Sie fror erbärmlich.
Falck hatte sich von ihr überreden lassen, an ihrem freien Tag nach Westberlin zu fahren. Er war gern mit Bach unterwegs, auch wenn er solche gemeinsamen außerberuflichen Aktivitäten noch nicht so richtig einschätzen konnte. Es war nur wenige Wochen her, dass sie sich kennengelernt hatten, beim Kriminaldauerdienst der Dresdner Kriminalpolizei. So viel war schon passiert, nicht einmal vier Monate, dass sich die Grenzen für sie wie auch alle anderen DDR-Bürger geöffnet hatte. So viel war geschehen in diesen wenigen Wochen, beinahe jeden Tag geschah Neues, und sogar Steffis Leben hatte er schon einmal gerettet. Ob sie ihm einfach nur dankbar war oder ihn wirklich mochte, war nicht leicht herauszufinden. Heute hatten sie endlich den Plan verwirklicht, sich endlich mal dieses verheißungsvolle Westberlin genauer anzusehen, und das hatten sie zur Genüge getan.
Sie hatten sich die Schaufenster angesehen, die teuren Autos auf dem Ku’damm bestaunt, waren im KaDeWe herumgelaufen, wie unzählige andere DDRler auch, und hatten sich wie Besucher eines Museums, wie in einer fremden Welt gefühlt, nicht wie Kunden in einem Geschäft, denn Geld hatten sie keines, um sich etwas kaufen zu können. Ihre hundert Mark Begrüßungsgeld hatten sie jeder für sich bei einem allerersten Besuch noch im November ausgegeben. So waren sie an den endlos langen Regalen mit Kleidung, Süßigkeiten, Fernsehern, Radios, CD-Spielern und Sportartikeln vorbeigegangen, sogar Spielzeug hatten sie sich angeschaut, um sich dann vorzustellen, wie es wohl gewesen wäre, wenn sie als Kind damit hätten spielen können. In der Bücherabteilung des Kaufhaus des Westens waren sie erstaunt, wie viele Bücher es gab, die man einfach so kaufen konnte, ohne dass sich jemand unter die Ladentheke bücken musste, um einem das Buch verstohlen zuzustecken. Was man früher nur mit viel Glück oder Beziehung, meistens aber gar nicht hatte kaufen und lesen können, stapelte sich hier auf Tischen. Zeitschriften gab es im Überfluss, zu jedem Thema, Autos, Pflanzen, Kleidung, Sport, Segeln, Kochen, Backen, Sex. In der Lebensmittelabteilung vom KaDeWe fühlten sie sich, als würden sie durch das Schlaraffenland wandern. Vieles hatten sie noch nie gesehen, echte Tintenfische, Süßwasserfische, Krabben, Kaviar, exotische Früchte, Wurst und Schinken aus aller Herren Länder, Schokolade in hunderten Variationen, Pralinen, unzählige Sorten Kaffee mit fantasievollen Namen. Seife, Waschmittel, Parfüms, und auch die Auswahl an Zigaretten fiel Falck auf, obwohl er gar nicht rauchte. Besonders beeindruckten ihn die Bilder von den einsamen, Marlboro rauchenden Cowboys auf ihren prächtigen Pferden in den weiten Landschaften Amerikas. Genau dorthin wünschte er sich in dem Augenblick auch.
Sie hatten stundenlang schwelgen können, allein nur in den Gerüchen, sie hatten sich gar nicht sattsehen können an dem Überfluss. Wie musste es wohl sein, sich all das hier zu jeder Zeit kaufen zu können, fragte er sich, und ob die Westdeutschen das zu schätzen wussten. Wenigstens die, die sich das hier leisten konnten. Bach und er jedenfalls konnten es nicht. Sie waren schier überwältigt vom Ku’damm, von seinen teuren Läden, den Casinos, Männern in Sportwagen. Nicht weit davon hatte Falck seinen ersten Obdachlosen gesehen, und erst da war ihm wirklich bewusst geworden, was das hieß. Dieser Mann, dessen Besitz aus ein paar Decken und zwei Taschen bestand, der in einem Durchgang lag und von niemandem weiter beachtet wurde, als würde er nicht existieren. Und er hatte festgestellt, dass oft in den Nebenstraßen der Glanz verschwunden war und sich der Müll türmte. Wie nahe Glamour und Schmutz hier doch waren.
Die Füße hatten sie sich wund gelaufen und völlig unterschätzt, wie groß Berlin war. Aber sie bereuten keinen Schritt und keinen Meter, den sie zurückgelegt hatten. Sie hatten Stadtviertel entdeckt, in denen sicherlich richtig reiche Leute wohnten, in Villen, die so groß waren, dass acht Familien darin hätten wohnen können. Durch die Hecken hatten sie Swimmingpools gesehen und teure Autos vor Garagen, Mercedes, Jaguar, sogar einen Ferrari und eine echte Harley Davidson. Lebten so Millionäre? Wie in einem Freilicht-Museum waren sie sich manchmal vorgekommen. Nachdem der letzte heiße Tee aus der Thermosflasche getrunken war und ihr Plan, auf einer Parkbank eine Pause einzulegen und ihre belegten Schnitten aus der Brotbüchse zu essen, an der eisigen Kälte gescheitert war, hatten sie ihre letzten paar Mark bei einem McDonalds ausgegeben.
Falck war von der Hektik und dem Angebot komplett überfahren gewesen und hatte in seiner Verzweiflung und der Angst, irgendetwas falsch zu machen, auf irgendeinen dieser »Bürger« gezeigt und Pommes frites und eine Cola mit Unmengen an Eiswürfeln im Becher bestellt. Nicht gerade die beste Idee, bei minus fünf Grad Celsius. Nun rumpelte es in seinem Magen, der mit dem ungewohnten Westessen nichts anzufangen wusste. Am Nachmittag, auf dem Weg zurück in den Osten, waren sie schließlich in Kreuzberg gelandet. Und hier zeigte sich mehr als deutlich die Kehrseite der westlichen Gesellschaft.
Jetzt froren sie beide und waren völlig erschöpft, auch wenn Bach es nicht zugeben wollte, weil sie dann nämlich auch hätte zugeben müssen, dass ihr Plan, Westberlin auf diese Weise zu erkunden, nicht wirklich gut durchdacht gewesen war. Sie wagten nicht, sich in ein Café zu setzen, denn sie hatten kein Geld mehr übrig, und es wäre ihnen peinlich gewesen, hinausgeworfen zu werden, weil sie nichts bestellten.
»Überleg mal, wie die hier gelebt haben, wie auf einer Insel! Das muss komisch und geil zugleich gewesen sein, so eingeschlossen von einem anderen Land, oder?« Bach wollte ihn anscheinend mit ihrer etwas aufgesetzten Euphorie anstecken.
Falck hob die Schultern. Er konnte es sich tatsächlich nicht vorstellen, aber vermutlich waren sich die Westberliner ihrer Sonderstellung mehr als bewusst gewesen.
»Mensch, Tobias, so viele Jahre haben wir davon geträumt, mal über die Mauer zu kommen. Und jetzt sind wir mittendrin!« Bach breitete die Arme aus und drehte sich einmal um sich selbst. »Das ist doch geil, oder? Überleg mal, das haben wir geschafft, ohne Blutvergießen, einfach so, indem wir auf die Straße gegangen sind.«
Falck sah sich um, das auffällige Verhalten seiner Kollegin war ihm etwas peinlich, doch anscheinend störte das hier niemanden.
»Wir? Du weißt aber schon noch, dass du mal einen Eid geleistet hast auf das Land. Mit allem Drum und Dran!«
»Ach, quatsch doch jetzt nicht. Ist doch Wahnsinn, was da alles passiert ist. Wirklich einmalig in der Weltgeschichte. Fühlst du das denn nicht? Wie toll es ist, nicht mehr gegängelt zu werden? Niemand bestimmt mehr, was du zu tun und zu lassen hast.«
Falck nickte und hob wieder die Schultern. Aber wenn er mal ehrlich war, hatte er nie wirklich darunter gelitten. Natürlich wusste er, wie der Staat und die Stasi mit den Bürgern umgesprungen waren. Vor allem, wenn sie nicht das taten, was ihnen aufgetragen wurde. Er sah sich um.
»Aber mächtig runtergewirtschaftet ist das hier schon auch, oder?«, sagte er trotzig. »Das nennt sich immerhin Sehnsuchtsort.«
»Ach, du Miesepeter!« Bach winkte ab. »Die mussten doch hier nur Geld reinbuttern, um Westberlin halten zu können. Hab gehört, wer hier wohnte, musste nicht zur Armee. Und früher gab es sogar Geld für diejenigen, die nach Westberlin zogen. Aber irgendwie ist das doch stark, wenn man hier direkt hinter der Mauer leben konnte. Und du musstest immer durchs Feindesland, wenn du in die BRD wolltest!«
»Feindesland. Wie das klingt. Das waren wir!«, protestierte Falck, aber für einen kurzen, kaum greifbaren Moment war ihm die Tragweite der ganzen Sache bewusst geworden.
»Ja, aber wir waren Feindesland für sie!«, wusste es Bach besser, dabei schlugen ihre Zähne vor Kälte aufeinander.
Falck versuchte noch einmal das Gefühl zu erhaschen, das ihn gerade übermannt hatte. Was es bedeutete, hier in Westberlin einfach so herumlaufen zu können. Das betraf nicht nur sie beide, das betraf die ganze Welt, und sie waren mittendrin im Geschehen. In Berlin hatte sich sinnbildlich und ganz konkret die Spaltung der Welt gezeigt. Hier hatte sich die Absurdität des Kalten Krieges manifestiert, in einem Bollwerk, das die Menschen einer Stadt voneinander trennte, und nun war diese Mauer gefallen, weil die Menschen in Polen, in der Tschechoslowakei, in der DDR und anderswo auf die Straße gegangen waren, weil sie ihre Stimmen erhoben und friedlich gegen Bevormundung, Unterdrückung, Gewalt und Unrecht demonstriert hatten. Man konnte nur hoffen, dass das nicht so schnell in Vergessenheit geriet.
»Du frierst, gib es endlich zu«, sagte er zu Bach. »Ich glaube übrigens nicht, dass die Westler uns als Feindesland betrachtet haben. Eher hatten sie Mitleid mit uns. Oder, keine Ahnung, haben uns belächelt. Ist bestimmt ein geiles Gefühl, der reiche Onkel aus dem Westen zu sein. Die armen Schweine ›aus der Zone‹, weißte.«
Bach ging nicht darauf ein. »Schau mal.« Sie zeigte nach vorn. »Das ist doch eine Kneipe. Da gehen wir jetzt rein!«
»Dschungel!«, las Falck laut. »Also, ich weiß nicht …«
»Komm schon!« Bach zitterte jetzt wie Espenlaub, und Falck ließ sich von ihr mitziehen.
»Hast du das gewusst? David Bowie war hier schon mal drin!« Bach hüpfte wie elektrisiert auf und ab. »David Bowie, überleg mal!« Zwei Stunden lang hatten sie sich in dem Lokal aufgewärmt, hatten sich unterhalten und Essen und Trinken spendiert bekommen von irgendwelchen Typen, die sie noch nie vorher gesehen hatten. Sie hatten über alles Mögliche geredet und immer wieder gestaunt, wie offen und locker die Leute waren. Niemand hatte sich über sie lustig gemacht. Interessiert waren sie gewesen und freundlich.
Nun wurde es dunkel, und morgen war Dienst. Immerhin mussten sie noch zur S-Bahn, um nach Königs Wusterhausen zu kommen, wo sie Bachs Trabi abgestellt hatten, und dann noch über zwei Stunden nach Dresden fahren.
»Ehrlich gesagt wusste ich bis vor Kurzem gar nicht, dass es einen David Bowie gibt!«
»Weil du immer nur Bong oder Sprungbrett geguckt hast!«, lachte Bach ihn aus. »Und Iggy Pop, kennst du den?«
Falck schüttelte den Kopf und war sich sicher, dass auch Bach gerade eben das erste Mal diesen Namen gehört hatte. »Nenn mal irgendein Lied von dem Kerl!«, rief er herausfordernd.
»Das Lied heißt: Tobias schwimmt auf der Wurschtsuppe.« Bach lachte gutmütig. »Aber Depeche Mode kennst du doch, oder? Die haben hier irgendwo ein Studio gehabt, wo sie schon drei Platten aufgenommen haben.«
Depeche Mode sagte Falck natürlich etwas, daran war man selbst in der DDR nicht vorbeigekommen. Die Musik mochte er.
»Komm jetzt, in diese Richtung müssen wir!« Er hakte sich bei Bach unter, die sich das auch gefallen ließ.
»Na, ihr zwee Hübschen!«, sprach sie jemand mit rauer Stimme an, als sie in Sichtweite der Mauer gekommen waren. »Wollta een echtes Souvenir, vonne Maua?«
Bach, die aufgewärmt, satt und leicht angesäuselt war, blieb sofort stehen. »Zeig mal!«, forderte sie den Typen auf, der mit seinen Jeansklamotten viel zu dünn gekleidet war.
Der Mann mittleren Alters legte seinen Aktenkoffer auf das Knie und klappte ihn auf. Er balancierte geschickt auf einem Bein, er musste das schon oft gemacht haben. Vermutlich konnte man so am schnellsten wegrennen, wenn die Polizei um die Ecke kam. Koffer zu und ab.
»Echte Mauabrocken, vonna echten Maua, mit meinen eijnen Händen rausgekloppt, im Schweeße meenes Anjesichts. ’n kleener für fünf Mark, ’n jroßer für zehne, wa? Fast jeschenkt!«
»Steffi!«, sage Falck mahnend, der nicht verhindern konnte, dass Steffi sich interessiert über den Koffer beugte.
»Nu sei mal keen so’n Spaßverderber!«, sagte der Mann. »Schließlich muss unsereens ooch leben, wa!«
»Ist das echt von der Mauer?«, fragte Steffi.
»Watn? Denkste, ich betrügt so ne hübsche Pflanze wie dir? Dit is so echt, wie ick hier steh! Willste deiner Liebsten nicht een kleenes Jeschenk machen?«, sprach er jetzt Falck direkt an.
Falck traute dem Mann nicht, der Betrug war förmlich zu riechen, doch es war ihm unangenehm, Steffi so offen vor dem Kerl zu warnen. Wie er auch nicht gewagt hatte, nach einer Cola ohne Eis zu fragen. Was hinderte ihn eigentlich daran? Eine Hemmung, eine Art Angst und das Bedürfnis, jede Konfrontation schon im Keim zu ersticken. Als hätte er kein Recht dazu, seinen Mund aufzumachen und für seine Ansprüche einzustehen.
Steffi nahm einen der kleineren Betonbrocken, die in Plastetüten abgepackt waren. »Den nehme ich!«
»Der is hübsch, wa, kieck ma, mit Graffiti druff!«
Steffi kramte in ihrer Handtasche und zog einen Fünfmarkschein heraus.
»Wat’n, nee, Süße, wat soll ick mit Spieljeld? Ick will echtes Jeld!«
»Hab ich aber nicht mehr!«
»Begrüßungsjeld schon ausjejeben?«
»Na ja«, Steffi hob die Schultern und gab dem Mann den Stein zurück.
»Weeßte wat, für zwanzig Ostmark jeb ick ihn dir, weil de so traurich kieckst!«
Steffi zögerte, und Falck zog sie unmerklich am Arm.
»Also gut!«, sagte Steffi, holte einen Zwanziger heraus und gab ihn dem Mann.
»Zwanzig Mark für einen Betonbrocken, der von überallher sein könnte? Du bist wirklich verrückt!«, raunte Falck ihr zu, als sie weitergegangen waren.
»Ich weiß!«, gab Steffi zu.
»Den hätten wir uns selbst von der Mauer klopfen können!«
»Ich weiß!«
»Der Typ lacht sich scheckig!«
»Ich weiß, Tobias, ich hab mich nur nicht getraut, Nein zu sagen!«
Falck schwieg. Tröstlich zu wissen, dass es nicht nur ihm so ging.
»Wenigstens hab ich jetzt ein Souvenir!«
»Ein gefälschtes.«
»Für mich ist es echt«, hielt Bach dagegen. »Selbst wenn es nicht von der Mauer ist!«
»Ach, ja?« Falck verstand seine Kollegin nicht.
Plötzlich schnellte Bach einen Schritt vor und stellte sich vor ihn. »Danke, dass du mitgekommen bist!« Ehe er sich’s versah, umarmte sie ihn für einen kurzen Moment. »War doch schön, oder?«
Falck nickte, ja, es war schön gewesen, vergaß man mal die Kälte und dass ihm die Beine wehtaten und dass er etwas deprimiert war angesichts der tausend schönen Dinge, die er sich so schnell nicht würde leisten können.
Und vielleicht wäre es jetzt an ihm gewesen, Steffi noch ein bisschen länger in seinem Arm zu halten. Doch die Gelegenheit war schon wieder vorbei.
1
Durch eine unscheinbare Tür betrat Falck das stillgelegte Fabrikgebäude auf der sogenannten Straße E. Sofort umfing ihn Wärme. Er durchquerte einen langen dunklen Gang, an dessen Wänden sich stumme Gestalten herumdrückten, die ihn und Steffi Bach beobachteten, die ihnen folgten. Es roch nach Zigarettenqualm, Alkohol und nach Mensch. Je tiefer sie in das Gebäude vordrangen, desto wärmer und feuchter schien es zu werden. Ein lautes Wummern ließ die Wände vibrieren. Nach wenigen Metern wurde ihm so warm, dass er den Reißverschluss seines Anoraks aufzog. Dann hatte er die nächste Tür erreicht und stieß sie auf.
Wie ein Schlag trafen ihn Hitze, Lärm und stickige Luft. Ein harter, wahnsinnig schneller Bass, so laut, wie er ihn noch nie in seinem Leben gehört hatte, legte sich auf sein Trommelfell. Der Anblick der unzähligen jungen Leute, die dicht gedrängt auf einer kleinen Fläche im Rhythmus tanzten und auf und ab sprangen, das trübe flirrende Licht, all das überwältigte ihn, so dass er unvermittelt stehen blieb.
Steffi Bach schob sich an ihm vorbei. Sie sagte etwas, das er nicht verstand, deshalb kam sie ihm so nahe, dass ihre Lippen fast sein Ohr berührten.
»Hast du Schiss?«, schrie sie ihm ins Ohr.
Er ging nicht darauf ein, denn er wusste, jedes Wort war in diesem Falle eines zu viel. Er folgte ihr, die zielsicher nach rechts abbog und sich am Rand der Tanzfläche tiefer in die Halle hineinbewegte. Irgendwo da vorne, ahnte er, wo ein Licht wie eine kaputte Glühlampe flackerte und ihm latente Übelkeit verursachte, musste der DJ sein. Die Musik, die kaum lauter und schneller sein konnte, steigerte sich urplötzlich in ein wahnsinniges Stakkato und ließ die Tanzenden aufschreien. Plötzlich sprang ihn jemand an. Falck erschrak, merkte jedoch, dass es nicht in böser Absicht geschehen war. Er blickte in ein Gesicht mit weit aufgerissenem Mund und riesigen Augen. Der junge Mann schrie, ließ von ihm ab, warf sich wieder ins Getümmel, wo er augenblicklich in der wild tanzenden und stampfenden Menge verschwunden war.
Falck beeilte sich, Bach wieder einzuholen. Sie zeigte keine Hemmungen, sich durch die immer dichter werdende Masse zu zwängen, durch Lücken, die es gar nicht gab, energisch schob sie Männer und Frauen beiseite. Keiner störte sich daran. Falck spürte, wie ihm der Schweiß von der Stirn rann, wie ihm heiß wurde in seinem Anorak und in den langen Unterhosen, die er sich vor Dienstbeginn vorsorglich angezogen hatte. Steffi drehte sich um und schrie ihm etwas zu, doch was immer es war, es ging in ohrenbetäubendem Lärm unter.
Auf der anderen Seite des Raumes stellte sich ihnen ein großer Typ in den Weg. Als Bach ihm ihren Ausweis zeigte, entlockte ihm das gleichermaßen ein Lachen und ein genervtes Augenrollen. Aber er ließ sie durch.
Hinter den riesigen Lautsprecherboxen war es etwas erträglicher, doch immer noch war es so laut, dass man sich nur durch Schreien verständigen konnte. Steffi stand jetzt vor dem Podium, das aus Brettern und Paletten errichtet worden war. Oben standen zwei Männer, der eine war voll beschäftigt mit seinen Plattentellern, der andere starrte einfach nur ins Leere. Dass Steffi ihn am Arm berührte, bemerkte er gar nicht. Der andere Typ stieß Steffi an und winkte lachend ab. Dann langte er selbst über die hüfthohe Seitenwand, tippte den DJ an und zeigte auf Steffi. Der DJ nickte, legte eine neue Platte auf, setzte die Nadel auf und wandte sich dann mit einem vom Ohr gezogenen Kopfhörer den beiden Polizisten zu.
Steffi Bach schrie ihm ins Ohr, er schrie zurück, zuckte mit den Schultern und ließ seinen Kopf ununterbrochen zur Musik vor und zurück schnellen. Dass sie Polizisten waren, schien ihm völlig egal zu sein. Wir sind hier wirklich die Trottel der Nation, dachte sich Falck. Er machte sich darüber schon längst keine Illusion mehr.
Als sie wieder gehen wollten, gab ihnen der große Typ auf dem Podium zu verstehen, dass sie einen anderen Ausgang benutzen sollten. Durch eine Tür kamen sie in einen Nebenraum. Auch hier war es immer noch zu laut, um sich in normaler Lautstärke zu unterhalten. Eine junge, spärlich bekleidete Frau kam auf Steffi Bach zugerannt. Die Frauen kannten sich offenbar, denn es folgten Umarmungen, Gelächter und längere Gespräche. Falck stand untätig daneben und fühlte sich ausgeschlossen. Er musste Steffi unbedingt dazu bringen, endlich weiterzugehen. Er brauchte frische Luft und wollte dem Lärm entfliehen.
Nun sprach die Fremde ihn an. Er verstand nichts, doch ihr offenes Lachen und ihre aufgedrehte Art entlockten ihm ein Lächeln. Steffi verabschiedete sich von ihr und zeigte entschuldigend nach draußen, fasste Falck am Ärmel und zog ihn mit sich. Die andere warf ihm eine Kusshand zu, die bei ihm mehr Eindruck hinterließ, als einer solch kleinen Geste zustand.
»Was hat sie gesagt?«, fragte Falck im nächsten Raum, in dem endlich eine erträgliche Lautstärke vorherrschte.
»Hübsche Jacke!« Steffi lachte vergnügt und zupfte ihn am Anorak.
Falck sah an sich herab. Noch vor einem Jahr hatte er sich sehr über den Anorak gefreut, den seine Mutter ihm zu Weihnachten geschenkt hatte. Blau mit weißem Streifen, leicht und trotzdem warm. Nun stigmatisierte ihn dasselbe Kleidungsstück als DDR-Bürger. Und egal wie neu, sauber oder modisch die Jacke bis vor Kurzem noch gewesen war, im Vergleich zur Mode aus dem Westen, den Jeans, Mänteln, den Jacketts und Blousons, wirkte sie jetzt einfach nur billig und schäbig.
»Was hat der DJ gesagt? Was hast du ihm gesagt?«
»Ich hab ihm gesagt, dass die Veranstaltung illegal sei und umgehend aufgelöst werden muss. Er meinte, ich solle ans Mikro gehen und es den Leuten selbst sagen.«
»Und warum hast du nicht?«
Steffi hob sichtlich amüsiert die Augenbrauen und deutete freundlich einladend auf die Tür hinter ihnen. »Bitte schön!«
Falck schüttelte den Kopf. Ständig wurde gewitzelt und gefrotzelt, doch wenn er einen Scherz machte, verstand es niemand.
»Komm jetzt!« Er wollte raus.
»Nee, ich warte noch. Ich bin so durchgeschwitzt, da friere ich draußen gleich ein.« Bach zog ihren Mantel aus.
Sie hatte recht. Falck folgte ihrem Beispiel und lehnte sich an ein dick isoliertes Rohr. »War das eine Freundin?«
Bach hatte sich eine Kippe angezündet und nickte. »Ist die Freundin vom DJ, zumindest zurzeit.«
»Ach, du kennst den?«
»Na klar.« Sie bewegte den Kopf zur Musik, wie der DJ es getan hatte.
»Du bist sonst selbst hier«, stellte Falck fest.
»Schlau kombiniert.«
»Was ist so gut hier? Hier gibt’s keinen Brandschutz, keine Fluchtwege, und vermutlich bekommt man einen Hörschaden nach ein paar Minuten!«
»Hä?«
»Vermutlich bekommt man …« Falck verstummte, er war schon wieder reingefallen. Eine junge Frau rannte an ihnen vorbei, stieß die nächste Tür auf und erbrach sich dahinter lautstark.
»Gib’s zu, du fandest das auch geil!«, sagte Steffi, als die Tür wieder zu war.
Falck erwiderte nichts, er musste das Erlebte erst einmal sacken lassen. Diese Musik, der Anblick der wie in Trance tanzenden Masse hatten ihn mehr beeindruckt, als er sich eingestehen wollte. Es war eine neue körperliche Erfahrung gewesen. Etwas Großes, das einen erfasste, betäubte und gleichzeitig aufputschte.
»Komm doch mal mit!«, sagte Bach.
Falck zuckte unsicher mit den Schultern, was aber vor allem daran lag, dass er mit der lockeren, direkten Art seiner Kollegin nicht umzugehen wusste. Wollte sie ihn provozieren, war das rein freundschaftlich gemeint, oder wollte sie etwas von ihm? Er verstand diese Frau einfach nicht.
»Na los, wir müssen!«, sagte er betont forsch und zog sich die Jacke über. Steffi Bach folgte ihm wortlos.
Weil sie das Gebäude über den Nebenausgang verließen, mussten sie das halbe Gebäude umrunden, um zum Auto zurückzukommen. Die Kälte packte sie sofort, obwohl sie versucht hatten, sich zu akklimatisieren. Falck fror augenblicklich, und Bach ging es nicht besser. Sie zitterte regelrecht und eilte auf den Dienstwagen zu. Der Trabant war zwar klein und eng, aber der geschlossene Innenraum versprach wenigstens ein bisschen Schutz vor der Kälte.
»Wo kommt ihr denn her?«, pflaumte ihr Vorgesetzter Hauptmann Edgar Schmidt sie auf halbem Wege an. »Habt ihr euch schön vergnügt da drinnen? Und was ist nun?« Ihm schien die Kälte nichts auszumachen. Mit offener Jacke und geöffnetem Hemdkragen kam er ihnen ein Stück entgegen. Allein sein Anblick ließ Falck noch mehr frieren.
»Was soll schon sein?«, konterte Steffi mit vor Kälte klappernden Zähnen, »da sind mehr als fünfhundert Leute drin, wenn du die Bude räumen willst, viel Spaß.«
Schmidt winkte genervt ab. »Geht uns sowieso nichts an, und ich lass sowieso nicht mehr so mit uns umspringen«, knurrte er wütend. »Guck sie dir doch mal an! Stehen da zu acht und bestellen uns her, damit wir reingehen!« Mit dem Kinn deutete er auf eine Gruppe uniformierter Polizisten, die abseits bei ihren Funkstreifenwagen standen und einen eher unbeteiligten Eindruck machten. »Anarchie, sag ich euch! Jeder macht, was er will. Habt ihr irgendwelche Drogendealer gesehen?«
»Drogendealer?«, fragte Bach nach und stampfte auf den Boden, um sich Wärme zu verschaffen.
»Na, Typen, die illegale Rauschmittel verkaufen. Das würde einen groß angelegten Polizeieinsatz rechtfertigen. Habt ihr welche gesehen? Bitte sag Nein!«
»Nein!«
»Gut, danke schön.«
Bach schlotterte. »Gib mir mal den Schlüssel vom Trabi!«, forderte sie Schmidt auf.
»Wo willste denn hin?«
»Nirgendwohin. Ich will die Heizung anmachen.«
»Der heizt doch kaum!«
»Besser als nichts, gib jetzt bitte!«
Schmidt langte in seine Tasche und händigte ihn ihr aus.
Steffi Bach setzte sich hinein und startete den Motor.
»Außerdem, Drogendealer, wie sollen die überhaupt aussehen? Haben ja kein Schild umhängen, wo das draufsteht«, sagte sie dabei.
Falck stöhnte innerlich auf. Schmidt war sowieso schon mies drauf. Entweder sah Steffi das nicht, oder sie ließ es absichtlich darauf ankommen.
Schmidt schnappte sich die Trabitür, ehe Bach sie zuziehen konnte. »Leute, die betont cool tun, die mit Händen in den Hosentaschen rumlaufen.«
»Dann müssen wir alle verhaften, auch Tobias!« Bach zog an der Tür, wollte sie schließen. Falck kam sich ertappt vor, nahm die Hände aus den Hosentaschen, steckte sie aber gleich wieder rein, denn es war wirklich eiskalt. »Guck dir die Leute doch an, Eddi, die tanzen und haben Spaß. Das ist doch nicht verboten! Lassen wir sie, und jetzt lass bitte die Tür los, wenn ich weiter so friere, bin ich morgen krank!«
Schmidt gab die Tür frei, wartete, bis Bach sie geschlossen hatte. Dann beugte er sich zur Scheibe herunter. »Ich sage nur Ecstasy«, sagte er laut, damit Steffi ihn hören konnte. »Oder E, wie die Insider sagen. Und wo sind wir hier? Straße E.« Er machte eine Geste, als erklärte das alles.
Falck war das jetzt zu dumm. »Mensch, lass doch jetzt. Können wir einfach ins Büro fahren?«
Schmidt wollte aufbrausen, dann winkte er ab. »Ja, ist ja gut.«
»Was ist denn los mit dir?«, fragte Falck. Er hatte den Eindruck, dass die Streitereien im Team zugenommen hatten, seit sie sich duzten. Ihn störte das. Vor gerade mal zwei Monaten hatte er zwei einschneidende Erfahrungen gemacht. Er hatte im Dienst einen Mann erschossen, und er hatte erfahren, dass er Vater eines kleinen Mädchens war. Seit diesem Tag fühlte er sich anders, ernster, reifer, weniger naiv. Seitdem wurde ihm das alberne Geplänkel im Büro und unter den anderen Kollegen schnell lästig, manchmal unerträglich. Irgendwie schienen alle gereizt zu sein. Schmidt sowieso immer. Bach neuerdings auch.
Schmidt hob die Schultern. »Geht mir alles auf den Kranz hier. Wir sind doch keine Polizei mehr, nur noch ein Kasperhaufen. Selbst die eigenen Leute lassen einen auflaufen. Am besten läufst du mit dem Gesetzbuch unter dem Arm herum. Es hält dir ja heutzutage keiner mehr den Rücken frei. Schau doch, wie die alle feixen. Selbst unsere Kollegen da drüben. Vor ein paar Monaten noch haben die alle gespurt.«
»Das war aber auch nicht die richtige Methode«, wagte Falck einzuwerfen, dabei wusste er sehr gut, was Schmidt meinte. Könnte es nicht den goldenen Mittelweg geben?
Schmidt hatte keine weitere Muße für Diskussionen. Er öffnete die Beifahrertür, klappte den Sitz vor. So weit ging er dann aber doch nicht, dass er sich hintersetzte. Falck musste sich auf die Rückbank quetschen.
»Nächsten Montag sind wir wieder eingeteilt«, knurrte Schmidt, als sie auf der Otto-Buchwitz-Straße stadteinwärts fuhren. Keine Neuigkeit. Es war zur Regel geworden, dass sie zu den Montagsdemonstrationen Bereitschaft hatten. Ihre Aufgabe bestand darin, möglichst unauffällig am Rand zu stehen und zu warten, bis die Demo zu Ende war und sich auflöste. Eine harmlose Angelegenheit eigentlich, jetzt, da es kein Regime mehr gab, das dies zu unterbinden versuchte. Über die Wochen war Falck jedoch aufgefallen, dass der Ton der Demonstrierenden sich geändert hatte. Die Stimmen, die einen neuen Staat und einen freundlichen Sozialismus forderten, waren beinahe verstummt, dagegen wurde jetzt immer lauter nach der D-Mark und der deutschen Einheit gerufen. Außerdem fielen die Neonazis auf, die mit ihren Reichskriegsflaggen in der Menge mitliefen und immer mehr wurden. Meistens junge Kerle mit kurzen Haaren oder Glatze. Sie schienen gut aufgestellt zu sein und traten so selbstbewusst auf, dass Falck sich fragte, ob sie nicht wirklich aus dem Westen gesteuert wurden, denn so schnell konnte sich die Szene eigentlich nicht organisiert haben.
»Fahr mal unten rechts!«, befahl Schmidt an der Doktor-Kurt-Fischer-Allee. »Bisschen Präsenz zeigen.«
»Wird gar keine da sein, ist doch viel zu kalt«, erwiderte Bach, bog aber ab wie geheißen.
Es dröhnte im Auto, als die harten Reifen über das Kopfsteinpflaster knatterten. Stumm sahen sie sich um. Bach bremste ein wenig ab.
»Ein paar sind schon da«, sagte Schmidt. Sie hatten es selbst schon gesehen. Der Straßenstrich war hier entstanden, kaum dass die Mauer gefallen war. Erschreckend viele junge Frauen, gerade aus dem sozialistischen Erziehungssystem entlassen, waren bereit, ihren Körper anzubieten, um sich damit schnelles Geld zu verdienen. Einige von ihnen waren sogar erstaunlich flexibel, was die Bezahlung betraf, und ließen sich auch mal mit Kassettenrekordern entlohnen oder mit Schmuck. Sie machten dabei einen völlig unbekümmerten Eindruck, und einmal mehr stellte Falck fest, wie unterschiedlich die Menschen die neue Freiheit definierten. Während einige kreativ wurden, Geschäfte eröffneten, Cafés, Galerien oder Versicherungsagenturen, trauten andere noch immer nicht diesem Frieden. Jeden Tag gingen Hunderte oder Tausende in den Westen. Andere glaubten, den Hitlergruß machen und Ausländer jagen zu dürfen, und andere prostituierten sich, als wäre es das Normalste auf der Welt, auf diese Art sein Geld zu verdienen. Andere verlegten sich auf Schwerstkriminalität. Zwei Banküberfälle hatte er in der kurzen Zeit seit dem Mauerfall schon miterlebt, wie im wilden Westen, mit Tuch vor dem Gesicht und Pistole. Die Zahl der Einbruchsdiebstähle war extrem angestiegen. Es hatte sogar offenen Straßenraub gegeben. Falck verstand seine Welt nicht mehr und konnte und wollte diese Entwicklung nicht einfach so akzeptieren. Nur weil das DDR-Regime zusammengebrochen war, hieß das doch nicht, dass alle gängigen Regeln über Bord geworfen werden konnten. Ein Diebstahl blieb ein Diebstahl, ein Raub ein Raub, egal unter welcher Regierung. Oder etwa nicht? Doch Schmidts düster gemaltes Bild von der neuen Gesellschaft schien sich schneller zu verwirklichen, als man sich hätte vorstellen können. Im Gegenzug schienen sich die Polizei und das Recht langsam aufzulösen.
Da musste man kein Prophet sein, um das zu erkennen. Der eine oder andere Kollege hatte schon angekündigt, nicht für den ehemaligen Staatsfeind arbeiten zu wollen. Andere gab es, die so mit der Stasi verstrickt gewesen waren, dass es ein Wunder wäre, würde man sie weiter beschäftigen. Und dann gab es noch diejenigen, die sich mit Sicherheitsunternehmen selbstständig machen wollten, und natürlich immer wieder die, die von einem zum nächsten Tag in den Westen gingen.
»Da warte ich noch drauf, dass wir hier die Erste kalt aus dem Gebüsch zerren«, brummte Schmidt und setzte Falcks Gedanken damit nahtlos fort. Wieder schwiegen alle im Auto, denn es schien wirklich nur eine Frage der Zeit, dass jemand diese Freizügigkeit und Offenheit falsch interpretierte.
»Ach, dreh um«, befahl Schmidt in das Schweigen hinein, »wir fahren ins Büro, und ich schwöre, bis Dienstschluss fahren wir heute nicht mehr raus. Dann ist erst mal langes Wochenende. Und, ihr Turteltäubchen, habt ihr wieder was vor?« Vom Beifahrersitz aus drehte er sich erst nach links und sah dann nach hinten.
Dass Falck und Bach zusammen in Berlin gewesen waren, sollte eigentlich niemand wissen. War es so offensichtlich, dass sie sich gegenseitig sehr sympathisch fanden? Sie hatten es noch nie ausgesprochen. Falck fürchtete, sich mit seiner Vermutung lächerlich zu machen, er sah Bach schon, wie sie lachte und ihm einen Vogel zeigte. Und im Grunde genommen wollte er diesen gewissen Zauber zwischen seiner Kollegin und sich auch nicht zerstören, der durch diese ungeklärte Situation entstanden war.
»Also, ich für meinen Teil«, sagte Bach nun, »ich werde drei Tage lang pennen.«
»Mit wem?«, fragte Schmidt und zwinkerte Falck über die Schulter zu.
Bach seufzte. »Wahnsinnig originell!«
2
»Mensch, Tobias!« Claudia strahlte ihn an. »Das muss ja ein Vermögen gekostet haben!«
Falck hob die Schultern, freute sich und war doch verlegen. Es bereitete ihm Vergnügen, sie so zu überraschen, andererseits fühlte er sich in der Pflicht.
Claudias Wohnung in der Böhmischen Straße war kalt, trotz der Kohle, die er ihr besorgt hatte. Die hohen Räume waren schlecht zu heizen, noch dazu standen alle anderen Wohnungen im Haus leer. Auch das machte ihm Sorgen. Er wollte sie und das Kind hier nur ungern allein lassen. Er hatte ihr schon einen zusätzlichen Türriegel und eine Kette montiert. Lieber wäre ihm noch, sie hätte ein Telefon.
Der Einkauf, auf der Küchenanrichte ausgebreitet, hatte tatsächlich ein Vermögen gekostet. Joghurt aus Westdeutschland, Kaffee, Schokolade. All das gab es jetzt für DDR-Mark zu kaufen, aber zu horrenden Preisen. Allein die kleinen Becher Joghurt kosteten drei Mark das Stück. Claudia war von ihren Eltern komplett allein gelassen worden, regelrecht verstoßen, mit ihrer kleinen Tochter, deren Vater er sein sollte, es sicherlich auch war und auch sein wollte.
»Ich hasse Joghurt eigentlich!«, flüsterte sie und griente verlegen.
»DDR-Joghurt hasst du, aber den hier nicht!« Das glibberige, stichfeste Zeug, dass ihnen bisher als Joghurt bekannt gewesen war, verabscheute er regelrecht. Der hier war sahnig und hatte Geschmack.
Claudia nickte, nahm sich einen Becher und holte einen Löffel aus der Schublade, doch dann legte sie beides ab.
»Du«, sagte sie leise und wendete ihren Blick ab, sah zur Tür, dann auf die Anrichte, »das ist wirklich ganz anständig von dir!«
Endlich sah sie ihn wieder an und hatte feuchte Augen.
»Ach, so teuer war das nun auch nicht!«
»Nicht das!«, sagte sie und kam dann ganz nah an ihn heran, um ihn kurz zu umarmen.
»Ach so, das …«, fiel es ihm ein, und es war ihm doppelt peinlich, »das war doch das Mindeste.« Seine erste Alimente-Zahlung war offenbar auf Claudias Konto eingegangen. Er zahlte das wirklich gern, und es riss kein Loch in seine Finanzen. Allerdings hatte es erst des Hinweises seiner Mutter bedurft, von alleine wäre er nicht darauf gekommen.
»Viele wären nicht so anständig, schon gar nicht in solchen Zeiten.« Claudia hob die Schultern. »Bin ja auch schuld, hätte was sagen müssen, damals.«
Falck winkte ab. Er hätte sich vielmehr gewünscht, ihre Umarmung hätte länger gedauert, und sie würden sich nicht immer nur mit Wangenkuss begrüßen und verabschieden. Jetzt waren sie Eltern eines Kindes, das in ihrer ersten und einzigen gemeinsamen Nacht entstanden war. Und doch verband sie dieses Kind nun für immer. Insgeheim fragte er sich, ob vielleicht irgendwann doch noch einmal ein richtiges Familienleben daraus entstehen würde. Überhaupt befand sich Falck seit dieser Zeit in einem seltsamen Zustand. Neben Steffi und Claudia gab es ja auch noch seine Exfreundin Ulrike, die aus dem Westen zurückgekehrt war. Auch sie hatte er geliebt, und obwohl sie ihn sehr verletzt und vor allem in eine äußerst verfängliche Situation gebracht hatte mit ihrer Ausreise noch vor dem Mauerfall, hatte der Gedanke an sie einen gewissen Reiz. Geschrieben hatte sie ihm schon mehrmals und immer wieder beteuert, wie leid ihr das alles tat und dass sie es wiedergutmachen wollte. Er konnte nicht behaupten, sie eindeutig zurückgewiesen zu haben, er hatte ausweichend geantwortet.
Wenn Claudia ihm jetzt ein Zeichen geben würde, eine Geste, ein Wort, dann wüsste er, was er tun würde. So aber blieb alles offen, war alles möglich und unmöglich. Irgendwie war es auch reizvoll. Doch irgendwann würde er sich entscheiden müssen.
»Wollen wir zu Julia gehen?«, fragte Claudia. »Sie wird bald aufwachen!«
Sie sahen alle drei gleichzeitig auf, als sich am Montagvormittag die Tür zu ihrem Büro öffnete, ohne dass jemand vorher angeklopft hätte. Frau Zille, die ihrer Abteilung zugewiesene Schreibkraft, winkte eine Frau ins Zimmer. Falck schätzte sie auf um die fünfzig.
»Ja?«, fragte Schmidt gedehnt. Frau Zille gegenüber schlug er einen deutlich moderateren Ton an, obwohl sie keine Polizistin war, oder vielleicht gerade deshalb. Frau Zille war immer sehr freundlich, wenn auch resolut. Sie kochte für sie ungefragt Kaffee, erstellte lesbare Fassungen von ihren Protokollen und war sehr geschickt darin, unliebsame Besucher abzuwimmeln.
»Das ist Frau Reinders, sie wurde mit ihrem Anliegen an unsere Abteilung verwiesen«, stellte sie jetzt die Frau vor und sah Schmidt dabei bedeutungsvoll über die Ränder ihrer Brille an. Schmidt nickte nur.
»Setzen Sie sich bitte«, forderte er Frau Reinders auf.
Frau Zille ließ ihren Blick noch ein, zwei Augenblicke auf Schmidt ruhen, wie eine Lehrerin, die mahnend in das Klassenzimmer blickte, bevor sie es verließ.
Schmidt erwiderte diesen Blick ungerührt und wandte sich dann an die Besucherin. »Wie können wir Ihnen denn helfen?«
Frau Reinders war modisch gekleidet, trug einen Rollkragenpullover unter dem aufgeknöpften Wintermantel und eine Pelzmütze. Sie hielt ihre Handtasche auf dem Schoß, nachdem sie sich hingesetzt hatte.
»Ich möchte meinen Sohn als vermisst melden«, sagte sie. Falck ahnte an der Art, wie sie es sagte, dass sie heute schon einige Male abgewiesen worden war.
Schmidt gab sich alle Mühe, sich seinen Unmut nicht anmerken zu lassen. Eigentlich gab es eine eigene Abteilung für Vermisstenfälle. Das war nicht die Aufgabe des Kriminaldauerdienstes. Schmidt räusperte sich.
»Wie alt ist denn Ihr Sohn?«
»Sechsundzwanzig. Wissen Sie, das habe ich heute schon drei Mal erzählt. Immer wies man mich ab. Dann bin ich zufällig Frau Zille über den Weg gelaufen. Wir kennen uns flüchtig.«
Schmidt ging nicht weiter darauf ein, blieb aber geduldig. »Seit wann ist er weg?«, fragte er dann.
»Seit Sonntag.«
»Also seit gestern.«
»Ja, das kann ich mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, er war Samstag schon weg. Da wollte er eigentlich zum Abendessen kommen.«
»Wohnt er allein?«
»Ja. Ich war heute schon bei seiner Wohnung. Da ist er nicht. Und die Nachbarn sagten, er sei Sonntag schon nicht da gewesen. Er würde nicht wegfahren, ohne mir Bescheid zu geben!«
»Haben Sie bei Bekannten oder Freunden nachgefragt?«, fragte Schmidt.
»Ja, habe ich. Erfolglos. Sonst wäre ich ja wohl nicht hier. Da muss etwas passiert sein. «
Schmidt sah nun doch einigermaßen gequält aus. »Frau Reinders, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber … wissen Sie, jeden Tag hauen Leute in den Westen ab. Manche auch ganz spontan.«
»Nein, das würde er nicht tun. Das weiß ich. Ich bin sicher, dem Jungen ist etwas geschehen.«
»Was macht Sie da so sicher?« Schmidt lehnte sich zurück, griff automatisch nach seiner Hemdtasche, ließ aber die Zigarettenschachtel dann anstandshalber doch unangetastet.
Frau Reinders atmete tief durch. »Mein Sohn war während seiner NVA-Zeit bei den Grenztruppen. Da kam es dreiundachtzig zu einem Vorfall, einem … illegalen Grenzübertritt. Mein Sohn sah sich gezwungen, zu schießen. Wissen Sie, ich muss Ihnen das ja nicht erzählen, aber er hatte keine andere Wahl. Hätte er nicht geschossen, hätte sein Streifenführer ihn gemeldet. Mario sagte mir, er hätte versucht, vorbeizuschießen. Er traf aber unglücklicherweise. Der … der Flüchtende ist gestorben, verblutet.«
Schmidt warf einen ungewohnt hilflosen Blick zu Falck, dann zu Bach. »Glauben Sie, das steht in einem Zusammenhang mit dem Verschwinden Ihres Sohnes?«
»Kommt Ihnen das denn so abwegig vor?« Frau Reinders sah in die Runde.
»Wissen Sie denn, wer das Opfer war? Kennen Sie den Namen?«, fragte Falck.
»Nein. Und was heißt denn hier ›Opfer‹? Er ist der Täter gewesen. Das war ein illegaler Grenzübertritt, ob es einem nun passt oder nicht. Egal, wie sich mein Sohn entschieden hätte, jede Entscheidung hätte sein Leben verändert, so oder so. Wenn er nicht geschossen hätte, hätte man ihn eingesperrt. Er ist eigentlich das Opfer.«
»Wir wollen hier nicht über die Deutung von Begriffen oder die Rechtslage debattieren«, übernahm Schmidt das Gespräch wieder. »Den Angehörigen dürfte der Name des Schützen nicht bekannt sein. Ich wüsste nicht, wie sie ihn herausgefunden haben sollten. Ich denke, Sie müssen sich hier wirklich in Geduld üben. In dieser neuen Zeit ist so mancher überfordert. Wenn Sie wüssten, was hier alles schon passiert ist.«
Frau Reinders hatte nur aus Höflichkeit abgewartet, bis Schmidt fertig war. »Die Angehörigen des Toten haben aber offenbar Anzeige erstattet, wegen Mordes. Noch im November oder Dezember letzten Jahres.«
Schmidt seufzte leise. »Aber gegen wen denn? Gegen den Staat oder Ihren Sohn persönlich? Das ist, wie gesagt, kaum möglich.«
»Mein Sohn hat nur Andeutungen gemacht. Er wollte nicht weiter darüber reden, weil Weihnachten war. Aber das alles hat ihn sehr mitgenommen. Einen Menschen umzubringen, auch wenn man nach Recht und Gesetz handelt, das lässt einen nicht kalt.«
Dass sie ihn ausgerechnet jetzt ansah, musste wohl Zufall sein, doch Falck spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss und leichte Übelkeit seinen Magen flutete.
»Frau Reinders«, sprach Schmidt weiter, »die Angehörigen können bestenfalls gegen den Staat geklagt haben, wie eine Million anderer Leute. Der Name Ihres Sohnes wurde nicht preisgegeben. Man müsste jahrelang in den Akten recherchieren, um die Vorgänge aufzudecken und zu analysieren. Dazu müsste man aber erst einmal Einsicht bekommen.«
»Ja, vielleicht hatte ja jemand Einsicht. Es wurden doch auch schon Stasizentralen gestürmt, und Unmengen von Akten kamen in alle möglichen Hände. Ich weiß nur: Mein Sohn ist weg, und er würde nie einfach so weggehen! Das weiß ich einfach.«
»Gut«, beschwichtigte Schmidt und nahm sich jetzt doch eine Zigarette. »Gut, angenommen, es ist so. Was sollten wir tun?«
Die Frage verblüffte Frau Reinders. »Sie sind doch die Polizei«, sagte sie und klang dabei weder überheblich noch aggressiv.
»Ich kann die Angelegenheit dem Staatsanwalt vortragen, der wird sie aller Voraussicht nach abtun. Ich bekomme keinen Ermittlungsbefehl. Also bekommen wir keine Akteneinsicht und keine weiteren Befugnisse. Wenn Sie nicht einen ganz konkreten Verdacht haben. Eine Morddrohung. Einen Erpresserbrief. Einen Hilferuf. Irgendetwas, das auf ein Verbrechen im Zusammenhang mit dem Verschwinden Ihres Sohnes hindeutet.«
Er hatte recht, wusste Falck und seufzte innerlich. Wie viele Leute waren sich sicher, dass ihre Kinder niemals abhauen, stehlen, vergewaltigen, morden, sich selbst umbringen würden. Suizid hatte die Frau offenbar noch gar nicht in Betracht gezogen. Die Tat hatte ihren Sohn so viele Jahre lang beschäftigt, nun war ihm der Rückhalt weggebrochen, der Staat, der ihn schützte und der ihm all die Jahre versichert hatte, richtig gehandelt zu haben. Jetzt galten Männer wie er als Mörder. Jetzt bestätigte die öffentliche Meinung, was Mario Reinders wohl selbst die ganze Zeit von sich zu wissen geglaubt hatte. Was, wenn er mit dieser Schuld nicht mehr hatte leben wollen?
Frau Reinders gab sich Schmidts Argumentation für diesen Moment geschlagen und schwieg. Dann sah sie auf.
»Und wenn ich Ihnen etwas liefere? Wenn ich in seine Wohnung gehe und etwas finde?«
»Dann schauen wir, was wir machen können«, sagte Schmidt.
Falck wusste, dass er das nur sagte, um sie loszuwerden, doch es funktionierte. Sie stand auf. »Bekomme ich Ihre Nummer?«
Bach kritzelte ihr eine Nummer und ihre Namen auf einen Zettel und gab ihn der Frau.
»Ich lasse Ihnen noch ein paar Fotos hier, ein paar ältere und eines von Weihnachten«, sagte Frau Reinders und holte aus ihrer Handtasche einen Briefumschlag heraus, den sie Steffi Bach gab, die am nächsten saß.
»Man muss nicht immer das Schlimmste vermuten«, wollte Bach sie trösten.
»Ich wäre nicht hier, wenn ich nicht das Schlimmste vermutete.«
»Der hat vielleicht einen Blinddarmdurchbruch und liegt in irgendeinem Krankenhaus«, meinte Schmidt, nachdem Frau Reinders gegangen war. »Oder er ist einfach nur abgehauen.«
Falck war aufgestanden, um sich mit Bach zusammen die Fotos anzusehen. Auf den Bildern war ein junger Mann zu sehen, mit Oberlippenbart, kurzen Haaren, einmal in NVA-Uniform, einmal mit seinem Motorrad, einmal in Badehose, einmal vor einem Weihnachtsbaum. »Wir könnten anfragen, ob es in den letzten zwei Tagen Selbstmorde gab.«
Bach wollte Schmidt die Fotos geben, der schüttelte aber nur den Kopf und zündete sich eine neue Zigarette an.
Bach steckte sie in den Umschlag zurück. »Wenn jemand den Tag und den Ort des illegalen Grenzübertritts weiß, noch dazu den Namen des Opfers, dann glaube ich schon, dass man die Sache eingrenzen kann. Wenn also jemand weiß, wo und wie er suchen muss, findet er den Vorgang. Entweder im NVA-Archiv oder bei der Stasi. Dann kann er Anzeige erstatten. Oder es war blanker Zufall.«
Schmidt winkte ab. »Aber was hat er davon? Ich glaube nicht, dass die jetzige Regierung Interesse hat, diese Fälle aufzuklären. Das wird Jahre dauern, ehe irgendeine Gesetzesgrundlage geschaffen wird. Immerhin haben die Grenzsoldaten nach dem damals vorherrschenden Recht gehandelt.«
»Wenn er den Vorgang genau benennen kann und Anzeige erstattet, wird die Anonymität des Schützen aufgehoben.« Bach zuckte mit den Achseln. »Glaube ich zumindest.«
Schmidt winkte ab. »Davon abgesehen, es ist nicht unsere Arbeit. Übrigens: Die andere Schicht hat berichtet, dass am Samstag ein Farbiger durch die Stadt gejagt wurde, über die Straße der Befreiung weiter über die Brücke bis zur Semperoper, wohin er sich hineinretten konnte. War ’ne Gruppe Glatzen, zehn Mann. Am helllichten Tag. Und die Leute haben zugeguckt. Passanten, Touristen.«
»Ich würde mich einer Gruppe Neonazis auch nicht in den Weg stellen«, wagte Bach anzumerken.
Schmidt grunzte. »Es heißt, ein paar hätten gelacht oder Beifall geklatscht. Ich sag euch, das dauert nicht mehr lang, da bringen die einen um.«
Dass ein paar Leute geklatscht hatten, konnte sich Falck gut vorstellen, doch die meisten hatten vermutlich nur Angst gehabt. Die Nazis traten so unverschämt auf. Selbst den dreizehnten Februar, den Tag, an dem Dresden fünfundvierzig im alliierten Bombenhagel untergegangen war, versuchten sie schon für sich zu vereinnahmen, als wären es nicht gerade die Nazis gewesen, die diesen Krieg erst angezettelt hatten.
»Das sind eben die Schattenseiten der neuen Zeit«, murmelte Bach, »ich lass mir die Wende nicht schlechtreden.«
»Wisst ihr, wer eigentlich den Begriff Wende geprägt hat?«, fragte Schmidt. »Egon Krenz, der wollte eine Wende einleiten, in der SED-Politik. Was so viel bedeutete wie: Wir tun ein bisschen als ob, und alles bleibt wie gehabt. Jetzt sagt jeder Wende. Dabei war es eine Revolution!«
Das Telefon brachte ihn um den Beifall für seine Ausführung, dementsprechend ungehalten ging Schmidt ran.
»Dauerdienst«, blaffte er, in seiner unnachahmlichen, stets gehetzt klingenden Art. »Ja, und? … Sie sind hier beim Kriminaldauerdienst. … Könnte ja sein, Sie haben sich verwählt … geht klar.«
Schmidt krachte den Hörer auf die Gabel. »Ein Holländer ist abhandengekommen«, sagte er und sah sie mit großen Augen herausfordernd an. Bach ergab sich zuerst.
»Ein Holländer?«, fragte sie.
Falck ließ sich diesmal nicht ins Bockshorn jagen. »Ein Gemälde?«, fragte er.
»Wie kannst du das gehört haben?«, knurrte Schmidt beleidigt. »In der Gemäldegalerie. Alte Meister.«
Falck freute sich insgeheim. Er hatte gar nichts gehört, nur seine Schlussfolgerungen gezogen.
Es war gar nicht so einfach, sich zur Gemäldegalerie Alte Meister im Zwinger durchzuarbeiten. Die ganze Innenstadt war voller Menschen. Schmidt stellte den Trabi direkt vor dem Semperbau des Zwingers ab, sie mussten nur noch die dreißig Meter bis zur Eingangstür laufen, wo ein Museumsmitarbeiter frierend auf sie wartete.
»Hier hängt doch die sechstonnige Martina, oder?«, fragte Schmidt.
»Bitte, wer?« Der Mann sah sie irritiert an.
»Er meint die sixtinische Madonna«, klärte Bach ihn auf und hatte für Schmidt nur Kopfschütteln übrig. »Heute ist doch eigentlich Ruhetag, oder?«, fragte sie. »Aber es ist trotzdem jemand da?«
»Es ist immer jemand da. Doktor Maschke wartet dort vorn auf sie. Das ist der Kurator und stellvertretende Direktor.« Der Mann wies ihnen den Weg in die Ausstellungsräume.
Doktor Maschke, ein hagerer, weißhaariger Mann von etwa sechzig Jahren, kam ihnen bereits entgegen.
»Sie sind die Spezialisten?«, fragte er hoffnungsvoll.
Schmidt nickte. »Spezieller geht’s gar nicht.«
»Ah ja.« Doktor Maschke schüttelte jedem eifrig die Hand.
Falck sah sich ehrfürchtig um. Er konnte sich nicht entsinnen, wann er das letzte Mal hier gewesen war, vermutlich als Schulkind mit seinen Eltern. Diese faszinierenden Räume müsste man viel öfter besuchen, dachte er bei sich und ahnte gleichzeitig, dass es bei dem Vorsatz bleiben würde.
»Da ist es, bitte«, sagte Maschke, nachdem er mit ihnen durch zwei Ausstellungsräume gegangen war und jetzt auf ein Bild von etwa siebzig Zentimetern im Quadrat deutete. Es handelte sich um das Porträt einer vollbusigen und etwas mehrdeutig lächelnden Frau in einem leinenen und recht offenherzigen Mieder.
»Das ist die Milchmagd von Hendrick ter Brugghen. Öl auf Eichenholz. Vermutlich um sechzehnhunderteinundzwanzig entstanden. Er war einer der nicht ganz so bekannten holländischen Alten Meister, ein Anhänger des italienischen Malers Caravaggio, zählte zu den sogenannten Utrechter Caravaggisten. Er wurde nur einundvierzig Jahre alt, schuf zahlreiche Gemälde, mit hauptsächlich religiösen und mythologischen Themen, aber auch einer ganzen Anzahl alltäglicher Personen. Von seinem Stil stark beeinflusst wurden spätere Maler wie Jan Vermeer, von dem das berühmte Mädchen mit dem Perlenohrgehänge stammt, der einige Jahrzehnte später seine Schaffenszeit hatte. Falls Sie es nicht wussten, Vermeer wurde auch nur zweiundvierzig Jahre alt. Das Leben als Künstler muss damals wirklich sehr entbehrungsreich gewesen sein.«
Schmidt nickte und hörte mit interessiertem Blick zu, und Falck wurde einmal mehr bewusst, wie angespannt er jedes Mal war, weil er die Reaktion seines Vorgesetzten nicht einschätzen konnte. Würde er sachlich bleiben, ironisch reagieren, sarkastisch, würde er seine schlechte Laune zeigen oder, was am schlimmsten war, versuchen, witzig zu sein?
»Das ist ja sicherlich alles sehr interessant«, begann Schmidt, »aber das Gemälde scheint ja offensichtlich da zu sein. Es hieß doch, es sei gestohlen?«
»Das ist es ja!« Mehr begeistert als betroffen durchbohrte Maschke mit dem Zeigefinger die Luft. »Es ist eine Fälschung. Das Bild wurde ausgetauscht!«
Schmidt beugte sich vor, und Falck fürchtete schon das Schlimmste, dass Schmidt an der Farbe kratzen würde, zum Beispiel.
»Wie wollen Sie das erkannt haben? Ich meine, Sie haben doch die Bilder nicht so genau vor Augen, dass Ihnen so etwas sofort auffällt?«
»Nein, allerdings. Es war wirklich Zufall. Das Bild wurde kürzlich von einer unserer Restauratorinnen gereinigt. Heute war sie da, um sich ihr Werk vor Ort zu betrachten. Da fiel es ihr auf. Morgen wird ein Experte aus Westdeutschland kommen, der diese Fälschung hier analysieren soll. Vielleicht bekommen wir Hinweise darauf, wer diese angefertigt hat. Es gehört schon einiges Wissen und Geschick dazu. Der Fälscher muss es ja nicht nur ›nachmalen‹ können, sondern er muss auch über die Materialien der damaligen Zeit, die Art und Weise des Auftrags, der Grundierung informiert sein. Noch dazu braucht es ein gewisses Geschick, das Bild aus seinem Rahmen zu entfernen und auszutauschen …«
»Moment, bitte«, unterbrach Schmidt ihn und hob beide Hände. »Eines nach dem anderen.«
Maschke stoppte abrupt, sah Schmidt jedoch freundlich fragend an.
»Wieso denn ein Westdeutscher?«
»Nun, der Mann gilt als Experte für diese Epoche der holländischen Malerei.« Fast entschuldigend hob Maschke die Schultern.
»Aber wenn das eine Fälschung ist, wird sie doch jemand aus der DDR angefertigt haben. Wie kann denn ein Westdeutscher Hinweise auf den Fälscher finden?«
»Nun, ich habe den Mann nicht ausgesucht. Das haben andere bestimmt.«
»Na gut«, gab Schmidt sich zufrieden. »Zuerst benötigen wir die Namen aller Mitarbeiter hier, die Dienstpläne …«
»Also, für unsere Leute hier lege ich meine Hand ins Feuer.«
Schmidt brachte Maschke mit nur einem Fingerzeig wieder zum Schweigen. »Da wäre ich vorsichtig«, sagte er in einem Tonfall, den Falck noch gar nicht kannte. »Ich bin jahrelang mit einem Kollegen und Freund durch dick und dünn gegangen, wie man so schön sagt.« Jetzt kippte der Ton schon wieder ins Ironische. Schmidt schien so verletzt, dass er es gar nicht anders ertragen konnte. »Dann hab ich erfahren, dass er mich für die Stasi bespitzelt hat.« Schmidt hielt inne. »Egal. Also, Namen und Dienstpläne. Dann den Zeitraum, in dem das Bild verschwunden sein könnte. Den Namen der Restauratorin benötigen wir natürlich zuerst.«
»Den kann ich Ihnen gleich nennen. Karina Schüttauf, sie arbeitet seit fast zwanzig Jahren für uns.«
»Wo wohnt sie?«
»In dem vorderen Hochhaus auf der Michelangelostraße, was ja eine ganz nette Koinzidenz darstellt, nicht wahr?« Maschke amüsierte sich über seinen eigenen Witz.
Schmidt ging gar nicht darauf ein, so etwas fand er nur lustig, wenn es aus seinem eigenen Mund kam. Er machte mit dem Zeigefinger eine kreiselnde Bewegung, die an Falck und Bach gerichtet war. Sie sollten eine Durchsuchung der Wohnung veranlassen.
Zwischen Falck und Bach entspann sich daraufhin ein wortloses kleines Duell darüber, wer von beiden zum Auto gehen musste. Falck hob Notizbuch und Stift an. Er hatte zu tun. Bach kniff die Lippen zusammen, gab sich geschlagen und marschierte ab.
»Was ist dieses Bild eigentlich wert?«
Maschke hob in einer langsamen Bewegung die Schultern. »Schwer zu sagen. Ein paar hunderttausend Mark auf jeden Fall.«
»DDR-Mark?«
»Nein, D-Mark. Die Zeiten haben sich geändert, wissen Sie ja, ich fürchte, da wird noch einiges auf uns zukommen. Den Kunstsammlern öffnet sich ja ein Markt, der Jahrzehnte so gut wie verschlossen war. Da tun sich jetzt Möglichkeiten auf, viel Geld zu verdienen.«
Schmidt nickte scheinbar zustimmend, doch Falck sah, dass er gedanklich ganz woanders war.
»Sagen Sie«, begann der Hauptmann irgendwie unheilvoll, »wäre nicht zufällig die Restauratorin hier gewesen, hätten Sie die Fälschung vermutlich nicht entdeckt, oder?«
»Vermutlich nicht, nein. Das gebe ich zu, so genau hat man die Bilder nicht im Kopf. Da kann man jahrelang Kunsthistorik studiert haben, und diese Fälschung hier ist ja auch hervorragend gemacht.«
»Ist es dann nicht auch möglich, dass hier schon einige andere Gemälde ausgetauscht wurden?«
»Na, das ist ja ganz und gar …« Maschke sprach nicht zu Ende, stattdessen drehte er sich um und betrachtete die Bilder und Gemälde um sich herum. Dann sah er wieder Schmidt an, der eine gewisse Befriedigung in seinem Blick hatte, fiel Falck auf. Es gehörte nicht viel dazu, dachte er sich, zu erkennen, dass sein Vorgesetzter die Verunsicherung anderer brauchte, um seine eigene zu verbergen.
»Vielleicht müssen Sie mal eine groß angelegte Untersuchung durchziehen.«
Maschke nickte langsam und nachdenklich, seine fast freudige Erregung, die nicht dem Diebstahl des Originals, sondern eher der Fingerfertigkeit des Fälschers und Diebes geschuldet war, verflog gänzlich.
Nun schien es Schmidt fast leidzutun. Und ihm tat Schmidt leid, stellte Falck fest. Dem Mann war vor einiger Zeit die Frau weggelaufen, seine Kinder durfte er nicht sehen, und jetzt noch die Sache mit seinem ehemaligen Freund und Kollegen, von der Falck bisher noch gar nichts gewusst hatte. Schmidt war zutiefst verletzt, wollte es aber nicht eingestehen und schon gar nicht sich anmerken lassen.
»Ich fürchte«, meinte Maschke nach einigem Nachdenken, »jetzt wird erst recht niemand Interesse an einer derartigen Inventur haben. Es gab ja schon den einen oder anderen Fall von Kunstraub in unserer Republik, der in Fachkreisen bekannt wurde. Es gab nur eine Richtung, in die solche Kunstgegenstände gewandert sein können. Zur Devisenbeschaffung.« Nun wirkte Maschke auf einmal fast deprimiert.
»Ist es sehr kompliziert, das Bild aus dem Rahmen zu nehmen?« Schmidt inspizierte den goldenen, verzierten Rahmen näher.
»Es bedarf schon gewisser Kenntnisse.«
»Ich gehe davon aus, dass der Täter sich auskannte. Das Gemälde wird sicher nicht zur Besuchszeit ausgetauscht worden sein«, überlegte Schmidt. »Schwer ist es nicht? Ich meine, vom Gewicht.«
»Nein, tatsächlich ist es ja nur ein dünnes Brett.«
»Ist es möglich, dass das echte Gemälde nach der Restauration gar nicht wieder zurückgekehrt ist?«
Maschke riss die Augen auf. »Sie meinen, Frau Schüttauf …?«
»Ich meine erst mal gar nichts. Haben Sie oder jemand anderes den Rahmen angefasst?«, fragte Schmidt.
»Ja, habe ich. Und Frau Schüttauf sowieso.«
Jetzt kam Bach zurück. »Geht klar«, sagte sie nur, »wir können gleich los.«
»Gut«, sagte Schmidt, »klärt ihr das, ich bleibe hier und lasse die Spurensicherung kommen.«
3
Falck legte den Kopf in den Nacken und blickte an dem Sechzehngeschosser hoch. Hier eine Wohnung zu bekommen, das hatte er sich immer gewünscht, und wenn es nur eine ganz kleine war. Es gab hier Ein- oder Zweiraumwohnungen, das würde vollkommen genügen. Endlich raus aus der Wohnung der Schurigs. Nicht, dass sie ihn loswerden wollten, im Gegenteil, doch ihm war es langsam einfach zu lästig. Immerhin war er inzwischen fast Ende zwanzig. Die Zeiten hatten sich geändert, er würde bestimmt etwas finden. Insgeheim malte er sich aus, Claudia überraschen zu können, mit einer schönen warmen Wohnung, einem weiten Blick über Dresden, in Zentrumsnähe. Doch dazu müsste er wissen, wie es mit ihnen beiden weitergehen sollte. Noch dazu schob sich ihm gerne mal das Bild seiner Kollegin in den Kopf.
»Na, träumst du was Schönes?«, fragte Bach.
Sie stieß die Metalltür zum gläsernen Vorhaus auf. Die eigentliche Eingangstür war zu. Hier gab es eine Sprechanlage.
Falck deutete nach draußen, zwei Kinder näherten sich. Sie betraten das Vorhaus, grüßten artig, schlossen dann auf. Falck stellte seinen Fuß unauffällig in die Tür. Sie traten ein, als die Kinder um die Ecke verschwunden waren.
»Aufzug?«, fragte Bach.
»Sie wohnt in der Achten!« Für Falck erschloss sich die Antwort automatisch.
Bach drückte den Aufzugsknopf. Beide Aufzüge waren gerade unterwegs.
»Allein fahr ich mit so was nicht. Ich wurde mal begrabscht in so ’nem Ding.«
»Den hast du doch locker umgeschmissen, oder?«
»Da war ich zwölf oder so. Wir haben in Prohlis in den Sternhäusern gewohnt. Den Typen hatte ich noch nie gesehen, der hat mir regelrecht aufgelauert, und hätte sich mein Vater nicht gewundert, warum ich nicht schon oben bin, und in das Aufzugsfenster reingeguckt, wer weiß, was da noch passiert wäre.«
Sie mussten den ganzen langen Flur bis ganz nach hinten laufen, um die Wohnung von Frau Schüttauf zu finden. Auf ihr erstes Klingeln hin reagierte nur ein Hund mit Bellen. Auf das zweite Klingeln hin öffnete ihnen ein Mann, circa um die fünfzig.
»Kripo Dresden. Herr Schüttauf?«, fragte Bach und zeigte ihre Marke.
Der Mann nickte zögernd. »Was wollen Sie denn?« Ein kleiner Hund, ein Spitz, kam in den Flur, sah sie an und knurrte.
»Wir haben einen Durchsuchungsbescheid. Ist Ihre Frau zuhause?«
»Gerade nicht.« Der Mann wich zurück und machte eine einladende Geste.
Es kam Falck seltsam vor, dass der Mann gar nicht wissen wollte, warum sie die Wohnung durchsuchen wollten. Sie betraten die Wohnung, der Hund wich mit kleinen Schritten zurück, ohne sie aus dem Blick zu lassen.
»Wann kommt sie denn wieder?«, fragte Bach und sah sich dabei neugierig um.
»Ich denke, sehr bald. Sie macht nur Besorgungen.«
Oder schafft etwas weg, dachte Falck.
»Wo genau ist sie hin?«, fragte Bach.
»In die HO-Kaufhalle, nehme ich an. Ich muss auch eigentlich weg, ich muss zur Schicht. Können Sie draußen warten, bis meine Frau kommt?«
Bach runzelte die Stirn. »Sie haben verstanden, wer wir sind?«
»Ja, aber können Sie die Wohnung nicht durchsuchen, wenn meine Frau da ist? Oder meinetwegen bleiben Sie hier, ich gehe los. Ich möchte nicht unpünktlich zur Arbeit erscheinen.«
»Erzählt Ihnen Ihre Frau gelegentlich mal etwas?«
»Was soll sie mir denn erzählen?«
»Meine Kollegin meint, ob sie Ihnen Interna aus ihrem Restauratoren-Beruf erzählt, dass heute etwas geschehen ist und solche Sachen«, konkretisierte Falck.
»Ist denn etwas geschehen?«, fragte Schüttauf zurück. Er schien nervös zu sein und hatte es offenbar wirklich eilig.
Falck schüttelte den Kopf. »Wenn Sie nichts wissen, bleibt es auch dabei. Und es ist erforderlich, dass Sie hierbleiben. Wir schreiben Ihnen auch gern eine Entschuldigung!«
»Also gut!« Der Mann seufzte und ging mit ihnen ins Wohnzimmer. »Dann sehen Sie sich um«, sagte er und setzte sich an den Esstisch.
Er fragte nicht einmal nach dem Durchsuchungsbescheid, stellte Falck fest. Eigentlich sollte sich die Suche als nicht so kompliziert erweisen. Ein Gemälde, auch wenn es nicht so groß war, versteckte sich nicht so leicht.
»Ich fang im Schlafzimmer an«, verkündete Bach.
Falck öffnete ein paar Türen der Schrankwand, die aus DDR-Produktion stammte und noch neu war. Oder sie war einfach gut gepflegt, weil man auch auf solche Dinge ewig hatte warten müssen. Genauso lange wie auf einen Farbfernseher, eine Radioanlage oder auch ein gutes Fernglas. Jetzt sollte es das alles geben, schneller, preiswerter vielleicht. Fraglich war nur, ob man den Dingen dann denselben Wert beimaß. Ob man sich genauso daran erfreuen konnte. Es gab immer eine Kehrseite.
Falck bückte sich, sah unter das Sofa. Dann presste er sein Gesicht dicht an die Wand, um hinter die Schrankwand zu sehen, trat weit zurück, reckte sich, um zu sehen, ob auf ihr etwas lag, tastete die Polster der Couch ab, sah unter dem Tisch nach, zog die Platten vom Ausziehtisch auseinander. Schüttauf sah ihm teilnahmslos zu.
Dann betrat Falck die kleine Küche, sah sich um und fragte sich, warum die Frau das Gemälde zuhause aufbewahren sollte. Es gab andere Möglichkeiten. Selbst ein Schließfach auf dem Bahnhof schien ein besserer Ort zu sein.