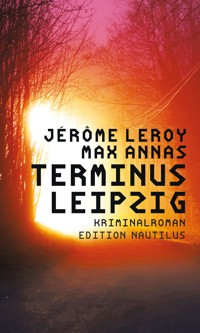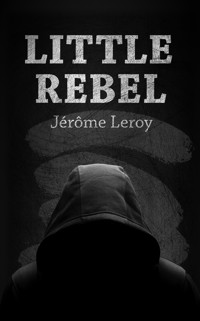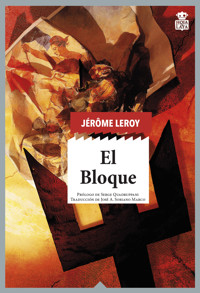Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Man nennt sie die "Verdunkelten". Plötzlich gehen sie, eines Morgens, nehmen nur das absolute Minimum mit sich, oder auch gar nichts. Ohne eine Spur verlassen sie ihre Partner, Kinder, Haustiere – so viele, dass die Polizei nicht einmal mehr Vermisstenanzeigen aufnimmt. Sie lösen sich in Luft auf, wie die ganze Epoche sich auflöst: Öffentliche Gebäude und Plätze sind von Attentaten verwüstet, der Müll wird nicht mehr abgeholt, Tränengas hängt in der Luft. Seit den Anschlägen von 2015 befindet sich Frankreich in einem Zustand ständigen Aufstands. Der Geheimdienst versucht, dem Phänomen auf die Spur zu kommen. Auch Guillaume Trimbert, 55 Jahre alt, Autor, ehemaliger Lehrer, ehemaliger Ehemann, ehemaliger Held linksextremer Demos, hat eine "Gefährder-Akte", und Agnès Delvaux, gerade 30 Jahre alt, Hauptmann des Geheimdienstes, beobachtet ihn. Sie dringt in seine Wohnung ein, sobald er diese verlässt. Aber was treibt sie dazu, nicht nur seinen Briefkasten zu durchwühlen, sondern auch an seinen Hemden zu schnuppern und seine Platten zu hören? Siebzehn Jahre später, in einem idyllischen Weiler, der inzwischen wieder von Karren und Kaminfeuern geprägt wird, erzählt Agnès ihrer Tochter Ada, was ihr Leben verändert hat zu einer Zeit, als sich die Welt veränderte. "Gesellschaftskritik und Utopie gehen Hand in Hand in diesem Buch, das daherkommt wie ein Thriller. Was sich am Ende zeigt, ist eine machtvolle und erschütternde Parabel." L'Humanité "In geschliffenstem Stil entfaltet Leroy hier eine Art unzeitgemäße Melancholie, ein Lob auf das Nutzlose als Mittel des Widerstands und auf die nicht für den augenblicklichen Anschluss an alles aufgewendete Zeit." Libération "In diesem knarzenden Thriller malt Jérôme Leroy das Verlassen und die Poesie als Massenvernichtungswaffen gegen den Kapitalismus aus. Ein köstlicher Kampf, bei dem Oblomow die World Company niederstreckt." Paris Match
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JÉRÔME LEROY
DIE VERDUNKELTEN
KRIMINALROMAN
AUS DEM FRANZÖSISCHEN ÜBERSETZTVON CORNELIA WEND
Die Originalausgabe des vorliegenden Buches erschien unter dem Titel Un peu tard dans la saison © Éditions La Table Ronde, 2017.
Dieses Buch erscheint im Rahmen des Förderprogramms des französischen Außenministeriums, vertreten durch die Kulturabteilung der französischen Botschaft in Berlin.
Die Quellenangaben zu den literarischen Zitaten finden Sie auf Seite 221.
Edition Nautilus GmbHSchützenstraße 49 aD - 22761 Hamburgwww.edition-nautilus.deAlle Rechte vorbehalten© Edition Nautilus GmbH 2018Deutsche ErstausgabeSeptember 2018Umschlaggestaltung:Maja Bechert, Hamburgwww.majabechert.deePub ISBN 978-3-96054-084-7
Für Dominique Forma
Inhalt
PROLOG: Ada ist schließlich auch noch da
ERSTER TEIL: Aufhören ist schwierig
Das muss an der Kälte liegen
Wie eine Farbe verblasst
Die Überlebenden kontaktieren
Den Schlüssel zu Zimmer 27 und einen Gedichtband
Neben mir in einem dunklen Kinosaal
Wie oft trafen wir einander und schieden im Streit
Es war nie lange schön in dieser Gegend
Ein Kinderspiel
Aber vor allem beschäftige dich mit etwas anderem
Während des Transports wird er schlafen
Seine grünen Augen, deren Farbe sich je nach Wetter änderte
Aber vor fünf Minuten war er noch da
Mehr schlecht als recht um seinen Hals
Kleine Kriegsfragmente eingebettet ins tägliche Leben
Ihr Kontakt zu den Vögeln
ZWEITER TEIL: Man liquidiert und geht von dannen
Mit einem kleinen Salat aus frischen Kräutern
Auch diese Fertigkeit ist uns verlorengegangen
Auf einer Chaiselongue
Du solltest es doch lassen, Trimbert, also lass es …
Ich kannte immer noch nicht die Beschaffenheit seiner Haut
Es entscheidet sich gerade
Ein Leinenanzug, der ihm etwas zu weit war
In einem Frühling, den man daran hätte hindern sollen jemals vorbeizugehen
Ich fahre sicher gerade in ein Funkloch
In Parallel-Einsamkeiten
Und jetzt werden Sie die Geschichte verlassen
EPILOG: Und Ada lebt mit der Sanftmut, für immer.
»Die Idee wegzugehen ist mir nicht plötzlich gekommen. Sie hat sich vielmehr in Form eines langsamen Schwindels aufgedrängt, so wie das Bild seines Falls den Mann verfolgt, der zu Fall kommt.«
ANTOINE BLONDIN, L’Humeur vagabonde
PROLOG
Ada ist schließlich auch noch da
Ich könnte versuchen, von dem Punkt aus, an dem ich jetzt bin, an dem wir nunmehr alle sind, die Geschichte der Reihe nach zu erzählen. Eine Geschichte aus der Welt davor, eine Geschichte einer zu Ende gehenden Welt. Es wäre meine Geschichte. Und seine. Keinesfalls unsere, denn die Ironie des Ganzen ist, dass wir uns letzten Endes kaum gekannt haben, er und ich.
Ich weiß jedoch nicht, ob es mir gelingt, sie der Reihe nach zu erzählen. Ich habe nur lückenhafte Erinnerungen, unvollständige Unterlagen und Tonaufnahmen, die man bald nicht mehr abspielen kann, da wir von nun an alles, was uns einst als technischer Fetisch diente, einem glücklichen Vergessen anheimgeben. Wir reparieren die Geräte nicht, wir brauchen sie nicht mehr.
Wir beide geben gute Anschauungsobjekte dafür ab, wie der Wahnsinn in unterschiedlicher Stärke und Ausprägung nach und nach von uns allen Besitz ergriffen hat, in einer vergleichsweise kurzen Zeitspanne, wenige Jahre oder auch nur Monate. Wir übten beide Berufe aus, die nicht sehr weit verbreitet waren und uns eine privilegierte Sicht auf das ermöglichten, was wirklich im Gange war. Rein äußerlich betrachtet waren sie zwar ziemlich verschieden, der Sache nach aber weniger.
Selbst wenn ich in dieser neuen Welt, die noch in den Kinderschuhen steckt, keinen einzigen Leser finden sollte, so ist Ada schließlich auch noch da. Sie will es womöglich wissen, so wie auch ich es wissen wollte. Oder ist es ihr völlig egal? Ich habe keine Ahnung. All das ergibt vermutlich keinen Sinn für sie. Und angenommen, sie liest es, weil es ihr nicht völlig egal ist, verzeiht sie mir dann, hasst sie mich oder lacht sie einfach darüber, wie über eine mäßig komische Anekdote ohne tiefere Bedeutung? Ich bin nicht imstande zu sagen, wie sie reagieren wird, sie, die Teil dieser neuen Welt ist und bald ihren siebzehnten Geburtstag feiert. Sie ist ein Kind der Welt danach. Ich trete ans Fenster des Landhauses, man sieht bis zum Horizont nichts als Hügel, sanft gewellt, wie in der Toskana, ohne den geringsten Hinweis auf die Anwesenheit von Menschen, abgesehen vielleicht von diesem ockerfarbenen Fleck dort hinten zwischen den Zypressen, er könnte das Dach eines Bauernhauses sein.
Ich strecke mich im Sonnenlicht, blicke auf den Tisch aus rohem Holz, in das pudrige Licht. Da steht eine Teetasse, die runde Abdrücke auf den Unterlagen hinterlassen hat, auf denen man mal seine, mal meine Handschrift erkennt. Da sind Blätter, Hefte, ein paar Fotografien und ein Laptop, der bald keinen Nutzen mehr hat, wenn die Batterie aufgebraucht ist. Mein Drucker ist gestern nach dem letzten Ausdruck kaputtgegangen. Ich werde wieder mit der Hand schreiben wie früher.
Der Rat der Gemeinden und Regionen hat vor einem Monat beschlossen, dass wir von jetzt an keinen Strom mehr benötigen. Ich habe selbst dafür gestimmt und Ada auch. Das Elektrizitätswerk von Barcelonne-du-Gers, das letzte, das noch läuft, wird den Betrieb einstellen. Wer möchte, kann sich zu seinem persönlichen Gebrauch immer noch Solarmodule basteln oder, wer an einem Fluss lebt, eine Mühle bauen. Ich wette, das werden nicht viele sein. Das Licht von Kerzen, Öllampen oder Holzfeuern verleiht unseren Abenden ganz neue Farben, menschlichere.
Da muss ich an ein Ereignis denken, das schon sehr lange zurückliegt, den großen Sturm von 1999, als an Silvester ohne Vorwarnung der Strom ausfiel, während wir beim Essen saßen. Nach einem kurzen Moment der Orientierungslosigkeit, begleitet von einigen nervösen Lachern, ging die Feier mit Kerzenleuchtern weiter, die man aus diversen Ecken hervorholte. Die Unterhaltung nahm daraufhin eine andere Wendung, die Stimmen wechselten die Tonlage, die Gesichtszüge veränderten sich, sie wirkten sanfter, traten im Halbdunkel deutlicher hervor. Als nach zwei oder drei Stunden der Strom wieder da war, hatten alle das Gefühl, aus einem Traum herausgerissen zu werden, ich zumindest. Ich war damals siebzehn und mit siebzehn ist man noch nicht ernst zu nehmen.
Jetzt ist die Welt wieder siebzehn Jahre alt und Ada ist genauso alt, oder fast. Unsere Tage sind im Winter kurz und im Sommer auf betörende Art unendlich. Wir kehren zu einem archaischen Rhythmus zurück, das heißt, zu einem, der Sinn macht. Ich weiß seitdem auch, dass uns, wenn wir die Dichter, die er liebte, in der Helligkeit einer Halogenlampe oder auf dem Bildschirm eines Tablet-Computers lasen, etwas von dem verloren ging, das sie uns sagen wollten. Ich bin sicher, er hätte das genauso gesehen und es hätte ihm gefallen, die Verse, die er auswendig kannte, im Schein einer Flamme aufflackern zu sehen.
Vergnügte Schreie hallen vom Taubenschlag herüber. Die Kinder aus dem Dorf haben ihren Spaß, und ich höre, ohne sie zu sehen, Ada heraus, an ihrer etwas dunkleren, ruhigen Stimme, mit der sie den Jüngeren gerade ein altes Spiel erklärt.
Das wird ein schöner Tag.
Von nun an werden sie alle schön.
ERSTER TEIL
Aufhören ist schwierig
»Im Laufe der Stunden, der Tage, der Wochen machst du dich von allem frei. Du stellst fest, manchmal fast mit einer Art Trunkenheit, dass nichts dich belastet, dir gefällt oder missfällt.«
GEORGES PEREC, Ein Mann der schläft
Das muss an der Kälte liegen
Es war kurz vor den Attentaten, als ich herausfand, wer er war, und ihn aufspürte. In den letzten Dezembertagen des Jahres 2014, während der Feiertage, wie man gemeinhin sagt. Er wohnte in einer schönen Wohnung in der obersten Etage am Square Henri Delormel im 14. Arrondissement, seit er vor etwa fünfzehn Jahren nach Paris gekommen war. Achtzehn Monate später sollte der Colonel mir von der neuen großen Angst berichten, die bei der Staatsgewalt umging, der Angst vor der Verdunkelung und vor denen, die man beim Geheimdienst und in gewissen Regierungskreisen die Verdunkelten nannte, in Ermangelung eines besseren Ausdrucks.
Die Wohnung mietete er gegen ein lächerliches Entgelt von seiner Mäzenin. So nannte ich sie, seit ich von ihrer Existenz wusste. Ich fand kein anderes Wort dafür. Puffmutter wäre nicht korrekt gewesen und hätte zudem meinen ersten, ungünstigen Eindruck zu sehr durchscheinen lassen. Eins stand jedenfalls fest, allein von seinen Tantiemen, dem Zeilenhonorar für seine Artikel und dem, was er durch die Mitarbeit an ein paar Drehbüchern verdiente, hätte er sich diese Wohnung mit den Möbeln aus den 30er Jahren und Blick auf den hübschen Innenhof nicht leisten können.
Als ich das erste Mal dort war, schaute ich von der Rue Ernest-Cresson aus ziemlich lange zu seinen Fenstern hoch. In dem Moment wusste ich noch nicht genau, was ich tun wollte. Oder doch, eigentlich schon. Aber ich hatte es noch nicht in Worte gefasst. Das Unbewusste. Es gehörte zu den Dingen, an die Militärs nicht glaubten – womit sie immer gut gefahren waren – und Spione erst recht nicht.
Und wenn man beides in einer Person war, wie in meinem Fall …
Es war kalt in diesem Hof. In der Mitte stand ein Weihnachtsbaum, und ein kleines Mädchen probierte mit Hilfe seines Vaters – zumindest vermute ich, dass es sein Vater war – seine Inlineskates aus, sicherlich ein Weihnachtsgeschenk. Ich hatte die Kapuze meines Dufflecoats über den Kopf gezogen, in dem ich nach Meinung des Colonels wie eine ewige Gymnasiastin aussah. Der Colonel, der selbst in seinen erotischen Phantasien ein Traditionalist war, gab mir ein Gefühl von Sicherheit. Und darum liebte ich ihn vermutlich. Letztendlich war ich eher einfach gestrickt.
Verrückt vielleicht, aber nicht kompliziert.
Ich weiß nicht, ob ich an dem Tag gehofft hatte, ihm zufällig zu begegnen. Es wurde dunkel, und zugleich setzte leichter Schneeregen ein, die feuchte Kälte zog mir in die Knochen. Ich hätte ihn auf Anhieb erkannt, glaube ich. Durch die Fotos, die es im Internet von ihm gab, durch seine wenigen Fernsehauftritte. Ich wusste ziemlich genau, wie er aussah.
Ich konnte ihm sogar ansehen, ob er müde war, genervt oder glücklich. Ich hatte seine Brillen-Wechsel zur Kenntnis genommen, seine Gewichtszunahme, seine Diätversuche, und welche Hemdenfarben gut zu seinem Teint passten. Darauf achtete er offenbar, denn auf den Pressefotos trug er immer ähnliche Farben. Er sah wie ein alter Preppy aus. Das passte zu seiner Doo-Wop-Plattensammlung und seinem 504er-Cabriolet, das er kaum noch fuhr.
Für die übrigen Informationen gab es eine Akte, und er hatte sogar seinen eigenen kleinen Gefährdervermerk, der unscheinbare Schriftsteller. Man konnte ihn auf den ersten Blick schwer einschätzen: Er war Kommunist, zahlte bis heute seine Beiträge, aber war seit seinem Weggang aus Lille 2001 nicht mehr aktiv. Er hatte mehrere Artikel in der rechten Presse veröffentlicht, zählte Royalisten, die inzwischen mehr oder minder solide geworden waren, zu seinen Freunden, unterhielt aber auch Kontakte zu den Anarchisten vom Plateau de Millevaches. Er war unter anderem sehr eng mit einem anderen Krimiautor befreundet, Simon Tavaniello, und hatte bei den Unruhen 2005 und dem Fiasko von Tarnac 2008 mehrere ziemlich radikale Petitionen unterschrieben.
Tavaniello seinerseits hatte eine bewegte Jugend hinter sich. Nachdem er in den 70ern kurz mit dem Gangstertum geliebäugelt hatte, saß er eine Weile in einem niederländischen Gefängnis ein, weil er verdächtigt wurde, bei einem Überfall zur Finanzierung revolutionärer Aktionen logistische Unterstützung geleistet zu haben. Nach ein paar Monaten wurde er aus Mangel an Beweisen entlassen, ließ sich in Belleville nieder und beteiligte sich direkt oder indirekt an Aktionen der Linksextremen. Unter anderem betreute er geheime Publikationen, in denen propagiert wurde, »die Gesellschaft des Spektakels und der Warenwirtschaft« für immer abzuschaffen, wie es im Post-Situationisten-Slang hieß. Er veröffentlichte auch Krimis und Essays über den Anti-Terror-Kampf als Ideologie und letztes Mittel des Kapitalismus zur Aufrechterhaltung der Ordnung.
Dieser Simon Tavaniello sah das alles ganz richtig, auch wenn die Wahrheit weit darüber hinausging. Er mochte uns nicht, weil er uns durchschaut hatte, ohne uns zu kennen. Ich fand das sehr intelligent und ziemlich unterhaltsam, wie er sich so herantastete. Ich war selbst eine Spielernatur, in meiner Domäne. Dann ließ Tavaniello sich in Eymoutiers nieder, in einem Haus auf einer Anhöhe oberhalb der kleinen Stadt. Unterhalb seines abschüssigen, von Bäumen zugewachsenen Gartens floss die Vienne vorbei.
Dort habe ich mir einmal die Hände gewaschen. Das Wasser war eiskalt, der Himmel blau, man hörte die Stiftskirche von der anderen Seite eine dieser hohlen Nachmittagsstunden schlagen, die etwas Trügerisches haben, weil sie suggerieren, es gäbe Momente am Tag, in denen nichts passiert.
Aber für Tavaniello interessierte ich mich nicht, oder jedenfalls noch nicht. Ich interessierte mich für ihn und zwar nur für ihn.
Um ehrlich zu sein, las ich aus den Angaben, die mir zur Verfügung standen, einen gewissen Hang zum Schmierenkomödiantentum heraus, gepaart mit einer leichten geistigen Verwirrung. Er war also ein Verwirrter. Und er wartete wie so viele andere darauf, sich langsam zu verflüchtigen, hinzuwerfen, einen Schritt zur Seite zu tun statt nach vorne.
Er wartete darauf, ein Verdunkelter zu werden.
Seine Fenster waren erleuchtet. Das war nicht oft der Fall. Er war einer jener vagabundierenden Schriftsteller, die davon lebten, an den abgelegensten Orten, in einem Vorort von Arras oder im Herzen der Ariège, Lesungen in Büchereien abzuhalten, oder von Stipendien für den Aufenthalt in einer Schriftsteller-Residenz in der hinterletzten Ecke der Creuse oder des Pays d’Auge, oder von Auftritten auf Messen zum Thema Kriminalliteratur, Jugendliteratur oder Poesie.
Er wollte offenbar nicht allein von den Zuwendungen seiner Mäzenin abhängig sein. Männer in seinem Alter logen sich gerne etwas vor. Das Problem war, dass sie schlecht darin waren, und dass sie eines Tages aufhörten, sich etwas vorzulügen, weil sie es nicht mehr schafften. Also fingen sie wahlweise an zu trinken, begingen Selbstmord oder, das war neu, verdunkelten sich.
Ich war gerührt, wie ich da so im Hof stand.
Ich war gerührt und mir war kalt.
Am Ende überwog die Kälte.
Ich ging zurück in die Avenue du Maréchal-Leclerc, betrat einen chinesischen Imbiss, aß Nems und kantonesischen Reis und trank grünen Tee. Literweise grünen Tee. Ich hatte verdammt große Mühe, mich wieder aufzuwärmen.
Irgendwann kam die Chinesin, die hinter dem Tresen stand, mit Papierservietten zu mir herüber.
»Sie weinen ja, Mademoiselle …«
»Ach ja? Das muss an der Kälte liegen.«
Wie eine Farbe verblasst
Man müsste sich verflüchtigen, ein für alle Mal verschwinden. Ich rede selbstverständlich nicht von Selbstmord. Nein, einfach weggehen. Ich weiß nicht, ob »weggehen« das richtige Wort ist. Man muss sich dazu nicht geografisch entfernen, nicht unbedingt. Man könnte zunächst in einem anderen Viertel leben, wenn die Stadt groß genug ist. Das würde schon reichen, zumindest für den Anfang. Dann hätte man eine neue Wohnung, ein neues Haus, einen anderen Garten, einen anderen Blick auf die Dächer, die Bäume, die Kirchtürme …
Allein schon durch die Tatsache, dass ich dann andere Wege zurücklegen würde, wäre ich so gut wie unsichtbar, das wäre ein guter Anfang. Die Stadt sähe anders aus, die Gesichter der Entgegenkommenden ebenfalls. Man müsste auch seinen Tagesablauf variieren, nicht mehr zur gewohnten Zeit rausgehen. Das könnte für eine Weile dieses immer drängender werdende Bedürfnis befriedigen, woanders und anders zu sein.
Niemandem Bescheid sagen, es nicht groß ankündigen, jedes Pathos vermeiden.
Mit einfachen Maßnahmen würde man seinen Entschluss bekräftigen: Die Anschrift ändern, klar. Die Handynummer wechseln, die E-Mail-Adresse, den Facebook-Account langsam eingehen lassen, nur noch hin und wieder etwas posten. Man würde zunächst noch auf die anderen reagieren und hin und wieder auch auf Freundschaftsanfragen eingehen. Dann würde man die Abstände zwischen seinen Lebenszeichen unauffällig von Mal zu Mal größer werden lassen. So tun, als wäre alles normal, als wäre alles in Ordnung, und im Übrigen wäre auch alles in Ordnung.
Es wäre sogar alles mehr in Ordnung als je zuvor.
Es wäre ein bisschen wie der Versuch, mit dem Rauchen aufzuhören, man brauchte nur ein Quäntchen Willenskraft dafür. Wenn man große Brüche vorher ankündigt, hat das immer etwas Heuchlerisches, steckt da immer ein »Haltet mich zurück, oder ich tue mir noch etwas an« mit drin.
Nein, es ginge darum, sich zu verflüchtigen, wie gesagt, auszubleichen, sich auszuradieren.
Zu verblassen, wie eine Farbe verblasst.
Natürlich müsste ich Paris verlassen. Ohne irgendjemandem etwas zu sagen, vor allem nicht Constance. Sie würde diese Entscheidung für einen Spleen halten. Sie würde mir anbieten, sie zu finanzieren. Ich höre sie schon mit ihrer schönen, rauchigen Stimme sagen: »Machen Sie das, mein Lieber. Gönnen Sie sich ein paar Monate des Umherschweifens. Sie müssen sich um nichts kümmern. Ich übernehme das.« Und dann wäre das Ganze sinnlos. Liebe, verehrte Constance …
Früher war der Mensch dem Menschen ein Wolf, jetzt übernimmt das eine Kamera. Wenn man nicht mit Freunden zusammen ist, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann, oder an der Tür alle Smartphones eingesammelt werden, wie in diesen Filmen über die Mafia, in denen die Waffen abgegeben werden müssen, wenn alle Capi zusammenkommen, dann ist es unmöglich, mal eben betrunken seinen Hintern zu entblößen, ohne dass das am nächsten Tag auf YouTube zu sehen ist. Oder aus purer Provokation bei der dritten Flasche Bourgueil zu erklären, wie sehr man Stalin schätzt, oder auch beides auf einmal, was mir früher wohl mal passiert sein muss, als noch nicht alle ausgerüstet waren wie eine Drohne der US Air Force. Diese Art der Video-überwachung ergänzt natürlich jene, die in unseren Städten immer omnipräsenter ist. Früher wurde man ausspioniert, wenn man vor die Tür trat, jetzt wird man es auch in geschlossenen Räumen.
Ich weiß, dass mich allein eine Sache davon abhält, den Computer, das Internet, die Sozialen Netzwerke und das Handy aus meinem Leben zu verbannen. Und zwar die Tatsache, dass ich das alles vorerst noch aus, sagen wir mal: ökonomischen Gründen benötige. Wenn mir eine Lösung in den Schoß fallen sollte, die mich davon entbindet, mir meinen Lebensunterhalt verdienen zu müssen, dann verschwinde ich komplett von der Bildfläche. Und aus der Welt, da das Netz ja gerade dabei ist, die Welt zu werden. Es besteht keinerlei narzisstische Abhängigkeit. Zumindest glaube ich das nicht, auch wenn ich viel in den Sozialen Netzwerken unterwegs bin. Ich habe meine bereits geschriebenen und noch zu schreibenden Bücher, um meinen Narzissmus zu befriedigen. Und ich weiß, dass auch das Bedürfnis zu schreiben vorübergehen wird, wenn ich erst einmal weggehe.
Nein, die Lösung ist nicht Constance. Constance ist mein Mutterland. Ich bin ihr Überseedepartement, ich koste sie viel Geld (also in einem vernünftigen Maß), ich bringe ihr nicht viel ein, aber bei mir kann sie ein wenig Sonne tanken. Da sie eine ausgezeichnete Psychoanalytikerin ist, dürfte sie das alles genauer durchschaut haben als ich. Das Geld, das sie mir gab, als ich vierzig war und sie fünfundfünfzig, gab sie mir als gelegentlichem jüngeren Liebhaber. Sie schwankte zwischen der Rolle einer Mäzenin und der einer reichen Frau, die sich einem Gigolo hingibt, der etwas von Literatur versteht. Inzwischen sind wir beide fünfzehn Jahre älter. Constance ist mit all der dafür erforderlichen Würde auf der Schwelle zur alten Dame und wird nicht versuchen, das Alter mittels der Schönheitschirurgie auszutricksen, und ich selbst habe die fünfzig überschritten. Das Geld, das sie mir nach wie vor gibt, ist nun das Geld einer Mutter für ihren Sohn, der so tut, als wäre er ein ewiger Student.
Wenn es mir gelingt zu verschwinden, können mir die, die mich gern haben, auf schönem, hellblauem Velinpapier Briefe schreiben. Schon jetzt halten einige von uns an dieser archaischen Praxis fest. Cénabre, Marcheur, Gourvenec und ich schreiben uns nach wie vor, schicken einander Postkarten. Oder sie steigen in den Zug, um mich zu besuchen. Es sei denn, ich lande an einem Ort ohne Bahnhof, was noch besser wäre. Oft macht mir jedoch der Gedanke Angst, aufzulisten, wer mir fehlen würde, wenn ich mich entschließen sollte wegzugehen. Und ebenso macht es mir Angst, aufzulisten, wem ich fehlen würde. Ich fürchte, das endet unentschieden, ein miserables Spiel, ein typisches Null zu Null.
Ab und an treffe ich bei Eymoutiers, vermittelt durch Tavaniello, junge Leute um die zwanzig, die intelligent und sensibel sind, an die Befreiung des Menschen glauben, an Gemeinschaften, die auf der gleichen politischen Überzeugung beruhen, an Wachstumsbeschränkung. Selbst ihnen ist manchmal schwer zu erklären, dass ich, bevor sie geboren wurden, eine Welt erlebt habe, in der es möglich war, nicht erreichbar zu sein, ohne dass das irgendjemanden beunruhigt hätte oder irgendwie verdächtig gewesen wäre. Eine Welt, in der ich ohne Textverarbeitungsprogramm schrieb, in der ich auch ohne Handy nicht meine Verabredungen verpasste. Eine Welt, in der ich in einem alten Cabriolet ohne GPS-System unterwegs war, nur mit einer alten Michelin-Karte, die ich auf den gebräunten Schenkeln von Sophie, Hélène oder Andréa ausbreitete, die neben mir saßen. Eine Welt, in der man Geld im Innenraum der Bank tauschen musste, wenn man im Ausland war, und es nicht an einem Automaten holte. Das war weniger praktisch. Aber durch die heutige Praxis hat man das Gefühl, nie mehr weit weg zu sein. Sogar Mariama, nicht mehr die Jüngste mit vierzig, die groß darin ist, grundsätzlich alles radikal anzuzweifeln, hört nicht auf, mir zu erklären, dass es nur darauf ankommt, wie man eine Technik einsetzt. Dass sie ein großartiger Beschleuniger einer kommenden Revolution sein könne. Ich bezweifle das, um ehrlich zu sein.
Erinnerst du dich noch, Sophie, an den Sommer 1980 auf den Kykladen, an diese kleine Bank auf Ios, in der wir unsere Ausweise und unsere American-Express-Travellerschecks bis zum nächsten Tag hinterlegen mussten, um Bargeld zu bekommen, an den Angestellten im Anzug, der akzentfrei Französisch sprach, an den Ventilator, der für angenehme Kühlung sorgte und deine blonden Haare herumfliegen ließ, außer dieser einen Strähne, die an deiner Schläfe klebte wie eine Schmachtlocke, an die Ägäis, die man durch die staubige Luke hinter dem Schalter sah?
Bevor es den Euro gab, empfand ich, wenn ich keine hundert Kilometer von meinem Zuhause entfernt an einem Badeort wie Koksijde Francs in belgische Francs tauschte, ein fast körperlich spürbares Vergnügen, eine Grenze zu überschreiten. Dass dieses Gefühl verblasst, liegt natürlich nicht am Euro und den Geldautomaten. Jedenfalls nicht nur.
Einer der Nebeneffekte des Handys ist zum Beispiel die Entwertung eines gegebenen Versprechens oder einer Vereinbarung. Es ist so dermaßen einfach etwas abzusagen, dass es fast zu einem Mittel wird, sich seine eigene Bedeutung zu beweisen. Dem letzten. Denn, machen wir uns nichts vor, wir sind nicht mehr besonders wichtig. Für niemanden. Das kommt mir persönlich entgegen. Ich brenne darauf, mich zu verflüchtigen. Ein Tag ohne Anruf machte mir vor noch gar nicht so langer Zeit Angst. Wenn das heute passiert, empfinde ich eine Art Euphorie, einen kurzen Moment des Triumphes in einem Leben, das schon sehr lange einen faden Beigeschmack hat.
Ja, früher gab es Liebesgeschichten, auch schöne und dauerhafte und starke, wie zum Beispiel mit Sophie. Oder mit Andréa. Gehen Sie in eine Bibliothek und überzeugen Sie sich selbst, wenn Sie mir nicht glauben. Schauen Sie hinter den Computern nach, da gibt es sicher noch ein paar alte Romane. Versuchen Sie es mal mit Die Lilie im Tal. »Sie brachte mich zum Weinen. Sie wirkte gleichzeitig mild und furchterregend; ihr Gefühl bekundete sich allzu kühn; es war zu rein, um dem jungen, von Lustempfindungen beunruhigten Menschen auch nur die mindeste Hoffnung zu lassen.«
Trennung oder Entfernung waren für Liebende damals gottgegeben. Jeder Soldat fern der Heimat, jeder Seemann auf großer Fahrt wartete auf die Post, die der für den Postdienst zuständige Unteroffizier brachte, oder auf die postlagernden Briefe beim nächsten Zwischenstopp. Manchmal war es traurig, weil die Beziehung nicht hielt, aber wenn sie hielt, dann war es fürs Leben. Heute ist das anders: Kaum macht der in Mali stationierte Marineinfanterist Anstalten, eine Granate auf eine Höhle im Ifoghas-Gebirge abzufeuern, wird er auch schon von einer verliebten oder genervten SMS seiner Freundin gestört, die wissen will, welchen Rock sie anziehen soll, wenn sie ausgeht.
Ich erinnere mich an einen prophetischen Film, Hier spricht Denise, so aus dem Jahr 1995 oder 1996. Ein amerikanischer Film über die Anfänge des Handys. Junge, ineinander verliebte New Yorker Freunde verbringen ihre Zeit damit zu telefonieren, aber sie sehen sich nie, wie so viele Monaden, die auf eine SIM-Karte reduziert sind. Das einzige Mal, als es ihnen endlich gelingt sich zu sehen, ist am Ende des Films, als einer von ihnen stirbt. Man muss schließlich zur Beerdigung gehen.
Mariama sagte mir, der Arabische Frühling sei durch Twitter ausgelöst worden. Kann gut sein. Da war Big Brother wohl für einen kurzen Moment abgelenkt. Aber inzwischen hat er sich am Riemen gerissen. Probieren Sie mal in China einen Tweet abzusetzen, nur so zum Spaß.
Die Sozialen Netzwerke haben geschafft, was die Geheimpolizeien sämtlicher Regime sich nicht in ihren kühnsten Träumen ausgemalt hätten: Die Leute liefern sich selbst ans Messer. Das ist ein Erfolg auf ganzer Linie, wenn die gesamte Menschheit zu einer Geheimpolizei wird, die sich darüber hinaus auch noch selbst verwaltet.
Ein Bulle, der ins Autorenfach gewechselt war, erklärte mir einmal während eines Krimifestivals, dass es für einen Verbrecher heute quasi unmöglich sei, im großen Stil auf die Flucht zu gehen, wie früher mal Mesrine. Wegen der vollständigen Digitalisierung der Realität. Man kann sich darüber freuen. Aber es kann einem dabei auch angst und bange werden. Eines der elementarsten Menschenrechte existiert nicht mehr.
Das Recht zu verschwinden.
Ich habe Lust auf eine Flucht, so wie ich Lust habe auf Mariama: um mich zu verlieren.
Die Überlebenden kontaktieren
Bei ihm wie auch bei den anderen, die zu Verdunkelten werden würden, war das offenbar ein schleichender Prozess. Es gab eine ganze Reihe von kleineren Vorkommnissen, die ihn schließlich dazu bewogen, diesen Schritt zu tun. Er brauchte knapp zwei Jahre, um sich der unsichtbaren Menge anzuschließen, die den Anfang des Endes ausgerufen hatte. Der Colonel hatte Recht. Der Untergang vollzog sich binnen nicht einmal eines Jahrzehnts.
Dabei hätte ich in Bezug auf ihn genügend Anhaltspunkte für seine bevorstehende Verdunkelung finden können, ob in seinen Krimis, seinen Gedichten, seinen Jugendromanen oder auch in seinen Statusanzeigen in den Sozialen Netzwerken, von denen er am Ende nicht genug bekommen konnte, obwohl ihm vollkommen klar war, was für eine Falle sie darstellten.
Tatsächlich war er verdammt wortkarg für jemanden, der so viel geschrieben hat. Ohne großen Erfolg, nebenbei gesagt. Klar, da waren die Einträge in seinen Notizbüchern und die Textfragmente in seinem Computer, aber das war auch schon alles. Und es wirkte nicht so, als plante er, daraus ein Buch zu machen. Schade eigentlich. Ich hätte den Colonel sonst vielleicht davon überzeugen können, dass ein Schriftsteller, der ohne es zu ahnen über das schrieb, was kurz bevorstand, eine Spezialbehandlung verdient hätte. Das hätte manches vereinfacht.
Aber nein, er veröffentlichte weiter seine Krimis, die alle hochpolitisch waren und dieses Thema nicht einmal streiften. Bestenfalls in seiner Poesie, aber das mag ich mir auch im Nachhinein einbilden. Andere als ich, auch beim Geheimdienst, wären womöglich in der Lage gewesen zu erkennen, was er da in einigen seiner Gedichte ausbrütete. Aber wer las denn noch Gedichte in diesen Zeiten? Wir hatten beim Geheimdienst durchaus eine inoffizielle Abteilung zur Überwachung von Fiktion in Literatur, Fernsehen und Film, aber für Poesie hatten wir niemanden. Das war ein echter Fehler, wenn ich es recht bedenke …
Das einzige Buch, das ich noch von ihm habe, eine Ironie des Schicksals, ist der letzte Gedichtband, den er kurz vor seiner Verdunkelung veröffentlicht hat. Die Überlebenden kontaktieren. So lautet der Titel. Ich bin vor ungefähr einem Jahr darauf gestoßen, in einem Zeitschriftenladen von La Souterraine. Es war der einzige Laden in der ausgestorbenen Stadt, der von den Plünderungen verschont geblieben war. Das hätte ihm sicherlich ein Lächeln entlockt, diesem großen Fan von Untergangsszenarien. Oder es hätte den weinerlichen, launenhaften Narziss in ihm beruhigt zu erfahren, dass sein Gedichtband durch eine seltsame Laune der Vertriebswege in La Souterraine im Regal stand. Zwischen einem Thriller, in dem telepathisch begabte Neonazi-Vampire durch die Gegend geisterten, und der Autobiografie einer B-Prominenten aus einer Realityshow und inmitten lauter vergilbter Zeitungen, den allerletzten Ausgaben, deren alarmierende Schlagzeilen zum Zeitpunkt ihres Erscheinens bereits obsolet waren, da es schon geschehen war.
Aber ich greife vor. Zu dem Zeitpunkt, als ich ihn fand, war ich auf Hypothesen angewiesen, und in gewisser Weise bin ich das immer noch. Man könnte zum Beispiel mutmaßen, dass sein fünfzigster Geburtstag ihm so zugesetzt hatte. Das war eine grob vereinfachende Erklärung, aber sie war dennoch nicht ganz von der Hand zu weisen.
Ein Indiz, das diese banale These des nicht akzeptierten Alterns stützte, war, dass er seinen Fünfzigsten, der vier Jahre zurücklag, als ich begann, mich mit ihm zu befassen, nicht gefeiert hatte. Vielleicht hatte er kein Geld, oder er hatte keine Lust. Oder er schob vor, er hätte kein Geld, auch wenn das für Leute wie ihn nie eine echte Entschuldigung wofür auch immer war, und er damit nur eine gewisse Lustlosigkeit kaschieren wollte, eine tiefer sitzende Angst. Denn fünfzig zu sein bedeutete, Übergewicht und Bluthochdruck zu haben und seine Verführungskraft einzubüßen.
Ich hatte so eine Ahnung, dass es dem Colonel, der etwa im gleichen Alter war, ähnlich erging, wenn er mir beim Ausziehen zusah. Er zog mich nie aus, sondern sah mir lieber dabei zu. Anfangs dachte ich, er würde auf Striptease stehen. Überhaupt nicht. Im Grunde blickte er mich so erwartungsvoll an, als würde ich ihm gleich den Schlüssel überreichen, mit dem man die Zeit zurückdrehen kann, als wäre mein nackter Körper eine Art Passierschein zu seiner Jugend, als wäre ich sein letztes Mal, seine letzte Frau, als verkörperte ich für ihn zugleich eine Sehnsucht nach dem Vergangenen und eine letzte Chance. Das wühlte mich natürlich auf und trug mit zu meinem grandiosen Orgasmus bei.
Aber kommen wir lieber auf ihn zurück, auf Trimbert.
Guillaume Trimbert.
Als ich seinen Namen erfuhr, bevor ich das erste Mal am Square Henri Delormel war, sprach ich ihn mehrmals laut vor mich hin, vorm Badezimmerspiegel. Wiederholte ihn laut, von Mal zu Mal lauter. Dabei fiel mir ein, dass Jean-Pierre Léaud es in Geraubte Küsse bei Delphine Seyrig genauso gemacht hatte. Damals hatte ich noch Zeit, Filme zu sehen, im Filmclub vom Gymnasium Victor Hugo in Besançon. Die kleine Agnès Delvaux wurde am Wochenende nicht oft abgeholt, als sie keine zwei Kilometer von zu Hause entfernt auf dem Internat war. Sie störte.
»Fabienne Tabard. Fabienne Tabard. Fabienne Tabard.«
»Guillaume Trimbert. Guillaume Trimbert. Guillaume Trimbert.«
Eins war mir klar: Er hatte sich und anderen in einer Tour etwas vorgelogen. Er war schließlich Schriftsteller. Sein Job verlangte das. So wie es unser Job als Geheimdienstler auch verlangte. Da fragt man sich schon, ob die Literatur ihm nicht in erster Linie dazu diente zu lügen oder nur die Wahrheit zu sagen, die ihm zupass kam. Aragon, den er sehr gerne las, tat mit seinem Wahr-Lügen genau das. Und außerdem sah es ihm ähnlich, dass er die Verantwortung für seine Entscheidungen, sein Scheitern, seine kleineren und größeren Feigheiten auf äußere Umstände schob, die man gelten lassen konnte und die ihn entlasteten. Nicht genug Geld, um einen Geburtstag zu feiern, na klar, es fiel mir schwer, das zu glauben.
Schließlich hatte er die Mäzenin, die ihm alles gab, was er nur wollte, oder fast alles. Constance Soligny, eine Psychoanalytikerin und strenge Lacan-Adeptin. Ihr Mann war ein durch die Medien bekannter Professor, der sie nicht mehr anrührte, als sie Trimbert kennenlernte. Genauer gesagt war er ein sehr weit rechts stehender, durch die Medien bekannter Professor und hatte sie nie angerührt. Als versteckter Schwuler brauchte er diese Ehe aus Anstandsgründen, und um seine erzkatholischen Familienwerte glaubhaft rüberbringen zu können, wie auch sein Interpretationsschema des Chaos auf dieser Welt, das einzig und allein um die Frage der Identität kreiste. Alle redeten ständig von Identität in dieser zu Ende gehenden Welt. Constance und ihr Mann waren kinderlos und lebten in bestem Einvernehmen miteinander. Beide waren reich und mondän und bildeten eines dieser Paare, bei denen die stillschweigende Übereinkunft, die Interessen des anderen zu respektieren, ein Garant für die Dauer ihrer Verbindung war. So verlangte er nie Rechenschaft über ihre Liebhaber oder die spezielle Beziehung, die sie zu Trimbert unterhielt. Er, der in Talkshows als Verteidiger der sogenannten »Francité« auftrat, hätte kein Problem darin gesehen, wenn Constance Trimbert, der manchmal auch zu einem ihrer Dîners eingeladen wurde, einen Scheck ausgestellt hätte, damit er seinen Fünfzigsten feiern konnte.
Nein, Trimbert wollte einfach nicht. Auf seinem Nachttisch lag ein witziges Buch, das einer seiner Verleger 1970 herausgebracht hatte, Leitfaden für den Mann, der es geschafft hat. Gleich das erste Kapitel war überschrieben mit: »50! Willkommen im Club!« Darin waren Restaurants und Bars aufgeführt, Gesundheitsratschläge, Landgasthöfe, die sich für den Ehebruch eigneten, Modeboutiquen und Mechaniker, die Sportwagen reparieren konnten von Marken, die heute keiner mehr kannte. Trimbert, dieser unverbesserliche Nostalgiker, dürfte dieses Buch auf zweierlei Weise gelesen haben. Einmal so wie er auch Proust las, mit einer melancholischen Sehnsucht nach der Auberge du Grué des Grues, »direkt an der D116 gelegen, die an der Eure entlangführt, mitten auf dem Land, Telefon: 46-50-25«, und dann aber auch mit einem gewissen Gefühl der Bitterkeit und Angst beim Vergleich zwischen dem Mann von fünfzig, der es »geschafft hat« im Paris dieser Zeit, und seinem eigenen Leben im Jahr 2010. Auf einmal glaubte dieser angebliche Kommunist, todunglücklich zu sein, weil er nur ein paar hundert Bücher besaß, ein Peugeot-Cabriolet und auf die nächste Überweisung seines letzten Zeilenhonorars warten musste, um sich ein Paar Weston-Schuhe leisten zu können. Wenn ich ihn unter diesem Gesichtspunkt betrachtete, dann gesellte sich zu meiner unbestimmten Wut noch Verachtung hinzu. Diese Mischung hätte tödlich für ihn sein können, und genau das war sie letzten Endes auch.
Seinen Vierzigsten hatte er richtig groß gefeiert. Aber damals war er noch Lehrer und verheiratet. Er lud um die hundert Gäste in ein Herrenhaus in Flandern ein. Es gab ein Buffet mit regionalen Spezialitäten, deren Namen so kompliziert waren, dass niemand sie hätte schreiben, geschweige denn aussprechen können, so zum Beispiel Potjevleesch, Stoemp, Swiateçzna oder Kaszanka. Und dann hatte er auch noch eine Frittenbude für draußen gemietet. Flandern und Polen: der Norden eben. Fünf oder sechs Biersorten aus Bio-Mikro-Brauereien, Zero-Dosage-Champagner, was will man mehr.