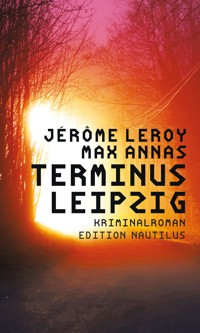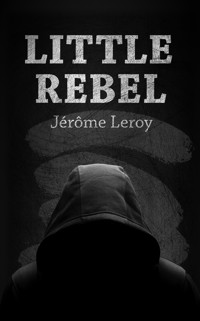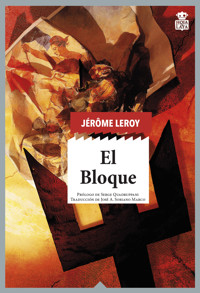Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein hellsichtiger Politthriller über die zunehmende Faschisierung staatlicher Strukturen Berthet soll getötet werden. Er ist Agent der Unité, einer geheimen Parallelpolizei, die zu einem Staat im Staate geworden ist, ein gut arbeitender Mann fürs Grobe, der nicht viele Fragen stellt. Aber Berthet ist in Ungnade gefallen. Vielleicht, weil er zu viel weiß, vielleicht aber auch, weil seine Besessenheit von Kardiatou Diop, der jungen Staatssekretärin, dem Medienliebling und Postergirl der diversity, die Pläne der Unité zu stören droht. Denn die Unité dient schon lange nicht mehr der Verteidigung der Demokratie, sondern eher der Welt des Geldes und dem entfesselten Kapitalismus. Berthets Marotten konnte man hier lange tolerieren, aber nun ist seine zweifelhafte Zuneigung zu Diop zum Problem geworden: Sie soll ausgeschaltet werden, denn sie ist Gegenkandidatin von Agnès Dorgelles, der Chefin des rechtsextremen Patriotischen Blocks, bei den Kommunalwahlen in einer Gemeinde in Zentralfrankreich. Wie ein Schutzengel, von weitem und ohne dass sie davon weiß, hat Berthet Diop seit Jahren beschützt und gefördert. Und wenn die Unité ihr ans Leder will, wird sie an ihm nicht vorbeikommen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jérôme Leroy, geboren 1964 in Rouen, ist Autor, Literaturkritiker und Herausgeber. Er hat als Französischlehrer gearbeitet, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Leroy hat zahlreiche Kriminalromane veröffentlicht. Auf Deutsch erschienen bisher Der Block (2017), ausgezeichnet mit dem Deutschen Krimipreis 2018 in der Kategorie International (3. Platz), und Die Verdunkelten (2018). Der Schutzengel wurde ausgezeichnet mit dem Prix des Lecteurs Quai du Polar 2015.
JÉRÔME LEROY
DER SCHUTZENGEL
KRIMINALROMAN
AUS DEM FRANZÖSISCHEN ÜBERSETZT VON CORNELIA WEND
Die Originalausgabe des vorliegenden
Buches erschien unter dem Titel
L’ange gardien © Editions Gallimard, Paris, 2014.
Dieses Bucherscheint im Rahmendes Förderprogrammsdes französischenAußenministeriums, vertreten durch dieKulturabteilung der französischen Botschaftin Berlin.
Ein kleines Glossar finden Sie am Schluss des Buches.
Edition Nautilus GmbH · Schützenstraße 49 a
D - 22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte vorbehalten
© Edition Nautilus GmbH 2019
Deutsche Erstausgabe
März 2020
Umschlaggestaltung:
Maja Bechert, Hamburg
www.majabechert.de
Portraitfoto:
©HACQUARD et LOISON/Opal
ePub ISBN 978-3-96054-225-4
Für Serge Quadruppani
Wenn man jedoch fragt, was diese drei sind, dann wird die große Armut offenbar, an welcher die menschliche Sprache leidet. Immerhin hat man die Formel geprägt: Drei Personen, nicht um damit den wahren Sachverhalt auszudrücken, sondern um nicht schweigen zu müssen.
Augustinus, De Trinitate
Sehr gut!
Ändern wir nichts!
Wir leben in einer phantastischen Zeit!
Eddy Mitchell, Ändern wir nichts
Inhalt
EINS BERTHET
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
ZWEI MARTIN JOUBERT
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
DREI KARDIATOU DIOP
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Epilog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Glossar
EINS
BERTHET
Das ist eine ziemlich schlechte Idee
1
Berthet soll getötet werden.
Das ist eine ziemlich schlechte Idee.
Einmal, weil Berthet es gemerkt hat, dann, weil Berthet das nicht mitmachen wird, und schließlich, weil Berthet in diesen Dingen kein Anfänger ist. Mit der Zeit entlockt ihm das nur ein müdes Lächeln. Die Möglichkeit eines gewaltsamen Todes begleitet ihn schon sehr lange, auch wenn er nicht so weit gehen würde zu behaupten, sie sei für ihn inzwischen etwas Alltägliches geworden, denn er weiß, dass man weder dem Tod noch der Sonne ins Auge schauen darf.
Aber mit der Zeit wird eben alles relativ. Zumal Berthet inzwischen über sechzig ist. Damit hat er das offizielle Renteneintrittsalter überschritten. Er ist früh ins Berufsleben eingestiegen und seine Arbeit hat ihm unweigerlich ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft abverlangt. Insofern könnte man sagen, ein Mann in seinem Alter sollte aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit eigentlich gar nicht mehr arbeiten müssen.
Dazu muss man jedoch wissen, dass Berthet nie in die Rentenkasse eingezahlt hat. Mehr noch, er hat während seiner gesamten beruflichen Laufbahn eigentlich nie ein richtiges Gehalt oder sonstige Bezüge erhalten. Er hat keine Lohnzettel, Gehaltsabrechnungen oder Scheckheftabschnitte, die ordentlich abgeheftet im Schrank verstauben, und die man nie wieder anschaut, außer wenn man alt wird oder eine Steuerprüfung droht.
Berthet fühlt sich nicht alt, und er ist nie mit dem Finanzamt in Berührung gekommen.
Nur einmal, bei diesem Mitte der neunziger Jahre ertrunkenen Oberfinanzdirektor aus Südfrankreich, an dessen Tod Berthet einen gewissen Anteil hatte; der Mann war auf die unglückselige Idee verfallen, gegen den ausdrücklichen Wunsch seiner Partei bei den Wahlen zu kandidieren.
Aber das zählt eigentlich nicht.
Obwohl Berthet gerade in höchster Gefahr schwebt, fällt ihm jetzt diese alte Geschichte ein, eine unter vielen. Im Moment kommt alles wieder hoch, schon komisch.
Vermutlich denkt er wegen der Hitze daran, die an diesem Abend in Lissabon herrscht. Sie erinnert ihn an einen anderen heißen Tag zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort.
Tod durch Ertrinken in einem Pool also.
Der Oberfinanzdirektor gehörte ursprünglich dem Bloc Patriotique an, jener rechtsradikalen Partei, die in dem Departement zu der Zeit sensationelle Wahlerfolge feierte. Dann kehrte er der Partei den Rücken, weil der alte Dorgelles, der Chef des Patriotischen Blocks, ihn nicht auf einen aussichtsreichen Listenplatz für die Europawahl setzen wollte, die wenige Monate später anstand.
Der Oberfinanzdirektor war ein Abgeordneter aus Lancrezanne, der Block hatte das Rathaus dieser nicht gerade unbedeutenden Stadt erobert. Als der Abgeordnete erfuhr, dass Dorgelles ihn nicht für die Europawahl aufstellen wollte, wurde er von heute auf morgen zum Abweichler. Mit acht anderen Gemeinderäten und zwei Stellvertretern im Schlepptau bildete er eine neue Gruppe im Gemeinderat.
Die regionale Presse kannte kein anderes Thema mehr, die nationale Presse wurde ebenfalls aufmerksam. Dorgelles wurde als willkürlicher Despot tituliert, was er ohne Frage war. Das machte sich in den Umfragen bemerkbar. Der Patriotische Block büßte kostbare Punkte ein, und die Unité kam zu dem Schluss, dass sich das in der momentanen Lage nicht gut machte. Man forderte Berthet also auf, diesen nörgelnden, faschistischen Spitzenbeamten zu eliminieren. Natürlich nicht aus Sorge um die Demokratie. Die Unité machte keine Politik – oder sie tat nichts anderes, je nachdem, wie man es betrachtete.
Berthet waren die Gründe der Unité damals vollkommen schnuppe. Heute ist das ein wenig anders, aber das ändert an dem grundsätzlichen Problem auch nicht viel. Man war auf dem üblichen Weg mit ihm in Kontakt getreten, hatte ihm ganz einfach einen postlagernden Brief auf den Namen Berthet in ein Postamt des 14. Arrondissements in der Rue Marie-Rose geschickt. In einem Umschlag aus Kraftpapier befanden sich sehr spärliche Instruktionen: Ein paar Angaben zur Biografie des Oberfinanzdirektors, ein Foto von ihm, ein vorläufiges Datum für die geplante Liquidierung, und ein Überweisungsschein für eine Zahlung auf eines von Berthets vielen Konten.
In diesem Fall eine BNP-Zweigstelle in Noyon, wo er ein Konto auf den Namen Jacques Sternberg besaß. Berthet konnte sich nicht erinnern, der Unité dieses Konto genannt zu haben. Das ärgerte ihn. Schließlich hatte die Unité für ihn mehrere Konten unter seinen diversen Tarnnamen eröffnet. Daneben gab es die anderen Konten, die nur er allein kannte.
Damit gab die Unité ihm indirekt zu verstehen, dass sie sein Konto auf den Namen Jacques Sternberg in Noyon entdeckt hatte. Berthet sagte sich, dass er irgendwo anders ein neues Konto eröffnen müsse, unter einem anderen Namen, um das Gleichgewicht zwischen den Konten, die die Unité kannte, und denen, die sie nicht kannte, wieder herzustellen. Dieses Spielchen ging nun schon ein paar Jahre. Die Unité wusste, dass ihre Mitarbeiter sich fast alle persönlich absicherten. Denn sollte man sie aus irgendwelchen Gründen mal fallenlassen, mussten sie untertauchen können, auch wenn es sehr kompliziert war unterzutauchen, wenn man der Unité angehörte.
Berthet hatte, offen gestanden, gar nicht die Absicht zu verschwinden, aber man wusste ja nie. Schließlich waren bereits so einige Leute plötzlich in Ungnade gefallen, hatte man mit so einigen Leuten kurzen Prozess gemacht. Manchmal ahnte man, warum es jemanden traf, manchmal aber auch nicht. Tatsächlich hatte es Methode, dass ständig dieses Damoklesschwert über allen schwebte, so sah moderne Personalführung aus. Wer weiß, vielleicht hatte die Unité dieses Terrormanagement überhaupt erst eingeführt, das heute in Betrieben der öffentlichen Hand gang und gäbe ist, seit diese mit der Privatwirtschaft konkurrieren müssen. Die endgültige Entscheidung bezüglich des Oberfinanzdirektors ließ man ihm ebenfalls auf dem üblichen Weg zukommen, das heißt durch eine Botschaft in einem Internetforum für Videospiele.
Berthet schritt also zur Tat. Er checkte in einem dieser günstigen Hotels an der Autobahn in der Nähe von Lancrezanne ein, wo man alles über Computerterminals abwickelte. Er zahlte mit der Kreditkarte auf den Namen Jacques Sternberg. Da die Unité das Konto in Noyon nun kannte, konnte er sich jegliche Tricksereien sparen.
Es war Sommer. Es war sehr heiß in Lancrezanne. Berthet versuchte erst gar nicht, die defekte Klimaanlage wieder in Gang zu bringen, und riss das Fenster auf. Draußen in der Dunkelheit zeichneten sich die Umrisse des oberhalb der Stadt liegenden Mont-Lancre ab. Da irgendwo lag das Haus des Oberfinanzdirektors, eine dieser schönen Patriziervillen, die in der dichten Vegetation am Hang fast verschwanden.
Berthet hatte ein feines Gehör, die Wände waren dünn, aber irgendwie gelang es ihm zu schlafen, trotz der vögelnden Paare, die gerade ihre Ehepartner betrogen, und der Handelsvertreter, die wie kleine Kinder von Albträumen geplagt wurden, weil sie ihre Zielvorgaben nicht einhalten konnten, und der Lastwagen, die kurz vorm Autobahnkreuz abrupt abbremsten.
Berthet brauchte drei Tage, um alles auszukundschaften, dann hatte er den idealen Zeitpunkt für die Liquidierung des Oberfinanzdirektors ausgemacht. Der verließ sein Büro immer gegen fünfzehn Uhr, kam nach Hause, nahm ein Bad im Pool, fuhr dann wieder in die Stadt und schaute bei der Gelegenheit im Rathaus vorbei. Der Beamte planschte also eine knappe Stunde lang ganz allein in seinem Pool herum. Berthet hatte herausgefunden, dass die Frau des Oberfinanzdirektors in dieser Zeit wahlweise auf der Couch ihres Psychoanalytikers lag, an einem Töpferworkshop teilnahm oder aber mit einem sozialistischen Anwalt schlief. Das einzige Kind des Paares, eine Tochter, besuchte derzeit in Aix-en-Provence die Vorbereitungsklasse für eine Elite-Uni.
Was die Leute eben so machten.
Neben den üblichen Gefahrenquellen wie Nachbarn, der überraschende Besuch des Gasmanns oder die unerwartet frühe Rückkehr der durchanalysierten, ehebrechenden Hobby-Töpferin, musste Berthet bei dieser Mission, die die internen Angelegenheiten des Patriotischen Blocks betraf, auch noch vor dem Sicherheitsdienst der Partei auf der Hut sein, insbesondere vor der Delta-Gruppe, die von einem gewissen Stanko geleitet wurde. Der ehemalige Skinhead und frühere Fallschirmjäger war ein zu Tobsuchtsanfällen neigender Zwerg und halber Homo, gefährlich wie ein unbekanntes Virus. Berthet hatte schon mal mit der Delta-Gruppe und Stanko zu tun gehabt. Wenn die sich in eine Sache einmischten, dann gab es immer Probleme, die meistens nur durch den Einsatz extremer, manchmal irrationaler Gewalt gelöst werden konnten, was leider zur Folge hatte, dass man die Aufmerksamkeit von viel zu vielen Menschen auf sich zog.
Wenn aber nun die Unité die Beseitigung des Oberfinanzdirektors anordnete, dann bedeutete das, Dorgelles hatte, aus welchen Gründen auch immer, selbst nicht den Entschluss gefasst, den Rebell zu beseitigen. Denn sonst hätte die Unité das logischerweise Stanko und seine Schergen erledigen lassen, beziehungsweise es ihnen nahegelegt.
Berthet stieg zu Fuß zu der Villa des Beamten hoch, über verschlungene Straßen und Wege, die sich zwischen Bougainvillea, Clematis, Lavendel und Korkeichen den Mont-Lancre hinaufschlängelten. Es duftete gut nach Mittelmeer und nach Harz. Die Zikaden machten einen Höllenlärm, schlimmer als jede Autobahn.
Als Berthet die Villa erreichte, tat er das Übliche. Er vermied, ins Visier der Überwachungskamera zu geraten, achtete beim Überklettern der Mauer darauf, nicht in die dort eingelassenen Scherben zu greifen und schlug den alten Flandrischen Treibhund nieder, der wegen der Hitze hechelte und knurrend auf ihn zukam. Der Hund würde später wieder zu sich kommen. Das Tier durfte auf keinen Fall getötet werden, denn das wäre ein ziemlich eindeutiges Indiz für Fremdeinwirkung gewesen.
Dann baute Berthet sich vor dem Oberfinanzdirektor auf, der ungefähr so alt war wie Berthet heute. Er hatte sich gut gehalten, noch nicht mal einen Bauchansatz. Berthet hingegen sah man damals mehr als heute an, dass er ein Killer war. Der Beamte erblasste unter seinem gut gebräunten Teint, der für einen Mann der besseren Gesellschaft aus dem Süden typisch war. Er lag in Badehose auf einem Liegestuhl mit einem Laptop auf den Schenkeln.
»Sind Sie einer von Stankos Leuten?«, fragte der Oberfinanzdirektor.
Berthet antwortete nicht.
»Ich warne Sie, ich habe Instruktionen hinterlassen, für den Fall, dass mir etwas zustoßen sollte. Das sollten Sie Dorgelles lieber sagen, bevor Sie noch einen Fehler begehen. Und wo ist mein Hund?«
Sie waren alle gleich. Sie sagten alle das Gleiche, behaupteten, sie hätten Vorkehrungen getroffen. In den allermeisten Fällen stimmte das nicht. Und während ihr Tod unmittelbar bevorstand, machten sie sich Gedanken über Nebensächlichkeiten. Das erstaunte Berthet immer wieder.
»Wie heißen Sie?«, fragte der Steuerbeamte noch.
»Jacques Sternberg«, antwortete Berthet.
»Ach, mal wieder ein Jude.«
Berthet nahm den Laptop des Spitzenbeamten mit einer angesichts der Umstände erstaunlichen Vorsicht an sich und stellte ihn ordentlich auf dem Boden ab. Der Mann wich noch nicht einmal zurück. Dann drückte Berthet auf einen ganz bestimmten, mysteriösen Punkt irgendwo in der Gegend zwischen Hals und Schulter des Oberfinanzdirektors.
»Sie tun mir verdammt weh, Monsieur Sternberg. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich glaube, ich schreie gleich.«
Berthet legte seine andere Hand über den Mund des Oberfinanzdirektors und sagte:
»Aber ja doch, Sie können sich noch bewegen, sehen Sie.«
Er nötigte ihn aufzustehen und führte ihn zum nur wenige Schritte entfernt liegenden Pool, dabei verringerte er den Druck auf diesen ganz bestimmten, mysteriösen Punkt etwas. Man hatte in diesen Fällen immer das Gefühl, eine Marionette zu bewegen. Der Beamte hatte eine komische Art zu gehen, wie ein Krebs im Seitwärtsgang, mit verdrehter Wirbelsäule, dabei schwitzte er sehr stark.
Berthet zwang ihn, die Leiter zum Pool hinabzusteigen, an der Seite, wo er noch Boden unter den Füßen hatte.
»Ich flehe Sie an«, sagte er, nachdem Berthet die Hand von seinem Mund genommen hatte.
Berthet erhielt den Druck auf den ganz bestimmten, mysteriösen Punkt aufrecht und drückte seinen Kopf unter Wasser, dabei wurde sein Arm nass, bis zum Bündchen seines Fred-Perry-Poloshirts. Der Oberfinanzdirektor wehrte sich nicht, weil der Druck auf diesen ganz bestimmten, mysteriösen Punkt ihn lähmte. Ihm blieb nichts anderes übrig, als zu ertrinken, was er dann auch ziemlich schnell tat, nachdem er noch etwas wie »dreckiger Jude« gestammelt hatte. Danach kamen nur noch Blasen aus seinem Mund und dann regte er sich nicht mehr.
Berthet trat den Rückweg an, die Zikaden wollten einfach keine Ruhe geben. Der Ärmel seines Poloshirts trocknete sehr schnell in der provenzalischen Sonne. Als er zurück im Stadtzentrum war, trank er auf einer Caféterrasse am Cours la Fayette einen Mauresco, blickte den jungen Frauen hinterher, entdeckte keine einzige, die Kardiatou ähnlich sah, war darüber leicht frustriert, bestieg seinen Mietwagen, gab ihn beim Autoverleih am Bahnhof zurück, nachdem er sein Gepäck aus dem Kofferraum genommen hatte, und bestieg den Sechzehn-Uhr-vierzig-Zug nach Paris.
2
Berthet soll getötet werden.
Das ist eine ziemlich schlechte Idee.
Vor allem grenzt es an Beleidigung.
Allein schon, wen sie ihm da schicken. Das riecht verdammt nach Outsourcing. Mehr noch, es riecht nach Outsourcing vom Outsourcing. Die Unité hat offenbar Finanzprobleme. Sie lagert aus, aber sie lagert schlecht aus. Sie spart an allen Ecken und Enden, wird zum Erbsenzähler, zum Pfennigfuchser.
Das zeigt, wie tiefgreifend diese Wirtschaftskrise ist, denkt Berthet. Zugleich versucht er die Situation abzuschätzen, in der er sich befindet, und Strategien zu ersinnen, mit denen er seinen jämmerlichen Verfolgern entkommen kann. Dabei verfällt er jedoch nicht in übermäßige Panik.
Trotzdem, sie übertreiben es echt mit der Austeritätspolitik. Der Neoliberalismus zwingt die Staaten in die Knie. Ihre Finanziers, ihre Bankiers, ihre Weiße-Kragen-Kriminellen sind schlimmer als alles, was Berthet in seiner gesamten Laufbahn kennengelernt hat.
Und er hat weiß Gott so einiges kennengelernt.
Auch wenn Berthet weiß, dass es unprofessionell ist, in seinem Beruf persönliche Animositäten zu hegen, würde er mit dem größten Vergnügen dem Auftrag nachkommen, ein paar Kerle von Goldman Sachs abzuknallen oder andere Zauberlehrlinge des sogenannten »Marktes«. Seit der Krise im Jahr 2008 hat Berthet eine Menge Kohle verloren. Er lässt sich nicht gerne übers Ohr hauen. Er hat auch seinen Stolz, er möchte schließlich nicht so dumm dastehen wie irgendein Landarzt, der seine gesamten Ersparnisse an der Börse investiert hat, und dann, als er die sechzig erreicht, feststellen muss, dass sein Vermögen um vierzig Prozent geschrumpft ist. Berthet hat eine Menge bedeutender Persönlichkeiten um die Ecke gebracht. Er hat so manches Staatsgeheimnis erfahren. Er war an Verschwörungen beteiligt, die so dermaßen raffiniert waren, dass niemand überhaupt bemerkte, dass es sich um Verschwörungen handelte, noch nicht mal die Verschwörer selber. Und wenn Berthet sich jetzt seine Wertpapierkonten und -bestände ansieht, dann muss er feststellen, dass man ihn verarscht hat, und zwar nach Strich und Faden. Sollte er die Gelegenheit bekommen, einen Börsenhändler umzulegen, würde er sich möglicherweise sogar eine Inszenierung von geradezu barocker Opulenz einfallen lassen, was eigentlich gar nicht seine Art war, ihn zum Beispiel ans Kreuz nageln oder ihm nach allen Regeln der Kunst die Haut abziehen.
Schon wieder kommen alte Erinnerungen hoch, ausgerechnet jetzt, wo diese Versager ihn ausschalten wollen. Erinnerungen, die mit den Finanzproblemen der Unité zu tun haben, und eben diese Finanzprobleme werden ihm das Leben retten, wenn denn die Unité hinter diesem idiotischen Versuch steckt, und er wüsste nicht, wer sonst.
Berthet erinnert sich an einen Buchhalter der Unité, der genau so aussah, wie man sich einen Buchhalter vorstellt, und der behauptete, er hieße Queneau. Aber bei der Unité konnte man wie ein Buchhalter aussehen und sich trotzdem darauf verstehen, durch das Drücken ganz bestimmter mysteriöser Punkte am menschlichen Körper jemanden dazu zu nötigen, sich zu ertränken, ohne dass bei der Autopsie irgendetwas Auffälliges festgestellt würde. Da konnten die Journalisten noch so viel spekulieren, es hätte nicht die geringste Konsequenz. So wie in dem Fall des Oberfinanzdirektors zum Beispiel. Queneau stellte also eine Adidas-Tasche auf den roten Resopalküchentisch in der eigens angemieteten Wohnung am Rande einer beliebigen französischen Stadt, sagen wir mal Le Mans, oder meinetwegen auch Poitiers.
Die Adidas-Tasche enthielt eine für damalige Verhältnisse ziemlich große Summe. Das war Anfang der achtziger Jahre. Dieses Geld deckte die geschätzten Kosten für die geplante Mission ab. Darin war das Honorar für Berthet und für die Agenten, die er sich zur Unterstützung holen würde, bereits enthalten. Wenn Berthet Bargeld von der Unité erhielt, war es ihm immer selbst überlassen, wie viel davon er für sich persönlich nahm, vorausgesetzt, er verlangte nicht im Laufe der Operation eine ungerechtfertigte Aufstockung.
Berthet sah wieder vor sich, wie sich die metallicblaue, leicht seidig glänzende Adidas-Tasche von dem roten Resopaltisch abhob. Ein Anblick, der einem fast in den Augen und an den Zähnen wehtat. Aber er hatte die achtziger Jahre schon immer extrem hässlich gefunden. Ein ästhetisch betrachtet völlig inakzeptables Jahrzehnt. Berthet zum Beispiel litt damals persönlich ganz besonders unter den schmalen und zugleich schreiend bunten Lederkrawatten und den Songs von Jakie Quartz. Berthet zählte also unter Queneaus Augen die Geldbündel. Damals waren es noch Francs. Auf den schönen Scheinen waren Gesichter abgebildet, keine vom Computer entworfenen virtuellen Landschaften.
Nachdem Berthet Queneau ein Bier angeboten hatte und Queneau ihm im Gegenzug eine Gitanes, versuchte Berthet ein wenig Konversation zu machen, und drückte seine Verwunderung darüber aus, wie problemlos die Unité so große Summen lockermachte, obwohl es sie offiziell gar nicht gab. Queneau sah ihn daraufhin an und sagte dann diesen sibyllinischen und sehr stichhaltigen Satz, der Berthet so gut gefiel, mehr wegen seines sibyllinischen Charakters als wegen seiner Stichhaltigkeit, denn Berthet hatte eine Schwäche für Geheimnisse, er lebte im Geheimen, und das Sibyllinische ist die poetische Seite des Geheimnisses.
Außerdem mochte Berthet Poesie, er las gerne Gedichte.
Gerade hat er in der Tasche seines Leinenanzugs eine Originalausgabe vom Gedichtroman von Georges Perros stecken. Berthet denkt, es wäre besser, er hätte jetzt stattdessen eine Knarre bei sich, selbst wenn er diese Clowns vermutlich relativ leicht mit bloßen Händen töten könnte. Man muss sie sich nur mal ansehen, dieses Lumpenproletariat mit der falschen Hautfarbe, ausgemergelt und sichtlich drogenabhängig.
Queneau sagte also, während er seine Gitanes ausdrückte und dabei einen Rülpser unterdrückte, nachdem er seine 33-Export-Dose zur Seite gestellt hatte:
»Geister müssen nicht aufs Klo gehen.«
Damit wollte er sagen, dass eine Organisation, die offiziell nicht existierte, die aber für den Staat unentbehrlich war, sich nicht mit solchen Lappalien wie administrativen oder budgetären Fragen abgeben musste. Ja, Berthet fand, diesem Bild wohnte eine gewisse Poesie inne. So könnte der Titel eines Gedichtbandes lauten. Geister müssen nicht aufs Klo gehen. Eines Tages würde Berthet auch etwas schreiben. Er verspürte von Tag zu Tag einen größeren Drang dazu, aber er hatte weder die nötige Zeit, noch das nötige Talent, dachte er. Man müsste jemanden finden, der das für einen erledigen konnte. Einen Ghostwriter. Da kommt Berthet eine Idee, aber nun ja.
Während er die jungen Taugenichtse beobachtet, die ihn aus dem Weg räumen sollen, denkt er, dass der tendenzielle Fall der Profitrate innerhalb der marktwirtschaftlichen Systeme und die sich daraus ergebende Austeritätspolitik alle dazu zwingt, aufs Klo zu gehen, selbst die Geister. Niemand, keine einzige Organisation, kann mehr so tun, als hätte sie nicht auch ein Bedürfnis.
Noch nicht mal die Unité.
Was war das noch für ein Auftrag, für den Queneau ihm das Geld überbrachte?
Ach ja, jetzt fällt es Berthet wieder ein.
Bürgerkrieg in einem Land des Nahen Ostens. Dort hatte man einen unserer Botschafter erschossen. Der Botschafter hatte ein palästinensisches Flüchtlingslager besucht und war mit seinem Chauffeur auf dem Rückweg zur Botschaft, ein mutiger Typ, ein früheres Résistancemitglied. Die Hauptstadt des Landes war in eine Vielzahl von Enklaven aufgesplittert, die von Verrückten aller Art beherrscht wurden, Anführer diverser politisch-religiöser Gruppierungen. Sie verfügten über ein reichhaltiges Waffenarsenal und zeichneten sich durch extreme Grausamkeit aus. An fast jeder Ecke der in Ruinen liegenden Stadt gab es Straßensperren, zwischen den durch Dauerbeschuss mit Maschinenpistolen brüchig gewordenen Häusern hatte man Checkpoints errichtet. Der Wagen des Botschafters wurde durch zwei alte schwarze BMW blockiert. Denen entstiegen ein paar Typen, natürlich mit Sturmhauben, und ansonsten ohne besondere Kennzeichen.
Nach dem Bericht, den Berthet gelesen hatte, hatte der Botschafter den Chauffeur angewiesen, die Türen zu verriegeln. Der Botschafter war intelligent und mutig. Ihm war klar, dass man ihn entführen wollte, und dass er als Geisel für Frankreich ein sehr viel größeres Problem wäre denn als Toter. Die Angreifer aus den schwarzen BMW waren wütend, sie hatten es eilig und sahen schon einen Transportpanzer der UNO anrollen. Also durchsiebten sie den Peugeot 607, der noch nicht mal gepanzert war, mit den Kugeln ihrer Kalaschnikows. Man fand elf Kugeln in der Leiche des Botschafters. Beim Chauffeur, der kurz darauf im Krankenhaus verstarb, waren es ein paar weniger.
Da die Geiselnahme gescheitert war, brüsteten die Auftraggeber sich nicht mit ihrer Tat, noch nicht mal inoffiziell. Dementsprechend nahmen die entlegensten Gruppierungen das Attentat für sich in Anspruch. Sogar die Roten Brigaden entblödeten sich nicht, sich dazu zu bekennen. Dabei konnte sich niemand vorstellen, wie diese Stümper, die den ganzen Tag Toni Negri lasen, bekanntermaßen lausige Schützen und von der politischen Polizei ihres eigenen Landes unterwandert waren, eine solche Operation an einem zweitausendfünfhundert Kilometer von Rom entfernten Kriegsschauplatz hätten durchführen können.
Der Auslandsnachrichtendienst kam relativ schnell zu dem Schluss, dass diese Operation vom Geheimdienst einer der regionalen Mächte, die in den Konflikt verwickelt waren, initiiert worden sein musste. Die regionale Macht fand, dass Frankreich sich ein wenig zu sehr in die internen Angelegenheiten des Landes im Kriegszustand einmischte und eine der Parteien den anderen vorzog. Sie mochte die neokoloniale Politik Frankreichs nicht.
Natürlich hatte man keine handfesten Beweise, nur einen begründeten Verdacht. Also erhielt der Auslandsgeheimdienst die Erlaubnis, Vergeltungsmaßnahmen durchzuführen. In den Wochen nach dem Anschlag kam ein Dutzend hochrangiger Militärvertreter der regionalen Macht auf ziemlich brutale Weise ums Leben. Aber offenbar war man an höherer Stelle der Meinung, dass das nicht genügte, um es den Schweinen zu zeigen.
Dementsprechend forderte man den Inlandsnachrichtendienst auf, ein paar Leute aufzutun, die in Frankreich lebenden Staatsangehörigen der betreffenden Regionalmacht einen Denkzettel verpassen könnten. Man wollte zeigen, dass man es an Bösartigkeit mit ihnen aufnehmen beziehungsweise sie darin noch übertrumpfen konnte. Beim Inlandsgeheimdienst reagierte man eher unwirsch darauf. Man hatte nämlich wenig Interesse, in einen neuen Kreuzzug hineingezogen zu werden, ohne offiziellen Auftrag, und diesen wollte die Regierung natürlich nicht erteilen.
Man regte es nur an, mehr nicht.
Man ließ es durchblicken.
Man munkelte es in den Hinterzimmern.
Und wenn man sich im Bereich bloßer Andeutungen bewegt, ist das eher ein Fall für die Unité. Sie existiert zwar offiziell nicht, aber versteht alles ohne weitere Erklärungen. Die von der Unité sind echte Spezialisten für Euphemismen, für Unter- und Übertreibungen, für doppelte Verneinungen, für Anspielungen und alles, was dazugehört.
Kurzum, Berthet erhielt in diesem Wohnblock am Rande einer Provinzstadt auf dem roten Resopalküchentisch Geld, um ein Team zusammenzustellen und eine Reihe von Anschlägen gegen in Frankreich lebende Staatsangehörige der Regionalmacht zu verüben, die in den Tod des französischen Botschafters verwickelt waren. Nachdem Queneau gegangen war, kontaktierte Berthet zwei andere Agenten, die er schätzte, Couthon und Desmoulins, er sprach ihnen von einer Telefonzelle vor dem Wohnblock aus aufs Band. Anfang der achtziger Jahre gab es noch Telefonzellen vor Wohnblocks, aber ihre Tage waren gezählt.
Couthon und Desmoulins erschienen am nächsten Tag. Zuerst Couthon. Er klingelte bereits um zehn Uhr morgens an der Tür. Er sah aus wie ein verbummelter Student, trug eine fadenscheinige Jeans, einen Wildlederblouson, ein kragenloses Hemd, hatte lange, ungewaschene Haare und eine Trotzkisten-Nickelbrille. Couthon hatte einen Rucksack dabei und mehrere Plastiktüten vom Supermarkt, prall gefüllt mit allerlei Fertiggerichten und vergorenem Traubensaft.
»Ich dachte mir, wir müssen sicher einige Zeit hierbleiben«, sagte er statt einer Begrüßung.
»Das war vorausschauend von dir«, sagte Berthet.
»Du leitest also die Operation. Ist sonst noch jemand dabei?«
»Desmoulins.«
»Desmoulins mag ich gerne. Ich habe sie eine Ewigkeit nicht gesehen. Ist sie immer noch so hübsch?«
Desmoulins traf eine Stunde später ein. Ja, sie war wirklich hübsch. Hübscher als Couthon und auch sauberer. Desmoulins sah aus wie eine Doppelgängerin von France Dougnac, eine Schauspielerin, die man heute nicht mehr kennt, so wie man heute auch keine Telefonzellen vor Wohnblöcken mehr kennt.
»Alles okay, Jungs?«
Desmoulins roch so gut wie der Frühling draußen. Unter ihrer Blümchenbluse zeichneten sich ihre Brustwarzen ab, und angesichts ihrer beigen Caprihose, die über ihren gebräunten Knöcheln endete, bekam Berthet Lust, an den Strand zu fahren.
Sie setzten sich an den roten Resopaltisch und machten sich an die Arbeit. Berthet erklärte ihnen, worin ihr Auftrag bestand. Sie gingen die Zielpersonen durch, sechs an der Zahl, und teilten das Geld aus der blaumetallicfarbenen Adidas-Tasche auf.
Sie kamen überein, dass sie die Sozialwohnung nicht bis zum Ende ihres Einsatzes als Basis nutzen wollten. Wenn sie bei der letzten Zielperson angekommen wären, würden sie umziehen. Die Unité hatte die Wohnung angemietet und es war nicht ausgeschlossen, dass sie nach Abschluss des Auftrags die Liquidierung von Berthet, Couthon und Desmoulins beschließen würde. Das war schon vorgekommen. Die Großreinemacher fallen einer Säuberung zum Opfer. Wenn die Unité also ihre Leute losschickte, sollte man ihnen die Arbeit nicht unnötig erleichtern, und wenn sie dann feststellen sollte, dass die Gelegenheit in diesem Fall keine Diebe und auch keine Henker machte, käme sie womöglich von ihrem Plan ab. Auch das war schon vorgekommen und konnte jederzeit wieder vorkommen.
An diesem Punkt seiner Erinnerungen blitzte bei Berthet kurz ein ebenholzfarbener Gedanke an Kardiatou auf.
In den folgenden Wochen fügten Berthet, Couthon und Desmoulins den Staatsangehörigen der regionalen Macht empfindliche Verluste zu.
Ein Kulturbeauftragter, der in Nogent-sur-Marne in einem Jugendzentrum einen Film über sein Land vorstellte, brach sich auf der Treppe seines Hotels, immerhin ein Drei-Sterne-Hotel, das Genick, nachdem er festgestellt hatte, dass der Fahrstuhl außer Betrieb war. In anderen Zeiten war dieser cinephile Vortragsreisende ein berüchtigter Folterknecht in einem der politischen Gefängnisse der Regionalmacht gewesen. Aber das wiederholte Herumtrampeln auf Hoden oder Einführen von Flaschenscherben in Vaginen hatte bei ihm offenbar auf Dauer nervöse Störungen ausgelöst. Das erklärte, warum er nun als Diplomat eine ruhige Kugel schob.
Ein Paar, das einen Feinkostladen für Spezialitäten aus dem Nahen Osten führte, starb in seinem Schlafzimmer an Rauchvergiftung durch ein Feuer ungeklärter Ursache, bei dem ihr Laden völlig ausbrannte. Sie schliefen direkt darüber. Das Paar verkaufte nicht nur Hummus und Ras el Hanout, sondern ihr Geschäft diente auch als Postadresse für die geheimen Aktivitäten der Regionalmacht auf französischem Territorium.
Ein anderes Paar, das ebenfalls von dort stammte, wohlhabende Touristen, die ein Haus in Domme besaßen, wurde eines Abends von einer polizeibekannten Motorradgang angegriffen. Sie quälte, vergewaltigte und ermordete das Paar und ergriff dann mitsamt ihren Wertsachen und ihrem Schmuck die Flucht. Dem Paar aus Domme konnte man eigentlich nichts vorwerfen, außer der Tatsache, dass es eng mit dem Präsidentendiktator der Regionalmacht befreundet war. Andererseits kann man sich seine Familie zwar nicht aussuchen, seine Freunde aber schon.
Eben dieser Fall hatte Berthet ziemlichen Ärger bereitet. Er hatte so eine Vorahnung und fuhr deshalb, sicher ist sicher, im Morgengrauen noch mal los, um die Arbeit der Motorradgang zu überprüfen. Die schöne Villa mit Blick über das Tal der Dordogne war völlig verwüstet und voller Blutflecken. Gut, dass Berthet auf seinen Instinkt gehört hatte. Sie hatten zwar gewütet wie die Berserker, aber schlampig gearbeitet und es versäumt, die Frau zu liquidieren. Berthet fand sie nackt und gefesselt vor der Kloschüssel vor, dort hockte sie und spuckte Blut.
Als sie Berthet hereinkommen hörte, wandte sie sich um. Sie hatte ein schönes Gesicht, sah aus wie eine arabische Prinzessin, so etwas in der Art war sie auch, aber zugleich war sie eine hochrangige Expertin für Desinformation, genau wie ihr Mann. Ihr Betätigungsfeld waren NGOs, die in den Konflikt involviert waren, bei dem der französische Botschafter sein Leben verloren hatte.
Berthet tötete sie, indem er ihren Kopf gegen den Rand der Kloschüssel schlug.
Er verbrachte den Tag am Ufer der Dordogne bei Souillac, legte sich auf ein Feld und las Paul-Jean Toulet. Abends traf er Couthon und Desmoulins in einem Restaurant in Sarlat, so wie es besprochen war. Berthet blaffte Desmoulins an, die für die Motorradgang verantwortlich war:
»Es ist nicht meine Aufgabe, deine Arbeit zu kontrollieren, Desmoulins«, sagte er, während er ein Glas mittelmäßigen Cahors leerte. Aber ein Cahors ist nun einmal oft mittelmäßig.
»Die Motorradfahrer wurden am späten Vormittag gefunden«, informierte Couthon sie. »Sie hatten sich auf einem Hof verschanzt und ballerten mit Jagdgewehren mit abgesägtem Lauf herum. Das sind echte Irre. Die Beamten haben nicht lange gefackelt. Drei sind tot. Einer liegt im Koma. Du hast ihnen jedenfalls guten Stoff geliefert, Desmoulins, als du sie in diesem Nachtclub in Périgueux angebaggert hast.«
»Damit habe ich nichts zu schaffen. Dieses Teufelszeug haben die in den Laboren der Unité fabriziert. Ich hatte ein bisschen was von meiner letzten Mission aufgehoben, für alle Fälle. Der einzige Überlebende wird sich an nichts erinnern. Aber gib dir keine Mühe, mich zu rehabilitieren, Couthon. Berthet hat Recht. Es wäre meine Aufgabe gewesen, ihre Arbeit zu überprüfen.«
Berthet bedeutete ihr, es sei halb so schlimm. Nachdem er den ganzen Nachmittag Paul-Jean Toulet gelesen hatte, während der Fluss in der Sonne glitzerte, war er milde gestimmt.
Desmoulins war offenbar trotzdem nicht ganz wohl in ihrer Haut. Man konnte sich nie sicher sein. Berthet leitete diese Mission. Er würde einen Bericht verfassen. Wenn er Desmoulins’ Fehler in seinem Bericht erwähnte, würde sie dafür teuer bezahlen müssen.
Berthet aß den letzten Happen von seinem Salat mit gefülltem Gänsehals. Aufträge im Périgord waren noch nie sein Fall gewesen. Das war bis heute so. Schon damals, und da war er noch jung, musste er jede noch so kleine Sünde hinterher im Fitnessraum wieder abtrainieren.
»Wir müssen über unser weiteres Vorgehen entscheiden«, sagte er. »Eine Person ist noch übrig. Die anderen sind ja nicht blöd, die werden inzwischen auch gemerkt haben, dass sich die Todesfälle unter ihresgleichen verdächtig häufen. Sie haben Angst, sind wütend, sind gewarnt. Außerdem stellt sich die Frage, wie wir uns der Unité gegenüber verhalten wollen. Ich sage noch mal, was unsere Alternativen sind: Entweder wir verlassen die Basis, die sie uns zugeteilt haben, oder wir vertrauen ihnen. Was meint ihr?«
Couthon mit seiner Trotzkisten-Nickelbrille blickte von seinem Pflaumenbrand aus Souillac auf und sah Berthet an, als sei der nicht ganz bei Trost.
Desmoulins schaltete sich ein und sagte:
»Ich bin, ehrlich gesagt, kein großer Fan von rotem Resopal.«
Als Berthet später seinen Bericht verfasste, war dieser Satz mit ausschlaggebend dafür, dass er beschloss, Desmoulins’ Nachlässigkeit in Domme unter den Tisch fallen zu lassen. Desmoulins erfuhr nie davon. Beim Gedanken daran findet Berthet, dass er sich damals doch recht großzügig gezeigt hat, um nicht zu sagen, wahre Größe bewiesen hat. Ab und an hat er solche Anfälle von Selbstzufriedenheit. Das ist ihm durchaus bewusst, aber er denkt sich, dass es unerlässlich ist, sich ein gewisses Maß an Selbstwertgefühl zu bewahren, wenn man gezwungen ist, eine nackte junge Frau, die zuvor gefoltert worden war, zu töten, indem man ihren Kopf gegen eine Kloschüssel voller Blut schlägt, und all das im Namen eines geopolitischen Kräftemessens, das letztendlich doch relativ abstrakt ist.
Berthet, Couthon und Desmoulins entschieden also, sich einen anderen Unterschlupf zu suchen. Die in der blauen Adidas-Tasche enthaltene Summe war so großzügig bemessen, dass sie sich diese kleine Extravaganz zu ihrer eigenen Sicherheit problemlos leisten konnten. Sie fuhren in eine Stadt im Zentrum Frankreichs, eine Unterpräfektur der Auvergne, und mieteten in einer schmalen Straße in Bahnhofsnähe eine altmodisch möblierte Wohnung ohne Resopaltisch in der Küche: Fensterläden aus Holz, eine beige verputzte Fassade, runde und grüne Berge, ein hellgrauer Himmel, sie waren unverkennbar im Zentralmassiv gelandet.
Sie fuhren mit dem Zug nach Paris und nahmen zügig ihren letzten Auftrag in Angriff, die Beseitigung der letzten noch verbliebenen Zielperson. Es handelte sich um einen Millionär und Waffenhändler, der bei Vésinet in einem Stadtpalais lebte.
In jener Nacht trugen sie Kampfanzüge und Rangers, die sie in einem Militäroutlet in Saint-Ouen erstanden hatten. Sie verschafften sich Zugang zum Grundstück und dann zur Garage. Couthon, ein guter Mechaniker, machte sich daran, den Bentley Mulsanne des Millionärs und Waffenhändlers so zu manipulieren, dass der zu erwartende Unfall nach technischem Versagen aussehen würde, was das Image der englischen Marke etwas ankratzen sollte.
Da tauchte ein Bodyguard des Millionärs und Waffenhändlers mit einer sehr kompakten kleinen Maschinenpistole in der Hand auf, einer Mini-Uzi.
»Ist es dir nicht peinlich, dich bei deinem Feind mit Waffen einzudecken?«, murmelte Desmoulins und packte ihn am Hals, während sie ihm ein belgisches M7-Bajonett in den Rücken stieß. Sie fing ihn auf, bevor er auf den Betonboden knallte.
»Scheiße!«, rief Berthet aus, der Couthons Manipulationen an der Mechanik des Bentley Mulsanne mit einer Taschenlampe beleuchtete. »Du kannst aufhören, Couthon! Den Autounfall nimmt uns eh keiner mehr ab.«
»Und was machen wir nun?«
»Wir bringen den Kerl wie geplant um. Die Unité wird hinter uns saubermachen. Sie wird sich auch darum kümmern, den Medien eine saubere Geschichte zu präsentieren. Dafür haben die ihre Spezialisten«, sagte Berthet.
»Das wird der Unité nicht gefallen«, sagte Couthon.
»Zum Glück haben wir uns eine andere Bleibe gesucht«, sagte Desmoulins, die ihr M7-Bajonett an der Leiche des Leibwächters abwischte.
»Zum Glück sind wir auf alles vorbereitet«, sagte Berthet, und holte drei nicht registrierte SIG-Sauer P220 aus seiner Tasche, auf die er Schalldämpfer montierte, bevor er den beiden anderen ihre Waffe gab.
»Gehen wir, wir sollten nicht trödeln.«
Die drei hatten sich in ihrer möblierten Wohnung in der Auvergne den Grundriss des Patrizierhauses vorher genau angesehen. Sie wussten also, wo das Schlafzimmer des Millionärs lag, und sie wussten auch, dass der Leibwächter in normalen Zeiten noch einen Kollegen hatte. Allerdings war nicht auszuschließen, dass er inzwischen mehr als nur einen Kollegen hatte, nachdem den in Frankreich lebenden Angehörigen der Regionalmacht aufgefallen sein dürfte, dass die Sterblichkeitsrate in ihren Reihen in letzter Zeit rasant gestiegen war.
Bevor sie weiter in das Haus eindrangen, machte Desmoulins den Sicherungskasten ausfindig und drehte den Strom ab. Die Alarmanlage war bereits ausgeschaltet, und die Telefonkabel waren durchtrennt.
Bei der Erinnerung an diesen Abend und daran, wie einfach sein Job früher einmal war, wird Berthet direkt melancholisch. Dabei beobachtet er weiter die Amateure, die ihn in die Zange nehmen sollen. In den letzten dreißig Jahren musste er sich permanent fortbilden, um in Bezug auf die modernen Technologien auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Ein paar arrogante Jungspunde, Neulinge bei der Unité, vermutlich irgendwelche Hacker, die draußen auf dem Terrain aufgeschmissen wären, bildeten regelmäßig Alte wie ihn weiter. Das fand in schmucklosen Vortragsräumen oder Büros von Briefkastenfirmen statt, die meistens extra für diesen Anlass in einem Hochhaus bei La Défense angemietet wurden, oder in einem dieser neuen Geschäftsviertel, die in größeren Provinzstädten unweit der neuen TGV-Bahnhöfe wie Pilze aus dem Boden geschossen waren. Die Zeit, in der es genügte, einen Schraubenschlüssel, eine Nagelfeile und eine kleine Schere im Gepäck zu haben, um in eine Villa einzudringen, war ein für alle mal vorbei. Gut, ein bisschen Know-how hatte man schon auch noch mitbringen müssen.
Nein, seit Mitte der achtziger Jahre, diesem verfluchten Jahrzehnt, musste man wie ein in die Jahre gekommener Angestellter zu diesen Seminaren gehen, in irgendwelchen Konferenzräumen mit Scheiben aus Rauchglas. Man musste in Großraumbüros hinter Computerbildschirmen hocken und erniedrigende Übungen über sich ergehen lassen. Man musste sich von irgendwelchen übelriechenden Bubis überwachen lassen, die einem über die Schulter schauten, während man auf einer Tastatur herumtippte oder versuchte, das geheimnisvolle Innenleben eines Smartphones zu ergründen. Dabei nuckelten sie an ihren Milchshakes, wodurch ihr Mundgeruch um eine Schokoladennote bereichert wurde.
Scheiße aber auch.
Natürlich waren in dem Patrizierhaus nicht nur zwei Bodyguards. Es waren fünf an der Zahl, den, der neben dem Bentley Mulsanne lag, nicht mitgerechnet. Der wäre sicher auch lieber bei einem von schwerem Artilleriefeuer begleiteten Kampf unter strahlend blauem Himmel in den Ruinen einer weißen Stadt gestorben, wie ein echter Mann!
Berthet, Couthon und Desmoulins arbeiteten schnell, präzise und aufeinander abgestimmt. Dazu benötigten sie keine extra Nachtsichtbrille wie diese Weicheier von Sondereinsatzkräften heute. Es genügte, auf jedes noch so kleine Geräusch in der Dunkelheit zu achten, über einen guten Orientierungssinn zu verfügen, und sich den Grundriss besser eingeprägt zu haben, als irgendein von einer anderen Person vorab programmierter Computer das je könnte. Die gute alte Zeit eben.
Das Trio liquidierte die Leibwächter zügig und bravourös. Zwei in der ersten Etage, drei in der zweiten Etage, wo sich auch das Schlafzimmer des Millionärs und Waffenschiebers befand. Nur einem einzigen gelang es, vorher noch eine kurze Salve abzugeben, die in der Boulle-Standuhr stecken blieb. Das verursachte natürlich einen Heidenlärm, aber angesichts des großen Parks rund um die Villa gab es keinen Grund zur Beunruhigung.
Die drei setzten ihre SIG-Sauers nur sparsam, aber dafür umso effizienter ein. Fast geräuschlos fiel hier jemand auf den Teppich, sackte dort jemand auf einem Sessel zusammen, die Unité-Agenten erledigten ihre Aufgabe mit Virtuosität, ja fast Eleganz.
Der Millionär hatte sich aus seinem riesigen Schlafzimmer in sein riesiges Badezimmer geflüchtet. Bevor sie zu ihm vordringen konnten, mussten sie noch eine Frau beseitigen, vermutlich eine Prostituierte, die starr vor Schreck in einem überdimensionierten Bett mit einem grauenvoll pseudobarocken Baldachin saß.
Was war das doch für eine gesegnete Zeit, in der es noch keine Mobiltelefone gab. Der Gejagte hatte schlicht Angst, wie ein in die Enge getriebenes Tier, und klammerte sich nicht verzweifelt an sein Handy wie an einen letzten Strohhalm, indem er wie wild darauf herumtippte. Nein, er stand einfach nur nackt und fett wie er war am Waschtisch, zitterte und murmelte etwas auf Arabisch. Dann wechselte er ins Französische und bot ihnen, wenig überraschend, Geld an. Berthet erklärte ihm müde, dass er sich das sparen könne, und Couthon schoss.
Danach berieten sie noch darüber, ob sie das im Haus vorhandene Bargeld mitgehen lassen sollten. Couthon war dafür. Er fand, dann sehe es nach einem niederträchtigen Raubmord aus. Berthet und Desmoulins waren dagegen. Berthet sagte, das sei wenig glaubwürdig und im Übrigen wolle die Unité so oder so, dass es nach einer indirekten Racheaktion des französischen Staates aussehe.
»Und was ist mit der Motorradbande von Domme?«, merkte Couthon an. »Die durfte sich doch auch bedienen, oder etwa nicht?«
Das war nicht ganz falsch. Schließlich gab Berthet seine Zustimmung, aber sie hatten nicht mehr besonders viel Zeit. Sie mussten sich also mit einer mittelgroßen Summe Bargeld begnügen, das sie in diversen Schubladen fanden, und den Hartmann-Safe im Büro, der hinter einem Corot versteckt war – vermutlich eine Fälschung, wie die meisten Corots – zu ihrem Bedauern unberührt lassen. Dafür fehlte ihnen die nötige Ausrüstung.
Am nächsten Tag saßen sie im Wohnzimmer ihrer Wohnung zusammen. Sie waren gerade erst zurückgekehrt und zugegebenermaßen ziemlich müde. Sie teilten das Geld gerecht auf, dann hörten sie Radio. Dort war von einem Blutbad in einer Vorortvilla bei Vésinet die Rede, das sicherlich in Zusammenhang mit dem Dauerkonflikt im Nahen Osten stehe. Dann aßen sie mit einem geradezu beängstigend großen Appetit Kutteln mit Lammfüßen und Puylinsen und tranken dazu vier Flaschen Wein, Saint-Pourçain, an dem sie ganz offenbar Gefallen fanden.
Desmoulins rülpste satt und schlug vor:
»Wie wär’s, wenn wir jetzt zusammen ins Bett gehen, alle drei? Aber nur unter der Bedingung, dass du vorher duschst, Couthon.«
Berthet, Couthon und Desmoulins vögelten mit großer Begeisterung einen guten Teil des Tages und der folgenden Nacht. Nachdem Berthet zum Höhepunkt gekommen war und Couthon seinen Platz überließ, lauschte er erneut auf das Radio, das immer noch lief. Dort brachten sie diese eklige Achtziger-Jahre-Musik, unterbrochen von Informationen zum Blutbad in Vésinet. Berthet fragte sich, wie die Unité es aufnehmen würde, dass sie nicht an ihrer ursprünglichen Basis geblieben waren und vereint um den roten Resopaltisch warteten, und ob sie das als Beleg für übertriebenes Misstrauen der Hierarchie gegenüber werten würde, oder vielmehr als ein Zeichen dafür, dass es sich bei Berthet, Couthon und Desmoulins um vorausschauende und umsichtige Agenten handelte.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte Desmoulins, die offenbar Gedanken lesen konnte und erneut seinen Schwanz in ihrem Mund verschwinden ließ, ihr sommersprossiges Gesicht ging auf und nieder, während Couthon sie unermüdlich von hinten nahm und sich dabei ab und an seine Trotzki-Brille zurück auf die Nase schob, ohne dabei aus dem Rhythmus zu kommen.
Tatsächlich hatte es kein Nachspiel für sie.
Drei Wochen später überreichte Berthet Losey, seiner üblichen Kontaktperson, seinen Bericht. Losey machte keinerlei Anmerkung dazu, dass sie den Unterschlupf gewechselt und sich in Vésinet bedient hatten. Vielleicht wusste er auch nichts davon oder es war ihm schlicht egal. Er wirkte mit Recht zufrieden, und nach einer kurzen Unterredung im Büro einer Scheinfirma, einer angeblichen Versicherungsagentur in der Rue de Maubeuge, ließ er es sich nicht nehmen, Berthet zu elsässischem Sauerkraut mit Speck und Würsten im Terminus Nord im Gare du Nord einzuladen, auch wenn Sauerkraut eigentlich keine Saison hatte.
3
Berthet soll getötet werden.
Das ist eine ziemlich schlechte Idee.
Er glaubt zu wissen, warum er getötet werden soll, und hat deshalb eine Stinkwut. Es ist zugleich so vorhersehbar und so dumm von der Unité.
Schon ein Jammer, denkt Berthet, dass die Unité, genau wie die staatliche Eisenbahn, die Post oder auch das Bildungswesen, mangels ernsthafter Investitionen ihre Leistungen so zurückfahren muss. Denn letztendlich ist die Unité, ob es einem nun gefällt oder nicht, auf ihre zugegebenermaßen etwas spezielle Art auch Teil des öffentlichen Dienstes, nur dass die von ihr angebotenen Dienste eben streng geheim sind.
Berthet, der im Grunde seines Herzens in Wirtschaftsfragen ein Sozialliberaler ist – man schaue sich nur an, welche politischen Ideen ihn umtreiben –, meint, die Unité müsse neben dem Staat noch andere Finanzquellen auftun, sich wohl oder übel ein bisschen was einfallen lassen, um attraktiv für Investoren aus der Privatwirtschaft zu werden. Selbstredend hat Berthet dabei nicht hochriskante Geldanlagen bei Banken im Sinn, die nur ans Spekulieren denken und ein toxisches Finanzprodukt nach dem anderen erfinden, durch die man innerhalb weniger Jahre sechzig Prozent seiner mageren Ersparnisse einbüßt, statt den versprochenen Gewinn zu machen.
Berthet ist einer der langjährigsten und verdientesten Mitarbeiter der Unité. Als solcher glaubt er, sich ein gewisses Urteil darüber erlauben zu können, was bei der Unité schiefläuft. Vor fünf oder sechs Jahren hat er Losey deshalb ein Memo übergeben, verbunden mit der Aufforderung, es an einen Vorgesetzten seiner Wahl weiterzureichen. In diesem Memo legte Berthet dar, dass die Unité, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben wolle, unbedingt lernen müsse, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. Das bedeute, anders ausgedrückt, die Mitarbeiter im Außendienst sollten einen gewissen Spielraum bekommen, sich die nötige Kohle selber zu beschaffen, und die Vorgesetzten sollten alle Tricks und Kniffe decken, die das alleinige Ziel hätten, Geld in die Kasse zu spülen. Im Übrigen sei das im kleineren Rahmen schon immer Usus gewesen. Es gehe also nur darum, eine Praxis offiziell anzuerkennen beziehungsweise zu unterstützen, die in einer Grauzone bereits existiere. So eine Grauzone sei die reine Heuchelei. Ein riesiges verstecktes Gebiet innerhalb der Demokratien, die nicht öffentlich eingestehen wollten, dass sie zu gewissen unschönen Dingen gezwungen sind, um so noch größere Übel abzuwenden. Eine Eigenfinanzierung oder öffentlich-private Partnerschaften hätten der Unité helfen können, ihre budgetären Engpässe zu überwinden, statt an qualifiziertem Personal zu sparen oder gar Leistungen an Subunternehmer zu übertragen und damit den gesicherten Ablauf ihrer Operationen zu gefährden.
An qualifiziertem Personal spart man jedenfalls, wie unschwer an den Clowns zu erkennen ist, die Berthet folgen und dabei ein geradezu erschreckendes Selbstvertrauen an den Tag legen. Was glauben sie eigentlich, mit wem sie es zu tun haben? Mit einem Touristen? Mit einem Handlanger? Es ist Berthet ein Rätsel, wer in der Unité sich einen solchen Schnitzer geleistet und derart jämmerliche Kleinkriminelle engagiert haben könnte, Kostendruck hin oder her. Das kann nur jemand gewesen sein, der ihn nicht besonders gut kennt oder ihn unterschätzt. Vermutlich jemand, der meint, ein Mann über sechzig in diesem Beruf sei quasi ein Toter auf Urlaub.
Einer von den Neuen? Vielleicht haben sie Losey aufs Abstellgleis geschoben. Vielleicht musste er einem jungen Idioten Platz machen, der eine Eliteschule besucht hat und glaubt, man könne Berthet so mir nichts, dir nichts um die Ecke bringen. Einer, der meint, Berthets Heldentaten seien nur Legenden und die Alten von der Unité würden, eben weil sie alt sind, übertreiben und die Beseitigung eines möglicherweise hochverdienten, aber inzwischen abgetakelten Agenten zu einem Riesenproblem stilisieren. Hochverdient auch nur, wenn man die K-Affäre (K wie Kardiatou) ausklammerte. Ja, vermutlich haben sie Losey aufs Abstellgleis geschoben. Oder er ist zu alt oder zu müde, sich den jungen Ehrgeizlingen entgegenzustellen. Oder er ist in die Sache schlichtweg nicht eingeweiht.
Berthet geht im Geiste ein paar Namen durch, stellt Hypothesen auf und sinnt zugleich darüber nach, wie er diese jämmerlichen Gestalten loswerden kann, die ihm nach dem Leben trachten. Es gibt Grenzen, das muss man einfach mal sagen. Außerdem wartet in seinem Bett im Hotel Duas Nações in der Rua Augusta eine Frau auf ihn, die er nur ungern noch länger warten lassen möchte.
Berthet muss feststellen, dass ihm niemand einfällt, der dafür in Frage käme. Er kennt die Neuen einfach zu wenig, weder die Agenten noch die Führungsebene, die Chefs, wie Losey. Er trifft halt immer weniger Leute.
Mit Kardiatou fing es an, klar, aber der Wunsch, sich aus allem zurückzuziehen, verstärkte sich mit den Jahren, ob mit oder ohne Kardiatou. Nicht nur, um der Unité zu entkommen, sondern um der Welt zu entkommen. Um sich selbst zu entkommen. Um dem Alter zu entkommen. Berthet schiebt die Hand in die Tasche seines Leinenanzugs, tastet nach der Originalausgabe vom Gedichtroman. Er spürt das Pergamin, mit dem er das Buch eingeschlagen hat. Einen kurzen Moment lang ist Berthet glücklich. Das Alter. Man muss ein gewisses Alter erreicht haben, um sich an einem Pergaminpapier zu erfreuen, in das ein geliebtes Buch eingeschlagen ist.
Berthet setzt seinen Weg durch die Nacht in Richtung Rossio-Bahnhof fort. Dabei vergisst er nicht die Clowns, die ihm folgen und versuchen, sich unauffällig unter die spärlichen Gäste der Caféterrassen der Baixa zu mischen, aber Perros sagt ihm:
Ich habe es so eingerichtet, dass man mich
in meinen unterirdischen Gängen in Ruhe lässt
Berthet kann sich noch so oft sagen, dass dieses amateurhafte Auftreten ihm zweifelsohne das Leben retten wird, er ist trotzdem fast ein bisschen sauer, dass die Unité zu solch verzweifelten Methoden greift. Was versprechen sie sich davon? Glauben sie im Ernst, diese linkischen Typen könnten ihm irgendetwas anhaben? Glauben sie an einen Zufallstreffer, oder was? Es hat Zeiten gegeben, da wäre es der Unité nicht im Traum eingefallen, auf einen glücklichen Zufall zu setzen, Zeiten, in denen sie sich nicht wie die Nationallotterie aufgeführt hätte.
Losey, der Berthet intelligent fand, las also sein Memo und sprach ihn anschließend darauf an. Er sagte, ohne näher ins Detail zu gehen, die Unité greife bereits auf Partner in der Privatwirtschaft zurück, und diese seien bereit, viel Geld für die von der Unité angebotenen Leistungen zu bezahlen, wie zum Beispiel den Personenschutz eines Emirs oder bedeutender Börsenmakler. Aber die Idee, dass die Agenten sich vor Ort selber ihre Finanziers suchten, nein, da habe man dann doch zu große Sorge, das Ganze könne in organisierte Kriminalität abgleiten.
»Sie wissen, worauf ich anspiele, nicht wahr, Berthet?«
Berthet schaute in eine andere Richtung.
Losey fuhr fort und erläuterte:
»Ihr Memo ist ein nettes Gedankenspiel, es benennt die Probleme, die der Führungsebene auf den Nägeln brennen. Ich kann Ihnen nur eine grobe Einschätzung geben, wie Ihr Memo aufgenommen wurde, zum einen, weil ich nicht zur Führungsebene gehöre, und zum anderen, weil Geheimnisse nun einmal, das wissen Sie so gut wie ich, unser Geschäft sind.«
Berthet wusste, dass zumindest einer der beiden Punkte gelogen war. Er hatte im Laufe der Jahre mitbekommen, dass Losey einer von den Oberhäuptlingen war, einer der Gründer der Unité. Das änderte jedoch nichts daran, dass Losey wie jeder x-beliebige Agent jederzeit auf die Abschussliste geraten konnte. Auf die Dauer fiel Berthet nur eine einzige Analogie ein, mit der man die Funktionsweise der Unité erklären konnte, und das war der Stalinismus. Mit dem kleinen Unterschied, dass es in der Unité keinen Stalin gab, aber ob nun Stalinismus oder modernes Management, das lief aufs Gleiche hinaus.
Innerhalb des Führungszirkels gab es zwei Strömungen, so hatte Losey es ihm an jenem Tag erklärt. Diese standen für den ewigwährenden Konflikt zwischen den Alten und den Neuen. Die Neuen meinten, man könne nur durch eine Öffnung hin zur Privatwirtschaft wettbewerbsfähig bleiben und letzten Endes auch Geld verdienen, denn die Zeit der Tempelritter sei nun einmal vorbei. Es sprach ihrer Meinung nach nichts dagegen, dass die Unité ihre Mitarbeiter nach Leistung bezahlte und die brillantesten Chefs eine Vergütung erhielten, die diesen Namen verdiente. In der Privatwirtschaft gebe es schließlich auch so etwas wie Aktienoptionen, einen goldenen Fallschirm und einen goldenen Handschlag. Die Neuen sahen nicht ein, wieso sie angesichts der großen Verantwortung, die sie trugen, und der Tatsache, dass sie in einigen Fällen sogar in den Gang der jüngeren Geschichte eingegriffen und mit dem Leben Hunderter oder gar Tausender gespielt hatten, am Ende mit einer Dezernentenpension gemäß Beamtenbesoldungstabelle abgespeist wurden, selbst wenn sie sich durch Nebeneinkünfte ein schönes finanzielles Polster geschaffen hatten.
Die Alten wiederum betonten die Risiken, die mit der Umwandlung der Unité in einen privaten Dienstleister verbunden waren, in eine Art multinationalen Konzern für Geheimagenten, wie es sie in den USA bereits gab. Wer konnte schon wissen, ob nicht, eben wie in den USA auch, am Ende Unternehmen wie Blackwater daraus hervorgingen, Privatarmeen, die aus lauter Söldnern bestanden? Die Alten fanden diese Entwicklung bedenklich. Sie waren der Meinung, die Unité könne unter diesen Umständen sehr schnell das Wohl der Nation aus den Augen verlieren, dem sie eigentlich dienen sollte, und sich zu einem echten Monstrum entwickeln, einer Macht, deren Arbeitsweise so undurchsichtig und komplex wäre, dass niemand mehr in der Lage wäre, sie zu kontrollieren. Sie sahen die Gefahr, dass die Unité am Ende nur noch im eigenen Interesse handeln würde. Das sei ja bereits manchmal der Fall, wenn das also jetzt der Normalfall werden sollte …
Das sei nicht ungefährlich, so ein Staat im Staate, nicht gerade sehr republikanisch, sagte Losey, der noch immer ein großer Sauerkrautliebhaber war und Berthet dieses Mal in der Brasserie Bofinger traf.
»Nation«, »republikanisch«, niemand außer Losey nahm noch solche Worte in den Mund. Er war genauso old school wie Sauerkraut mit Speck und Würsten, wie Bofinger, wie das Licht, das durch das Glasdach fiel und ihnen das angenehme Gefühl vermittelte, sich in einem komfortablen Aquarium zu befinden, in dem man sich mit gleichermaßen fettem wie delikatem Comfort Food den Magen vollschlug, wie eben dem schlichten Sauerkraut auf elsässische Art.
Damit würde man auch, fuhr Losey fort, die Voraussetzung für die Gründung anderer Unités schaffen, und das würde zwangsläufig eine mörderische Konkurrenz nach sich ziehen. »Wir reden hier schließlich nicht über den Verkauf von Bordeauxweinen, Airbus-Jets oder meinetwegen auch Atomkraftwerken an die Chinesen, sondern über nichts Geringeres als den Ausverkauf von Staatsgeheimnissen, nationaler Sicherheit und geopolitischen Interessen.«
Losey verschlang mit zwei Happen eine Wurst aus dem Jura und kippte sein Glas Riesling herunter. Auf einmal sah er unendlich melancholisch aus.
»Die Frage ist nur, hat der Staatsdienst noch irgendeinen Sinn?«, fragte er Berthet. »Droht der Unité nicht indirekt das gleiche Los wie den Nationalstaaten, weil sie nicht in der Lage ist, sich an eine globalisierte Welt anzupassen?«
Losey seufzte und fuhr fort:
»Anders gesagt, ist die Unité in ihrer jetzigen Form nützlicher als der Zoll, der Grenzen überwacht, die es nicht mehr gibt? Möglicherweise gibt es gar keine rein staatlichen Angelegenheiten mehr, Berthet, und das, was man als ›Tiefen Staat‹ bezeichnet, nimmt das zur Kenntnis und handelt entsprechend. Da spielt es dann auch keine Rolle mehr, ob eine multinationale Uranfabrik öffentlich oder privat ist. Wenn das multinationale Unternehmen seine Interessen bedroht sieht oder die Rohstoffe knapp werden, zögert man inzwischen nicht mehr, einen Krieg vom Zaun zu brechen. Das ist zwar im Grunde nichts Neues, aber mit dem Zweiten Irakkrieg ist es ganz offenkundig geworden. Jeder auch nur halbwegs informierte Bürger hatte schnell kapiert, worum es da eigentlich ging, nämlich um die Sicherung der Ölvorkommen, um sonst gar nichts. Von wegen ›Verteidigung der Demokratie‹, verarschen kann ich mich auch alleine! Das möchten die Neuen immer gerne ins Protokoll schreiben. Ich, das dürften Sie inzwischen verstanden haben, Berthet, bin eher auf der Seite der Alten. Ein Alter, der so seine Zweifel hat … Außerdem werde ich auch langsam alt. Ich merke natürlich, dass sich die Unité verändert, ob ich will oder nicht. Ich verschließe nur die Augen davor.«
Dann deutete Losey mit einer merkwürdigen Handbewegung auf einen Punkt irgendwo über seinem Kopf, als wollte er auf höhere Sphären verweisen, oberhalb des Glasdaches der Brasserie. Diese Geste wirkte wie ein Eingeständnis seiner Hilflosigkeit, als würde er damit einräumen, dass ihm all das im Grunde über den Kopf wuchs.
Dann seufzte er auf und schien sich wieder zu fangen.
Nichtsdestotrotz fiel Berthet mit einem Mal auf, dass Losey mit seiner Korpulenz, seinem ziegelroten Teint, seinen glasigen Augen und seinem perfekt sitzenden Maßanzug tatsächlich inzwischen ein alter Mann war in einer Welt, die er zu beherrschen geglaubt hatte und die er nicht mehr verstand, ein alter Mann, der fast ein wenig verloren wirkte. Dabei hatte Losey Berthet seit einer halben Ewigkeit, ohne mit der Wimper zu zucken, damit beauftragt, die furchtbarsten Dinge zu tun, und dabei wirklich nie den Eindruck gemacht, von irgendwelchen Skrupeln geplagt zu werden.
Losey schenkte Berthet und sich Riesling nach. Er trank ein paar Schlucke und fand endlich wieder zu seinem gewohnten Gesichtsausdruck und seinem üblichen Ton zurück. Der kurze Moment der Schwäche war vorüber. Nun verkündete er, und dieses Mal schwang in seiner Stimme fast ein gewisser Stolz mit:
»Ich bin auf der Seite der Alten. Wir müssen bei der Geldbeschaffung kreativer sein, das stimmt, aber dabei dürfen wir nicht vergessen, wofür es die Unité gibt. Was ihr eigentlicher Auftrag ist.«
Dann redete Losey über die Alten, die die Unité zu Beginn der Fünften Republik gegründet hatten, als Berthet noch ein Kind war und in seinem Schülerkittel die Pierre-Larousse-Grundschule in der Rue d’Alésia besuchte. Losey liebte es, Berthet regelmäßig daran zu erinnern, dass er alles über ihn wusste, wirklich alles, inklusive seiner schlechten Aufsatznote in der vierten Klasse. Das Thema: Herbstanfang.
Einige Agenten, Berthet war einer von ihnen, hatten sich als Pioniere in kreativer Eigenfinanzierung versucht. Darauf spielte Losey wohl an, weniger auf den Raub in Vésinet. So hatte Berthet 1987 in einem kleinen Badeort an der Côte d’Albâtre ein Casino überfallen, um für seinen Auftrag, die Destabilisierung eines Präsidentschaftskandidaten, finanziell besser gerüstet zu sein. Berthet fand die ihm zur Verfügung stehenden Mittel zu knapp bemessen. Mit dem Geld hätte er noch nicht mal einen Couthon oder eine Desmoulins anheuern können.
Also nahm er Kontakt zu ein paar Ganoven in Le Havre auf. Er hatte sich einen ziemlich schlauen Plan ausgedacht, alles ausgekundschaftet, wie sich das gehörte, aber diese Kriminellen aus Le Havre waren echte Idioten. Es gab Tote.
Berthet sieht die Szene wieder vor sich. Sie hatten ungefähr dreihunderttausend Francs an Bargeld eingesackt. Das Casino war eher klein, aber gut besucht. Es war irgendwann zwischen Weihnachten und Silvester. Alles lief wie am Schnürchen. Vor dem Eingang wartete ein gestohlener R25 auf sie. Aber als sie dann mit prall gefüllten Tüten zum Ausgang gehen wollten, musste einer dieser Möchtegerngangster unbedingt noch mit seiner MAT49 angeben. Vielleicht war der Idiot ja frustriert, dass er eine Waffe dabeihatte und sie nicht benutzen konnte. Er feuerte also über den Köpfen der kreidebleichen Spieler eine Salve ab, um ihnen zu zeigen, mit wem sie es zu tun hatten. Die MAT49 ist eine legendäre Waffe, aber der Umgang mit diesem Maschinengewehr erfordert militärisch geschulte Präzision, wenn man nicht einfach nur wild drauflosballern will.
Die Salve des ungeschickten Kerls aus Le Havre kostete einen Croupier und zwei Spieler das Leben, die rund um den Roulettetisch saßen.
Genauer gesagt, einen Spieler und eine Spielerin. Sie war Berthet gleich ins Auge gefallen. Die schöne Blondine mit den blauen Augen war ohne Begleitung da. Sie war sehr distinguiert, um die vierzig und trug einen gewissen Hochmut zur Schau. Er konnte nicht anders und hatte sie während des Überfalls eingehend durch die Schlitze seiner Sturmhaube gemustert.
Berthet, der ewige Romantiker mit einem Hang zur Sentimentalität, vertiefte sich für einen kurzen Moment in die Vorstellung, mit ihr in einer dieser typischen Fachwerkvillen an der Küste zu leben, wie es sie oberhalb von Saint-Valeryen-Caux gab und die sich durch eine ebenso überladene wie charmante Architektur auszeichneten. Berthet würde stundenlang aufs Meer schauen und dabei diese Frau streicheln. An Regentagen würden sie oft miteinander schlafen, vor allem an Regentagen. Der gläserne Erker des Wohnzimmers würde dem Grau in Grau und der spritzenden Gischt draußen vor dem Fenster einen Rahmen geben, während sie beide lang anhaltende Orgasmen erlebten. Danach würde man wieder die nachmittägliche, atemlose Stille hören, nur unterbrochen von dem Prasseln des Regens auf das Glasdach des Erkers.
Berthet war und blieb ein verhinderter Chardonnien. All das hatte er sich ausgemalt, bevor die 9-mm-Kugeln das Gesicht der Blonden zerfetzten und sich auf dem grünen Tuch des Spieltisches Blutspritzer, Körperfetzen und Zähne verteilten, vor allem auf den Einsatzfeldern Rouge, Impair, Manque und den Zahlen Zwei und Vier.