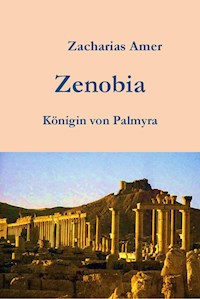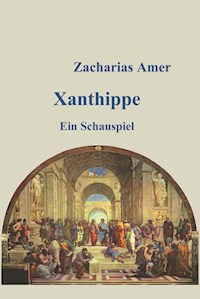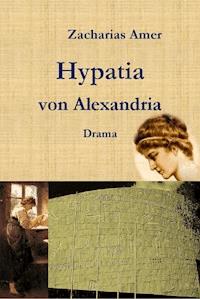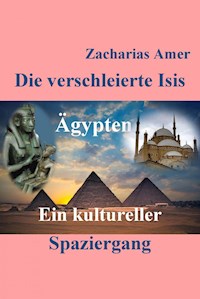
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der kulturelle Spaziergang ist keine Kulturgeschichte Ägyptens. Die Gegenwartsbezüge sind stets präsent und auf die kommt es letztendlich an. In der langen, ereignisreichen ägyptischen Geschichte spielte die Religion eine dominante Rolle. Sie war und ist das Fundament, auf dem alles entstand, florierte und verwelkte. Ägypten ist und bleibt im Würgegriff der Religion. Wer seine Kulturgeschichte verstehen will, kommt also nicht umhin, sich mit der Religion auseinanderzusetzen. Das Land ist mit den drei monotheistischen Religionen eng verflochten. Die bedeutenden biblischen und koranischen Geschichten nehmen direkten Bezug auf Ägypten oder spielen dort. Obwohl solche, von Menschenhand erschaffene Geschichten konstruierte Gebilde sind, ohne jedwede historische Substanz, prägen sie nach wie vor das Leben der Menschen und verhindern ihre freie Entwicklung. Daher müssen die "heiligen" Geschichten zuerst entheiligt werden. Der Islam hat keine Aufklärungsphase erlebt, dabei hätte er sie nötiger denn je. Er erhebt einen universellen Anspruch und wehrt sich vehement gegen eine Trennung von Staat und Religion. Wie ließe sich im Lichte dessen das Versagen des politischen Systems in den letzten 60 Jahren erklären? Es schaffte den Nährboden für den religiösen Fundamentalismus, der in Ägypten entstand und dort noch floriert. Welche schäbige Rolle spielte der Westen in dieser Tragödie? Warum musste der arabische Frühling scheitern? Der kulturelle Spaziergang kann solche Fragen nicht beantworten, aber er kann helfen, Hintergründe und Zusammenhänge besser zu verstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zacharias Amer
Die verschleierte Isis
Ägypten
Ein kultureller Spaziergang
2014
Impressum
Texte: © Zacharias Amer. Berlin, 2014
Umschlag: © Zacharias Amer
Verlag:
nhalt
Vorwort 2
1. „Dieser unermesslichen große Dinge Ägyptens“
Rainer Maria Rilke 8
2. Gräber, Tempel, Kolosse 29
3. Hatschepsut (1473-1458 v. Chr.) 45
4. Als die Arbeiter streikten 64
5. Humor - Die Kuh im Schwalbennest 72
6. Die Klagen des Ipuwer I 79
7. Die Frau im Alten Ägypten und heute 117
8. Die Klagen des Ipuwer II 137
9. Joseph in Ägypten 172
10. Aswan 186
11. Abu Simbel 207
12. An Deck 231
13. Altägyptische Literatur 244
14. Ein Dorf-Besuch 275
15 Kairo284
16. Arabische Eroberung 303
17. Vom Volkscharakter und anderen Katastrophen 325
18. Alexandria 335
Anhang 344
Vorwort
Das uralte Volk der Ägypter schuf einst die älteste Hochkultur der Welt und war jahrhundertelang die dominierende Macht der alten Welt: kulturell, politisch und militärisch. Gegenwärtig dümpelt das Volk vor sich hin und zeigt sich unfähig, die eigenen Probleme zu lösen. Gewiss schützt eine glorreiche Vergangenheit nicht vor einer schäbigen Gegenwart. Griechenland und Ägypten dürften als Paradebeispiele dafür gelten, mit dem kleinen Unterschied, dass Griechenland immerhin eine Demokratie ist, wo die geplagten Bürger die Chance haben, eine korrupte Regierung zum Teufel zu jagen, auch wenn der Wechsel selten etwas Positives bewirkt; denn da löst eine raffgierige Clique von Politikern die andere ab. Bis 2011 hat Ägypten klugerweise aus einer mit Lethargie gepaarten Selbsterkenntnis heraus einen solchen Versuch gar nicht erst unternommen, und so kannte man in Ägypten das Wort ‚Demokratie‘ nur vom Hörensagen. Bedingt durch ein politisches System, das die Menschen knebelt und durch eine Religion, die sie dafür gefügig macht, herrschte im Land eine bleierne Schwere, die wie ein immerwährender Alptraum wirkte. Dann geschah doch das Unvorstellbare, die Menschen haben es endlich geschafft, ihren alten, senilen Despoten hinwegzufegen. Bis zum Schluss klammerte er sich an die Macht, die er so gern an seinen Sprössling weitervererben wollte, als ob er das Land von seiner Oma geerbt hätte, als wäre es sein Privateigentum, über das er frei verfügen dürfte, und ließ seine Schergen auf die Demonstranten schießen. Sie töteten dabei hunderte und verletzten tausende andere. Erst als die Demonstranten ihm die Schuhe entgegenstreckten und ihre höchste Verachtung damit ausdrückten, dämmerte es bei ihm, dass seine Zeit um war. 30 Jahre lang herrschte er mit eiserner Hand und wurde von der sogenannten Freien Welt dafür belobigt, obwohl das Land ein Polizeistaat war, mit einem Heer von Schnüfflern, Geheimdienstlern, Schlägertypen und Folterknechten übersät, die jeden Unliebsamen verfolgten, einlochten oder zu Tode folterten. Wem sein Leben lieb war, hielt die Schnauze, heuchelte oder spielte den braven, treuen Bürger. Der Personenkult war ebenso ekelerregend wie die Rolle der Massenmedien, die keine Ehre zu haben schienen. Ja-Sager Parlamentarier sahen ihre Hauptaufgabe darin, in die Hände zu klatschen, lauthals zu rufen und einen Bluthund hochleben zu lassen. Wirtschaft der Günstlinge, deren Hauptarchitekten die Söhne des Herrschers waren, florierte. Sie scheffelten die Millionen und die Milliarden, ließen andere für sich arbeiten wie Zuhälter ihre Dirnen. Die Staatskasse sahen sie als ihre Privatschatulle an. Es gab Mafiosi-Strukturen, bei denen Schutzgelder kassiert wurden. So hinterließ der Tyrann ein Land am Rande des Ruins. Während die einen in Saus und Braus lebten, siechte das Land vor sich hin. Nur der Glaube verlieh den Menschen die Kraft, dieses trostlose Leben zu ertragen. Vielleicht war es die Verzweiflung, die den Mut von Al-Tahrir-Platz gebar. Millionen standen mit dem Rücken zur Wand, hatten nichts zu verlieren als ihr armseliges Leben und fragten sich: ist es nicht einerlei, auf welche Art man krepiert?
So war der 11. Februar 2011 einer der wenigen glücklichen Tage, die Ägypten je erlebt hat. Die Revolution begann zwar am 25. Januar 2011, aber schon lange davor gärte es im Land, die Ereignisse in Tunis waren der Funke, der das Fass zum Explodieren brachte.
Die Menschen dachten, nun wird alles besser und sehnten „die blühenden Landschaften“ herbei, doch bald folgte die Ernüchterung. Die jungen Revolutionäre, die wagemutig ihr Leben riskierten, sahen zu, wie andere die Früchte ihrer Arbeit ernten. Die gutorganisierten Muslimbrüder gewannen die Wahlen und, wie einst die Nazis, dachten sie daran, die Demokratie, die sie an die Macht hievte, gleich abzuschaffen. Sie hatte ja ihr Soll erfüllt und kann zu Grabe getragen werden. So waren sie bestrebt, ihre Macht zu zementieren, die Schaltstellen im Staat mit ihren Anhängern zu besetzen und sie schafften es sogar, in einer Nacht und Nebel-Aktion, eine islamische Verfassung zu verabschieden. Mit dem Mut der Verzweiflung gingen am 30. Juni 2013 wieder Millionen auf die Straße und das Militär, nicht zuletzt aus Eigennutz, sah seine Chance gekommen, um mit dem Spuk aufzuräumen und zwar gründlich: hunderte wurden getötet, tausende verhaftet und die ganze Führungsriege der Muslimbrüder samt dem Staatspräsidenten landete im Gefängnis. Die Muslim-brüder wurden als eine Terrororganisation erklärt.
Nachdem die Muslimbrüder mit ihrem Präsidenten Mursi ein Jahr lang herumgepfuscht hatten, kamen die Militärs und setzten den Pfusch fort. Erstaunlich, wie schnell die neuen Machthaber das fortführten, was man überwunden zu haben glaubte: in den Gefängnissen folterten Polizisten weiter wie eh und je, Massenmedien wurde ein Maulkorb verpasst, jede Kritik wurde im Keim erstickt, jede freie Stimme mundtot gemacht. Der Polizeistaat Mubaraks kehrte mit Pauken und Trompeten zurück.
Für die Militärs scheint Demokratie genauso pervers wie für die religiösen Fanatiker. So unterschiedlich beide Lager auch sein mögen, beide funktionieren nach dem Befehls-Gehorsam-Prinzip. Religiöse Fanatiker verpassen ihren Anhängern als erstes eine Gehirnwäsche: wer glaubt, braucht keinen Verstand zu haben, scheint ihre Devise zu sein, und bei den Generälen ist das Kadavergehorsam ohnehin das erste, was man einem Rekruten beibringt, das Denken wird ihm schnell ausgetrieben, der Wille gebrochen. Wer von beiden regiert, kann auf das ganze Land nur das anwenden, was er ja gelernt hat, so sorgt er schnell für die angestrebte Grabesruhe. Das Volk hat also die Wahl zwischen Pest und Cholera.
Weder die Revolution von Februar 2011, noch das, was die Militärs zu einer Revolution hochstilisiert hatten (am 30. Juni 2013 gingen angeblich 30 Millionen Menschen auf die Straße, um die Absetzung des „islamistischen“ Präsidenten Mursi zu fordern, das Militär nahm das Angebot dankend an, verhaftete, im Namen des Volkes, den Präsidenten und löste das Parlament auf…) können als Revolution bezeichnet werden; denn von „radikalen Veränderungen der bestehenden politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse“ kann keine Rede sein. Zwar wurde das herrschende Regime beseitigt (zuerst Mubarak, dann Mursi), dies führte aber keineswegs zu tiefgreifenden Veränderungen im System. Der Neuanfang misslang, die Machtstrukturen blieben unverändert.
Seit der „echten“ Revolution von 1952, durch die die britische Besatzung beendet wurde, wird Ägypten von Militärs regiert. Alle Präsidenten waren Armeeangehörige, kein Zivilist war dabei, vom einjährigen Intermezzo mit Mursi mal abgesehen. Schritt für Schritt baute die Armee ihre Machtstellung aus, sie schuf eigene Wirtschaftsbetriebe und entwickelte sich zu einem tüchtigen „Geschäftsmann“, der Narrenfreiheit genoss, niemandem Rechenschaft schuldig war und der von niemandem kontrolliert werden durfte. Der Staatspräsident, der aus ihren Reihen kam, gewährte der Armee freie Hand und bekam als Gegenleistung die Zusicherung, dass er nicht weggeputscht wird und dass die eigentliche Aufgabe der Streitkräfte darin besteht, ihm seinen Thron zu sichern. An diesen antidemokratischen Strukturen konnten die zwei angeblichen Revolutionen (vom 2011 und 2013) nichts ändern. Die Armee zeichnet nach wie vor den Weg auf und gibt die Richtung vor. Wer Demokratie spielen möchte, hat ihre Spielregeln zu akzeptieren und die sind ganz eindeutig: ihre Sonderstellung, die sogar in der Verfassung verankert ist, darf nicht angetastet werden. Kommt ein Zivilist an die Macht, dann muss er mitspielen, um die Armee einen großen Bogen machen, sie gewähren, ihre Geschäfte machen lassen, käme er auf die Idee, an diesen tiefverankerten Strukturen etwas zu ändern, muss er eben abgesetzt werden. Das gleiche gilt auch für das Parlament. Das ist Demokratie auf ägyptisch.
Die Momente, in denen das Volk seine Macht spürte, waren allzu kurz. Ja, es war nur eine Schwalbe, die geschwind das Land überflog, daraus wurde kein Frühling. Sie ließ das Land zerrütteter denn je.
Was ist das für ein Land, in dem die Verhältnisse so beschaffen sind, in dem jede keimende Hoffnung auf ein menschenwürdiges Leben, auf soziale Gerechtigkeit so rasch verfliegen? Man fragt sich, warum der ehrenhafte Versuch, demokratische Strukturen einzuführen, so miserabel scheiterte. Liegt es an dem religiösen Menschenbild, das keine freien Individuen kennt, sondern nur eine Masse, die zu gehorchen hat, einerlei, was mit ihr geschieht? Ist Politik nur ein Spiegelbild der Religion? Zweifelsohne wirkt die Religion identitäts- und sinnstiftend, aber sie macht die Menschen auch lethargisch, schicksalsgläubig, gar hörig und sie hemmt ihre freie Entwicklung.
Ist diese Gesellschaft resistent gegen Veränderungen? Wie kann ein Land, in dem Millionen von der Hand in den Mund leben, dessen Städte aus allen Nähten platzen und dessen ländliche Gebiete unterentwickelt sind, dessen Bildungssystem genauso marode ist wie die gesamte Infrastruktur, das keine soziale Versorgung kennt, kein richtiges Gesundheitssystem besitzt..., wie kann ein derart beschaffener Staat sich frei entwickeln, Korruption und Vetternwirtschaft ernsthaft bekämpfen, wenn es immer wieder von den Uniformierten geknebelt und von Hohlphrasendreschern regiert wird? Ist nicht ein Scheitern bei alldem folgerichtig?
Kann ein unbefangener Blick, der über die Jahrhunderte gar Jahrtausende schweift, Antworten auf dringende Fragen liefern? Wohl kaum, aber er kann vielleicht helfen, diese ewigen Fehlschläge begreiflich zu machen.
Die ägyptische Geschichte kennt sehr viele Höhen- und Tiefpunkte. Ein Faktor blieb dabei über die Jahrtausende fast unverändert und prägte nachhaltig die Volksseele, nämlich die tiefsitzende Religiosität, bei der das Leben eine beiläufige, eine rudimentäre Rolle zu spielen scheint. Tyrannen hatten immer ein leichtes Spiel gehabt, das Volk entwickelte unterdessen seine eigene Lebens-strategie, es tröstete sich auf das Jenseits und perfektionierte die Duldsamkeit.
Das Werk provoziert bewusst und nimmt vieles, was für heilig gehalten wird, auf die Schippe mit dem Ziel, den Fanatismus ins Lächerliche zu ziehen. Denn erst wenn der Umgang mit der Religion sich entkrampft, wenn auch über das „Heilige“ gelacht wird, besteht Hoffnung, den Fanatismus zu besiegen und sich von seinem Würgegriff zu befreien. So versteht sich der kulturelle Spaziergang letztendlich als ein Plädoyer für Toleranz.
1.„Dieser unermesslichen große Dinge Ägyptens“... Rainer Maria Rilke
„Was war das für ein Moment der Windstille in der großen Ägyptischen Zeit? Welcher Gott hielt den Atem an, damit diese Menschen um den vierten Amenophis so zu sich kommen? Wo, plötzlich, stammen sie her? Und wie schloß sich wieder, gleich hinter ihnen, die Zeit, die einem „seienden“ Raum gegeben, - es „ausgespart“ hatte?!“[1]
Doch nicht nur die Zeit des IV. Amenophis (Echnaton) hat es Rilke so angetan, sondern die ganze Zeitspanne, in der diese einzigartige Kultur entstand, aber auch die Landschaft, die Menschen... Die Ägyptenreise, die Rilke vom 10. Januar bis zum 25. März 1911 unternahm, hat sein Schaffen nachhaltig beeinflusst, obwohl die Reise keineswegs glücklich verlief. Drei Wochen lang lag Rilke krank im Hotel-Sanatorium Al-Hayat in Helwan am Stadtrand von Kairo. Das hat seine Erlebnisse trotzdem nicht getrübt; denn er hat anscheinend in Ägypten das gefunden, wonach er sich gesehnt hat. Nachdem er Algier und Tunis besucht und die märchenhafte orientalische Welt kennengelernt hatte, fieberte er Ägypten entgegen: „…und hatte noch Wege und Wege, hatte Ägypten vor mir, den Nil, die unerhörtesten Menschendinge, die je erzeugt und erzwungen worden sind.“
Rilke hat die Bilder dieser einmaligen Landschaft verinnerlicht, in seinen großartigen Dichtungen verarbeitet und hat bis zum letzten Atemzug davon gezehrt. 1923, also 12 Jahre nach der Ägyptenreise, empfiehlt er einer Freundin: „Statt weiter und weiter zu reisen in unruhige und verstörte Länder, wärs nicht richtiger, langsam in einer eigenen »Dahabieh« (eine Nilbarke) den Nil entlang zu fahren?; das ist keine Reise mehr, das ist ein Leben, eine Verwandlung, ein Traum des Daseins... und eine wirkliche tiefe Besinnung.“[2] Denn „das Wunder der unberührbar überlieferten Landschaft, in der neben dem Stromgott und dem fortwährenden Anheben der Wüste ein Streifen dichtesten, drängendsten, entschlossensten Lebens verläuft, auf dem Menschen und Tiere und rasch heranwachsende Pflanzen sich in gleichsam ewige, starke Bedingungen teilen“[3] schwebte ihm stets vor Augen.
In der 2. Duineser Elegie taucht dieses Bild, das ihm die ägyptische Landschaft bot, wieder auf:
Fänden auch wir ein reines, verhaltenes,
schmales Menschliches,
einen unseren
Streifen Fruchtlands
zwischen Strom und Gestein.
Denn das eigene Herz
übersteigt uns
noch immer wie jene.[4]
Abb.1:Der schmale Streifen zwischen Strom und Gestein
In der 10. Elegie, „diese vielleicht großartigste Vision, die Rilke jemals gestaltet hat“[5], wird das Klageland beschrieben, das man mit Ägypten identifiziert hat, obwohl Rilke sich ausdrücklich dagegen gewehrt hat. „Die alte Kultur Ägyptens .. verfügte noch über die uns längst verlorenen ‚sichtbaren Äquivalente‘; das Leidland dagegen ist eine reine Sprachwelt, deren ‚Abstraktheit‘ durch beständige Allegorisierungen (z.B. „Tränenbäume und Felder blühender Wehmut“ V. 65) und durch die direkte Transformation in Sprachzeichen und Wörter unübersehbar signalisiert wird.“ [6]
Bei der Darstellung des Klagelandes werden die Klagen personifiziert, sie treten auf und jammern über sich selbst, über die Herrlichkeit vergangener Tage als sie ein mächtiges Geschlecht waren: „Wir waren, sagt sie, ein Großes Geschlecht, einmal, wir Klagen.“ Eine Klage führt einen Jungverstorbenen
...durch die weite Landschaft der Klagen
Zeigt ihm die Säulen der Tempel oder die Trümmer
jener Burgen, von wo Klage-Fürsten das Land
einstens weise beherrscht. [...]
Naht aber Nacht, so wandeln sie leiser, und bald
mondets empor, das über alles
Wachende Grab-Mal, Brüderlich jenem am Nil,
der erhabene Sphinx -: der verschwiegenen Kammer
Antlitz.
Und sie staunen dem krönlichen Haupt, das für immer, schweigend, der Menschen Gesicht
auf die Wange der Sterne gelegt.[7]
Weinend verabschiedet sich die Klage von dem Toten und einsam steigt er dahin, in die Berge des Ur-Leids, er geht allein fort, um seinen Tod zu vollenden.
Denn der Tod ist die Vollendung des Lebens. Das Totsein und das Lebendigsein, Diesseits und Jenseits gehören zusammen, sie ergänzen einander bzw. sind eins und dasselbe. „Das Totsein (nicht) als die Gegenform des Lebens, (sondern) als dessen Eigentlichkeit“,[8] diesen Gedanken hat Rilke in der altägyptischen Kultur wohl am meisten bewundert.
Die Menschen haben sich von jeher nie mit der Endgültigkeit des Todes abgefunden. Sie versuchten mit aller Gewalt seine Endgültigkeit aufzuheben: die alten Ägypter schufen ihr eigenes Jenseits und ließen die Toten am Leben teilhaben, so wie sie es heute noch tun. Ihr Jenseits war allerdings völlig anders geartet als das, was die späteren, monotheistischen, Religionen daraus machten. Es war nicht eine andere Welt, eine geläuterte, in der Schatten lebten, kein Gegenüber, sondern ihr Jenseits war identisch mit ihrem Erdendasein, sie verlängerten das Leben gewissermaßen über den Tod hinaus. Beide Welten waren somit kongruent. Die Alten Ägypter kannten keine Transzendenz. Alle Menschen, zu allen Zeiten schien die Frage, „wie entkommt man dem Tod“, brennend zu interessieren. So machte sich Gilgamesch auf den Weg, um der Unsterblichkeit teilhaftig zu werden; Pythagoras übernahm indisches Gedankengut und propagierte die Seelenwanderung; Sokrates sprach von der Unsterblichkeit der Seele und in der Mythologie wurde eine Klasse zwischen Menschen und Göttern installiert, in der die Auserwählten weiterlebten.
Doch die Beziehung, die die Ägypter zum Tod hegten, ist dabei eine ganz besondere. Sie haben den Tod eher gehasst, wollten ihn um jeden Preis besiegen, für null und nichtig erklären, ihn als Fortsetzung des Lebens ansehen. Sie erfanden die Mumifizierung, um für das körperliche Fortleben zu sorgen, das war die erste Voraussetzung für das wahre Leben nach dem Tod. In der Mumie steckte gewissermaßen das Leben, deswegen hatten manche Grabräuber vorsichtshalber die Mumien in Brand gesteckt, um nicht von denen verfolgt zu werden. Die Ägypter gingen noch ein Stück weiter und ließen den Toten zu einem Gott werden. Was früher nur dem Pharao vorbehalten war, wurde im Neuen Reich auf alle Menschen ausgedehnt. „Gott-Sein ist die Existenzform des Jenseits, die allen Menschen zuteilwird.“[9] Jeder Tote wurde zum Gott Osiris, zu einem toten und wieder auferstandenen Gott. Aus Liebe zum Leben haben die Ägypter den Tod gebändigt, ihm den Stachel genommen, er verlor seine Endgültigkeit, seine Bitterkeit und wurde zu einer Übergangsstufe degradiert. So ist „trotz der gewaltigen Grabmonumente …diese Kultur immer lebensbejahend gewesen, und sie hat gerade in ihren Grabbildern immer neu die Freude an den Schönheiten des Diesseits gestaltet.“[10]
Die Toten stehen auch nicht irgendwann auf, sondern sind vom ersten Tag ihres jenseitigen Lebens an quicklebendig. Ein Toter war nie richtig tot, er war so aktiv, dass er selten zur Ruhe kam[11]. Er konnte sogar Rache an Lebenden nehmen und ihnen das Leben schwermachen. Diese wandten sich an einen anderen Toten und baten um dessen Vermittlung, er möge so nett sein und diesen Bösewicht von seinen Rachegelüsten abhalten. „Tote erschienen als Gespenst und klagten über ihr verfallenes Grab, drehten einem den Kragen um, wenn er einen Stein von ihrem Grabbau losbrach; raubten den Säugling aus dem Arme der Mutter, würgten das Vieh oder aber verhalfen den Hinterbliebenen zu Segen und Gerechtigkeit, kurz, sie hatten überirdische Macht und waren darum ebenso gefürchtet wie verehrt.“[12] Tote erhielten von ihren Angehörigen Briefe, in denen sie alles zu lesen bekamen, was sich da oben (oder da unten) so abspielt, so blieb ein Toter immer auf dem Laufenden. Leben und Tod waren nicht voneinander zu trennen, sie waren dicht ineinander verwoben. So war es folgerichtig, dass die Toten tagtäglich die Sonnenstrahlen erblickten. Wenn die Sonne uns Lebende verlässt, macht sie sich auf den Weg und lässt die Toten an ihrem Glanz teilhaben. Die Seelen der Toten, ihre Bas, waren putzmunter und begleiteten die Sonne auf ihrer nächtlichen Fahrt. Die Bas, vogelförmig mit einem Menschenkopf, stiegen mit der Sonne in die Unterwelt und vereinigten sich mit den Körpern, die sie beim Tod verlassen mussten und erweckten sie so zum Leben. Im „Talfest“ trafen sich Lebende und Tote und feierten gemeinsam den Tod. Dieses „schöne Fest vom Wüstental“ fand jährlich statt.
Dieses Verschmelzen der beiden Aspekte des Daseins ist ein Ziel, dem die Duineser Elegien und die Sonette an Orpheus nacheifern. „Lebens- und Todesbejahung erweist sich als Eines in den „Elegien“, schreibt Rilke an seinen Übersetzer „Das eine zuzugeben ohne das andere, sei, so wird hier erfahren und gefeiert, eine schließlich alles Unendliche ausschließende Einschränkung. ...Wenn man den Fehler begeht, katholische Begriffe des Todes, des Jenseits und der Ewigkeit an die Elegien oder Sonette zu halten, so entfernt man sich völlig von ihrem Ausgang und bereitet sich ein immer gründlicheres Mißverstehen vor. Der „Engel“ der Elegien hat nichts mit dem Engel des christlichen Himmels zu tun (eher mit den Engelgestalten des Islam) ...“[13]
Auf das Christentum war Rilke ohnehin nicht gut zu sprechen. Was er in Cordoba sah, hatte auf ihn eine Schockwirkung gehabt, durchaus verständlich. Wer in Cordoba war und die herrliche Mesquite besucht hat, wird dieses Erlebnis stets in frischer Erinnerung bewahren. Die Eleganz und die erhabene Einfachheit der Säulen sind wahrlich beeindruckend. Gleichzeitig wird man sich über den hässlichen Schandfleck, Kathedrale genannt, mitten in der Moschee reichlich ärgern und sie zum Teufel wünschen. Doch sie bleibt als Mahnmal christlichen Hasses und Fanatismus. Diese Geschmacklosigkeit, ausgerechnet dort, wo die drei verfeindeten Religionen ein friedliches Leben nebeneinander geführt und eine imponierende Toleranz praktiziert hatten, ist eine Freveltat. Da hat sich die angebliche Religion der Liebe als schäbig und wurmig gezeigt. Auch Rilke konnte seinen Ärger nicht verbergen. Seine Aversion gegen alles Christliche schlug in Hass um: „Ich bin seit Cordoba von einer beinah rabiaten Antichristlichkeit, ich lese den Koran, er nimmt mir, stellenweise, eine Stimme an, in der ich so mit aller Kraft drinnen bin, wie der Wind in der Orgel [...] Mohammed war auf alle Fälle das Nächste; wie ein Fluß durch ein Urgebirg, bricht er sich durch zu dem einen Gott, mit dem sich so großartig reden läßt jeden Morgen, ohne das Telefon „Christus“, in das fortwährend hineingerufen wird: Hallo, wer dort? – und niemand antwortet.“[14]
Rilkes Abneigung gegen das Christentum hatte zwei Gründe: erstens die Mittlerrolle, die Christus darin spielt und die ablehnende Haltung des Christentums gegen die Sexualität, die Rilke als Herabwürdigung des Lebens sah. Gegen diese Prüderie, die das Christentum zweitausend Jahre lang gepredigt hat, hat Rilke in seinen Briefen sowie in dem „Brief des Jungen Arbeiters“ von 1922 heftig polemisiert: “Die Christlichkeit (hat)... behauptet, dort in Christus zu wohnen, obwohl doch in ihm kein Raum war, nicht einmal für seine Mutter, und nicht für Maria Magdalena, wie in jedem Weisenden, der eine Gebärde ist und kein Aufenthalt. [ ... ] Sie haben aus dem Christlichen ein métier gemacht, eine bürgerliche Beschäftigung, sur place, einen abwechselnd abgelassenen und wieder gefüllten Teich. [ ...] Diese zunehmende Ausbeutung des Lebens, ist sie nicht eine Folge, der durch die Jahrhunderte fortgesetzten Entwertung des Hiesigen? Welcher Wahnsinn, uns nach einem Jenseits abzulenken, wo wir hier von Aufgaben und Erwartungen und Zukünften umstellt sind. Welcher Betrug, Bilder hiesigen Entzückens zu entwenden, um sie hinter unserm Rücken an den Himmel zu verkaufen!“[15]
Rilke übersah dabei, dass die Prüderie im Islam nicht minder präsent und genauso weitverbreitet ist wie im Christentum, auch wenn der Islam eine positivere Einstellung zum Sinnlichen hat. Noch vor einigen Jahren diskutierten Religionsgelehrte in Ägypten darüber, ob eine Frau sich vor ihrem Ehemann ausziehen darf. Schließlich geht es nicht um „Vergnügen“, sondern einzig und allein um Fortpflanzung und die lässt sich sicherlich „gesittet“ angezogen, oder halb angezogen, vollziehen, das ist doch zum Mäusemelken.
Die negative Rolle, die das Christentum gespielt hat, hat also dazu geführt, im Islam das Positive hervorzukehren. Der Islam sieht in Christus nur einen Propheten wie alle anderen auch, eine Vermittlerrolle zwischen Gott und den Menschen ist bei ihm nicht vorgesehen, und da der unerschaffene Gott weder Söhne noch Töchter hat, kann Jesus auch nicht sein Sohn gewesen sein.
Rilke sah Ägypten als „Gegenbild zur christlichen Kultur mit ihrer scharfen Dichotomisierung von Leben und Tod, Diesseits und Jenseits, da hier (in Ägypten) das Totenreich als unmittelbare Fortsetzung des irdischen Lebens mit all seinen Bräuchen und Gepflogenheiten gedacht wurde. Vor diesem Hintergrund wäre Rilkes Deutung des ägyptischen Totenkultes zu verstehen.“[16] Kerngedanke dieses Kultes ist die Einheit zwischen Leben und Tod und dieser Gedanke wird in Rilkes reifen Meisterwerken „Die Duineser Elegien“ und „Die Sonette an Orpheus“ thematisiert. Die Duineser Elegien, Rilkes gewaltiger Klagegesang über die Verlassenheit des Menschen, seine Welteinsamkeit, liefern eine Deutung des Daseins jenseits aller „überlieferten religiösen Systeme“[17]. Der am Dasein leidende Mensch erscheint hier wie ein Rufer in der Wüste, keiner hört ihn, kein Gott weit und breit. Sogar vom Engel, einem Wesen jenseits der irdischen Sphäre, ein „Statthalter des unzugänglich gewordenen Gottes“[18] ist keine Hilfe zu erwarten. Diese „Heimatlosigkeit des Daseins“[19] ruft nach einem „poetischen Gegenentwurf“ des Daseins und der kann, nach Rilkes Konzeption, nur im „Welt-Innenraum“ verwirklicht werden. „Der Mensch der Elegien ist hauslos, eine ungewisse und halbgare Existenz ohne objektiv bestimmbaren metaphysischen Ort: Jedes der zehn großen Gedichte ist ein Versuch, sich zu orientieren.“[20]
Die Elegien zählen in der Tat viele Formen des Daseins auf und stellen sie als uneigentlich dar. Diese Formen spiegeln die Flüchtigkeit des Menschen wider. Auch bei den Formen, bei denen der Mensch als eigentlich erscheint wie beim Sterbenden, beim Liebenden, beim Helden oder beim Kinde sind vorübergehend. So eilen (in der 6. Elegie) die Helden und die früh hinüberbestimmten (die früh verstorbenen) in den Tod, „sie stürzen dahin wie das Rossegespann in Karnak“, sie eilen ihrem Lächeln voran, das kaum Zeit findet, sich zu entfalten. Im Kind hingegen sieht Rilke die beiden Aspekte des Daseins, Leben und Tod vereint, denn Tod wohnt im Kind inne, aber es weiß nichts davon. Dieses Gefühl den Tod „sanft zu enthalten und nicht böse zu sein“ nennt Rilke am Ende der 4. Elegie unbeschreiblich.
Nur Bauten der Vergangenheit, so wie die ägyptischen Säulen, Pylone, der Sphinx... sind in der Lage dem Schicksal zu trotzen. Stolz verkündet der Dichter:
..... Dies stand einmal unter
Menschen,
mitten im Schicksal stands, im vernichtenden, mitten
im Nichtwissen-Wohin stand es, wie seiend, und bog
Sterne zu sich aus gesicherten Himmeln. Engel,
dir noch zeig ich es, da! in deinem Anschaun
steh es gerettet zuletzt, nun endlich aufrecht.
Säulen, Pylone, der Sphinx, das strebende Stemmen,
grau aus vergehender Stadt oder aus fremder, des Doms.
War es nicht Wunder? O staune, Engel, denn wir sinds,
wir, O du Großer, erzähls, daß wir solches vermochten,
mein Atem reicht für die Rühmung nicht aus. (7. Elegie)
Diese mächtigen Bauten sind fähig, sich das Schicksal gefügig zu machen.
Auch in der Sonette an Orpheus sieht Rilke „...oft sehr weit Herstammendes geformt, Wesentliches aus dem ägyptischen Erlebnis...“[21]
O die eherne Glocke, die ihre Keule
täglich wider den stumpfen Alltag hebt.
Oder die eine, in Karnak, die Säule, die Säule,
die fast ewige Tempel überlebt.[22]
Abb.2Rilkes Säule. Die Säule des Taharka (692-664).Trotz alldem scheiterten die Ägypter in ihrem Versuch, den Tod zu überwinden. Die Gräber sind verfallen, die Mumien verwelkt, „Könige aufgedeckt, verfault und verwürmt.“[23] Die Diskrepanz zwischen Leben und Tod, Diesseits und Jenseits kann nur noch in Orpheus, im Künstler, aufgehoben werden.[24]
Wenn aber Orpheus singt:
Geht ihr zu Bette, so laßt auf dem Tische
Brot nicht und Milch nicht; die Toten ziehts (Erster Teil, VI).
dann glaubt man beinah einen alten Ägypter zu hören.
Ägyptische Landschaft spielte bereits in Rilkes einzigem Roman „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“ eine Rolle. In der Thebais, in dem Gebiet um das Tal der Könige, in der Wüstenklarheit, sah Malte den einzigen Ort, der würdig wäre, Beethovens Musik aufzunehmen und an das All zurückzugeben, weil es der „einzige Platz (ist), wo auf der Erde ungestört noch Kosmos waltet“.[25]
Schon vor Beginn der Reise nach Ägypten war Rilke auf das Land seelisch vorbereitet. Er besuchte häufig den Louvre, der über eine beachtliche ägyptische Abteilung verfügt, und er kam mehrfach an dem Obelisken auf dem Place de le Concorde vorbei, der in Paris, genau wie Malte, ein trauriges Dasein führt und stets an seinen Zwillingsbruder in Luxor denken muss, während er die Blechlawinen um sich sausen hört, „um dessen Granit herum immer ein wenig blonder alter Wärme flimmert und in dessen Hieroglyphenhöhlungen: in der immer wieder vorkommenden Eule, altägyptisches Schattenblau sich hält, eingetrocknet wie in Farbenmuscheln“[26]. 1905 lernte er viele ägyptische Kunstwerke bei Rodin kennen, der in Meudon sogar ganze Vitrinen mit ägyptischen Skulpturen hate und in seinem Testament bekannt hat: „mehr als alles zieht mich das Ägyptische an. Es ist rein. Geistige Eleganz schlingt sich um alle seine Werke.“[27] Als 1907 Rilkes Frau, die Bildhauerin und Rodin-Schülerin Clara Westhoff nach Ägypten fuhr, nahm Rilke daran lebhaften Anteil. Er legte ihr ans Herz, ihre Eindrücke schriftlich festzuhalten, weil er auch die Absicht hege, ins Land zu reisen und mit ihr gemeinsam ein Buch über Ägypten herauszugeben. Und als sie zurückkam, schrieb Rilke: „Sie hat ungeheuer viel innerlich Erworbenes mitgebracht und vieles, was auch für mich von äußerster Gültigkeit ist: zunächst auch dies: eine immense Bestätigung Rodin's und seiner Kunst durch jene gewaltigen dauernden Dinge.! Nun erzählt sie mir viel und ich schreibe vieles auf und lerne Wichtiges kennen.!“[28] Rilke hatte auch konkrete Pläne, ein Buch über altägyptische Plastik zu schreiben, denn er sah in der ägyptischen Plastik nicht nur die Rodin’sche Theorie bestätigt, sondern jenen Plastiken gebührt sogar das Erstgeburtsrecht: „in Rilkes dichterischen Transponierungen altägyptischer Rundplastik wird seine fundamentale Auseinandersetzung mit der Kunst Auguste Rodins nicht nur poetisch weiter-, sondern zugleich an deren Ursprung zurückgeführt.“[29] Die ägyptischen Skulpturen, insbesondere jene der Amarna-Zeit ließen seine reghafte Fantasie in die Ferne schweifen, zu einer geheimnisvollen Welt, die keine Geheimnisse kennt: “Das, was da so schön von der Pflanzenwelt gezeigt wird, wie sie kein Geheimnis macht aus ihrem Geheimnis, wissend gleichsam, daß es anders nicht als in Sicherheit sein könne: das ist, denk Dir, genau das, was ich in Ägypten vor den Skulpturen empfand, seither immer vor aegyptischen Dingen empfinde: dieses Bloßgelegtsein des Geheimnisses, das so durch und durch, so an jeder Stelle geheim ist, daß man es nicht zu verstecken braucht. Und vielleicht ist alles Phallische (wie vor-dachte ichs im Tempel von Karnak, denken konnt ichs noch nicht) nur eine Auslegung des menschlich heimlich-Geheimen im Sinne des offen-Geheimen in der Natur. Ich kann das ägyptische Gott-Lächeln gar nicht erinnern, ohne daß mir das Wort „Blütenstaub“ einfällt....“[30] Und über das ägyptische Museum in Kairo, das mit Skulpturen überladen ist: „dieses Museum ist doch so eigentlich erst die Einweihung in Skulptur, es ist unerhört; was sich unter diesen unbeschreiblich entlegenen Dynastien ausgeformt hat und wie alles sich in der Form selig fühlt und für immer erkannt und unendlich belohnt.“[31] An einem anderen Tag schreibt er: „Ich war innerlich genau so vorbereitet auf diese inkommensurablen Dinge, wie ichs immer zu sagen versuchte vorher und zu beweisen -, ich habe ein Einsehen für sie, das rein und klingend ist und voller Kontur, und meine Aufmerksamkeit wächst ihnen gegenüber ins Große, wird Raum, in den sich jedes einzelne mitten hineinstellt und ist, ist, ist.“[32]
Rilkes Anteilnahme an den Erlebnissen seiner Frau war nicht bloß eine vorübergehende. Während Clara in Ägypten weilte, besorgte sich Rilke Richard Andrees Handatlas und vertiefte sich in den Fluss, der sich so herrlich und fast unnatürlich durch die Landschaft durchschlängelt. Über den Nil schrieb er: „Zum ersten Mal fühle ich einen Fluß so, so wesenhaft, so bis an den Rand der Personifikation heran wirklich, so als ob er ein Schicksal hätte, eine dunkle Geburt und einen großen, ausgebreiteten Tod, und zwischen beiden ein Leben, ein langes, ungeheueres, fürstliches Leben, das allen, die in seiner Nähe waren, zu tun gab, jahrtausendelang; so groß war es, so anspruchsvoll, so wenig zu bewältigen. (Wie war die Wolga dagegen unpersönlich, wie war sie nur ein immenser Weg durch jenes andere erhabene Land, dessen Gott noch überall im Werden ist -.)“[33]
Nach der Reise legte sich Rilke eine ägyptische Handbibliothek zusammen, kontaktierte namhafte Ägyptologen der Zeit, beschäftigte sich mit altägyptischer Literatur und ließ sich von Ptahhotep (5. Dynastie, um 2350 v. Chr.) zu einem Gedicht inspirieren, er spielte mit dem Gedanken, eine zweite Reise zu unternehmen, gar an eine Ausgrabung mit dem Ägyptologen Georg Steindorff in Aniba nahe Abu-Simbel teilzunehmen, und „er plante einen Roman, dessen Stoff ihm auf seiner ägyptischen Reise entgegengekommen war, es sollte eine Geschichte aus der Glanzzeit des Pharaonenreiches werden; er sprach von Skizzen, Teilstücken, Brouillons größeren Umfangs.“[34]
Bei Rilke erleben wir einen völlig anderen Echnaton als den, den Thomas Mann in „Joseph und seine Brüder“ schildert. Bei Rilke spürt man die innere Anteilnahme, seine Ergriffenheit. Einer Freundin empfiehlt Rilke: „Meine Freundin, sehen Sie, in Berlin, den Kopf Amenophis des Vierten, im mittleren Lichthof des Ägyptischen Museums (von diesem König hätt ich Ihnen viel zu erzählen), fühlen Sie an diesem Gesicht, was es heißt, der unendlichen Welt gegenüber zu sein und in so beschränkter Fläche, durch die gesteigerte Ordnung einiger Züge, ein Gleichgewicht auszubilden zur ganzen Erscheinung. Könnte man sich nicht abkehren von einer Sternennacht, um in diesem Antlitz dasselbe Gesetz in Blüthe zu finden, dieselbe Größe, Tiefe, Unausdenk-barkeit? An solchen Dingen habe ich schauen gelernt und als sie später in Aegypten zahlreich vor mir standen, in ihrer eigensten Natur, da kam das Einsehn in sie in solchen Wellen über mich, daß ich fast eine ganze Nacht unter dem großen Sphinx lag, wie vor ihm ausgeworfen von allem meinen Leben..“[35]
Fasziniert hat ihn auch der Sonnengesang des Echnaton „Dieses Wunder des Amenophis-Kopfes - nach Lou Andreas-Salome ein Porträt von einem Rainer-Traum - versucht Rilke durch die Lektüre des Sonnengesanges dieses Königs zu erhellen bzw. in seinen geistigen Wurzeln zu erfassen, wobei nicht nur einige Motive und Metaphern dieses Sonnengesanges in den Duineser Elegien (Zehnte Elegie) wiederbegegnen, sondern zusammen mit Nanny-Wunderly-Volkart auch ein Buch über Sonnengesänge geplant war. .“[36] Rilke war sich auch dessen bewusst, dass der Sonnengesang des Echnaton weitreichende Folgen hatte. Er wanderte nicht nur wörtlich in die Bibel, sondern beeinflusste fast zweieinhalbtausend Jahre später den heiligen Franz von Assisi.
Neben dem Sonnengesang des Echnaton hat ein anderer Text der altägyptischen Literatur Rilkes Interesse geweckt: „Das Gespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele“. Die Geschichte des Lebensmüden, der den Tod als Befreiung aus dem Leben empfindet, stammt aus der ersten Zwischenzeit, ca. um 2100 v. Chr. In diesem Gedicht beschließt ein Lebensmüder, der Schlechtigkeit der Welt überdrüssig, seinem Leben ein Ende zu setzen und versucht seine Seele, sein BA, jener „… frei bewegliche seelische Teil des Menschen, das lebenspendende Prinzip“ zu überreden, ihm zu folgen. Dies sei unerlässlich; denn nur der BA allein garantiere ihm eine Fortsetzung des Lebens im Jenseits, auf den er nun seine ganze Hoffnung setzt. Sein BA aber „sucht den Menschen auf das Diesseits zurückzulenken, fordert zum ungetrübten Genuss des Lebens auf (wie später die Harfnerlieder) und droht sogar, sich vom Menschen zu trennen. […]Am Schluss ist der Ba versöhnt und bereit, im Diesseits wie im Jenseits beim Menschen zu bleiben und sein Schicksal mit ihm zu teilen. Wäre es anders, müsste die menschliche Person zerfallen. Im Totenbuch und in anderen Jenseitstexten wird betont, dass sich Ba und Körper immer wieder neu vereinigen müssen, damit ein Wiederaufleben der Verstorbenen möglich wird.“[37]
An seine Seele gewandt lamentierte der geplagte Mann, dessen Text von seiner Aktualität nichts eingebüßt hat:
Siehe, anrüchig ist mein Name durch dich,
mehr als der Gestank von Aasgeiern
an Sommertagen, wenn der Himmel glüht…
Zu wem soll ich heute sprechen?
Die Angehörigen sind schlecht, die Freunde von heute kann man
nicht lieben…
Habgierig sind die Herzen, ein jeder beraubt seinen Nächsten…
Die Milde ist zugrunde gegangen, Gewalttätigkeit ergreift Besitz von jedermann…
Man plündert. Jeder bestiehlt seinen Nächsten.
Zu wem soll ich heute sprechen?
Der Verbrecher ist ein Vertrauensmann,
Der Bruder, mit dem man lebte, ist zum Feind geworden…
Die Angehörigen sind böse,
man wendet sich zu Fremden, um Redlichkeit zu finden…
Die Herzen sind habgierig,
man kann sich auf keines Menschen Herz (mehr) verlassen…
Es gibt keine Gerechten,
die Welt bleibt denen überlassen, die Unrecht tun…
Ich bin mit Elend beladen,
weil mir ein Vertrauter fehlt.
Zu wem soll ich heute sprechen?
Das Übel, welches die Welt schlägt -
kein Ende hat es!
(dann erscheint ihm der Tod als die Erfüllung all seiner Wünsche):
Der Tod steht heute vor mir
wie das Genesen eines Kranken,
wie wenn man ins Freie tritt nach einem Leiden...
wie der Wunsch eines Menschen, sein Heim wiederzusehen,
nachdem er viele Jahre in Gefangenschaft verbrachte.
Wahrlich, wer dort ist, ist ein lebendiger Gott,
der die Sünde bestraft an dem, der sie tut.
Von diesem über viertausend Jahre alten Text, in dem das Ringen zwischen Leben und Tod thematisiert wird, war Rilke entzückt. Rilke wagte sogar mit seiner Deutung dem bekanntesten Ägyptologen seiner Zeit, Adolf Erman, zu widersprechen und fand Unterstützung bei anderen Ägyptologen. Enthusiastisch schreibt er darüber: „... Heute morgen verbrachte ich eine merkwürdige Stunde bei Baron Bissing, dem Aegyptologen, hatte die Freude zu sehen, daß meine intuitive Deutung eines altaegyptischen Gedichts unwillkürlich im Recht ist den bisherigen gelehrten Ausdeutungen gegenüber.“[38]
In seinem Gedicht „Tränen, Tränen, die aus mir brechen“ (Paris, 1913) thematisierte Rilke eines der meist dargestellten Szenen in der ägyptischen Religion „die Wägezeremonie“.
TRÄNEN, Tränen, die aus mir brechen.
Mein Tod, Mohr, Träger
meines Herzens, halte mich schräger,
daß sie abfließen. Ich will sprechen.
Schwarzer, riesiger Herzhalter.
Wenn ich auch spräche,
glaubst du denn, daß das Schweigen bräche?
Wiege mich, Alter. (Werke II, S. 71)
Abb.3Anubis, der Herzhalter bei der Wägezeremonie.Anubis wurde als Schakal dargestellt. Er war der Totenbalsamierer, der dem Toten das Herz aus der Brust entnahm. Er führte den Toten vor Osiris, dem Totenrichter, Gott der Unterwelt, und wog dessen Herz gegen die Feder der Ma’at, Göttin der Wahrheit. Der schreibkundige Gott Thot führte dabei das Protokoll.
In dem Requiem für eine Freundin, das Rilke zum ersten Todestag von Paula Modersohn-Becker 1908 schrieb, redet der Dichter in guter alter ägyptischer Manier mit der Toten. Er fragt sie, ob er (nach Ägypten) reisen soll, und ob sie von dort Wünsche hätte, die er für sie erfüllen kann:
Sag, soll ich reisen? Hast du irgendwo
ein Ding zurückgelassen, das sich quält
und das dir nachwill? Soll ich in ein Land,
das du nicht sahst, obwohl es dir verwandt
war wie die andre Hälfte deiner Sinne?
Ich will auf seinen Flüssen fahren, will
an Land gehn und nach alten Sitten fragen,
will mit den Frauen in den Türen sprechen
und zusehn, wenn sie ihre Kinder rufen.
Ich will mir merken, wie sie dort die Landschaft
umnehmen draußen bei der alten Arbeit
der Wiesen und der Felder; will begehren,
vor ihren König hingeführt zu sein,
und will die Priester durch Bestechung reizen,
daß sie mich legen vor das stärkste Standbild
und fortgehn und die Tempeltore schließen.
Dann geht der Dichter auf den Auferstehungsmythos des Gott Osiris:
Da
trugst du dich ab und grubst aus deines Herzens
nachtwarmem Erdreich die noch grünen Samen,
daraus dein Tod aufkeimen sollte: deiner,
dein eigner Tod zu deinem eignen Leben.
Und aßest sie, die Körner deines Todes
wie alle andern, aßest seine Körner,
und hattest Nachgeschmack in dir von Süße
die du nicht meintest...
Die Frühverstorbene fand nicht den für sie angemessenen Tod. Die Keime ihres Todes ist die bürgerliche Ehe, die sie einging, für einen wahren Künstler gleicht dies, nach Rilkes Ansicht, einem Todesurteil. „Die sogenannte Kornmumie des Osiris war ein mit Erde und Saat gefüllter Blumenkasten in Form des Gottesleibes; das Aufsprießen der Saat symbolisierte die Auferstehung... Rilke gewinnt daraus ein Bild für das Verfehlen des ‚eignen Todes‘: Die Malerin hat dessen Keimen und Reifen nicht geduldig abgewartet, sondern die Saatkörner ‚gegessen‘ und ist so einen ihr, der Künstlerin, fremden Tod gestorben.“[39]
Bei alldem verwundert es wenig, dass Rilke selber seine Reise nach Ägypten als „Wasserscheide seines Lebens“[40] sah. Die großen Dinge Ägyptens, die Monumentalität seiner Bauwerke waren für ihn von essentieller Bedeutung; denn „in diesen Kunstwerken und Bauten wird Menschliches, über die ihm sonst eigenen Raum- und Zeitmaße hinaus vergrößert, in die Zusammenhänge des kosmischen Raums (dem der Sterne und der elementaren Naturgewalten) und der kosmischen Zeit hineingestellt. Dass Menschenwerk dem standhalten, ja es ausdrücken kann, verdeutlicht vor allem der Sphinx. [...] Dass Menschliches so in kosmische Bezüge einzurücken vermag, ist für Rilke ein Hoffnungszeichen dafür, dass der Mensch vielleicht doch nicht so verloren und isoliert im All steht, wie es zunächst scheinen mag.“[41] Ägypten war, im Gegensatz zu den anderen Ländern, die er besuchte und die auf ihn großen Einfluss übten, wie Russland, Frankreich und Spanien, etwas Besonderes. Der Weg in das Niltal war für Rilke bahnbrechend: „jeder Strich Europas bis weit hinein in die Ebenen des Ostens schenkte ihm aus Vergangenheit oder Gegenwart eine Frucht, wenn sie oft auch nur in der Erkenntnis bestand, daß der Kern des Lebens erst noch zu suchen sei. Im Nilland aber, wo vor fünftausend Jahren eine Afrika, Asien und wohl auch Alteuropa verpflichtete Hochkultur entstand, die dem Menschen Welt und Dasein deutete, glaubte Rilke ein ,Ziel‘ gefunden zu haben. Hier sah er nicht nur den ewigen Strom des Werdens gebändigt und dem zerfließenden Leben durch Bilder von ,beinahe‘ ewiger Größe einen Halt gegeben. Hier traf er auf Gottesdienst, der den Alltag durchdrang, echt und gültig wie sonst nirgendwo. Denn hier lebten einst Götter wirklich, wogegen die Zeitgenossen Gott oft mit Bildern verstellten und ihn allein im Munde führten. Die mit dem Menschenbereich jetzt nicht mehr im Einklang lebende Kreatur traf der Dichter dort damit in inniger Verbindung. Über die Schranken seines begrenzten Daseins hinaus hatte der Mensch in Ägypten noch die andere Hälfte des Lebens, den Tod, festzuhalten und zu gestalten vermocht. Rilkes Durst nach den Wassern des Lebens, sein Ringen um wahre Verwirklichung irdischen Seins, versprach ihm der Nil mit seinen heiligen Fluten vom Ursprung her zu stillen. So wurde der Weg nach Ägypten für den Dichter ein Gang zu den Geburten und zu den Schatten. Was die Menschheit einst in der Stufe der Kindheit erlebt hatte: hier war es zeitlos als eine Erfüllung zu schauen.“[42]
Liest man all die schönen Worte Rilkes über die unermesslichen großen Dinge Ägyptens und sieht oder hört, dass die Radikalislamisten eben diese Dinge am liebsten aus der Welt schaffen wollen, verschlägt es einem buchstäblich die Sprache.
Man fragt sich, wo die Aversion dieser Hohlköpfe gegen die altägyptische Kultur herkommt. Jeder, der sich ein wenig mit dem Koran auskennt, weiß, dass er die alten Geschichten aus der Bibel wiederholt, manchmal auf sehr eigenwillige Art und Weise, weil man die Geschichten ja nur vom Hörensagen kannte und so wurde das biblische Kauderwelsch übernommen, ohne sich viel Gedanken darüber zu machen. Man ließ das Ganze von oben herabfallen und gab ihm dadurch den heiligen Schein, den es bedurfte. Dabei hat man die adaptierten Mythen seinen Bedürfnissen angepasst. Ein Großteil dieser Geschichten, hat keinerlei historische Substanz, es sind fabulöse Geschichten, zusammengesetzte Fiktionen. Da auch eine Fiktion ein Mindestmaß an historischer Substanz bedarf, um nicht als völlig aus der Luft gegriffen zu erscheinen, bot sich Ägypten geradezu an. Es war schließlich die erste Staatsgründung in der Weltgeschichte, an der man sich ebenso abmühen wie aufrichten konnte. Für die Gewährleistung, alles Erdichtete sei wahr, benötigte man Ägypten als Gegenkraft. Nur im Lichte der ägyptischen Geschichte, auf dem Boden seines historischen Fundaments spielten sich die Geschichten ab. Die Kulisse war da und das war schon mehr als die halbe Miete. So gaben sich diese Landstreicher, die man Propheten nennt, die Klinke in die Hand, entweder ließ man sie direkt aus Ägypten kommen wie Moses, oder dorthin wandern wie Joseph und seine Brüder oder fabrizierte ihnen ein Dasein als Händler wie bei einem Schafhirten namens Abraham. Den macht man gleich zum Oberhäuptling, zum Gotterfinder und verfrachtetet ihn in sehr, sehr weit zurückliegende Zeit, die ahistorischer nicht hätte sein können, um das Erstgeburtsrecht für sich in Anspruch zu nehmen. Echnaton hingegen, der wahre Ideengeber, wurde totgeschwiegen.
2.Gräber, Tempel, Kolosse
Ägypten hat die Entdeckung und Erforschung seiner alten Geschichte den Europäern zu verdanken. Diese kamen aber keineswegs nur als Forscher und Archäologen ins Land, sondern ein Gutteil von denen waren wahre Räuber, Geschäftemacher, Abenteurer, die die Schätze des Landes ausplünderten. Sogar seriöse Gelehrte konnten der Versuchung nicht widerstehen. Champollion, der mit seiner Expedition das Grab Ramses VI. als Lager benutzte, ließ aus dem herrlichen Grab von Sethos I. zwei Szenen entfernen und in den Louvre bringen. Lepsius soll 15000 Stücke nach Deutschland verschifft haben. Bei seiner Vorgehensweise ging der tüchtige Preuße alles andere als zimperlich vor, so musste eine verzierte Säule im Grab Sethos I. sogar zerstört werden, um Teilen daraus habhaft zu werden. Gewissensbisse schien keiner dabei zu haben, man tat es schließlich, wie Lepsius es formulierte: „zum Besten der Wissenschaft und für ein wissbegieriges Publikum.“ Schätze, die der ganzen Welt gehören, dürfen nicht an einem so schäbigen Ort wie Kairo verbleiben, sondern bedürfen eines kultivierteren Ortes wie London, Paris oder Berlin. An Ausreden waren Plünderer nie verlegen. Sie sahen sich sogar im Recht, schließlich handelten sie, als Bewahrer der Kultur, deren Schätze als Kulturerbe der Menschheit zu betrachten sind und daher vor Missachtung, Schlamperei und Korruption der Beamten und Regierungsvertreter geschützt werden mussten, auch im Interesse Ägyptens. Waren es nicht Ägypter, die schon im Altertum die Gräber ausplünderten? Hatte nicht der Staat selber solche Raubtouren organisiert, um an die Schätze heranzukommen und den eigenen Haushalt zu sanieren? Unter Ramses IX. fanden Grabräubereien in großem Stil statt. Es gab Banden, die sich darauf spezialisiert hatten und sie hatten Beziehungen zu den Priestern und hohen Beamten, die bestochen wurden, so dass häufig die Räuber ganz strafffrei davonkamen. Hatten nicht die verkommenen ägyptischen Herrscher im 19. Jahrhundert, die Khediven, die das Land langsam aber sicher in den finanziellen Ruin und in die politische Abhängigkeit stürzten, die besten Stücke an Staatsgäste verschenkt, um von diesen ein heuchlerisches Lobeswort zu hören oder mit einem wertlosen Orden beschenkt zu werden? Verteilten nicht diese auf Äußerlichkeiten bedachten orientalischen Hohlköpfe die Schätze, als wären sie ihr Privateigentum? Und war es schließlich nicht ein ägyptischer Vizekönig, der ernsthaft mit dem Gedanken spielte, die Cheops Pyramide in die Luft zu jagen, weil Wahrsager ihm verkündet hatten, darin befänden sich unermessliche Schätze, und nur an diesen war der Bandit interessiert? Ein derart verkommener Staat darf ausgeplündert werden, um die wertvollen Kulturschätze vor ihm zu schützen. In London, Paris, New York oder Berlin sind die Schätze hingegen in guten Händen und werden ihrem Wert entsprechend auch behandelt. Nein, ein schlechtes Gewissen hatten die Plünderer wahrlich nicht. Dass sie dabei logen und betrogen und ihre Geschäfte machten, störte dabei wenig. Die Habgier der Schatzgräber wäre nicht so zerstörerisch gewesen, hätten sie nicht die willigen einheimischen Vollstrecker gefunden. Raffgier war zu allen Zeiten und in allen Völkern weitverbreitet, gute Geschäfte kennen weder Nationalität noch Moral. Erstaunlich, dass man in diesem Land, das seinen Räubern, einheimischen wie ausländischen ausgeliefert war, überhaupt noch Schätze findet. Die Bauern und Händler wollten am Reichtum partizipieren und taten alles, um geraubte Schätze an den Meistbietenden zu verschachern und die Herrscher waren, wie so häufig, primitiv und ungebildet.
Christliche Fanatiker hatten in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung viele Tempel zerstört und sie in Viehställe verwandelt. Sie hausten darin wie die Vandalen, zechten, fraßen und hinterließen ihren Unrat, sie zerstörten Reliefs und malten ihre verdammten Kreuze überall. Fanatische Muslime folgten und verfuhren genauso barbarisch, sie zertrümmerten der Sphinx die Nase und schoben es Napoleon, der von Ehrerbietung für die Landeskultur beseelt war (er tat wenigstens so) und nie zugelassen hätte, dass einer seiner Soldaten eine solche Tat begehe, in die Schuhe. Später kamen die Engländer und raubten von den Schätzen, was übriggeblieben war. Als ob es sich bei ihnen um eine Berufung gehandelt hätte, trieben sie ihr Unwesen überall auf der Welt und waren stets auf den eigenen Vorteil bedacht.
Andererseits kann man als Ägypter seinen Stolz nicht verbergen, in allen europäischen Metropolen entweder auf ein ganzes ägyptisches Museum oder auf die Riesenabteilung eines solchen zu treffen, sogar dort, wo man das gar nicht erwartet wie z.B. in der Eremitage.
Für jeden Ägyptenreisenden ist eine Nilkreuzfahrt beinah Pflicht. Sie ist ja auch schön und empfehlenswert. Sie fängt gewöhnlich in Luxor an und geht bis Aswan und zurück. Auf dieser Fahrt lernt man ein Gutteil der unermesslich großen Dinge Ägyptens kennen. In und um Luxor: den Luxor-Tempel, Karnak, das Tal der Könige, den Hatschepsut-Tempel, die Memnonkolosse, und, falls es die Zeit erlaubt, das Ramesseum, Medinet-Habu, Dir al-Medineh... Wenn das Schiff sich in Bewegung setzt, folgen die Tempel von Esna, Edfu, Kom-ombo und nahe Aswan der Philae-Tempel. Ein kurzer Trip zum Abu-Simbel darf natürlich nicht fehlen. Kämen noch die Pyramiden, die Sphinx in Kairo, und die Stufenpyramide in Saqqara hinzu, so hätte man fast all die großen Dinge Ägyptens gesehen. Eine wahrlich beeindruckende Vielfalt von Sehenswürdigkeiten. Hat man alles eingesaugt, so kehrt man glücklich und mit Kultur vollbetankt heim. Genau das wollte ich einmal miterleben, das Land mit den Augen eines Touristen sehen. Natürlich kann sich eine Reise in das eigene Land niemals zu einer „normalen“ Reise entwickeln, auch wenn man die Touristenkappe anzieht, sich einen Strohhut besorgt und brav der Touristenroute von Luxor bis Abu Simbel folgt, sich Tempel und Gräber anschaut und das unvergleichliche Panorama auf dem leidenden, schweigsamen Fluss genießt. Nein, man kann nicht einfach Tourist werden, auch wenn man so tut als ob. Trotzdem war es höchst interessant, die Perspektive zu wechseln und bei der ersten Reisehälfte den Touristen nachzueifern. Man kann sogar verstehen, wenn die Leute von diesem Land so schwärmen und immer wieder dorthin pilgern. Aus unserer Reisegruppe war eine Dame dabei, die die gleiche Reise zum 14. Mal machte, ach die Glückliche! Die muss inzwischen jeden Tempelstein kennen und nachts auf Hieroglyphisch träumen, vor allem aber jeden Müllhaufen auf dem Weg dorthin; denn diese sind genauso unbeweglich wie die Pyramiden, sie pflegen nie zu verschwinden, sondern eher zu wachsen, aus einem Häufchen kann im Laufe der Jahre ein Berg werden. Die Menschen sitzen daneben oder in der Nähe, schlürfen ihren Tee, rauchen ihre Wasserpfeifen und machen den Eindruck, als ob sie darauf achten, dass dem wachsenden Berg nichts geschieht. Es ist ja auch eines der wenigen Wachstumsraten im Lande, von der Bevölkerungsexplosion mal abgesehen.
Schon beim Verlassen des Schiffes fallen die Soldaten auf, die oben an der Treppe stehen und ihre Schutzaufgabe wahrnehmen. Sie tragen die schwarze Winterkleidung aus Wolle, die bei diesen Temperaturen, zumindest tagsüber, eigentlich überflüssig sind. Was wohl in deren Köpfen vorgeht, wenn sie täglich die Ströme von Touristen beobachten, für deren Schutz sie wie angewurzelt dastehen, kann man nur erahnen. Auf den Schultern tragen sie Gewehre, russischer Bauart, die höchstwahrscheinlich im Notfall nicht funktionieren würden, Kalaschnikow oder so was Ähnliches, die eher zum Taubenschießen taugen. Die Soldaten schauen sich vergnügt die blonden Herren und Damen an, vielleicht fragt sich einer von denen: Warum soll ich die beschützen, die an einem Tag mehr ausgeben als ich im ganzen Monat verdiene, was habe ich davon? Dabei weiß er genau, dass er nur Befehlen zu gehorchen hat. Ja, ausgerechnet die, die am wenigsten verdienen und es am nötigsten haben, bekommen kein Trinkgeld. Sie sind die ärmsten der Armen und können sich so gut wie nichts leisten. Sie stehen da und sind bereit, ihr Leben zu opfern; denn kämen wirklich bewaffnete Fundis hierher, wären sie die ersten, die abknallt werden und das für den Hungerlohn, den sie bekommen. Irgendwie ist das ungerecht. Verstohlen wandern ihre Blicke den Frauen zu, je jünger, je wohlgeformter der Busen und knackiger der Hintern ist, umso vergnügter. Nach Feierabend gehen sie in die Moschee und absolvieren ihr Gebetssoll, Gott ist gnädig und verzeiht begehrliche Blicke.
Tal der Könige
Und schon die erste Station war atemberaubend.
„Wir ritten heute durch das gewaltige Tal, in dem die Könige ruhen, jeder unter der Schwere eines ganzen Berges, auf den sich auch noch die Sonne stemmt, als wär's über die Kraft, Könige zu verhalten“[43], schreibt Rilke an seine Frau über das Tal der Könige. Zum Glück sind die Gräber in den Felsen gehauen, so konnten die Räuber sie schlecht mitgehen lassen. Die reich verzierten Ruhestätten - man bekommt eine Ahnung davon, wie prachtvoll sie gewesen sein mussten, als sie fertiggestellt wurden - genießen inzwischen einen legendären Ruf und eine unglaubliche Anziehungskraft. Sie locken Menschen zu Tausenden aus aller Welt. Es ist zu befürchten, dass diese eines Tages dafür sorgen, dass von den herrlichen Malereien nichts übrigbleibt. In diesen Gräbern, die der Zeit trotzen und für die Ewigkeit geschaffen worden sind, wollte jeder Banause sich verewigen. Allein im Grab Ramses VI. wurden 995 Graffitis gezählt, die im ganzen Grab verstreut sind.
Bei jedem Grab ist man immer wieder aufs Neue erstaunt, wie die Arbeiter mit den primitiven Werkzeugen, die ihnen zur Verfügung standen, solche Schächte in den Felsen hauen, ohne Schutzmasken, Luftlöcher, Sicherheitsvorkehrungen… und wie sie das ganze so ebenmäßig verzieren und bemalen konnten. Die Reliefs und die Malerei in den Gräbern wirken lebendig, obwohl die altägyptische Kunst perspektivlos war. Ihre Ausdrucksform war eine einfache, klar strukturierte Sprache, die gerade durch diese Einfachheit am meisten beeindruckt. Man glaubt, die Alten haben die bunten Bilder für uns gemalt, damit wir sehen können, wie sie gelebt, woran sie geglaubt hatten und wie tief verwurzelt das religiöse Element war. Dabei dachten sie nicht im Geringsten an uns und an die herrlichen Bildbände, die man heute überall für wenig Geld erwerben kann. Ein Betrachter, ein Rezipient war nicht vorgesehen. Sie schufen ja auch keine Kunst, sie wussten nicht einmal was das ist: „Kunst“. Ein Künstler war ein Handwerker und es gab kein Wort für Kunst. „Der Bildhauer zum Beispiel, der die Grabstatuen – den dauerhaften Ersatz des Toten - schuf, wurde ’der leben lässt’ genannt.“[44] Der Zweck der Bilder ruht in sich selbst. Sie sollen das vermitteln, was sie darstellen. Sie sind ein Gehhilfsmittel für den Toten, das seinen Schlummer behaglich macht, eine Orientierungshilfe, ein kleiner Bakschisch für die Götter, um sie gnädig zu stimmen. Die praktische Veranlagung der alten Ägypter ist hier spürbar.
Manche Gräber sind labyrinthartig gebaut, man geht Treppen hinauf und hinab, biegt um die Ecke, wandert durch Korridore und Brunnenschächte bis man zur eigentlichen Grabkammer kommt. So ist das Grab Thutmosis III. (KV34) sehr verwinkelt, Touristen freundlich ist das nicht gerade und geholfen hat es auch nicht.
Abb.4:Grab Thutmosis III. KV 34Kaum hat man die Mumie bestattet, waren die Grabräuber schon da und haben alles ausgeplündert. Die hohe Treppe, die zum Eingang führt, wirkt wie eine Himmelsleiter, schließlich steigt man ja zu einem Gott. Von der Höhe geht es gleich in die Tiefe. Man versinkt in den Berg und wird von einem Korridor zum nächsten geführt, es tauchen Brunnenschächte auf und Pfeilerhallen.
Abb.5:Strichmännchen im Grab Thutmosis III.Nach der 1. Pfeilerhalle dringt man noch tiefer, macht eine erneute Drehung und kommt endlich zur Grabkammer, in der man die dunkelblaue Decke mit den goldenen Sternen, vor allem aber die vielen Strichmännchen, die sehr modern wirken und richtig niedlich aussehen, bewundern kann.
Mal sieht man den Thutmosis zwischen seinen Götterkollegen Hathor, Osiris und Anubis abgebildet, mal mit dem blauen Kopftuch vor Anubis stehen, alle hauchen ihm Leben ein, dabei sieht das Lebenszeichen, das Anubis in Händen hielt, eher wie ein Augenglas aus, als wollte er die Zähne unter die Lupe nehmen.
Dass für das Grab Ramses VI. extra Eintritt verlangt wird, nimmt man gern in Kauf; denn das Grab ist wirklich wundervoll. Auf den herrlich dekorierten Wänden sind unzählige Graffiti aus verschiedenen Zeiten zu sehen. Das Grab muss ja eine unglaubliche Anziehungskraft gehabt haben. Schon am Eingang wird der Besucher nett empfangen. Die hübschen Schwestern Isis und Nephty, begrüßen, mal stehend mal kniend, die Ankommenden. Gut aufgepasst haben sie aber nicht, das Grab wurde zeitig geplündert. Man sieht den Pharao unter seinesgleichen, die Götter empfingen ihn.
Die Bauweise ist hier eher einfach,man geht durch 4 Korridore und kommt über einen Brunnenschacht zu einer Pfeilerhalle, in der treffen wir den guten Ramses vor Osiris stehend. Es folgen zwei Korridore, im ersten erblickt man an der Decke die Barke des Re mit Szenen aus dem Amduat. In der Vorkammer (die letzte vor der Grabkammer) wird das Totenbuch zitiert, die „Auferstehung“ des Osiris ist an die Decke gemalt. Die Grabkammer ist mit Texten aus dem Buch der Erde dekoriert. An den anderen Wänden sind Szenen aus dem Buch der Pforten, Buch der Höhlen, Buch vom Tag, Buch der Nacht (die beiden letzten sind an der Decke angebracht) zu sehen, sowie ein Geier an der Laibung. Der lang gestreckte Leib an der mit Sternen übersäten Decke, sogenannte astronomische Decke, ist der der Himmelsgöttin Nut, die am Abend die Sonne verschluckt, sie während der Nacht in ihrem Leib laufen lässt, um sie am nächsten Morgen als Skarabäus (Symbol der Wiedergeburt) aus ihrer Scheide zu gebären.
Hochinteressant ist auch das Grab der Tausret und des Sethnacht (KV 14). Tausret war die Ehegattin vom Sethos II. und übernahm die Regentschaft für Siptah, um nach dessen Tod (er starb 20-jährig) allein (zwischen 1194-1186) zu regieren. Unter Tausret war Baja der Kanzler, der im Hintergrund die Fäden zog. Er muss ein mächtiger Mann gewesen sein, denn für ihn wurde im Tal, das nur für Könige reserviert war, ein Privatgrab errichtet. Siptah litt unter Kinderlähmung, das linke Bein „war verkümmert und verkürzt“. Tausret war also zuerst eine Königin und dann alleinherrschender Pharao.
Sethnacht ist der Begründer der 20. Dynastie. Er regierte kurz (1187-1184), auf ihn folgte sein Sohn Ramses III. (1184-1153). Sethnacht usurpierte das Grab der Tausret, ließ ihre Bilder einfach entfernen und setzte an ihre Stelle seine eigenen. Nach der Eingangspassage, in der Tausret den Göttern opfert, zu sehen sind Anubis, die Horussöhne, Isis und Nephthy, wird Tausret von Anubis zu Osiris geführt. Die Wände sind mit Texten aus dem Totenbuch (Spruch 145) dekoriert. Danach folgen drei Korridore, dann die Grabkammer. Bei der Dekoration handelt es sich um vertiefte Reliefs. Bei der Mundöffnungszeremonie sieht man Anubis über eine Mumie gebeugt, flankiert von Isis und Nephty (Totenbuch Spruch 1515). Auch ist eine gewölbte Decke mit astronomischen Abbildungen zu bewundern. Der Sarkophag aus rotem Granit befindet sich noch in der 2. Grabkammer.
Man wünschte, der Besuch hätte Tage gedauert, um all die Pracht und Herrlichkeiten dieser Ruhestätten einzuatmen. Man kann sie wirklich nicht genug bewundern und sich keinen besseren Platz für einen fortwährenden Aufenthalt wünschen. O! Welch wunderbare Schätze verbargen diese ungeheuren Felsen, die so majestätisch in den Himmel ragen und welche Stille! Wie gemütlich muss der ewige Schlaf in dieser Gegend gewesen sein, aber bedauerlicherweise kann von ruhigem Schlaf keine Rede sein.
Beim Durchwandern glaubt man aus der Ferne die Worte zu vernehmen:
Wohl dem, der in Theben ist!
Dann landet man als Gelobter in Theben,
dem Gau der Wahrheit, dem Boden des Schweigens.
Die Unrecht tun treten nicht ein zu ihr,
der Stätte der Wahrheit;
die Fähre, die den Rechtschaffenen übersetzt,
ihr Fährmann setzt die Frevler nicht über.
Wohl dem, der in ihr landet!
er wird ein göttlicher Ba wie die Neunheit.[45]
Die heutigen Fähren sind anders, sie wissen weder von Wahrheit noch vom Schweigen, sondern nur von harter Währung. Sie setzen jeden über, der Geld hat. Aus dem Ort der Wahrheit und des Schweigens ist ein Tummelplatz geworden. Im Tal, das nur Königen vorbehalten war, herrscht heute reges Treiben, nicht nur das Gequake der Touristen in allen Weltsprachen, der Karten- und Bücherverkäufer, der Ordnungshüter und Transporteure sorgt für die gestörte Ruhe; denn diese setzte schon im Altertum ein. Kaum wurde ein Pharao begraben, waren die Räuber, die oft die Erbauer des Grabes und über dessen Lage bestens informiert waren, schon da. Sie waren wie alle Diebe zu allen Zeiten unbarmherzig, sie nahmen alles, was sie fanden und ließen sich weder vom Fluch noch von anderen Drohungen stören. Vor denen mussten sogar die Mumien in Sicherheit gebracht werden. Später hat man die Mumien völlig entwurzelt und zum musealen Gegenstand degradiert. Unter elektrischem Licht müssen sie Tag für Tag die neugierigen Blicke der Menschen ertragen. Man hat die Toten um ihre Ruhe gebracht und wandert nun als Tourist respektlos im Tal herum, raucht und knipst seine Bilder sogar dort, wo das Knipsen strengstens verboten ist. Aber wer will nicht seine Schlauheit unter Beweis stellen und innerlich über diese bedepperten Wächter, die einen sehr schläfrigen Eindruck machen, triumphieren? Welcher Schaden diesen Kulturdenkmälern dabei zugefügt wird, interessiert niemanden. Wie überall so ist auch hier die Devise: nach uns die Sintflut.
Luxor / Karnak
Abb. 6: Luxor