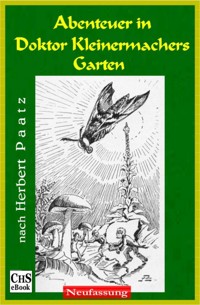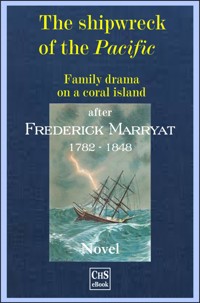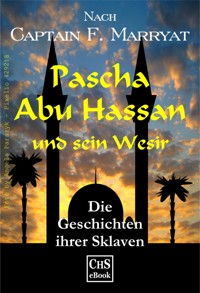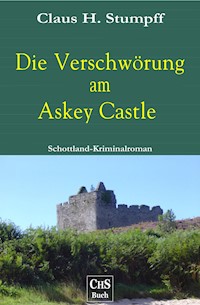
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
An schottischen Gewässern werden trotz der schädigenden Auswirkungen auf Mensch und Meeresfauna ständig neue Lachsfarmen errichtet. Gegen diese das ökologische Gleichgewicht belastende Massenfischhaltung formieren sich Bürgerinitiativen, deren Wortführer nacheinander und auf seltsame Weise ums Leben kommen. Detective Chief Inspector Paul O'Brien vom C.I.D INVERNESS macht die Bekanntschaft der attraktiven Lokalredakteurin Jenny Symon. Diese hatte wegen ihres aufrüttelnden Referats im INVERNESS REPPORT über die durch sogenannte ›AQUAKULTUREN‹ verursachten Umweltschäden Morddrohungen erhalten. Paul und Jenny werden zu Verbündeten bei der Aufklärung dieser grausamen Verbrechen und geraten dabei in Lebensgefahr. Als eine junge Familie bei einem Autocrash umkommt und die am Unfall beteiligten Fahrzeuge spurlos verschwinden, stoßen beide auf ein Geflecht von Korruption und Vertuschung bei Polizei und Staatsanwaltschaft. Doch die Mordserie geht weiter, sogar ein hoher Polizeibeamter wird eines der Opfer. Die Partner sind fassungslos, als sie schließlich den Serienkiller entlarven. Dieser verschleppt Jenny in die Ruine des ASKEY CASTLE. Von Polizei umstellt, droht er damit, die junge Frau zu erschießen. Paul O'Brien muss jetzt um Jennys Leben bangen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Claus H. Stumpff
Die Verschwörung
am
Askey Castle
Schottland-Kriminalroman
Independently published
Texte © 2022. Claus H. Stumpff
Umschlaggestaltung: Claus H. Stumpff
Coverbild: Castle Tioram am Loch Moidart, Scotland
Foto: Claus H. Stumpff
Inhalt
An schottischen Gewässern werden trotz der schädigenden Auswirkungen auf Mensch und Meeresfauna ständig neue Lachsfarmen errichtet. Gegen diese das ökologische Gleichgewicht belastende Massenfischhaltung formieren sich Bürgerinitiativen, deren Wortführer nacheinander und auf seltsame Weise ums Leben kommen.
Detective Chief Inspector Paul O'Brien vom Criminal Investigation Department (C.I.D) Inverness macht die Bekanntschaft der attraktiven Lokalredakteurin Jenny Symon. Diese hatte wegen ihres aufrüttelnden Referats im INVERNESS REPPORT über die durch sogenannte ›Aquakulturen‹ verursachten Umweltschäden Morddrohungen erhalten.
Paul und Jenny werden zu Verbündeten bei der Aufklärung dieser grausamen Verbrechen und geraten dabei in Lebensgefahr. Als eine junge Familie bei einem Autocrash umkommt und die am Unfall beteiligten Fahrzeuge spurlos verschwinden, stoßen beide auf ein Geflecht von Korruption und Vertuschung bei Polizei und Staatsanwaltschaft.
Doch die Mordserie geht weiter, sogar ein hoher Polizeibeamter wird eines der Opfer. Die Partner sind fassungslos, als sie schließlich den Serienkiller entlarven. Dieser verschleppt Jenny in die Ruine des ASKEY CASTLE. Von Polizei umstellt, droht er damit, die junge Frau zu erschießen. Paul O'Brien muss jetzt um Jennys Leben bangen.
Autor
Claus H. Stumpff wuchs in Berlin, Graz und Göttingen heran. Seine weiteren Lebensstationen waren Osterode a.H., Goslar, Frankfurt a. M., Nürnberg und München. Der gelernte Industriekaufmann befasste sich drei Jahrzehnte lang mit der Einrichtung und instrumentellen Ausstattung naturwissenschaftlicher Fachräume an Schulen. Später leitete er die Münchner Niederlassung eines Großunternehmens der Automobil-Industrie.
Seit dem Ruhestand widmet er sich der Schriftstellerei, wie auch der sprachlichen Überarbeitung und Neufassung historischer Editionen.
Seine besondere Liebe gehört den schottischen Highlands, die aus familiären Gründen zu seiner zweiten Heimat wurden. Seine dort gesammelten Erfahrungen kommen diesem Roman zugute.
Übersicht
Prolog
Erster Teil
Kapitel 1- Kapitel 2 Kapitel 3
Kapitel 4Kapitel 5 - Kapitel 6
Kapitel 7 - Kapitel 8 - Kapitel 9
Zweiter Teil
Kapitel 10 - Kapitel 11- Kapitel 12
Kapitel 13 - Kapitel 14 - Kapitel 15
Driter Teil
Kapitel 16 - Kapitel 17 - Kapitel 18
Kapitel 19 - Kapitel 20 - Kapitel 21
Vierter Teil
Kapitel 22 - Kapitel 23 - Kapitel 24
Kapitel 25 - Kapitel 26 - Kapitel 27
Kapitel 28 - Kapitel 29 - Kapitel 30
Kapitel 31
Fünfter Teil
Kapitel 32 - Kapitel 33 - Kapitel 34
Kapitel 35 - Kapitel 36 - Kapitel 37
Sechster Teil
Kapitel 38 - Kapitel 39 - Kapitel 40
Kapitel 41 - Kapitel 42 - Kapitel 43
Kapitel 44 - Kapitel 45- Kapitel 46
Epilog
Kapitel 47
Anhang
Erklärung des Autors
Impressum
PROLOG
Premiere in Schottland
Detective Chief Inspector (DCI) Paul O’Brien sitzt – wie fast immer in diesen regnerischen Tagen – missgelaunt hinter seinem Schreibtisch im CID Inverness (Criminal Investigation Department), umgeben von hohen Aktenstapeln. Er ist jetzt siebenunddreißig, also ein Mann in den besten Jahren, der allerdings bei einer Körpergröße von nur 1,78 Meter mit 92 Kilo etwas zuviel auf die Waage bringt. Rotblondes Haar und unzählige Sommersprossen auf seinem glatt rasierten, stets etwas geröteten Gesicht verraten seine irische Herkunft. Wegen eines schlecht behandelten Nasenbeinbruchs prägt ein typisches Boxerprofil sein äußeres Erscheinungsbild.
Seine Karriere begann er als einfacher Police Constable bei der London Metropolitan Police. Danach wechselte er zu Scotland Yard, wo er schon bald in den gehobenen Dienst berufen wurde. Aufgrund seiner kriminalistischen Erfolge stand seine Beförderung zum Detective Superintendent unmittelbar bevor. Doch völlig unerwartet erfolgte sein beruflicher Abstieg mit der Versetzung in die Provinz. Der Grund hierfür ist seine gesetzeswidrige Vernehmung eines brutalen Mörders. Dabei hatte er die Beherrschung verloren und wohl etwas zu fest zugeschlagen. Aber war es wirklich angebracht, einen treu dienenden Untertanen Ihrer Majestät deswegen ins Hinterland zu verbannen, in diesem Fall in eine der nördlichsten schottischen Provinzen? Nun gut, Inverness gilt bei Einheimischen wie Touristen als Königin des Nordens. Aber im hiesigen CID passiert einfach nichts, wozu man einen Mann mit seinen Erfahrungen braucht.
Doch dann wendet sich das Blatt.
Der alles einhüllende, weiße und kalte Nebel ist Paul O’Brien aus seiner Londoner Zeit noch in unguter Erinnerung. Doch hier, in der im Nordosten Schottlands gelegenen Hauptstadt der Grafschaft Invernessshire, leidet man nur selten unter diesem krankmachenden Dunst, der sich einem auf die Lungen legt und das Atmen erschwert.
An diesem Frühsommertag herrschte allerdings eine solche, einfach ekelhafte Wetterlage, denn ein kalter Nordostwind blies tief liegende Wolken von der Nordsee her weit ins Land hinein, was somit eine ideale Kulisse für den spektakulären Raubüberfall auf das Juweliergeschäft Thompson & Turner in der Invergarry Street bildete:
Zwei als Clowns maskierte Räuber drangen laut schreiend in den Laden ein. Einer erschoss den sich heftig wehrenden Seniorchef Harold Thompson, während der andere dessen Schwiegersohn Richard Turner niederschlug, mit Klebeband fesselte und in einen Abstellraum sperrte. Dabei war diesem Räuber nur kurz die Maske hinuntergerutscht. Der eingesperrte Turner hatte allerdings das Glück, kurz dessen Gesicht zu sehen, wie er nach seiner Befreiung angab. Seine Frau Sarah hatte gerade eine Kundin bedient, als diese beiden gezwungen wurden, sich bäuchlings auf den feuchten, schmutzigen Parkettboden zu legen. Nachdem die Gangster hastig sämtlichen Schmuck aus Vitrinen und Auslagen in mitgeführte Taschen gestopft hatten, verschwanden sie blitzartig in den jetzt von dichtem Nebel eingehüllten Straßen. Die sofort eingeleitete Großfahndung verlief deshalb erfolglos.
Nach Abschluss der ersten polizeilichen Vernehmungen, die unter der Regie Paul O’Briens stattfanden, zog sich Mr Turner allein in sein nur wenige Meilen nordöstlich von Inverness gelegenes Landhaus bei der Ortschaft Nairn am Moray Firth zurück, um sich von den Strapazen des Überfalls zu erholen. Sarah Turner war zwar unversehrt geblieben, doch sie hatte einen schweren Schock erlitten und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden
Zwei Tage waren seit dem Raubüberfall vergangen, als kurz nach dem abendlichen Schichtwechsel beim CID Inverness ein telefonisches Hilfeersuchen von Richard Turner einging. Zwar hatte O’Brien schon Feierabend, aber er nahm es mit der Zeit nicht so genau. Weil sein diensthabender Kollege, Detective Inspector (DI) Walter Adams, gerade nicht erreichbar war, stellte die Telefonzentrale den Anruf zu ihm durch. O’Brien nahm den Hörer ab, obwohl er sich bereits im Aufbruch befand.
»Helfen Sie mir, ich brauche dringend Polizeischutz! Bitte kommen Sie rasch!« hörte er die sich überschlagende Stimme Mr Turners. »Einer der beiden Räuber geht geradewegs auf mein Haus zu. Ich stehe oben am Schlafzimmerfenster und habe ihn sofort wiedererkannt. Das war der Typ, der mir sein Gesicht zuwandte, als ihm die Maske runterrutschte. Er muss das wohl bemerkt und diese Adresse ausfindig gemacht haben. Jetzt steht er unten und schaut zu mir hinauf. Dummerweise vergaß ich abzuschließen, aber nun ist es zu spät dafür. Bitte beeilen Sie sich, dem Kerl ist alles zuzutrauen! Sie finden mein Haus direkt an der Küste – gleich am Ortseingang von Nairn – hinter einer riesigen Eiche, dem einzigen Baum weit und breit!«
Ehe Paul O’Brien überhaupt zu Wort kam, hatte Mr Turner aufgelegt.
Das war natürlich ein gefundenes Fressen für O'Brien, also genau einer jener Fälle, auf die er schon mit Ungeduld wartete. Und Zuständigkeit hin, Zuständigkeit her, so etwas wollte er sich wegen des Schichtwechsels nicht entgehen lassen. DS Edward Hastings, sein Assistent, war bereits nach Hause gefahren. Den jungen Mann konnte er nicht ausstehen, denn der trug einen Oberlippenbart. Und jeglicher Bartwuchs war O’Brien zuwider, genauso wie lange Haare. Die pflegte sich Hastings zu einem Pferdeschwanz zu binden, wohl einem derzeitigen Modetrend folgend. Darum bereitete es O’Brien ein besonderes Vergnügen, Hastings wieder einmal den Feierabend zu vermiesen. Er rief ihn zu Hause an und befahl ihm, sich schleunigst auf den Weg nach Nairn zu machen:
»Ich fahre ebenfalls gleich los, aber Sie sind schneller dort. Das Landhaus liegt direkt an der Küste, nach Mr Turners Angabe bei einer riesigen Eiche, dem einzigen Baum weit und breit«, erklärte er in seinem üblichen, barschen Befehlston. Danach schnallte er sich den Pistolenholster um, zog die Lederjacke über und lenkte vorsichtig seinen alten Vauxhall durch den Nebelschleier nach Nairn zu Turners Landhaus.
Der 28-jährige DS Edward Hastings war wegen seiner guten Leistungen – besonders im Umgang mit Schusswaffen – erst kürzlich vom regulären Polizeidienst ans CID versetzt und DCI Paul O’Brien als Assistent zugeteilt worden. Die neue Aufgabe fesselte ihn ungemein. Allerdings bestand von Anfang an ein etwas angespanntes Verhältnis zwischen ihm und seinem Chef, der meist in barschem Tonfall seine Dienstanweisungen erteilte. Dass O’Brien sich ständig über anderer Leute Haartracht mokierte, ließ ihn mittlerweile kalt. Er vermutete, dass hier ein wenig Neid mit im Spiel stand. Edward Hastings war nämlich Bergsteiger und Extremkletterer; er pflegte viele Wochenenden mit seiner Freundin in den Hängen des Ben Nevis (höchster Berg Schottlands) zu verbringen. Zu extremsportlichen Betätigungen wie Freeclimbing (Klettern ohne Absicherung) war O'Brien schon wegen seiner Leibesfülle niemals fähig. Andererseits war ihm bewusst, dass er von O’Brien noch viel lernen konnte, zumal er hin und wieder berechtigte Rügen wegen eines Fehlverhaltens einstecken musste.
Hasting war nicht gerade begeistert, nach Feierabend zu einem Einsatzort dirigiert zu werden, zumal er aus der Stimme seines Vorgesetzten eine gewisse Schadenfreude heraushörte.
Noch immer hüllten Wolken die Küstenregion ein, die reinste Suppe war das heute. Richard Turner hatte zum Glück eine genaue Wegbeschreibung geliefert und Hastings fand das Landhaus auf Anhieb; die gewaltige Eiche war trotz der getrübten Sichtverhältnisse nicht zu übersehen. Seinen Wagen parkte er in einiger Entfernung und näherte sich vorsichtig dem aus dunkelgrauem Granitgestein errichteten Gebäude, wobei ihm der dichte Smog eine gute Deckung bot.
Langsam bewegte er sich auf das nur silhouettenhaft erkennbare Haus zu. Das vom Nebeldunst reflektierte Streulicht des Mondes verlieh der Landschaft einen gespenstisch weißen Schimmer. Einen Augenblick verharrte Hastings regungslos hinter einem mannshohen Ginsterstrauch, bis er sich schließlich hervorwagte. Die Haustür war nur angelehnt. Auf leisen Sohlen betrat er eine in völligem Dunkel liegende Diele. Er hielt den Atem an, aber nicht der geringste Laut war zu vernehmen. Sich behutsam vortastend erreichte er die in das obere Stockwerk führende Treppe. Plötzlich unterbrach der schrille, synchrone Klang zweier Telefone die Stille: ›Ring-ring‹ ertönte es sowohl aus nächster Nähe, wie auch von der oberen Etage her. Nur einmal, ganz kurz. Dann trat wieder Totenstille ein. Hastings wandte sich der Stelle zu, von der das Läuten herrührte. Nervös tasteten seine Finger über das glatte Holz der Wandvertäfelung, dann stieß seine rechte Hand an den in Augenhöhe angebrachten Telefonapparat. Er erschrak heftig, als erneutes Schrillen jetzt direkt an sein Ohr drang. Wieder gab es nur diesen einen Doppelklang. Nimmt denn keiner ab?, fragte er sich. Turner müsste doch im Haus sein. Warum nur ist alles dunkel hier? Er verharrte neben dem Telefon und lauschte angestrengt nach oben, aber nichts war zu hören. Bis zum Hals hinauf fühlte er das Pochen seines Herzens. Da! Es läutete zum dritten Mal. Zaghaft nahm er jetzt den Hörer von der Gabel und wurde Zeuge eines kurzen Gespräches:
»Hallo?«
»Bist du es, Dick?«
»Na klar, wer denn sonst!«
»Ist er tot?«
»Ja, mausetot! «
»Wann ist es passiert?«
»Vor etwa einer Stunde.«
»Okay!. Wann sehen wir uns?«
»Später. Ich will ihn gleich wegschaffen. Melde mich wieder!«
Dann wurde aufgelegt. Weil die Rede von einem Toten war, galt es äußerst vorsichtig zu sein. ›Wer war der Mann da oben? Turner? Oder gar sein Mörder? Und wer war der angeblich Ermordete, wo befand sich seine Leiche? Hoffentlich kommt O’Brien bald nach‹, waren seine Gedanken. Er wandte sich wieder der Treppe zu. Leise stieg er sie hinauf, bis er den oberen Treppenabsatz erreichte. Das schwache Mondlicht schimmerte durch eine nur einen schmalen Spalt geöffnete Zimmertür. Vorsichtig schob er sie auf und sah in ein Schlafzimmer. Auf Zehenspitzen betrat er den finstren Raum, als sich ein schemenhafter Schatten von einem Bett löste und zum Fenster hin bewegte. Aber anscheinend war seine Anwesenheit noch nicht bemerkt worden, denn die dunkle Gestalt pfiff leise vor sich hin.
DS Hastings ist zwar noch ein junger Beamter, aber niemals hätte er sich derart leichtfertig verhalten dürfen. ›Vorsicht ist das erste Gebot‹, hatte man ihnen auf der Polizeiakademie eingebläut. Doch nun war es passiert und einen derart groben Fehler begeht man nur einmal. Als er die Pistole aus dem Schulterholster zog, rutschte sein Handy aus der Jackentasche und fiel geräuschvoll auf den Teppichboden. Welch ein Missgeschick! Die Gestalt am Fenster drehte sich zu ihm um, als er sich nach dem Gerät bückte. Im gleichen Moment traf ein harter Gegenstand seinen Hinterkopf. Hastings vernahm noch seinen eigenen Aufschrei, dann sank er zu Boden.
Auch Paul O’Brien fand ohne langes Suchen das Landhaus. Knapp zehn Minuten nach Edward Hastings traf er in Nairn ein. Als er sich dem weiträumigen Gelände genähert hatte, verharrte er zunächst für ein paar Minuten in geduckter Haltung hinter einem Gebüsch. Diese Vorsichtsmaßnahme erwies sich als richtig, denn plötzlich sah er, wie ein Mann in langem Mantel von der gegenüberliegenden Seite des Grundstücks auf das Haus zulief, sich kurz umsah und durch die Eingangstür verschwand. Bei sich dachte er: ›Ob Hastings wohl schon drin ist? Das könnte für ihn gefährlich werden. Seinen Wagen habe ich nirgends stehen sehen‹. Im gleichen Augenblick hörte er einen Aufschrei, dann trat wieder beklemmende Stille ein. Jetzt war rasches, professionelles Handeln gefragt. Er schaltete seine Taschenlampe an, zog die Waffe und schlich fast lautlos die Treppe hinauf. Im Lichtkegel seiner Lampe sah er Hastings in der Türöffnung liegen, stieg über ihn hinweg und brüllte in die Dunkelheit »Hände hoch!«.
Am Fenster standen der völlig verdutzte Richard Turner und der Mann im langen Mantel, der O'Brien den Rücken zukehrte und sofort etwas zu Boden fallen ließ. Immer noch die Pistole im Anschlag beugte sich O’Brien über Hastings, der nur den Kopf anhob und mit gequälter Stimme flüsterte: »Ich komme schon zurecht Chef, kümmern Sie sich erst um die anderen dort«, um sich gleich wieder hintenüberfallen zu lassen.
Paul O’Brien war leider zu spät gekommen. Aber natürlich hätte das gleiche Schicksal auch ihn treffen können, daran musste er immer wieder denken, wenn ..., ja wenn er ohne Taschenlampe und ohne sich abzusichern in ein fremdes, ganz im Dunkeln liegendes Gebäude eingedrungen wäre. Nein, so hätte ein Mann wie er mit langjähriger Berufserfahrung nie gehandelt. ›Es wäre also in der Tat besser gewesen, wenn ich vor Hastings eingetroffen wäre. Zwar einen Bart tragen, aber kein bisschen Verstand haben! Und so einer ist bei der Polizei!‹ dachte er voll Zorn.
Die beiden Männer stets im Auge behaltend schaltete er das Licht an. Gerade noch rechtzeitig erkannte er, wie sich der Fremde umdrehte und auf ihn zustürzte. Aber O’Brien reagierte blitzartig und schoss gezielt in dessen rechtes Bein. Der Angreifer jaulte auf und befühlte mit schmerzverzerrtem Gesicht seine Wunde. Dann hob er die Hände über den Kopf und schrie wütend: »Bist wohl ein verdammter Bulle, wie? Schießt auf wehrlose Leute. Aber das werde ich dir heimzahlen!« Doch der Chief Inspector ließ sich nicht beirren und donnerte zurück:
»Halt’s Maul! Ich werde dafür sorgen, dass du keine Dummheiten mehr machst! Und jetzt zieh deinen dämlichen Mantel aus!«
Nur widerwillig gehorchte der Mann. Und an Mr Turner gewandt befahl O’Brien trotz seines Ärgers nun in ruhigerem Tonfall: »Fesseln Sie den Burschen mit irgendwas! Der kann uns beiden nicht mehr schaden!« Hilflos sah sich der Juwelier um und deutete dann auf die Fensterbank, wo neben dem Telefonapparat eine Klebebandrolle lag.
»Geht’s damit?«, fragte er zögerlich.
»Nur zu! Erst die Unterarme, dann die Hände und zum Schluss die Beine ganz unten. Nun machen Sie schon! Anschließend verbinden Sie ihm die Schusswunde, am Besten mit einem Stück Betttuch.«
Immer noch mit gezückter Pistole verfolgte O’Brien die Fesselung der vorgestreckten Arme des Fremden, der sich anschließend aufs Bett legen musste, um sich nun von Turner die Beine mit Klebeband umwickeln zu lassen. Danach zerriss Turner einen Kopfkissenbezug, krempelte das Hosenbein des vor Schmerz wimmernden Mannes hoch und legte ihm mit erstaunlichem Geschick einen Notverband an. »Ich war mal Sanitäter bei der Army, so was habe ich oft geübt, aber dies ist mein erster Ernstfall«, sagte er und bemühte sich um ein Lächeln.
Als die Fesselung des Fremden erledigt war, wies O’Brien Turner an, sich ans Fußende des Bettes zu setzen. Er selber trat jetzt ans Fenster, was Turner mit sorgenvoller Miene beobachtete. Dort verharrte O’Brien eine Weile und schaute in die Dunkelheit hinaus. Den Juwelier behielt er auch weiterhin im Auge. Dabei fiel sein Blick auf die Klebebandrolle, die um einiges dünner geworden wieder auf der Fensterbank lag. Schließlich drehte er sich um, nahm den Telefonhörer ab und betätigte fingerfertig die Wahltasten.
»Hier O’Brien. Kollege Adams? Aha, das ist gut! Habe hier zwei Festnahmen. Wieso? Ich und nicht zuständig? Nun, das erkläre ich Ihnen später. Ich bin hier im Landhaus von Richard Turner in Nairn. Wo? Gleich neben der großen Eiche am Ortseingang. Ich brauche dringend ein paar tüchtige Leute. Schicken Sie auch jemand von der Spurensicherung mit. Und auch einen Krankenwagen sowie den Notarzt. Wen? Leider den Kollegen Hastings. Und eine Schussverletzung haben wir auch noch. Mit Turner werde ich allein fertig, aber machen Sie trotzdem schnell.« Während er den Hörer wieder auflegte, bemerkte er zu seiner großen Erleichterung, dass sich Hastings wieder rührte.
Der Juwelier erhob sich vom Bett. »Was haben Sie vor? Was soll das ganze Theater?«, krächzte er gekränkt.
Paul O’Brien zog die Unterlippe hoch, wie immer, wenn er einen Tatverdächtigen im Visier hatte. Er stieß den Juwelier auf das Bett zurück. »Sie beide werden wohl ziemlich überrascht gewesen sein, als ich so aus dem Nichts auftauchte, nicht wahr?«, erkundigte er sich maliziös.
»Natürlich fühlte ich mich erleichtert, als Sie ins Zimmer hereinstürmten. Der Kerl dort wollte mich umbringen!« Er deutete voll Abscheu auf das Bett. Doch O’Brien fuhr unbeirrt fort:
»Hören Sie auf, Mr Turner, wir wollen jetzt nicht mehr um den heißen Brei herumreden! Das Klebeband hier« – er hob die Rolle wie eine Jagdtrophäe in die Höhe – »trägt das Logo der British Army. Mit dem gleichen Material wurden Sie in Ihrem Geschäft gefesselt. Vielleicht ein Zufall, vielleicht auch nicht. Unsere Leute werden das noch herausfinden. Und was ist das hier?« O’Brien hatte zuvor mit geschultem Blick beobachtet, wie Turner mit einer Schuhspitze etwas metallisch Glänzendes unter das Bett schob. Vorsichtig – seine Augen keine Sekunde lang von den Männern abwendend – zog er ein langes Messer unter dem Bett hervor. »Ein Hirschfänger, sieh einer an!«, rief er anerkennend. »Und Blut ist auch dran! Erzählen Sie mir nur nicht, dass Sie sich damit beim Rasieren verletzt haben!« Jetzt konnte er sich ein zynisches Grinsen nicht verkneifen. »Bestimmt werden Sie mir verraten, wie das Blut daran gekommen ist! Aber vielleicht ist das ja nur Marmelade!«, feixte er. Gleich darauf fuhr er Turner in schärferem Ton an. »Mann, so reden Sie schon!«, schrie er jetzt. Der Juwelier zuckte zusammen, sah zuerst zum Gefesselten hin, dann mit tränenfeuchten Augen zum Chief Inspector auf:
»Also, das war so: Gleich nach meinem Anruf bei der Polizei rannte ich zur Haustür hinunter, um sie abzusperren. Den Hirschfänger, der immer neben der Tür in dem Köcher steckt« – er deutete auf die leere Metallhülse an der Wand – »nahm ich mit. Aber der Typ dort unten war schneller als ich. Zum Glück war ich auf alles gefasst, denn in dem Augenblick, als er die Tür aufstieß, bohrte ich ihm schon das Messer zwischen die Rippen. Er fiel um und war sofort tot. Er müsste eigentlich noch neben der Haustür liegen. Das ist reine Notwehr gewesen, aber auch ein schwerer Schock für mich. Ich war danach fix und fertig und musste mich aufs Bett legen. Das dürfen Sie mir wohl glauben, Mister«
»Mein Name ist Paul O’Brien, ich bin Chief Inspector beim CID Inverness. Und glauben tu ich Ihnen gar nichts, Mr Turner. Es ist nämlich gar nicht möglich, von hier oben ein Gesicht dort unten zu erkennen. Nicht nur der Nebel, sondern auch die Zweige eines Strauchs verdecken jede Sicht zum Eingang. Ich bin mir daher sicher, dass Sie einen Ihrer beiden Komplizen erwartet hatten, um ihn umzubringen, weil Sie die Beute nicht durch drei teilen wollten. Um aber Notwehr geltend machen zu können, forderten Sie Polizeischutz an. Das hatten Sie wirklich raffiniert geplant. Ich muss Sie daher wegen des Verdachts des Mordes und der Mittäterschaft an einem Raubüberfall mit Todesfolge festnehmen. Bleiben Sie zunächst dort sitzen und verhalten sich ruhig, bis meine Kollegen eintreffen.«
Es dauerte eine halbe Stunde, bis Autotüren zuschlugen und das Blaulicht der Einsatzfahrzeuge tanzende Muster an die weißen Wände des Zimmers projizierte. Gleich darauf vernahm man die polternden Schritte der die Treppe hinauf eilenden Polizisten. Mit gezogenen Pistolen stürmten zwei Beamte in den Raum, steckten aber ihre Waffen wieder weg, nachdem sie sich davon überzeugt hatten, dass DCI O’Brien Herr der Lage war.
»Dort unten liegt ein Toter«, sagte einer der Polizisten. »In seiner Jackentasche fanden wir einen Reisepass und ein Flugticket.« Beides reichte er O’Brien, der sich die Papiere nur kurz besah und dann kopfnickend meinte:
»Sieh mal einer an, James Peacox! War der nicht zur Fahndung ausgeschrieben? Der war also Richard Turners Komplize! Und nach Rio sollte es gehen? Na ja, daraus dürfte wohl vorerst nichts werden!«
Turner erhob sich vom Bett und schrie: »Was sind das für Unterstellungen! Einen Mann mit diesem Namen kenne ich überhaupt nicht!«
»Halt die Klappe!«, konterte O’Brien und schob den Juwelier wieder auf seinen Platz zurück.
Inzwischen hatte sich Edward Hastings aufgerichtet, blieb aber noch neben der Tür am Boden sitzen. O’Brien hatte das gleich bemerkt. »Na, da ist er ja wieder, unser Held!« Wieder konnte er sich eine zynische Bemerkung nicht verkneifen. »Gut geschlafen? War wohl recht bequem auf dem Zöpfchen, nicht wahr?«
Der Sergeant war derartige Anspielungen gewohnt. »Danke für Ihre mitfühlende Nachfrage. Aber ich hab ’ne ganze Menge mitbekommen, Chef.« Hastings umfasste mit der linken Hand seinen Hinterkopf: »Ich wurde sogar Zeuge eines Telefonats, das Mr Turner mit diesem Mann dort führte.«
Er deutete auf das Bett. Dann gab er einen kurzen Bericht über das mitgehörte Gespräch. »Hinterher ist man immer schlauer! Ich hätte mir gleich denken können, dass es sich bei dem mit Dick angesprochenen Mann um Richard Turner handelt, denn schließlich ist ›Dick‹ die gebräuchliche Kurzform für Richard. Vermutlich wollte der Hausherr selber nach einem dreimaligen Lockruf – ohne den Verdacht eines Unbeteiligten zu erregen – das Gespräch annehmen. Er hatte wohl darauf gewartet und bestätigte dem Anrufer, dass jemand mausetot sei. Das dürfte wohl der Mann unten am Hauseingang sein.«
»Was sagen Sie nun, Mr Turner? Eindeutiger kann Ihre Komplizenschaft doch nicht bewiesen werden, oder?« Paul O’Brien trat mit grimmiger Miene vor den auf dem Bettrand sitzenden Juwelier und packte ihn an den Schultern.
»Das war Sam’s Idee. Ich will Ihnen gern alles erklären.« Turner wies hinter sich auf den gefesselten und leise vor sich hin jammernden Mann. »Sam Clark war mal einer meiner Verkäufer. Ich musste ihm vor einem Jahr kündigen, weil er auf eigene Rechnung gearbeitet hatte. Wohl aus Rache hat er mich einige Monate später dazu genötigt, bei dem Raubüberfall mitzumachen. Falls ich das ablehnte, wollte er meiner Frau und meinem Schwiegervater verraten, dass ich fremdgegangen war. Er hatte mich mit einer jungen Nutte in einem Sex-Club angetroffen. Na und? Was ist schon dabei? Hätte allerdings meine Sarah davon erfahren, bei ihrer maßlosen Eifersucht wäre es das endgültige Aus für unsere Ehe gewesen. Und Harold Thompson hätte mich natürlich achtkantig rausgeschmissen. Ich durfte ohnehin nur nach ständigem Drängen seiner Tochter in die Firma eintreten und hätte mir eine neue Existenz aufbauen müssen. Daher gönnte ich dem Geizkragen gern ein paar angstvolle Minuten und stimmte dem Überfall zu. Aber ich wollte wirklich nicht, dass dem alten Herrn etwas zustößt!«
»Dass ich nicht lache!«, tönte es nun vom Bett her. »Du elender Lump hast doch darauf gedrängt, dass wir den Alten umlegen, hast es dann schließlich selber erledigt. Ihr wart doch auf das Erbe scharf, du und deine schöne Sarah!« Sam richtete sich mühsam auf. Er schnaubte jetzt vor Wut:
»James Peacox und Richard Turner dienten einige Jahre bei der Army in derselben Sanitätskompanie. Allerdings waren sie nicht gerade das, was man gute Freunde nennt, denn James hat Dick mal ein Mädchen ausgespannt. Später verloren sie sich aus den Augen. Jedenfalls war Dick völlig überrascht, als ich ihm James als Partner für den Überfall vorstellte. James und ich gingen früher auf die gleiche Schule. Wir waren schon immer Kumpels und hatten schon so manches krumme Ding gedreht. Aber zum Glück sind wir immer heil davon gekommen und so planten wir gemeinsam die Aktion bei Thompson & Turner. Ich gebe ja zu, dass es meine Idee war und wir auf Dicks Mitwirkung bauten. Für den alten Thompson wäre das bestimmt kein Schaden geworden, seine Versicherung hätte ihm doch alles ersetzt. Aber Dick hatte James zugerufen ›Los schieß schon, mach ihn hin!‹ Ich habe das genau gehört. Als James zögerte, riss Dick ihm den Revolver aus der Hand und feuerte selber den tödlichen Schuss ab. Dann ließ er sich von mir fesseln. Seine Frau bemerkte vermutlich nichts von alldem, denn sie lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden.« Erschöpft machte Sam eine Atempause und fuhr dann mit einem Stoßseufzer fort: »Mit dem Tod von Harold Thompson haben wir nichts zu tun. Wir sind zwar Räuber, aber keine Mörder.«
Paul O’Brien hatte aufmerksam zugehört und bohrte nach: »Und was ist mit der Leiche hier vor der Haustür?«
»Turner bekam plötzlich Angst vor den Konsequenzen, denn die Polizei ist doch nicht dumm. Also wollte er einen Mitwisser weniger haben und schlug mir vor, halbe-halbe zu machen, falls ich mit der Beseitigung von James einverstanden wäre. Ehrlich gesagt, mir war das egal, ich wollte nichts anderes als meine eigene Haut retten. Dick lud daraufhin James für heute Nachmittag zu sich ein und wollte ihm den richtigen Empfang bereiten, wie er sich ausdrückte.«
»Soso! Und dann fragten Sie telefonisch nach, ob alles nach Plan verlaufen ist. Nun gut! Aber weshalb sind Sie nur wenig später hier aufgekreuzt?«
»Die Tür war unverschlossen, drinnen alles stockdunkel. Ich nahm an, dass Dick gleich nach meinem Telefonanruf James’ Leiche wegbrachte und inzwischen nach Inverness zurückkehrte. Ich wollte mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben, mir nur meinen und James’ Anteil an der Beute sichern und danach schnellstens abhauen. Ich schlich mich also nach oben, weil wir hier das Raubgut versteckten. Als ich im Dunkeln eine Gestalt in der Türfüllung stehen sah, erschrak ich natürlich. Ich dachte, es wäre Dick. Dem Kerl ist doch alles zuzutrauen und ich befürchtete, mir würde nun das gleiche Schicksal blühen wie kurz zuvor James. Ich gab ihm also mit der Pistole eins über den Schädel, als er sich nach etwas bückte. Leider traf es den Tölpel da unten!« Mitleidvoll betrachtete er den noch immer auf dem Boden sitzenden Hastings. »Und dann waren plötzlich Sie da!«
Richard Turner hatte zwar stillschweigend zugehört, aber man konnte ihm seine Erregung deutlich anmerken. Plötzlich sprang er auf und schrie Sam an: »Du hast mir das Ganze eingebrockt. Jawohl, wenn dieser Bulle nicht erschienen wäre, hätte ich auch dir das Messer in die Brust gestoßen!«
»Falls ich nicht früher abgedrückt hätte!«, ergänzte Sam unter hämischem Grinsen.
»Kaum, denn ich hatte alles dunkel gelassen, weil ich mir sicher war, dass du hier auftauchen würdest. Schließlich kennst du ja unser Versteck!«
»Schluss jetzt mit der Diskussion!«, rief O’Brien mit Kommandostimme, als zwei Sanitäter hereinkamen. Diese betteten Sam auf eine Tragbahre und schnallten ihn für den Weitertransport fest. Zuvor erlösten sie ihn von seinen Fesseln, was allerdings ein Fehler war. Denn als sie den Verletzten zwischen Bett und Fenster hindurch bugsierten, langte dieser sekundenschnell zum Boden und hielt gleich darauf einen Revolver in der Hand. Er hatte diese Waffe beim Auftauchen des Chief Inspectors fallen lassen. Aber O’Brien ließ den Mann nicht aus den Augen. Durch einen gut gezielten Schuss in dessen Unterarm konnte er weiteres Unglück verhindern. Der vor Schmerzen stöhnende Sam Clark wurde hinausgetragen, während ein Polizist Richard Turner Handschellen anlegte und den lauthals räsonierenden Mörder abführte.
Die komplette Diebesbeute konnte Paul O’Brien anschließend sicherstellen: Die Räuber hatten alles in einer Matratze versteckt.
In den darauffolgenden Tagen fand die kriminalistische Feinarbeit statt, wobei sich alle bisherigen Verdachtsmomente voll bestätigen sollten. Sarah Turner konnte allerdings nicht nachgewiesen werden, dass sie Kenntnis von dem geplanten Überfall hatte. Seit der Ermordung ihres Vaters führt sie nun sein Geschäft unter dem Firmennamen Jeweler Thompson Ltd weiter.
Wie sich herausstellte, stammte das Klebeband aus früheren Beständen der British Army. Vermutlich hatte Richard Turner eine Rolle davon mitgehen lassen, als er aus dem Sanitätsdienst entlassen wurde.
Den Revolver, mit dem Harold Thompson erschossen wurde, entdeckten die Fahnder erst später, und zwar in einem Pumpensumpf im Keller des Turnerschen Hauses in Inverness. Die Waffe war in Plastikfolie eingehüllt und vorher gründlich gesäubert worden, so dass keine Fingerabdrücke festzustellen waren. Richard Turner hatte allerdings auf der Innenseite der Folie DNA-Spuren hinterlassen, was ihn als Mörder seines Schwiegervaters identifizierte.
DS Hastings erholte sich schnell von den Folgen des K.-o.-Schlags, musste aber weiterhin die zynischen Bemerkungen seines Chefs erdulden.
Richard Turner wurde wegen zweifachen Mordes zu einer lebenslänglichen, sein Komplize Sam Clark wegen gemeinschaftlich begangenen schweren Raubes zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt.
Nach diesem so erfolgreich abgeschlossenen Fall konnte Paul O’Brien davon ausgehen, beim CID Inverness auch in Zukunft mit der Aufklärung ähnlicher Tatbestände betraut zu werden. Denn sogar in der hintersten Provinz werden Verbrechen verübt, deren Verfolgung dort kaum weniger gefahrvoll ist als in Metropolen wie London. Natürlich sollte ein Leben ohne Mord und Totschlag das einzig erstrebenswerte Ziel bleiben, auch für einen Kriminaler wie ihn. Weil jedoch die Realität nun einmal anders ist, wollte er auch seinen Beitrag zur Bekämpfung der überall ausufernden Kriminalität leisten. Und so sah er seiner beruflichen Zukunft hoffnungsvoll entgegen.
Doch dann wendet sich das Blatt:
>>>zurück zur Übersicht<<<
Erster Teil
1
Der Mordfall Thompson und seine rasche Aufklärung war lange Zeit das Tagesgespräch in Inverness. Paul O’Brien, der bis dahin eine Art Schattendasein im CID führte, sah sich plötzlich als Gegenstand öffentlichen Interesses. Das war ihm überhaupt nicht angenehm, denn er hasste jede Form übertriebener Publicity. Schließlich hatte er nichts als seinen Job getan. Allerdings brauchte er sich jetzt nicht mehr als Paria unter lauter schottischen Kollegen zu fühlen, die nur ungern einen Engländer unter sich duldeten, selbst wenn dieser nordirischer Abstammung war. Aber allein die Tatsache, dass er aus London nach hier strafversetzt wurde und einen ziemlich barschen Umgangston pflegte – und das noch in einem irisch gefärbten Dialekt – hatte ihm den Einstieg in sein neues Aufgabengebiet zunächst erschwert. Die meisten Invernessians, wie man die Bewohner dieser Stadt bezeichnete, sprechen nämlich ein vorzügliches Englisch. Angeblich hatten sie das von den Truppen Oliver Cromwells übernommen, welche die Stadt von 1652 bis 1662 besetzt hielten.
Einige Wochen nach der spektakulären Aufklärung des Mordfalls Thompson erhielt Paul O’Brien die Einladung zu einer Feierstunde im Saal des Rathauses. Anlass hierzu war die Ehrung einiger Persönlichkeiten der Stadt. So wollte das Polizeimusikkorps dem Abteilungsleiter für Kapitalverbrechen beim CID und O’Briens unmittelbarem Vorgesetzten, DSupt Gordon Bayne, mit einem Ständchen zum 50. Geburtstag gratulieren. Wie darüber hinaus gemunkelt wurde, sollte DCI O’Brien die Goldene Ehrenmedaille der Stadt Inverness für seinen Erfolg im Kampf gegen die Schwerstkriminalität verliehen werden.
Paul O’Brien war dieses ganze Theater total zuwider, wie er Detective Sergeant (DS) Hastings gegenüber äußerte. Er bemerkte außerdem die neidischen Bemerkungen seines Kollegen Detective Inspector (DI) Walter Adams, der gern selber den Mörder Richard Turner überführt hätte. Dann nämlich wäre ihm die Ehrenmedaille zugesprochen worden. Nach dessen Auffassung hatte O’Brien diesen Fall an sich gerissen. Andererseits bestand zwischen Detective Chief Inspector (DCI) Paul O’Brien und Detective Superintendent (DSupt) Gordon Bayne kein besonders gutes Verhältnis. Dieser schien seine Verdienste als einstiger Offizier der British Army durch militärisches Auftreten täglich unter Beweis stellen zu müssen. Um seinen damaligen Dienstrang zu demonstrieren, hatte er die Schulterklappen mit den drei Sternen eines Captains in einem Bilderrahmen an der Wand hinter seinem Schreibtisch zur Schau gestellt. Auch rein äußerlich präsentierte er sich durch einen wuchtigen, bereits leicht ergrauten Schnauzbart unter einer schmalen, leicht gebogenen Nase, wie schon während seiner aktiven Militärzeit.
Paul O’Brien dagegen hasste alles, was seinem Empfinden für Normalität entgegenstand. Dazu gehörten sowohl Glatzen, lange Haare oder Koteletten, aber auch jeglicher Bartwuchs. Noch nie hatte Paul O’Brien Bärte sowie Zigarrenrauch leiden können, weil ihn das an seinen verhassten Vater, den Metzger Alan O'Brien erinnerte, der ihn dazu ausersehen hatte, den elterlichen Betrieb in dem nordirischen Küstenstädtchen Larne später einmal zu übernehmen. Er war noch ein kleiner Junge, als er zuschauen musste, wie sein Vater lachend und mit einer unter seinem bauschigen Schnauzbart hervorlugenden Zigarre ein Kälbchen zur Schlachtbank führte. Anschließend drückte er – vor sich hin pfeifend – die Zigarrenglut auf dem Fell des zuckenden und sich vor Schmerzen aufbäumenden Tieres aus, hob die Axt, und mit einer fast belustigten Miene brachte er es durch einen gewaltigen Schlag auf die Stirn zu Fall. Und was danach an blutigem Gemetzel geschah, hatte sich fest in Pauls kindlichem Gemüt eingeprägt. Später wurde diese unmenschliche Art der Betäubung gesetzlich verboten, doch nicht weniger grausam erschien Paul der spitze Eisendorn, den der Vater mit einem wuchtigen Hammerschlag in den Schädel des Schlachttieres hineintrieb. Manchmal rutschte der Dorn ab, das Tier knickte brüllend ein und der Vorgang wiederholte sich an dem am Boden liegenden Opfer. Etwas humaner erschien Paul dann die Tötung mittels eines Bolzenschussgerätes, wobei er sich wegen des scharfen, metallischen Knalls jedesmal die Ohren zuhielt. Als sein Vater das bemerkt hatte, lachte er ihn aus. Doch vor der nächsten Schlachtung umwickelte er den Schussapparat mit einem dicken, feuchten Lappen, so dass nur ein schwächeres ›Klack‹ zu vernehmen war. Mit genau dieser Erfahrung sollte Paul O’Brien eines Tages einen der größten Kriminalfälle des Landes aufklären.
Aber Pauls Leben verlief völlig anders, als vom alten Alan O’Brien geplant war. Zwar hatte sich der junge Paul bereits den ruppigen und lauten Umgangston seines Vaters angeeignet. Aber gerade dadurch gelang es ihm, sich trotz seiner untersetzten, etwas fülligen Figur in seinem späteren Beruf mit Erfolg zu behaupten.
Die Erinnerung an den Vater wurde auch jetzt wieder wach, als er den Festsaal der Town Hall (Rathaus) betrat und von einer rotblonden, vollschlanken jüngeren Dame in dunkelblauem Kostüm an einen Platz in der vordersten Reihe geführt wurde. Etwas verwirrt starrte er auf den Schnauzbart seines Chefs, der ihn mit wohlwollendem Lächeln begrüßte und mit einladender Handbewegung auf den freien Stuhl neben ihm hinwies. Beide waren sich heute noch nicht begegnet und DSupt Gordon Bayne reichte Paul O’Brien lässig die Hand. Dann saßen beide schweigend nebeneinander, bis ein Murmeln durch die Sitzreihen ging und Klänge von Bagpipes (Dudelsacks) den Saal erfüllten, denn jetzt schritten zehn Piper (Dudelsackbläser) und drei Drummer (Trommler) ihren farbenprächtigen Kilts (Schottenröcke) nacheinander durch den Mittelgang nach vorne. Nachdem sich die Gruppe auf dem Podium aufgestellt hatte, spielte sie einige der bekanntesten schottischen Melodien, wonach die Gäste lang anhaltend applaudierten. Anschließend gab das Polizeimusikkorps eine Kostprobe seines Könnens. Nach flott gespielter, traditioneller Tanz- und Marschmusik trat endlich Lord Mayor (Oberbürgermeister) Robert Polson ans Rednerpult. Das Stadtoberhaupt rief nun einen Namen nach dem anderen auf, lobte jede einzelne auf die Bühne geholte Person für diese oder jene besondere Leistung, überreichte Urkunden und entließ die so geehrten Damen oder Herren mit gönnerhafter Gestik. Dann wandte sich sein Blick auf die erste Reihe, zuerst auf Paul O’Brien, dann aber auf DSupt Gordon Bayne. Der Lord Mayor räusperte sich kurz und begann endlich mit seiner Ansprache:
»Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste,
wir sind hier zusammengekommen, um einige Frauen und Männer aus unserer Stadt für besondere Leistungen zu ehren. Wie jedes Jahr will ich auch diesmal wieder eine Persönlichkeit besonders würdigen, die in uneigennütziger Weise und für die Sicherheit unserer Stadt ihr Leben aufs Spiel setzte. Sie alle haben von dem scheußlichen Verbrechen erfahren, das an dem Mitglied unseres Stadtrates, dem Juwelier Harold Thompson verübt wurde. Es ist Detective Superintendent Gordon Bayne vom hiesigen CID zu verdanken, dass er Thompsons Mörder so schnell und unter mutigem Einsatz seines Lebens zu fassen bekam. Dies war aber nur durch die effektive und straffe Führung seiner Mitarbeiter möglich gewesen. Die Stadt Inverness verleiht aus diesem Grund Gordon Bayne für besondere Verdienste die Goldene Ehrenmedaille der Stadt Inverness. Zusätzlich erhält er einen Gutschein für ein Urlaubswochenende zu Zweit im Holiday-Centre Aviemore. Aber ich möchte nicht versäumen, unserem tapferen Gordon Bayne auch zu seinem heutigen 50. Geburtstag zu gratulieren. (Tosender Beifall!) Ich bitte Sienun, lieber Superintendent, zu mirheraufzukommen, um die Auszeichnungen entgegenzunehmen.«
Paul O’Brien fühlte sich zunächst wie vor den Kopf gestoßen und schnaubte innerlich vor Wut. Was oben auf dem Podium ablief, nahm er nur noch mit halbem Interesse wahr. Erst als sich alle Gäste von ihren Plätzen erhoben, wurde ihm bewusst, dass volle Absicht dahintersteckte, seinen persönlichen Erfolg auf derart infame Weise zu konterkarieren.
Während sich unzählige Hände Gordon Bayne entgegenstreckten, um ihm zu seiner Ehrung zu gratulieren, rannte O’Brien zum Saalausgang, um den Ort dieser schamlosen Heuchelei zu verlassen.
Die gleiche Dame, die ihm anfangs seinen Platz zuwies, trat ihm vor der Tür entgegen, ein Tablett mit gefüllten Sektgläsern balancierend:
»Darf ich auch Ihnen ein Gläschen anbieten?«, fragte sie mit wohlklingender Stimme.
Paul O’Brien war gar nicht nach Sekt zu Mute, aber als er in das liebenswürdig fragende Gesicht der attraktiven Frau sah, konnte er das einfach nicht ablehnen.
»Vielen Dank! Aber nur weil Sie es sind«, gab er zur Antwort und nahm sich ein Glas.
»Aha, Sie sind also von der Presse«, meinte er, als er das Schild mit dem Logo des Inverness Report an ihrem Jackenrevers entdeckte. »Netter Name, Jennifer Symon! Aber warum muss die Mitarbeiterin einer Zeitung hier Plätze anweisen und Sektgläser halten? Bestimmt haben Sie etwas Wichtigeres zu tun.« Jetzt lachte er amüsiert.
»Da haben Sie recht, aber entschuldigen Sie mich bitte einen Moment!« Sie wandte sich von O’Brien ab, um vorbeigehenden Gästen Sekt anzubieten. Auch DSupt Gordon Bayne nahm sich ein Glas, musterte abwägend Paul O’Brien und die Serviererin, um gleich danach in der Menge unterzutauchen.
Inzwischen war das Tablett leer geworden und Jenny Symon stellte es auf einem Tischchen ab.
»Sie sind doch Chief Inspector O’Brien?«, fragte sie, wobei leichte Röte in ihr Gesicht stieg.
»Ach! Sie kennen mich?« fragte Paul O’Brien erstaunt.
»Nun ja, ich bin Lokalredakteurin beim Inverness Report und befasste mich eingehend mit dem Mordfall Thompson. Vielleicht haben Sie meinen Artikel mit der Überschrift ›Der Neue von Scotland Yard schlug zu‹ gelesen?« Sie sah ihn mit schelmischem Augenaufschlag an.
»Ja, natürlich, jetzt erinnere ich mich«, gab O’Brien nach kurzer Überlegung zu. »Alle Zeitungen berichteten über den Fall. Ich kann mich allerdings nicht mehr an jeden einzelnen Beitrag erinnern. Aber wie kommt denn eine Zeitungsredakteurin auf diesen Empfang, dazu noch als Servierdame und Platzanweiserin?«
Sie lachte. »Unser Chefredakteur ist ein Parteifreund des Lord Mayors und bat mich, wegen eines Krankheitsfalls bei dieser Veranstaltung auszuhelfen. Da mir ein kleiner Zusatzverdienst winkte, sagte ich gern zu. In dieser Rolle komme ich mir zwar etwas unbeholfen vor, obwohl man durchaus beides miteinander verbinden kann. Daher gleich meine Frage an den erfolgreichen Kriminalisten: Wieso eigentlich hat man nicht Ihnen die Goldene Ehrenmedaille und den Wochenendurlaub zuerkannt? Sie waren es doch, der den Mörder Richard Turner überführte und nicht dieser blasierte Ex-Offizier Bayne. Ich denke, das wird ein Nachspiel haben. Denen werde ich es noch geben!«
»Nein, lassen Sie das bitte!« O’Briens Augen funkelten und sein soeben noch freundlicher Gesichtausdruck verdüsterte sich. »Irgendwann kriegt auch der eins aufs Maul. Gordon Bayne wird mit dieser zweifelhaften Ehrung nicht auf Dauer glücklich sein. Zwar wünsche ich grundsätzlich niemandem etwas Schlechtes, doch für mich ist dieser Mann ab heute nichts weiter als ein Großmaul, das sich gern mit fremden Federn schmückt. Und ich bin gewiss nicht der Einzige, der so denkt. Ich lege persönlich zwar keinen besonderen Wert auf diesen ganzen Rummel, aber wenn schon, dann sollte es mit rechten Dingen zugehen. Hier werden doch nur privilegierte Personen geehrt, während es eine große Anzahl verdienter Bürger gibt, die – von der Öffentlichkeit völlig unbeachtet – ebenfalls beachtliche Leistungen vollbringen. Aber von denen spricht man nicht, schon gar nicht unser Lord Mayor und seine Parteifreunde, denn hinter allem stecken doch handfeste politische Interessen. Wie ich soeben erfahren musste, trat wieder einmal der jahrhundertealte Hass auf England zutage. Der bezieht sich übrigens auf jeden, der nicht schottischer Abstammung ist und es wagt, hier seinen Job zu machen, ob er nun Engländer ist oder Ire, wie ich zum Beispiel.«
»Sie sind Ire?«, fragte Jenny erstaunt. »Ich bin nämlich ein leidenschaftlicher Irland-Fan!«
»Das hört man gern. Allerdings stamme ich aus Nordirland, dem Küstenstädtchen Larne im Nordosten der Insel.«
»Und ich dachte schon, Sie kämen von einer der Hebriden-Inseln. Ihre gälisch gefärbte Aussprache kam mir so vertraut vor, ich bin nämlich auf Harris zu Hause, Dort sprechen die Leute nur gälisch, jedenfalls untereinander.«
»Wo meine Mutter herstammt, wird ebenfalls nur gälisch gesprochen. Ihre Wiege stand auf der kleinen Insel Coll, die liegt etwa acht Meilen westlich von Mull. Ich wusste gar nicht, dass man mir das noch anmerkt.«
Jenny schaute kurz auf ihre Armbanduhr. »Oh mein Gott! Ich muss ja noch in die Redaktion. Vielleicht könnten wir ein andermal etwas länger plaudern.« Sie reichte ihm ihre Visitenkarte und eilte davon.
Paul O’Brien schaute ihr noch eine Weile nach, als Sergeant Hastings auf ihn zukam. »Gehen wir jetzt, Chef?«
»Na gut, auf was warten wir noch!«, antwortete O’Brien nicht mehr ganz so missmutig.
Von Zeit zu Zeit betrachtete er das schmucke Kärtchen, das er unter die Klarsichtfolie der Schreibunterlage gesteckt hatte. Immer wieder musste er den Aufdruck lesen:
Jennifer Symon
Lokalredakteurin
Inverness Report
Aber sein Blick richtete sich hauptsächlich auf das kleine Porträt rechts neben dem in zierlichen Buchstaben gesetzten Text. Es zeigte eine junge Frau mit einem viel Wärme, Aufrichtigkeit und Humor ausstrahlenden Gesicht. Das war genau der Frauentyp, nach dem er bislang vergeblich Ausschau hielt. Seit jeher hatte er ein Faible für Mädchen mit rotblonden Haaren und dunkelgrünen Augen. Und diese hier zählte nicht zu den überall anzutreffenden, rappeldürren Frauen. Sie war vielmehr eine, die ihre weiblichen Rundungen nicht zu verbergen suchte. Bestimmt würden sie beide ein gutes Paar abgeben und auch figürlich gut zusammenpassen.
Seine Sturm-und Drang-Zeit hatte Paul längst hinter sich. Er war damals siebenunddreißig und ging völlig in seinem Beruf auf. Darum hielten sich seine Interessen am weiblichen Geschlecht auch in Grenzen. Er war in der Tat alles andere als ein Schürzenjäger, auch wenn hin und wieder hübsche Mädchen seine Aufmerksamkeit erregten.
Als er noch auf der Polizeiakademie war, kannte er viele reizvolle junge Damen, die sich gern von einem künftigen Polizisten verwöhnen ließen und sich auch sonst äußerst freizügig gaben. Dass er nur mittelmäßig groß war und ein wenig zur Dickleibigkeit neigte, störte keine von ihnen, denn in anderer Hinsicht hatte er einiges vorzuweisen. Aber nach jeder lustvollen Begegnung kehrte der nüchterne Polizeialltag umso frustrierender zurück.
Dann lernte er Anne Russel auf einer Geburtstagsparty kennen; sie war die Schwester eines seiner Kollegen. Zwischen ihm und der attraktiven jungen Frau entstand so etwas wie Liebe auf den ersten Blick und beide dachten an Heirat und gemeinsame Kinder. Schon nach kurzer Zeit bezogen sie eine gemeinsame Wohnung. Aber es dauerte nicht lange, da nervte ihn Anne mit ihrer Unzufriedenheit und ihren ewigen Nörgeleien. Wenn er nach einem anstrengenden Einsatz müde nach Hause kam, stand ihm nicht mehr der Sinn zum Fortgehen. Anne jedoch fühlte sich von ihrer Tätigkeit als Helferin in einer Tierarztpraxis nicht ausgefüllt und war regelrecht süchtig nach Kino- und Konzertbesuchen und wollte auf keiner Party fehlen. Doch Paul hatte kein Interesse an solcherlei Zeitvertreib, was Anne jedesmal zu Zornesausbrüchen verleitete. »Für deine kriminellen Weiber hast du Zeit, aber für mich nie!« Diese Worte musste er sich ständig anhören, sowie ihre Kritik an seiner schroffen Art, wie sie sich ausdrückte. In dieser Beziehung hatte Anne wohl recht gehabt.
Zu Beginn seiner Laufbahn war Paul dem obligatorischen Streifendienst zugeteilt gewesen, wo es nicht gerade zimperlich zuging. Seine Kollegen waren um einiges größer als er und um sich überall Gehör und Respekt zu verschaffen, musste er seiner Stimme eine gewisse Schärfe verleihen. Darum fiel es ihm auch schwer, im privaten Umgang den rechten Ton zu finden, was auch der Grund für ihre Trennung war. Paul bezog ein Eineinhalbzimmer-Appartement im Süden Londons. Endlich war er wieder ein freier Mann. Natürlich war es für ihn anfangs noch ungewohnt, wieder ganz auf sich allein gestellt zu sein. Besonders an den Abenden fühlte er sich einsam und empfand die Stille um ihn herum als bedrückend. Andererseits genoss er den Zustand von Unabhängigkeit, denn nun brauchte er auf niemanden mehr Rücksicht zu nehmen. Jetzt konnte er sich mit ganzer Leidenschaft seinem interessanten, aber auch ständig hohe Einsatzbereitschaft fordernden Beruf widmen, ohne sich für immer wieder vorkommende Verspätungen rechtfertigen zu müssen.
Dann kam die – seiner Meinung nach völlig ungerechtfertigte – Versetzung in die schottische Provinz. Beim CID Inverness erwarteten ihn zunächst ganz andere Aufgaben, als er es von Scotland Yard her gewohnt war. Es dauerte mehrere Wochen, bis er von einem Teil seiner neuen Kollegen akzeptiert wurde. Auch die Suche nach einer geeigneten Wohnung beschäftigte ihn eine Zeit lang und er musste zunächst mit einem einfach möblierten Zimmer in einer Fremdenpension vorlieb nehmen. Besuche durfte er hier nicht empfangen, darum fühlte er sich besonders in seiner Freizeit von anderen Menschen isoliert. Doch schließlich erwarb er von seinen Ersparnissen eine preiswerte Zweizimmerwohnung in der Anderson Street am River Ness. Nun konnte er wieder Ausschau nach einer passenden Frau halten. Er besuchte einschlägige Lokale und Diskotheken, aber die wechselnden, meist nur kurz andauernden Beziehungen befriedigten ihn nicht, denn eine seinen Vorstellungen entsprechende Partnerin befand sich nie darunter.
Seit seiner ersten Begegnung mit Jennifer Symon war ein knapper Monat vergangen. Immer wenn er ihre kleine Visitenkarte in die Hand nahm und die Blicke der jungen Frau auf sich gerichtet fühlte, geriet er ins Grübeln.
Auch jetzt erinnerte er sich wieder an den Tag, als ihn die Journalistin zum Platz neben DSupt Bayne geführt und später zu einem Glas Sekt überredet hatte. ›War der missratene Festakt im Rathaus eventuell ein Wink des Schicksals, habe ich vielleicht danach das große Los gezogen‹?, dachte er bei sich und verspürte den Wunsch, dieses reizende weibliche Wesen baldigst wiederzusehen. Nach einigem Zögern griff er zum Telefon und wählte die auf dem Kärtchen angegebene Nummer. Doch Miss Symon befand sich gerade in einer Besprechung. Als er gefragt wurde, ob er ihr eine Nachricht hinterlassen möchte, nannte er nur kurz seinen Namen und legte den Hörer wieder auf. Später ärgerte er sich über seine Zaghaftigkeit und nahm sich vor, es in den nächsten Tagen nochmals zu versuchen.
Aber es sollte ganz anders kommen.
>>>zurück zur Übersicht<<<
2
Als Paul O’Brien seinen Platz verließ, schaute ihm sein Chef noch eine ganze Weile hinterher. DSupt Gordon Bayne konnte den Mann von Scotland Yard nicht leiden, was allerdings auf Gegenseitigkeit beruhte. Vor allem passte es nicht in sein Weltbild, dass ausgerechnet ein Engländer, dazu noch ein relativ Neuer im Team, eine Belobigung erfahren sollte. Noch nie zuvor war einem Mitarbeiter des CID eine Auszeichnung wie die heutige verliehen worden. Darum hielt sich Bayne dafür prädestiniert, nach etlichen Dienstjahren eine besondere Ehrung verdient zu haben und baute dabei auf seine freundschaftlichen Beziehungen zu Staatsanwalt Henry Forster. Diesem war es schließlich gelungen, den ahnungslosen Lord Mayor Polson davon zu überzeugen, dass die Goldene Ehrenmedaille unbedingt an Superintendent Gordon Bayne, den Chef der Abteilung für Kapitalverbrechen beim CID, zu verleihen sei. Womit Bayne allerdings nie gerechnet hatte, war der Gutschein für einen Wochenende zu Zweit in einem der vornehmsten Hotels der östlichen Highlands. Das war eine echte Überraschung und er konnte es kaum erwarten, sich einmal in einer besonders exklusiven Atmosphäre nach Strich und Faden verwöhnen zu lassen.
Gordon Bayne war siebenundzwanzig gewesen, als er 1983 in den Falklandkrieg zwischen Argentinien und Großbritannien zog, den die damalige britische Premierministerin Margaret Thatcher heraufbeschworen hatte. Die Auswahl traf ihn, weil er recht gut Spanisch sprach; im Deutschen glänzte er ohnehin, da seine Mutter gebürtige Deutsche war. Mit neununddreißig Jahren war er dann als Captain aus der Army ausgeschieden.
Während sein Schulfreund Henry Forster das Jurastudium absolvierte, hatte er den militärischen Dienst vorgezogen, denn er war ein sportlicher Typ, der sich außerdem zum Kommandieren wie berufen fühlte. Trotzdem wurde ihm auf Dauer der soldatische Rummel zuwider, zumal er sich kaum Hoffnung auf eine weitere Beförderung zu machen brauchte. Den wahren Grund hierfür kannten freilich nur wenige außer ihm selber. Zu oft sprach er dem Whisky zu und war mehrmals alkoholisiert zum Dienst erschienen. Um einer unehrenhaften Entlassung aus der Army zuvorzukommen, hielt er Ausschau nach einem bequemeren und gleichzeitig besser bezahlten Job. Jetzt bewährte sich seine alte Freundschaft zu Henry Forster, dessen ältere Schwester Lucy mit dem Polizeipräsidenten von Edinburgh verheiratet war. Über diese Beziehung war ihm völlig unerwartet eine plötzlich frei gewordene Position bei der Kriminalpolizei in Inverness angeboten worden.
Als DSupt Bayne nach der Feier in der Town Hall von einer jungen Dame ein Glas Sekt angeboten wurde, blickte er nur flüchtig auf das Schildchen an dem Revers ihrer Jacke mit dem Logo des Inverness Report und fühlte sich leicht verunsichert. Ihm waren alle Presseleute unsympathisch, schon weil sie sich dazu berufen fühlten, überall herumzuschnüffeln und sich in Dinge einmischten, die sie besser kompetenteren Leuten überlassen sollten. Wenn diese Journalistin wenigstens schlank und mit einer aufreizenden Figur ausgestattet wäre, dann hätte er sie vielleicht in ein Gespräch verwickelt, wie er das bei ähnlichen Gelegenheiten immer mit gekonntem Charme praktizierte. Außerdem stand O’Brien neben ihr. ›Sollte der doch seinen Spaß mit dieser dummen Pute haben‹, dachte er gerade, als ihn Staatsanwalt Henry Forster zu sich winkte und mit verhaltener Stimme sagte:
»Hallo Gordon, mein Freund. Herzlichen Glückwunsch! Freut mich, dass unser Lord Mayor Polson mitgespielt hat. Na ja, schließlich gehört ihr beide dem MacKay-Clan an, da kann man sich schon mal einen Gefallen tun. Wo kämen wir denn hin, wenn jeder hergelaufene Engländer bereits nach seinem ersten Erfolg aufs Siegerpodest gehoben würde. Da kenne ich ganz andere Leute aus unserer schottischen Heimat. Einen wie dich zum Beispiel!«
Beide hielten sich jetzt den Mund vor Lachen zu und klopften sich gegenseitig auf die Schultern. Langsam schlenderten sie aus dem Saal und als sie sich verabschiedeten, bemerkte Henry die zusammengepressten Lippen seines Freundes.
»Du hast noch was auf dem Herzen, Also, was gibt’s?«. Gordon sah Henry aus übernächtigten Augen an, druckste noch eine Weile herum, bis er mit der Sprache herausrückte:
»Zu dumm! Mein Volvo ist ausgerechnet jetzt in der Werkstatt. Ich hatte mal wieder etwas zuviel getrunken, du weißt doch, wie das ist, wenn man mit einer tollen Frau ausgeht. Da bleibt es nicht bei einem oder zwei Gläschen. Na ja, danach stand mir so ein dämlicher Laternenpfahl im Weg.« Er lachte über die witzige Äußerung. »Der steht jetzt ein bisschen schief da, aber meinen Wagen hat es ganz schön erwischt. Es wird wohl einige Zeit dauern, bis ich ihn wiederbekomme.«
»Und so was erzählst du ausgerechnet einem Staatsanwalt? Du hast vielleicht Nerven! Na gut, zum einen Ohr rein, zum anderen raus, ich will nichts gehört haben. Aber was habe ich damit zu tun?« Forster sah seinen Freund missbilligend an.
»Ich brauche fürs Wochenende unbedingt einen Wagen, denn ich machte dieser Tage übers Internet die Bekanntschaft einer klasse Frau. Per E-Mail schickte sie mir ein tolles Foto von sich, du würdest Augen machen, wenn ich dir das zeigte! Leider wohnt sie ziemlich weit weg. Außerdem ist sie verheiratet, da läuft bei ihr zu Hause nichts. Du weißt ja, wie spießig unsere Hotels sind, schließlich bin ich hier bekannt wie ein bunter Hund. Da kam der Gutschein gerade recht. Und ausgerechnet jetzt musste mir das mit dem Auto passieren, wo ich mit meiner neuen Flamme ein paar aufregende Tage in Aviemore verbringen könnte.«
»Und Nächte!« Henry schmunzelte dabei, während Gordon verlegen grinste.
»Was dachtest du denn! Aber das Problem ist, dass sie leider kein Auto hat, das braucht ihr Mann. Und mit dem Busverkehr ist das auch so eine Sache, denn wir können ja nicht den ganzen Tag im Bett zubringen. Um es also kurz zu machen: Kannst du mir mal für ein paar Tage deinen Rover leihen?«
Henry Forster kniff die Lippen zusammen und zog die Augenbrauen hoch. »Du scheinst ja in großer Verlegenheit zu sein. Gut, ausnahmsweise kannst du den Wagen haben, es ist aber nicht mehr viel Sprit drin. Hol ihn dir heute Abend ab und behandle ihn besser als deinen.«^
3
Das an der Fernstraße A9 und am Fuße des Cairngorm Forest Park gelegene Gebirgsstädtchen Kingussie ist bekannt für sein Highland Folk Museum und den nur wenige Kilometer entfernt gelegenen Highland Wildlife Park. Das Museum befindet sich im Besitz der Universitäten Edinburgh, Glasgow, St. Andrew und Aberdeen. Es beherbergt eine Sammlung vielerlei Gegenstände, die sich einstmals bei den Bewohnern der Highlands und der Hebrideninseln in täglichem Gebrauch befanden. Im Außenbereich werden unter anderem historische Bauernkaten, eine Windmühle von der Insel Lewis sowie die früher üblichen landwirtschaftlichen Gerätschaften ausgestellt.
Die täglichen Besuchergruppen werden von einer jungen Frau durch die Museumsanlagen geführt. Für die 31-jährige Jane McNiven ist die Betätigung als Museumsführerin kaum mehr als ein leidiger Job und füllt sie keineswegs aus, zumal an regnerischen Tagen nur wenige oder gar keine Besucher kommen. Aber sie war froh, als ihr nach dem Tod des Vorgängers diese Tätigkeit angeboten wurde. Ihrem Mann Matthew war überraschend vom National Trust for Scotland (N.T.S) gekündigt worden, weil seine bisherige Tätigkeit als Forstaufseher inzwischen von den Angestellten des Wildparks übernommen wurde. Daher kam für beide Janes Zusatzverdienst zur rechten Zeit. Zum Glück fand Matthew schon bald eine neue Arbeit und konnte die Vertretung für eine große Versicherungsgesellschaft übernehmen. Das hatte zur Folge, dass er viel unterwegs war, denn sein Bezirk umfasste die Gebiete Caithness, Sutherland, Ross & Cromarty sowie Invernessshire.
Jane McNivens rein äußerliche Makel sind ihr leichter Silberblick und eine kleine Stupsnase. Aber ihre langen, dunkelblonden Haare, die schwungvoll geformten, vollen Lippen sowie das fein geschnittene Gesicht machen das wieder wett. Ihr sehr weiblicher und trotzdem mädchenhaft wirkender Körper hebt sich wohltuend von den oftmals groben Frauengestalten ländlicher Regionen ab. Obwohl sich Jane selber ziemlich hässlich findet, ist sie sich andererseits durchaus ihrer erotischen Ausstrahlung und der entsprechend stimulierenden Wirkung auf Männer bewusst.
Aber eines Tages stellt sie zu ihrem Leidwesen fest, dass ihr Mann sie betrügt. Als sie nämlich sein nach langer Reise verschwitztes Tweed-Jackett in die Reinigung geben wollte, entdeckte sie in einer der Taschen ein angebrochenes Päckchen Präservative. Bei ihr benötigte er so etwas nicht, denn sie kann aufgrund einer früheren Fehlgeburt keine Kinder mehr bekommen. Und als sie bald darauf auf der Rückbank seines Autos verräterische Flecken entdeckt, war es aus mit der Liebe. Endlich wurde ihr klar, warum Matthew schon seit geraumer Zeit nicht mehr mit ihr schlafen wollte und stets große Müdigkeit vortäuschte, wenn sie sich nach etwas Zärtlichkeit sehnte. ›Was können ihm wohl andere Weiber bieten, was ich nicht kann‹? Diese Frage ging ihr immer wieder durch den Kopf. Natürlich blieb ihr nicht verborgen, dass sie ein Blickfang für Männer aller Alterstufen war und registrierte mit Genugtuung die bewundernden oder lüsternen Blicke, die man ihr überall nachwarf. Darum konnte sie auch die Untreue ihres Mannes nicht begreifen, den sie auf einer Fährenüberfahrt vom Hafenstädtchen Mallaig zur Insel Skye kennenlernte und in den sie sich sofort verliebte. Seinetwegen hatte sie ihr ArchäologieStudium in Edinburgh abgebrochen, ihn kurz darauf geheiratet und ist Matthew in die ›Wildnis‹, wie sie sich ausdrückte, nach Kingussie gefolgt. Schon ein Jahr darauf erlitt sie eine Fehlgeburt, was zur Folge hatte, dass Matthews Interesse an ihr allmählich nachließ. Das wollte sie nicht länger erdulden und trug sich mit dem Gedanken an eine Scheidung.
›Was Matthew kann, das kann ich auch‹. Unter diesem Motto begann Jane, sich nach einer neuen Liebesbeziehung umzusehen. Allerdings erwies es sich als problematisch, in Kingussie oder der näheren Umgebung einen Freund zu finden, denn fast alle hier lebenden Männer waren entweder verheiratet oder kamen aus anderen Gründen nicht in Betracht. Es blieben also nur die Touristen, die in den Sommermonaten von den aus Edinburgh oder Glasgow eintreffenden Bussen vor den Hotels oder regionalen Sehenswürdigkeiten ausgespuckt wurden. Aber unter den Gruppen, die sie durch das Highland Folk Museum führte, befanden sich immer nur Männer im Rentenalter, leider nie jüngere. Ihre Schulfreundin Grace Baird riet ihr, es doch einmal im Internet zu versuchen. Dort würde sie mit ziemlicher Sicherheit fündig werden. Diesen wohlgemeinten Rat setzte sie daraufhin in die Tat um.
Wenn Matthew von seinen Reisen zurückkehrte, hatte er immer viele Schreibarbeiten zu erledigen und legte sich zu diesem Zweck einen Computer zu. Er lehnte es jedoch strikt ab, Jane in die Geheimnisse eines PC’s einzuweisen, weil er befürchtete, sie könnte versehentlich wichtige Dateien löschen. Außerdem benutzte er den PC dazu, um in Internet-Chats zu surfen oder E-Mails an wechselnde Geliebte zu senden. Als Matthew wieder einmal auf Reisen war, lud Jane ihre Freundin zu sich ein, um von ihr mit der Bedienung des Computers vertraut gemacht zu werden. Grace war an der Rezeption des The Star Hotel in Kingussie beschäftigt und hatte jahrelange Erfahrung mit der Arbeit am Computer. Daher konnte sie Jane fachmännisch erklären, wie man ins Internet gelangt und anschließend wieder alle verräterischen Spuren zu den ausgewählten Seiten löschen konnte. Denn Matthew durfte von ihren heimlichen Aktivitäten nichts erfahren.
Jane zeigte sich begeistert über dieses für sie neuartige Medium. Schon bald waren der PC und das Internet mit den vielfältigen Möglichkeiten die einzige Abwechselung an den sonst recht eintönigen Abenden. Aber sie scheute sich immer noch davor, sich in einen der so genannten Chats zu begeben.
»Ist doch nichts dabei. Klicke einfach auf den Link »www.lovemechat.uk«, hatte ihr Grace geraten. »Denn da surfen hunderte junger Männer und es wäre doch gelacht, wenn nicht einer für dich dabei wäre.«
Jane legte sich auf Graces Rat den Nicknamen ›butterfly‹ zu und loggte sich mehrmals in diesen Chatroom ein. Dort erschienen Surfer unter den seltsamsten Decknamen, wobei nicht zu erkennen war, ob es sich um Männer oder Frauen handelte. Von den Inhalten der hier übermittelten Botschaften war sie allerdings ziemlich enttäuscht, denn zu mehr als primitiven Sprüchen war anscheinend keiner der Teilnehmer in der Lage. Gerade als sie den Chatroom wieder verlassen wollte, loggte sich jemand als ›Mr. Honest‹ ein. Ob das wohl jemand für mich sein könnte?, fragte sie sich, fasste all ihren Mut zusammen und schickte an die E-Mail-Adresse dieses Teilnehmers ein Telegramm. Das war der Beginn einer nur kurzen, allerdings seltsamen Beziehung.
Der Fremde gab sich als Oliver Robinson zu erkennen. Er sei der Inhaber einer Whisky-Destillerie in einer kleinen Ortschaft östlich von Inverness und würde sich über eine persönliche Begegnung mit Madame Butterfly, wie er scherzhaft schrieb, sehr freuen. Er suche eine Freundin zum plaudern, ausgehen, gemeinsam essen gehen, aber auch für romantische, zärtliche Zweisamkeit. Dann sandte er Jane per E-Mail ein Porträtfoto, von dem sie sehr angetan war und es gleich an ihre Freundin Grace weiterleitete. Es stellte einen Mann um die Mitte Vierzig dar mit einem respektablen, bereits ergrauten Schnauzbart unter einer schmalen, aristokratisch gebogenen Nase. Sein Nickname Mr. Honest imponierte Jane, anscheinend wollte Oliver Robinson damit ausdrücken, dass er besonderen Wert auf Ehrenhaftigkeit legte. Sein Gesichtsausdruck ließ auf einen humorvollen Mann mit Lebenserfahrung schließen und Jane konnte sich vorstellen, mit ihm eine Liebesbeziehung einzugehen. Die Aussicht auf lustvolle Intimitäten nach jahrelanger Enthaltsamkeit hatte durchaus etwas Verlockendes an sich.
Grace hatte ihr zu dem Erfolg gratuliert und gemeint »Das ist ein toller Mann, Jane, den solltest du dir mal näher ansehen«.
Oliver Robinson erbat nun seinerseits ein Foto von Jane, das sie ihm mit Hilfe ihrer Freundin Grace bald zu übermitteln versprach. »Schicke ihm ein Ganzbild von dir, am besten gleich ein Nacktfoto«, empfahl ihr Grace. »Auf so was sind doch die Männer scharf, die anderen kleinen Mängel fallen denen dann nicht mehr auf. Sieh mich doch an! Meinst du ich weiß nicht, dass ich keine Schönheit bin? Mit meinen widerborstigen Haaren und den vielen Sommersprossen? Aber das macht mein knackiger Hintern wieder dreifach wett. Und du besitzt doch wirklich eine tolle Figur!«
Grace erstellte mit ihrem Smartphone ein Foto von Jane, in welchem deren weiblichen Reize voll zur Geltung kamen. Dieses Bild wurde Oliver gemailt, der von Janes erotischer Ausstrahlung fasziniert war und es kaum erwarten konnte, sie persönlich kennenzulernen. Er bat um ihre Telefonnummer, die sie ihm nach einigem Zögern verriet. Als er sich kurz darauf telefonisch meldete, war sie angetan von seiner sonoren Stimme und seiner humorvollen Ausdrucksweise. ›In den könnte ich mich schon verlieben‹, dachte sie bei sich und verabredete sich mit ihm für den darauffolgenden, dienstfreien Samstag.
Erwartungsvoll stand Jane am Fenster und schaute auf die Straße. »Ich fahre einen silbergrauen Rover«, hatte Oliver Robinson angekündigt. Pünktlich zur vereinbarten Zeit hielt eine elegante Limousine direkt vor ihrer Haustür, der ein sportlich gekleideter, groß gewachsener Herr entstieg. Jane erkannte in ihm gleich den Mann aus dem Internetfoto. Sie war ziemlich aufgeregt, als sie ihm entgegenging, und entsprechend steif und förmlich fiel die Begrüßung aus.
»Lassen Sie uns nur rasch wegfahren von hier«, sagte Jane. »Die Leute ringsum sind schrecklich neugierig und werden sich über uns die Köpfe zerbrechen.« Oliver nickte zustimmend und dann fuhren sie einige Kilometer aus dem Ort hinaus auf einen Parkplatz.
»Was haben Sie denn in dieser gottverlassenen Gegend verloren?«, erkundigte sich Jane, um eine Unterhaltung in Gang zu bringen.
»Ich halte mich nur dieses eine Wochenende in Aviemore auf, mache hier ein bisschen Urlaub, das musste mal wieder sein. Ich wohne derzeit in einem der feinsten Hotels, im The Old Highlander. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen nachher mein Appartement zeigen.«
»Warum nicht? Aber vorher würde ich Sie gerne durch das Volksmuseum führen«, bestimmte Jane. »Und falls es Sie interessiert, könnten wir danach einen kurzen Ausflug in den nahegelegenen Wildpark machen.«
Noch nie hatte Jane einen Besucher durch das Museum geführt, der sich fast jedes Exponat eingehend erklären ließ. Immer wieder zeigte sich Mr Robinson beeindruckt von den aus vergangenen Zeiten stammenden, zum Teil recht primitiven, abgenutzten Werkzeugen, landwirtschaftlichen Gerätschaften, grob gearbeiteten Webstühlen, Bauernmöbeln, Haushaltsgegenständen und einfachen Musikinstrumenten. Jane war mächtig stolz, die Bekanntschaft eines so imposanten, gebildeten Mannes gemacht zu haben, mit dem sie nicht nur zwanglos plaudern konnte, sondern der sich auch für ihre Arbeit als Museumsführerin interessierte. ›Den lasse ich mir nicht entgehen, und was Matthew kann, das kann ich schon lange‹