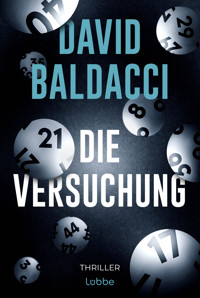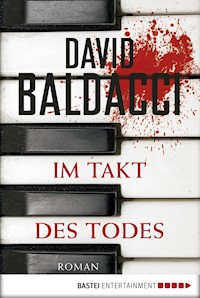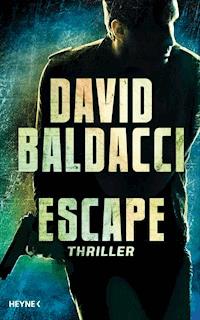9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zwei brisante Thriller von David Baldacci in einem eBook.
Die Wächter
Er ist einer der exklusivsten Clubs der Welt. Er existiert am Rande von Washington, D.C., hat keine Macht und besteht aus nur vier Mitgliedern. Ihr Ziel ist es, die Wahrheit zu finden. Doch dann werden die selbst ernannten Wächter Zeugen eines Mordes. Die Verschwörung, von der sie seit Langem ahnen, ist real - und sie bedroht das Weiße Haus, die Nation und die ganze Welt. Die Einzigen, die das wahre Ausmaß erahnen, sind eine junge FBI-Agentin, ein altgedienter Secret-Service-Mann und die vier Mitglieder des Camel Clubs-
Die Sammler
Der Sprecher des Repräsentantenhauses in Washington wird Opfer eines Anschlags. Als kurz darauf ein hochrangiger Mitarbeiter der Kongressbibliothek tot aufgefunden wird, ist für Oliver Stone und den Camel Club schnell klar: Diese beiden Morde müssen etwas miteinander zu tun haben. Was hat es mit dem wertvollen Buch auf sich, das der tote Bibliothekar sein Leben lang gehütet hatte und das nun verschwunden ist? Steht es in Zusammenhang mit den Staatsgeheimnissen, mit denen ein Unbekannter in großem Stil handelt? In ihrem zweiten spannenden Fall riskieren die Mitglieder des Camel Club wieder alles, um die Machenschaften in höchsten Regierungskreisen aufzudecken-
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1328
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
INHALT
Über dieses Buch
Zwei brisante Thriller von David Baldacci in einem eBook.
Die Wächter
Er ist einer der exklusivsten Clubs der Welt. Er existiert am Rande von Washington, D.C., hat keine Macht und besteht aus nur vier Mitgliedern. Ihr Ziel ist es, die Wahrheit zu finden. Doch dann werden die selbst ernannten Wächter Zeugen eines Mordes. Die Verschwörung, von der sie seit Langem ahnen, ist real - und sie bedroht das Weiße Haus, die Nation und die ganze Welt. Die Einzigen, die das wahre Ausmaß erahnen, sind eine junge FBI-Agentin, ein altgedienter Secret-Service-Mann und die vier Mitglieder des Camel Clubs …
Die Sammler
Der Sprecher des Repräsentantenhauses in Washington wird Opfer eines Anschlags. Als kurz darauf ein hochrangiger Mitarbeiter der Kongressbibliothek tot aufgefunden wird, ist für Oliver Stone und den Camel Club schnell klar: Diese beiden Morde müssen etwas miteinander zu tun haben. Was hat es mit dem wertvollen Buch auf sich, das der tote Bibliothekar sein Leben lang gehütet hatte und das nun verschwunden ist? Steht es in Zusammenhang mit den Staatsgeheimnissen, mit denen ein Unbekannter in großem Stil handelt? In ihrem zweiten spannenden Fall riskieren die Mitglieder des Camel Club wieder alles, um die Machenschaften in höchsten Regierungskreisen aufzudecken …
Über den Autor
David Baldacci wurde 1960 in Virginia geboren, wo er heute lebt. Er wuchs in Richmond auf und studierte Politikwissenschaft an der Virginia Commonwealth University (B. A.) und Jura an der University of Virginia. Er praktizierte neun Jahre lang als Anwalt in Washington, D.C., sowohl als Strafverteidiger als auch als Wirtschaftsjurist.
Von David Baldacci wurden bislang 29 Romane in deutscher Sprache veröffentlicht. Seine Werke erschienen auch in Zeitungen und Zeitschriften wie USA Today Magazine und Washington Post (USA), Tatler Magazine und New Statesman (Großbritannien), Panorama (Italien) und Welt am Sonntag (Deutschland). Außerdem hat er verschiedene Drehbücher fürs Fernsehen geschrieben.
David Baldacci ist verheiratet und hat zwei Kinder: Tochter Spencer und Sohn Collin. Er lebt mit seiner Familie in Virginia, nahe Washington, D.C.
DAVID BALDACCI
DIE WÄCHTER
DIE SAMMLER
Aus dem Amerikanischen von Uwe Anton
BASTEI ENTERTAINMENT
Digitale Originalausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgaben:
Copyright © 2005 (»The Camel Club«)und Copyright © 2006 (»The Collectors«) by Columbus Rose, Ltd.
Für die deutschsprachigen Ausgaben:
Copyright © 2007 (»Die Wächter«), © 2008 (»Die Sammler«) by Bastei Lübbe AG, Köln
Für diese Ausgabe: Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Esther Madaler
Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Orhan Cam | A and Rob
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-3867-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
DAVID BALDACCI
DIE WÄCHTER
Roman
Aus dem Amerikanischen von Uwe Anton
Dieser Roman ist den Männern und Frauen des United States Secret Service gewidmet und Larry Kirshbaum, einem großartigen Verleger und wundervollen Freund.
PROLOG
Umhüllt vom sanften Dunkel, das über dem ländlichen Virginia lag, glitt der Chevy Suburban über die Straße. Der einundvierzigjährige Adnan al-Rimi saß am Steuer und konzentrierte sich auf die kurvenreiche Strecke. Hier gab es viel Wild, und Adnan hatte keine Lust, plötzlich das blutige Geweih eines Hirschs durch die Windschutzscheibe krachen zu sehen. Adnan hatte es überhaupt satt, ständig attackiert zu werden. Er nahm seine behandschuhte Faust vom Lenkrad und tastete nach der Pistole, die unter seinem Jackett im Halfter steckte. Für ihn war die Waffe nicht bloß eine Beruhigung, sie war eine Notwendigkeit.
Auf der Rückbank saßen zwei seiner Begleiter. Der eine, der gerade munter in ein Handy plapperte, war Mohammed al-Zawahiri, ein Iraner, der kurz vor den Terroranschlägen des 11. September 2001 in die USA eingereist war. Neben ihm saß ein Afghane namens Gul Khan, der sich erst seit wenigen Monaten in den Vereinigten Staaten aufhielt. Khan war ein muskulöser Hüne mit kahlrasiertem Schädel. Er trug eine Tarnjacke und überprüfte soeben mit geschickten Fingern seine Maschinenpistole, schob das Magazin in den Ladeschacht und stellte die Waffe auf Zwei-Schuss-Feuerstöße ein. Regentropfen prasselten gegen die Scheiben. Khan beobachtete müßig, wie sie am Seitenfenster hinunterrannen.
»Nette Gegend«, sagte er auf Paschto, ein Dialekt, den Adnan nur mit Mühe verstand. »In meiner Heimat verrotten die Kadaver russischer Panzer auf den Äckern.« Mit tiefer Befriedigung fügte er hinzu: »Und massenhaft amerikanische Kadaver. Die Bauern pflügen einfach um sie herum.«
Adnan blickte in den Innenspiegel. Er fühlte sich nicht wohl bei dem Gedanken, dass hinter ihm ein Mann mit Maschinenpistole saß, mochte er auch islamischer Glaubensbruder sein. Ebenso wenig traute er Mohammed, dem Iraner, über den Weg. Adnan-al Rimi war in Saudi-Arabien geboren, aber schon als Junge in den Irak ausgewandert. Er hatte in dem grauenvollen Krieg zwischen dem Irak und dem Iran gekämpft und hegte noch heute eine heftige Abneigung gegen den Iran. Und Mohammed al-Zawahiri war Perser, kein Araber, was Adnans Misstrauen noch tiefer machte.
Mohammed beendete das Telefongespräch, wischte einen Dreckspritzer von seinen original amerikanischen Cowboystiefeln, warf einen Blick auf seine teure Armbanduhr, lehnte sich zurück und zündete sich eine Zigarette an. Er sagte etwas auf Farsi, und Khan lachte. Der Atem des Afghanen roch intensiv nach Zwiebeln.
Adnan packte das Lenkrad fester. Es behagte ihm nicht, dass der Iraner mit ernsten Angelegenheiten so schnoddrig umging.
Sekunden später hörte Adnan ein Geräusch und blickte zum Seitenfenster hinaus. Auch Mohammed hatte das Geräusch gehört. Er ließ die Scheibe herunter, steckte den Kopf ins Freie und blickte zum bewölkten Himmel hinauf. Als er rote Lichter blinken sah, rief er Adnan eine Anweisung zu. Adnan gab Gas. Die beiden Männer auf der Rückbank schnallten sich an. Der Chevy jagte über die gewundene Landstraße, wobei Adnan einige Kurven so eng nahm, dass die Männer auf der Rückbank sich krampfhaft an den Haltegriffen festhalten mussten.
Doch kein Auto der Welt konnte auf einer solch kurvigen Strecke einem Hubschrauber entkommen.
Mohammed erteilte Adnan auf Farsi den Befehl, den Wagen unter eine Baumgruppe zu lenken, um dort abzuwarten, ob der Helikopter weiterflog. »Vielleicht hat es einen Unfall gegeben«, sagte er und blieb beim Farsi. »Könnte es ein Rettungshubschrauber sein?«
Adnan zuckte die Achseln. Er beherrschte Farsi nicht allzu gut, sodass er die Nuancen dieser Sprache nicht immer erfasste. Doch man musste kein Linguist sein, um die Furcht in Mohammeds Stimme zu bemerken. Adnan lenkte den Wagen unter eine Baumgruppe und hielt. Die Männer stiegen aus und duckten sich neben das Fahrzeug. Khan richtete die Maschinenpistole gen Himmel. Adnan zückte ebenfalls die Waffe. Mohammed behielt lediglich das Handy in der Faust und blickte unruhig nach oben. Einen Augenblick hatte es den Anschein, als wäre der Hubschrauber verschwunden; dann aber fiel direkt über den Männern der Lichtstrahl eines Suchscheinwerfers durch das Blätterdach.
»Scheiße!«, stieß Mohammed auf Englisch hervor. Er nickte Adnan zu und gab ihm damit zu verstehen, er solle die Lage genauer prüfen.
Geduckt lief der Iraker zum Rand der Baumgruppe und spähte zum Himmel. Der Hubschrauber schwebte zwanzig Meter über den Wipfeln. Adnan kehrte zu seinen Gefährten zurück und meldete seine Beobachtung. »Möglicherweise suchen sie einen Landeplatz«, endete er.
»Haben wir ein Raketenabschussgerät im Wagen?«, fragte Mohammed nervös. Er war es gewöhnt, bei solchen Einsätzen der Lenker und Denker zu sein, nicht aber, den Frontsoldaten abzugeben, der das Töten erledigte und dabei oft selbst ums Leben kam.
Adnan schüttelte den Kopf. »Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir heute Nacht eins brauchen könnten.«
»Scheiße«, wiederholte Mohammed und lauschte angestrengt. »Hört ihr das auch? Ich glaube, sie landen.« Der Abwind der Rotoren ließ die Baumwipfel schwanken.
Adnan nickte seinen Begleitern zu. »Das ist ein Hubschrauber mit nur zwei Mann Besatzung. Wir sind zu dritt.« Er richtete den Blick auf den Anführer. »Nimm deine Waffe, Mohammed«, sagte er mit fester Stimme. »Wir gehen nicht kampflos in den Tod, sondern nehmen die Amerikaner mit.«
»Dummkopf«, sagte Mohammed schroff. »Die haben längst andere verständigt. Die nageln uns hier fest, bis Unterstützung kommt.«
»Unsere Ausweise sind erstklassig«, entgegnete Adnan. »Die besten Fälschungen, die man für Geld kaufen kann.«
Der Iraner sah ihn an, als hätte Adnan den Verstand verloren. »Wir sind bewaffnete Ausländer mitten zwischen den Schweinezüchtern Virginias. Wenn die meine Fingerabdrücke nehmen, wissen sie binnen Sekunden, wer ich bin. Wir stecken in der Falle.« Er verzog das Gesicht. »Wie konnte es so weit kommen?«
Adnan zeigte auf die Hand des Iraners. »Vielleicht, weil du andauernd mit dem Handy telefonierst. Du weißt doch, dass man die Dinger anpeilen kann. Ich hatte dich gewarnt.«
»Allahs Wille wird geschehen«, sagte Gul Khan und stellte die Maschinenpistole auf Dauerfeuer.
Ungläubig starrte Mohammed ihn an. »Wenn wir abgefangen werden, können wir unsere Pläne vergessen. Glaubst du, das ist Gottes Wille?« Er wies mit bebendem Finger in die rauschenden Baumwipfel. »Ich will«, sagte er energisch, »dass ihr mir die Amerikaner vom Leib haltet, wenn ich mich absetze. Knapp einen Kilometer westlich von hier ist eine Landstraße. Ich kann Marwan anrufen, dass er mich dort mit dem anderen Wagen abholt. Aber ihr müsst mir den Rücken freihalten.«
Mürrisch musterte Adnan den Anführer. An seiner Miene ließ sich ablesen, dass er jetzt ein Äquivalent für den Ausdruck »gequirlte Scheiße« benutzt hätte, gäbe es ihn in seiner Muttersprache.
»Also lenkt sie von mir ab. Unsere Sache verlangt dieses Opfer von euch!«, rief Mohammed und machte Anstalten, sich zu entfernen.
»Wenn wir sterben müssen, während du entkommst, gib mir wenigstens deine Waffe«, sagte Adnan. »Du wirst sie ja nicht brauchen.«
Der Iraner zog die Pistole und warf sie Adnan zu.
Khan, der bullige Afghane, wandte sich derweil in Richtung des Hubschraubers und lächelte. »Ich habe eine Idee, Adnan«, rief er über die Schulter. »Wir schießen in die Heckrotoren, bevor sie landen. Das hat sich in meiner Heimat gut bewährt. Sobald die Hubschrauber aufschlagen, bricht es ihnen das Genick.«
Die Kugel, die Khan traf, brach ironischerweise ihm das Genick. Der hoch gewachsene Afghane schlug zu Boden, als hätte jemand ihm die Beine weggetreten.
Adnan schwenkte die Pistole von seinem ersten Opfer fort und zielte auf Mohammed, den dieser offensichtliche Verrat zur panischen Flucht trieb. Doch er war kein Sprinter, und die Cowboystiefel, denen seine Vorliebe gehörte, behinderten ihn zusätzlich. Als er über einen morschen Baumstumpf stolperte, holte Adnan ihn ein.
Mohammed starrte seinen Gefährten an, der nun die Pistole auf ihn richtete. Einem Schwall von Beleidigungen auf Farsi folgten flehentliche Bitten in abgehacktem Arabisch; dann verlegte Mohammed sich aufs Englische. »Adnan, bitte… warum? Warum?«
»Du handelst mit Drogen, um mit dem Geld unsere Sache zu fördern, behauptest du«, sagte Adnan auf Arabisch. »Aber du verbringst mehr Zeit damit, dir affige Cowboystiefel und teure Juwelen zu kaufen, als du für die Sache des Islam aufwendest. Du bist vom rechten Weg abgekommen. Du bist fast schon Amerikaner geworden. Aber das ist nicht der Grund, weshalb du jetzt sterben musst.«
»Dann sag mir den Grund!«, schrie der Iraner.
»Dein Tod ist dein Opfer für unsere Sache.« Adnan lächelte nicht, doch in seinen Augen spiegelte sich Triumph. Er tötete Mohammed mit einem aufgesetzten Schuss in die linke Schläfe. Dann eilte er zu der Lichtung, auf der inzwischen der Hubschrauber gelandet war, dessen Luke sich in diesem Augenblick öffnete.
Adnan hatte gelogen. In Wirklichkeit bot der Helikopter Platz für vier Personen. Zwei düster blickende Männer stiegen aus und kamen zu Adnan. Sie trugen einen großen Gegenstand zwischen sich. Nachdem Adnan sich eine Flinte aus dem Chevy Suburban geholt hatte, führte er die Ankömmlinge zu Mohammeds Leichnam.
Der Gegenstand, den die Männer mit sich trugen, war ein Leichensack. Sie zogen den Reißverschluss auf. In dem Sack befand sich ein Mann, der bemerkenswerte Ähnlichkeit mit Adnan besaß und gleichartige Kleidung trug. Der Mann atmete, war nur bewusstlos. In der Nähe des toten Iraners lehnten die Männer ihn in Sitzhaltung an einen Baumstamm. Adnan reichte einem der Fremden seine Brieftasche, der sie dem Bewusstlosen in die Innentasche des Jacketts schob. Der andere Mann nahm von Adnan die Flinte entgegen, drückte sie Mohammed in die leblosen Hände, richtete den Lauf auf den Bewusstlosen und jagte ihm eine Kugel in den Kopf, wobei dem Mann ein Teil des Gesichts weggerissen wurde. Binnen eines Lidschlags wurde er vom Lebenden zur Leiche. In solchen Dingen war Adnan Experte, wenn auch nicht aus freien Stücken. Wer außer einem Irren könnte sich für eine solche Berufung entscheiden?
Einen Moment später eilten Adnan und die beiden Männer zum Hubschrauber und stiegen ein. Sofort hob der Pilot ab. Weder die Rumpfseiten noch das Heck des Helikopters wiesen eine Kennzeichnung auf, und die beiden Männer auf den vorderen Sitzen trugen keine Uniform. Sie streiften Adnan mit einem knappen Blick, als er sich nun auf einem der hinteren Sitze angurtete. Man hätte meinen können, die Männer versuchten seine Anwesenheit zu ignorieren.
Adnan verschwendete keinen Gedanken mehr an seine toten Kameraden. Längst gingen seine Überlegungen weiter, beschäftigten sich mit dem Ruhm, der ihm bald zuteil werden würde. Falls sie Erfolg hatten, würde die Menschheit voller Ehrfurcht und Achtung von ihm sprechen.
Offiziell war Adnan al-Rimi tot, aber nie würde sein Leben wertvoller sein als jetzt.
Der Hubschrauber flog auf Nordkurs, nach West-Pennsylvania, zu einer Ortschaft namens Brennan. Schon eine Minute später war es still am Himmel des ländlichen Virginia. Nur das Rauschen des Regens, der langsam die Ströme Blut fortspülte, war zu vernehmen.
KAPITEL 1
Er rannte und rannte, während rings um ihn her Kugeln einschlugen. Er konnte nicht erkennen, wer schoss, und er hatte keine Waffe, um das Feuer zu erwidern. Die Frau neben ihm war seine Ehefrau, und das Mädchen an ihrer Seite war ihre gemeinsame Tochter. Ein Geschoss durchschlug die Hand der Frau, und er hörte sie aufschreien. Dann fand eine zweite Kugel ihr Ziel, und mit einem Ausdruck ungläubigen Staunens riss seine Frau die Augen auf: Es war jener Sekundenbruchteil, da die Pupillen sich weiten und den Augenblick des Todes anzeigen, noch ehe das Gehirn ihn registriert. Als die Frau zusammenbrach, sprang der Mann zu dem kleinen Mädchen, um es mit dem Körper zu schützen. Seine Hände griffen nach ihr, verfehlten sie jedoch wie jedes Mal.
Er erwachte und setzte sich kerzengerade auf. Schweiß rann ihm über die Wangen und sickerte in seinen langen, struppigen Bart. Aus einer Flasche schüttete er sich Wasser ins Gesicht. Die kühlen Tropfen linderten den brennenden Schmerz, den sein immer wiederkehrender Albtraum jedes Mal hinterließ.
Als er sich vom Bett schwang, stießen seine Knie gegen die alte Kiste, die daneben stand. Der Mann zögerte, klappte dann den Deckel hoch. In der Kiste lag ein zerfleddertes Fotoalbum. Der Reihe nach sah er sich die wenigen Fotos der Frau an, die seine Gattin gewesen war; dann betrachtete er die Aufnahmen seiner Tochter, die sie als Säugling und als Kleinkind zeigten. Bilder aus späterer Zeit gab es nicht. Er hätte sein Leben dafür geopfert, seine Tochter nur für einen flüchtigen Augenblick als junge Frau sehen zu dürfen. Kein Tag verstrich, ohne dass er darüber nachgrübelte, was aus ihr hätte werden können.
Er ließ den Blick durch das spärlich eingerichtete Innere des Häuschens schweifen, betrachtete die staubigen Regale, die mit Büchern zu den verschiedensten Sachgebieten gefüllt waren. Beim großen Fenster, das den Blick auf das bereits im Dunkeln liegende Gelände bot, stand ein alter Schreibtisch mit Kladden, deren Seiten in seiner akkuraten Handschrift vollgeschrieben waren. Ein vom Ruß geschwärzter Steinkamin diente der Beheizung, und es gab eine Kochnische, in der er seine kärglichen Mahlzeiten zubereitete. Ein winziges Bad komplettierte das bescheidene Interieur.
Der Mann schaute auf die Uhr, nahm ein Fernglas von dem wackligen Holztisch, der am Bett stand, holte einen zerfransten Leinenrucksack vom Schreibtisch, packte das Fernglas sowie mehrere Kladden hinein und verließ das Häuschen.
Alte Grabsteine ragten vor ihm empor. Das Mondlicht schimmerte auf dem verwitterten, bemoosten Stein. Als er von der Veranda auf den Rasen stieg, vertrieb die kühle frische Luft vollends den brennenden Schmerz, den der Albtraum in seinem Kopf hinterlassen hatte, nicht aber den Schmerz seines Herzens. Er hatte an diesem Abend viel zu erledigen, doch ihm blieb noch ein wenig Zeit. Und wie immer, wenn dies der Fall war, trieb es Stone an einen bestimmten Ort.
Er ging durch das breite Tor aus Gusseisen, dessen verschnörkelte Beschriftung kundtat, dass sich hier, im Nordwesten Washingtons, der Friedhof Mount Zion erstreckte, der zur Methodistengemeinde gleichen Namens gehörte, deren Sitz sich ganz in der Nähe befand. Sie war die älteste Schwarzengemeinde der Stadt, gegründet im Jahre 1816 von Gläubigen, die es leid gewesen waren, ihre Religion in nach Rassen getrennten Gotteshäusern auszuüben, deren Vorsteher in der Heiligen Schrift den Grundsatz der Gleichheit aller Menschen vor Gott offenbar überlesen hatten. Zudem war das drei Morgen große Grundstück eine wichtige Zwischenetappe der Geheimorganisation The Underground Railroad gewesen, die während des Amerikanischen Bürgerkriegs Sklaven aus dem Süden in die Freiheit des Nordens geschmuggelt hatte.
Jahrzehntelang war der historische Friedhof vernachlässigt worden. Grabdenkmäler waren umgekippt worden, und hüfthoch hatte das Unkraut gewuchert, bis die Gemeinde den Mount Zion endlich mit einem Gitterzaun umschließen und ein Friedhofswärter-Häuschen errichten ließ.
In der Nähe befand sich der größere, bekanntere Friedhof Oak Hill, letzte Ruhestätte zahlreicher Berühmtheiten. Doch Stone war der Mount Zion mitsamt seinem Platz in der Geschichte – als Tor zur Freiheit – viel lieber.
Vor ein paar Jahren war Stone als Friedhofswärter eingestellt worden, versah seine Arbeit gewissenhaft und sorgte dafür, dass die Rasenflächen und Grabstätten sich stets in gutem Zustand befanden. Das Häuschen, das Stone als Friedhofswärter bewohnen durfte, war für ihn das erste richtige Heim seit langer Zeit. Die Gemeinde bezahlte ihn bar, ohne dass lästiger Papierkram anfiel; allerdings verdiente er ohnehin zu wenig, als dass er Lohnsteuer hätte zahlen müssen. Es reichte kaum zum Leben, und doch war es die beste Anstellung, die Stone je gehabt hatte.
Er spazierte zur 27th Street, erwischte einen innerstädtischen Bus und stieg einen Häuserblock weiter aus – dort, wo er gewissermaßen seinen »Zweitwohnsitz« hatte. Als Stone das kleine Zelt erreichte, kramte er das Militärfernglas aus dem Rucksack und beobachtete das Gebäude auf der anderen Straßenseite. Stone hatte den Feldstecher behalten, nachdem er seinem Vaterland stolz gedient, letzten Endes aber gänzlich das Vertrauen zur politischen Führung verloren hatte. Seinen wahren Namen nannte er seit Jahrzehnten nicht mehr. Mittlerweile kannte man ihn nur noch als Oliver Stone; dass er diesen Namen angenommen hatte, ließ sich nur verstehen, wenn man es als Geste verschmitzten Trotzes deutete.
Er fühlte sich dem schon legendären Wirken des aufmüpfigen Filmregisseurs verbunden, der die offiziöse Geschichtsschreibung hinterfragte – eine Darstellung der Geschichte, die häufig mehr mit Dichtung als mit Wahrheit zu tun hatte. Sich Oliver Stones Namen zuzulegen, hatte er als durchaus passend empfunden, denn auch er hegte großes Interesse an der »wahren Wahrheit«.
Unbeirrt beobachtete Stone durchs Fernglas das Kommen und Gehen drüben am Gebäude. Schließlich verschwand er in seinem kleinen Zelt und schrieb im Licht einer betagten Taschenlampe seine neuesten Beobachtungen in eine der Kladden, die er in den Rucksack gepackt hatte. Einige davon verwahrte er im Friedhofswärterhäuschen, den Großteil jedoch in Verstecken an anderen Orten. Im Zelt ließ Stone nie Schriftliches zurück; er wusste, dass man das Zelt regelmäßig durchsuchte. In seiner Brieftasche führte er stets die amtliche Genehmigung bei sich, hier ein Zelt aufschlagen und sein Recht wahrnehmen zu dürfen, an dieser Stätte seinem Protest Ausdruck zu verleihen. Und er pochte auf sein Recht.
Stone kehrte ins Freie zurück und blickte hinüber zu den Sicherheitsleuten, die mit halbautomatischen Pistolen und Maschinenwaffen ausgestattet waren und hin und wieder in Funkgeräte sprachen. Sie alle kannten Stone und verhielten sich ihm gegenüber auf wachsame Weise höflich, so wie Leute jemandem begegnen, von dem sie befürchten, er könnte jeden Moment auf sie losgehen. Stone seinerseits achtete darauf, den Sicherheitsleuten Respekt zu zeigen. Personen gegenüber, die Maschinenwaffen trugen, verhielt man sich allemal respektvoll. Oliver Stone war zwar alles andere als ein Durchschnittsbürger, aber verrückt war er deshalb noch lange nicht.
Er bekam Blickkontakt mit einem der Sicherheitsleute, der ihm daraufhin zurief: »He, Stone, ich hab gehört, Zappelphilipp ist mit dem Stuhl umgekippt! Gib die Meldung weiter!«
Einige andere Sicherheitsbeamte lachten über die Bemerkung, und selbst auf Stones Lippen legte sich ein Lächeln. »Wird gemacht«, rief er zurück. Er hatte gesehen, wie der Spaßvogel nur wenige Schritte von der Stelle entfernt, an der Stone nun stand, einen Mann niedergeschossen hatte. Der Gerechtigkeit halber muss allerdings erwähnt werden, dass der Mann vorher auf den Sicherheitsbeamten gefeuert hatte.
Stone zog die abgewetzte Hose höher um die schlanke Taille, strich die langen angegrauten Haare nach hinten und blieb einen Moment lang stehen, um den Schnürsenkel des rechten Schuhs neu zu binden. Stone war ein großer, hagerer Mann; das Hemd war ihm zu weit, die Hose zu kurz. Und mit den Schuhen hatte er andauernd Probleme.
»Du brauchst Klamotten neue, Oliver«, sagte in der Dunkelheit eine Frauenstimme. Stone hob den Blick und sah sie an der Statue des Generalmajors Comte de Rochambeau lehnen, eines Helden der Amerikanischen Revolution. Rochambeaus ausgestreckter Finger deutete auf irgendetwas – auf was, hatte Stone nie herausgefunden. Das Denkmal des preußischen Barons Steuben stand an der Nordwestseite, die Statue des polnischen Generals Kosciuszko an der Nordostseite des sieben Morgen großen Parks, an dessen Rand sich Stone nun aufhielt. Die Denkmäler zauberten jedes Mal ein Lächeln auf sein Gesicht. Inmitten von Revolutionären fühlte Oliver Stone sich wohl. »Du musst wirklich haben mal neue Klamotten, Oliver«, meinte die Frau, wobei sie sich im tiefbraunen Gesicht kratzte. »Und Haarschnitt, ja. Eigentlich du brauchst Rundumerneuerung, Oliver.«
»Na klar«, antwortete Stone. »Aber es ist alles eine Frage der Prioritäten, und zum Glück ist Eitelkeit nie eine meiner Schwächen gewesen.«
Die Frau nannte sich Adelphia. Sie besaß einen Akzent, den Stone nicht einordnen konnte. Slawisch, wahrscheinlich. Besondere Schwierigkeiten hatte Adelphia mit den Verben, die sie an reichlich unpassenden Stellen einflocht. Sie war eine große Frau mit langem schwarzem Haar, in dem sich die ersten grauen Strähnen zeigten, und tief sitzenden, düsteren Augen. Ihr Miene war meist finster, doch bisweilen hatte Stone eine Art bärbeißige Gutmütigkeit bei ihr erlebt. Ihr Alter ließ sich nur schwer schätzen, aber jünger als er war sie auf jeden Fall.
Das fast zwei Meter hohe, frei stehende Spruchband vor ihrem Zelt drohte:
EIN FÖTUS IST LEBEN WER GLAUBT ES NICHT, MUSS IN HÖLLE
Feingeistigkeit konnte man Adelphia nicht gerade nachsagen. Für sie existierte nur die Trennlinie zwischen Schwarz und Weiß. Grautöne gab es für sie nicht, obwohl sie in einer Stadt lebte, die diese Farbe erfunden haben könnte.
Auf dem kleinen Schild vor Stones Zelt stand schlicht und einfach:
ICH WILL DIE WAHRHEIT WISSEN
Selbst nach all den Jahren hatte er die Wahrheit noch nicht aufgedeckt. Aber war jemals eine Stadt erbaut worden, in der es schwieriger war, die Wahrheit aufzuspüren?
»Ich geh holen Kaffee, Oliver. Du möchtest auch? Ich Geld.«
»Nein, danke, Adelphia. Ich muss noch weg.«
Sie furchte die Stirn. »Wieder so ein Sitzung, wo du willst hin? Was du hast davon? Du kein junger Spund nicht mehr, und sollst nicht laufen in Dunkel herum. Hier gefährliche Gegend.«
Stone sah hinüber zu den Bewaffneten. »Mir kommt es eher so vor, als wäre es hier besonders sicher.«
»Ein Haufen Kerle mit Knarren für dich Sicherheit?«, erwiderte Adelphia patzig. »Von Sinnen bissa wohl, sag mal.«
»Vielleicht hast du recht«, sagte Stone. »Vielen Dank jedenfalls für deine Anteilnahme.«
Adelphia hätte sich jetzt gern mit ihm gezankt, und so lauerte sie auf eine Chance, die sie zu diesem Zweck nutzen könnte. Doch Stone hatte sich längst angewöhnt, Adelphia keine solche Gelegenheit zu geben. Verdrossen starrte sie ihn noch einen Moment an; dann schlurfte sie davon. Unterdessen heftete Stone den Blick auf ein Schild, das neben dem seinen stand:
ICH WÜNSCHE EINEN ANGENEHMEN WELTUNTERGANG
Stone hatte den Mann, der dieses Schild aufgestellt hatte, seit längerem nicht gesehen.
»Tja, den werden wir wohl haben«, murmelte er, als plötzliche Aktivitäten auf der anderen Straßenseite seine Aufmerksamkeit erregten. Bundespolizisten sammelten sich dort, Regierungsfahrzeuge fuhren auf, und an den Kreuzungen in der Nähe hatte die Schutzpolizei Aufstellung bezogen. Dann öffnete sich das beeindruckende schwarze Stahltor, das sogar dem Rammstoß eines M-1-Panzers widerstehen konnte, und ein schwarzer Suburban schoss heraus. An dem Fahrzeug flackerten grelle rote und blaue Lichter.
Da Stone augenblicklich durchschaute, was geschah, lief er die Straße entlang zur nächsten Kreuzung. Durch den Feldstecher verfolgte er, wie der am sorgfältigsten ausgetüftelte Autokorso der Welt sich auf die 17th Street bewegte. In der Mitte der eindrucksvollen Kolonne fuhr die einzigartigste aller je gebauten Limousinen.
Es war ein Cadillac DTS, ausgerüstet mit der modernsten Navigations- und Kommunikationstechnik. Auf den dunkelblauen Ledersitzen fanden sechs Personen reichlich Platz. Sensoren verstellten die Sitze automatisch. Der Wagen hatte ein einfahrbares Faltdach, war in geschlossenem Zustand jedoch vollkommen geschützt gegen den Fahrtwind und verfügte – für den Fall, dass die Außenluft einmal ungesund sein sollte – über eine eigenständige interne Sauerstoffversorgung. In der Mitte der Rückbank war das Präsidentenwappen eingeprägt; auf den Innen- und Außenseiten der hinteren Türen war es ebenfalls zu sehen. Auf dem rechten vorderen Kotflügel wehte die amerikanische Fahne, auf dem linken die Präsidentenflagge, die kundtat, dass tatsächlich Amerikas höchstes Regierungsmitglied in dem Wagen saß.
Die Karosserie bestand aus schussfesten Stahlplatten, die Fensterscheiben aus Polykarbonatglas, das so dick war wie ein Telefonbuch und von keiner Kugel durchschlagen werden konnte. Der Wagen hatte vier sich selbst reparierende Reifen und Nummernschilder mit 00-Kennzeichen. Was den Benzinverbrauch betraf, galt er als unschlagbarer Spritsäufer, doch im Preis von zehn Millionen Dollar waren immerhin ein CD-Zehnfachwechsler mit Sensurround-Klang inbegriffen. Zum Leidwesen aller, die auf ein Schnäppchen hofften, gewährten die Händler auf dieses Modell keinen Rabatt. Gemütvoll nannte man dieses Fahrzeug das »Ungetüm«. Es hatte nur zwei bekannte Nachteile: Es konnte weder fliegen noch schwimmen.
Die Innenbeleuchtung des Ungetüms flammte auf, und Stone sah den Mann in Akten kramen – zweifellos Akten von enormer Wichtigkeit. Neben ihm saß ein zweiter Mann. Stone musste lächeln. Das Einknipsen der Innenbeleuchtung war bestimmt ganz nach dem Geschmack der Sicherheitsbeamten. Selbst hinter dicker Panzerung und kugelsicherem Glas machte man sich nicht zu einem so leichten Ziel.
Als die Limousine die Kreuzung überquerte, verlangsamte sie das Tempo. Stone verkrampfte sich unwillkürlich, als der Mann, der im Ungetüm saß, in seine Richtung blickte. Für einen flüchtigen Moment hatten James H. Brennan, Präsident der Vereinigten Staaten, und der konspirativ gesonnene Bürger Oliver Stone direkten Blickkontakt. Der Präsident verzog das Gesicht und sagte irgendetwas. Unverzüglich schaltete sein Begleiter die Innenbeleuchtung aus. Stone lächelte ein zweites Mal. Ja, ich werde immer da sein. Länger als ihr beide.
Auch Präsident Brennans Begleiter kannte Stone gut. Der Mann war Carter Gray, der so genannte »Geheimdienstzar«, der eine erst kürzlich geschaffene Stelle auf Kabinettsebene besetzte, die ihm Macht über ein Budget von 50 Milliarden Dollar und 120000 bestens ausgebildete Mitarbeiter aller 15 amerikanischen Nachrichtendienste verlieh. Sein Machtbereich umfasste sämtliche Spionagesatelliten, die kryptologische Abteilung der NSA, die DIA und sogar die ehrwürdige CIA,1 die er früher als Direktor geleitet hatte. Anscheinend waren die Leute in Langley der Ansicht gewesen, Gray würde ihnen mit Respekt und Umgänglichkeit begegnen. Nichts davon war geschehen. Da Gray überdies ehemaliger Verteidigungsminister war, war man davon ausgegangen, dass er dem Pentagon – das von jedem Dollar, der für Geheimdienstzwecke aufgewendet wurde, 80 Cents verbrauchte – die Treue hielt. Auch diese Erwartung hatte sich als irrig erwiesen. Offenkundig wusste Gray über sämtliche Leichen im Keller Bescheid und hatte seine Kenntnisse genutzt, um beide Institutionen seinem starken Willen zu beugen.
Stone bezweifelte, dass ein einziger Mann, ein fehlbarer Mensch, über so viel Macht verfügen sollte – am wenigsten jemand wie Carter Gray. Vor Jahrzehnten hatte Stone engen Umgang mit ihm gepflegt, doch Gray würde seinen alten Kumpel heute wohl kaum wiedererkennen. Vor Jahren hätte alles noch anders kommen können, nicht wahr, Mr. Gray?
Unvermittelt wurde Stone das Fernglas aus den Händen gerissen, und er sah einem uniformierten, mit Maschinenpistole bewaffneten Sicherheitsbeamten in die Augen. »Wenn Sie den Mann noch mal begaffen, sind Sie Ihr Fernglas quitt, kapiert? Wüssten wir nicht, dass Sie harmlos sind, wären Sie es schon jetzt los.« Der Sicherheitsmann drückte Stone den Feldstecher wieder in die Hand und stapfte davon.
»Ich nehme lediglich meine verfassungsmäßig garantierten Rechte wahr, Officer«, sagte Stone mit so leiser Stimme, dass der Sicherheitsbeamte ihn nicht hören konnte. Rasch steckte Stone das Fernglas ein und wich zurück in die Schatten der Straßenlaternen. Mit humorlosen Typen, die Maschinenwaffen mit sich führten, legte man sich lieber nicht an. Stone atmete tief durch. Sein Leben stand täglich auf der Kippe.
Er kehrte ins Zelt zurück, öffnete den Rucksack und las im Licht der Taschenlampe mehrere Artikel durch, die er aus Zeitungen und Zeitschriften ausgeschnitten und in seine Kladden geklebt hatte. In den Artikeln ging es um Carter Gray und Präsident Brennan. Geheimdienstzar schlägt wieder zu, besagte eine Überschrift. Eine andere lautete: Brennan und Gray, das dynamische Duo.
Alles war recht zügig über die Bühne gegangen. Nachdem der Kongress sich anfangs gewunden und geziert hatte, reorganisierte er die amerikanischen Nachrichtendienste radikal und setzte sein ganzes Vertrauen in Carter Gray. Als oberstem Chef sämtlicher Geheimdienste unterstand Gray auch der NIC, der National Intelligence Council, dessen dienstlicher Auftrag unter anderem darin bestand, die Vereinigten Staaten innerhalb und außerhalb ihrer Grenzen mit allen Mitteln vor Terroranschlägen zu schützen.
Doch anfangs hatten die Ergebnisse seiner Tätigkeit Grays hohem Rang ganz und gar nicht entsprochen: Es gab eine Reihe von Selbstmordattentaten in Großstädten, bei denen zahlreiche Menschen ums Leben kamen. Zwei ausländische Würdenträger wurden beim Besuch der Vereinigten Staaten ermordet; sogar ein direkter, glücklicherweise misslungener Angriff auf das Weiße Haus war unternommen worden. Obwohl daraufhin viele Senatoren Grays Rücktritt forderten, gab der Präsident ihm volle Rückendeckung – und verglich man die Washingtoner Machtspiele mit Naturkatastrophen, war Präsident Brennan ein Hurrikan plus Erdbeben im Pauschalangebot.
Dann hatte sich allmählich eine Wende abgezeichnet. Ein Dutzend terroristischer Anschläge, die auf amerikanischem Boden erfolgen sollten, war vereitelt worden. Immer häufiger wurden Terroristen verhaftet oder getötet. Nachdem die amerikanischen Geheimdienste lange Zeit unfähig gewesen waren, die inneren Zirkel der Terrororganisationen zu knacken, gelang es ihnen endlich, den Gegner im eigenen Umfeld zu packen und seine Möglichkeiten zu mindern, den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten Schaden zuzufügen. Für diese Erfolge hatte Gray den Löwenanteil der Anerkennung eingeheimst.
Stone sah auf die Armbanduhr. Die Sitzung stand kurz bevor. Allerdings war der Weg lang, und Stones Beine, sein gewöhnliches Fortbewegungsmittel, fühlten sich heute müde an. Er kroch aus dem Zelt und warf einen Blick in die Brieftasche. Sie enthielt kein Geld.
In diesem Moment bemerkte er den Fußgänger. Unverzüglich hielt Stone auf den Mann zu, der eben die Hand gehoben hatte. Schon kam ein Taxi an den Bordstein gefahren. Stone beschleunigte seine Schritte und holte den Passanten ein, als der sich gerade ins Taxi schwang.
»Haben Sie Kleingeld übrig, Sir?«, fragte Stone, den Blick gesenkt, die Hand ausgestreckt und in so unterwürfigem Tonfall, dass er dem Angesprochenen erlaubte, eine Haltung selbstgefälligen Großmuts einzunehmen. Der Mann zauderte, biss dann aber in den Köder, lächelte und zückte seine Brieftasche. Stone machte große Augen, als er auf seinem Handteller einen frischen Zwanzigdollarschein sah.
»Gott segne Sie, Sir«, sagte Stone und schloss rasch die Finger um die Banknote.
So schnell er konnte, begab er sich zum Taxistand eines Hotels in der Nähe. Normalerweise hätte er einen Bus genommen, doch als Besitzer von zwanzig Dollar zog er es vor, sich zur Abwechslung eine Taxifahrt zu gönnen. Sobald er sich das lange, wirre Haar und den widerspenstigen Bart geglättet hatte, näherte er sich dem Taxi, das ganz vorn in der Warteschlange stand.
Als der Taxifahrer ihn sah, verriegelte er die Türen. »Zieh Leine!«, rief er.
»Die Vorschriften, die für Sie gelten«, erwiderte Stone durch das halb offene Wagenfenster und zeigte den Zwanzigdollarschein, »verbieten es Ihnen, jemanden zu diskriminieren.«
Die Miene des Taxifahrers bezeugte, dass er jeden diskriminieren würde, und aus jedem erdenklichen Grund, doch der Anblick des Geldscheins ließ seine Augen gierig funkeln. »Für einen Penner redest du ganz schön geschwollen«, sagte er. »Ich dachte, ihr habt alle einen an der Waffel.«
»Ich bin weder obdachlos, noch hab ich einen an der Waffel«, erklärte Stone. »Allerdings bin ich… sagen wir mal, ein wenig vom Glück verlassen.«
»Könnte das nicht jeder von sich behaupten?« Der Taxifahrer öffnete die Tür. Stone stieg ein und nannte ihm das Fahrtziel. »Vorhin hab ich den Präsidenten vorbeifahren sehen«, sagte der Taxifahrer. »Tolle Show.«
»Ja«, sagte Stone. »Irre Show.« Durch das Rückfenster des Taxis blickte er in Richtung Weißes Haus; dann lehnte er sich in den Sitz und schloss die Lider.
In was für einer interessanten Gegend ich doch wohne.
KAPITEL 2
Der schwarze Sedan fuhr langsam die einspurige, von dichten Baumreihen gesäumte Straße entlang und bog schließlich auf einen parallel verlaufenden Kiesweg ab. Nach dreißig Metern hielt das Auto. Tyler Reinke, Ende zwanzig, blond, von sportlicher Statur und hohem Wuchs, schwang sich vom Fahrersitz, während sich Warren Peters, Anfang dreißig, einsfünfundsechzig groß und mit schütterem schwarzem Haar, vom Beifahrersitz schob. Reinke schloss den Kofferraum des Fahrzeugs auf. Darin lag in nach vorn gekrümmter Haltung ein Mittdreißiger, dem man Arme und Beine straff mit Spanngurten gefesselt hatte. Er trug eine blaue Jeans und eine Windjacke mit dem Logo der Washington Redskins. Um den Mund war ihm ein dickes Tuch gebunden worden, und unter ihm lag eine Plastikplane. Doch im Gegensatz zu den meisten Personen, die verschnürt im Kofferraum verstaut wurden, war er noch am Leben, befand sich aber allem Anschein nach im Zustand tiefer Betäubung. Mit Hilfe der Plane hoben die Männer ihn aus dem Kofferraum und legten ihn auf den Boden.
»Ich hab die Umgebung ausgekundschaftet, Tyler«, sagte Peters. »Die Gegend ist günstig, nur das Gelände ist ein bisschen abschüssig. Wir tragen ihn in der Plane, dann bleibt nichts von uns an ihm hängen.«
»Alles klar«, erwiderte Reinke und schaute sich wachsam im zerklüfteten Gefälle des Terrains um. »Wir müssen langsam und vorsichtig vorgehen.« Behutsam machten sie sich an den Abstieg, stützten sich unterwegs wiederholt an Baumstämme. Zum Glück hatte es seit einer Weile nicht mehr geregnet, sodass das Erdreich einen festen Tritt gewährte. Dennoch erwies es sich als äußerst anstrengend, den Mann in der Plastikplane abwärts zu befördern, und sie mussten mehrere Pausen einlegen, in denen der untersetzte Peters mühsam um Atem rang. Schließlich gelangten sie auf ebenes Gelände. »Na endlich, wir sind fast da«, sagte Reinke. »Legen wir ihn erst mal ab und peilen die Lage.« Einem Kleidersack, den Reinke sich auf den Rücken geschnallt hatte, entnahmen die Männer zwei Nachtsichtgläser und unterzogen die gesamte Umgebung einer gründlichen Beobachtung. Als sie zufrieden waren, setzten sie den Weg fort. Fünfzehn Minuten später endeten der Lehm und die Felsen; da und dort ragten flache Findlinge aus der Oberfläche des gemächlich dahinströmenden Flusses.
»Geschafft«, sagte Peters. »Hier ist es.«
Reinke öffnete den Kleidersack, holte zwei Gegenstände heraus und legte sie auf den Erdboden. Vor dem größeren Gegenstand ging er in die Hocke und betastete die Umrisse. Sekunden später fanden seine Finger, was er suchte. Eine Minute darauf hatte das Schlauchboot sich vollständig aufgeblasen. Der andere Gegenstand, den der Mann ausgepackt hatte, war ein kleiner Bootsmotor, den er nun am Heck des Schlauchboots anbrachte. »Wir bleiben in der Ufernähe Virginias«, sagte Peters. »Das Motörchen ist ziemlich leise, aber auf dem Fluss breitet der Schall sich weiter aus als im Gelände.« Er reichte seinem Kumpan ein kleines Gerät. »Hier ist das GPS-System.«
»Wir müssen den Burschen ins Wasser tauchen«, sagte Reinke.
»Ja. Am besten gleich da am Ufer.« Sie zogen Schuhe und Socken aus, krempelten die Hosenbeine hoch und schleppten ihren Gefangenen zum weichen, schlickigen, aber steinigen Lehmboden des Ufers; dann wateten sie bis zu den Knien ins Wasser, tauchten den Mann mit dem ganzen Körper – ausgenommen das Gesicht, damit er nicht aufwachte – ins laue Nass und hoben ihn wieder heraus. Das wiederholten sie zwei Mal. »Das dürfte genügen«, sagte Peters, während er den durchnässten Mann betrachtete, der in seiner Ohnmacht leise stöhnte. Sie wateten zurück ans Ufer und legten den Gefesselten ins Schlauchboot. Noch einmal suchten sie durch die Nachtsichtgläser genau die Umgebung ab, ehe sie das Schlauchboot zu Wasser brachten und hineinstiegen. Peters warf den Motor an, und mit leidlicher Geschwindigkeit bewegte das Boot sich hinaus auf den Fluss. Der hoch gewachsene Reinke kauerte neben dem Gefangenen und behielt den GPS-Monitor im Auge, während sie das bewaldete Ufer entlang flussabwärts fuhren. »Es wäre mir lieber gewesen«, maulte Peters, der das Boot steuerte, »die Sache im Verborgenen durchzuziehen. Aber ich durfte ja nicht mitreden. Wenigstens kommt Nebel auf. Ich hab mir den Wetterbericht angesehen, und er stimmt ausnahmsweise. Ein paar Hundert Meter voraus ist eine versteckte kleine Bucht. Da machen wir Rast und warten, bis wieder klare Sicht herrscht, ehe wir weiterfahren.«
»Gut«, gab Reinke zur Antwort.
Von da an schwiegen die beiden Männer, während das Schlauchboot in die Nebelbank glitt.
KAPITEL 3
Alex Ford unterdrückte ein Gähnen und rieb sich die müden Augen. »Bleiben Sie wach, Ford«, drang eine deutliche Stimme aus seinem Ohrhörer. Kaum merklich nickte er und riss sich zusammen. In der Räumlichkeit war es warm, doch wenigstens musste er nicht die Kevlar-Schutzweste tragen, in der man jedes Mal das Gefühl hatte, sich einen Mikrowellenherd umgeschnallt zu haben. Wie üblich reizten die Kabel, die Ohrhörer und Handgelenk-Mikro mit dem Mini-Funkgerät verbanden, Alex’ Haut. Noch schlimmer fühlte der Ohrhörer selbst sich an; das Ohr wurde dermaßen wund davon, dass die leichteste Berührung schmerzte.
Alex’ Hand streifte die Pistole, die er im Schulterhalfter stecken hatte. Wie bei allen Agenten des Secret Service war das Vorderteil seines Anzugs großzügiger als normal geschnitten, damit die von der Waffe verursachte Ausbeulung nicht auffiel. Der Service war kürzlich auf die SIG 357 umgerüstet worden, eine Handfeuerwaffe mit genügend Durchschlagskraft, um für den Dienstgebrauch zu taugen; trotzdem hatten sich manche Agenten, die ihren alten Schießeisen den Vorzug gaben, über die Umstellung beklagt. Alex dagegen war kein ausgesprochener Pistolenliebhaber und hatte in dieser Hinsicht kein Problem. In all den Jahren beim Secret Service hatte er die Waffe nur selten gezogen und noch seltener damit geschossen.
Diese Erinnerung bewog ihn zu ein paar Gedanken über seine bisherige Laufbahn. An wie vielen Türen hatte er schon Wache gestanden? Unmissverständlich war die Antwort den Falten seines Gesichts eingekerbt und an der Mattigkeit seiner Augen abzulesen. Selbst als er aus der Personenschutzabteilung hatte ausscheiden müssen und zum WFO, dem Washingtoner Büro des Secret Service, versetzt worden war, um sich in der zweiten Hälfte seiner Karriere mehr mit Ermittlungsarbeit beschäftigen zu dürfen, hatte er seinen alten Argwohn beibehalten und hielt wie eh und je nach Personen Ausschau, die Übles gegen jemanden im Schilde führen mochten, für dessen Sicherheit er verantwortlich war.
Heute ging es um den Schutz hoher ausländischer Amtsträger, allerdings bei niedriger Alarmstufe. Alex Ford hatte das Pech gehabt, Überstunden aufgebrummt zu kriegen, um einen ausländischen Regierungschef zu beschützen, der zurzeit die Vereinigten Staaten besuchte; obendrein hatte er erst eine Stunde vor Feierabend von dem Auftrag erfahren. Deshalb hatte er jetzt, statt in seiner Lieblingskneipe bei einem Drink zu sitzen, die Aufgabe, unbedingt zu verhüten, dass irgendwer auf den Ministerpräsidenten Lettlands schoss. Oder Estlands?
Bei der Veranstaltung handelte es sich um einen Empfang im piekfeinen Four Seasons in Georgetown, doch die Gäste zählten offensichtlich nur zur zweiten Garnitur, und viele Teilnehmer waren lediglich aufgrund dienstlicher Anweisung zugegen. Die wenigen wichtigeren Geladenen umfassten eine Hand voll unterer Ränge aus dem Weißen Haus, ein paar Lokalpolitiker, die auf wohlwollende Erwähnung in der Presse hofften, sowie einen Kongressangehörigen, Mitglied irgendeines internationalen Freundschaftsvereins, der noch gelangweilter wirkte, als Alex Ford sich fühlte.
Der Secret-Service-Veteran hatte schon in der vergangenen Woche auf drei solcher Abendgesellschaften Überstunden schieben müssen. Es war jedes Mal das Gleiche: Die Monate vor einer Präsidentschaftswahl waren ein irrwitziges Karussell aus Partys, Wahlkampfveranstaltungen, Spendensammlungen und sonstigen einschlägigen Zusammenkünften. Kongressmitglieder und deren Mitarbeiter besuchten jeden Abend ein halbes Dutzend solcher Events, um kostenlose Mahlzeiten und Getränke zu schnorren, Wählern die Hand zu schütteln, Spendenschecks einzustreichen und bisweilen sogar über Sachfragen zu diskutieren. Und wenn auf einer dieser Partys jemand aufkreuzte, der unter dem Schutz des Secret Service stand, mussten Männer wie Alex nach einem langen Arbeitstag für die Sicherheit des Betreffenden sorgen.
Alex heftete den Blick auf seinen Einsatzpartner am heutigen Abend, einen großen, massigen Burschen vom WFO, der eine Bürstenfrisur à la Marine Corps hatte; er war ebenfalls erst in letzter Minute über den Sonderauftrag verständigt worden. Alex musste nur noch wenige Jahre durchstehen, bis er sich mit einer Regierungspension zur Ruhe setzen konnte; der junge Bursche aber blickte in seiner Karriere beim Secret Service noch zwei Jahrzehnten Achterbahnfahrt entgegen.
»Simpson hat sich wieder mal gedrückt«, brummte er. »Schon das zweite Mal hintereinander. Verraten Sie mir mal eines: Wem leckt der Typ eigentlich die Stiefel?«
Alex hob die Schultern. Es lag in der Natur der Sache, dass diese Art Dienst viel Zeit zum Nachdenken ließ – zu viel Zeit. In dieser Beziehung hatten Secret-Service-Beamte eine gewisse Ähnlichkeit mit Strafverteidigern: viel Leerlauf, sodass man ins Sinnieren geriet und im Geiste umfangreiche schwarze Listen lästiger Zeitgenossen erstellte, über die man Beschwerde einreichen sollte, während man unauffällig über die Schutzbefohlenen wachte. So hatte die Beschützerrolle seines Berufs Alex mittlerweile völlig abgestumpft.
Er blickte auf die Taste seines Handgelenk-Mikrofons und musste schmunzeln. Diese Taste verursachte seit Jahren Ärger. Wenn Agenten die Arme verschränkten, konnte es geschehen, dass sie die Taste versehentlich betätigten; es kam auch vor, dass sie klemmte und wider Erwarten das Mikrofon nicht abschaltete. Dann wurden über Funk anschauliche Beschreibungen irgendeiner heißen Braut verbreitet, die durch die Szenerie stelzte. Hätte Alex jedes Mal hundert Mäuse bekommen, wenn er die Frage »Hast du das scharfe Gerät gesehen?« zu hören bekam, wäre er längst im Ruhestand. Sofort raunzten alle anwesenden Agenten ins Mikrofon: »Da ist ’n Mikro an!« Zu sehen, wie daraufhin jeder Kollege sich überstürzt davon überzeugte, dass nicht er unabsichtlich solche Bekundungen der Lüsternheit ausstrahlte, war überaus erheiternd.
Alex verschob geringfügig den Ohrhörer und rieb sich den Nacken. Dieser Teil seiner Anatomie hatte sich in eine Art Eisenbahnkatastrophe aus geschädigten Blutgefäßen und angebrochenen Halswirbeln verwandelt. Als er einer Bewachergruppe für den Autokorso des Präsidenten angehört hatte, war der Wagen, in dem er mitfuhr, auf einer entlegenen Straße ins Schleudern gekommen, weil der Fahrer einem Stück Rotwild ausweichen musste. Dieser eigentlich eher harmlose Zwischenfall hatte bei Alex zu einem Schleudertrauma plus angebrochenen Halswirbeln geführt. Nach einer Reihe von Operationen und der Einpflanzung einiger hochfeiner Längen Stahl war der einst einsneunzig große Alex knapp zwei Zentimeter kleiner geworden, doch seine Körperhaltung hatte sich wesentlich verbessert, da Stahl sich nicht so leicht biegen ließ. Ein bisschen kürzer zu sein störte Alex erheblich weniger als das ständige Brennen im Nacken. Er hätte sich berufsunfähig schreiben lassen und aus dem Dienst ausscheiden können, doch auf diese Weise wollte er nicht von seinem Berufsleben Abschied nehmen. Außerdem war Alex Single und kinderlos. Deshalb hatte er sich wieder in Form gebracht, bis die Amtsärzte des Secret Service ihm ihren Segen gaben, nach Monaten der Schreibtischtätigkeit wieder im Außeneinsatz zu arbeiten.
Inzwischen hatte er den größten Teil seines Erwachsenenlebens in ständiger Hochspannung, aber lähmender Langeweile zugebracht, also im typischen Alltag eines Secret-Service-Agenten. Deshalb fragte er sich jetzt, wie er so schwachköpfig gewesen sein konnte, ein solches Leben weiterzuführen. Meine Güte, er hätte sich ein Hobby suchen können. Oder wenigstens eine Frau.
Alex kaute auf den Lippen, um sich von dem Brennen im Nacken abzulenken, während er stoisch mit ansah, wie sich die Gattin des unbekannten ausländischen Ministerpräsidenten foie gras in den Rachen schaufelte.
Klasse.
KAPITEL 4
Stone stieg aus dem Taxi. »Egal, wie klugscheißerisch du laberst«, sagte der Taxifahrer, bevor er abfuhr, »für mich bleibst du trotzdem ein Penner.«
Stone schaute dem Wagen nach. Er hatte es sich seit langem abgewöhnt, auf derartige Bemerkungen zu antworten. Die Menschen dachten sowieso, was sie denken wollten. Außerdem sah er wirklich wie ein Penner aus.
Er schlug den Weg zu einem kleinen Park ein, der sich neben dem Georgetown Waterfront Complex erstreckte, und blickte hinunter auf die bräunlichen Fluten des Potomac, die träg gegen die Ufermauern schwappten. Von unternehmungslustigen Graffitikünstlern, die es anscheinend nicht gestört hatte, ihrer Tätigkeit dicht über mehreren Metern Potomac-Brühe nachzugehen, war die Betonmauer flächendeckend grellbunt bemalt worden.
Wäre Stone ein wenig früher eingetroffen, hätte auf dem Whitehurst Freeway hinter ihm noch reger Verkehr geherrscht. In Georgetown gab es diverse Etablissements, die Leuten mit reichlich Kleingeld oder hinlänglichem Kredit allerlei Freuden verhießen. Stone hatte weder das eine noch das andere. Um diese späte Stunde jedoch hatten die meisten Feuchtfröhlichen sich nach Hause verzogen. Washington war eine Stadt, in der man früh aufstand und zeitig zu Bett ging.
Auch auf dem Potomac war es ruhig. Das Boot der Wasserschutzpolizei, das regelmäßig auf dem Fluss patrouillierte, musste zurzeit südwärts unterwegs sein, zur Woodrow Wilson Bridge. Umso besser, sagte sich Stone. Zum Glück begegnete er auch an Land keinen Polizisten. Er lebte in einem freien Land, doch bisweilen erwies dieses Land sich als ein bisschen weniger frei für jemanden, der auf einem Friedhof wohnte, dessen Bekleidung zerlumpt war und der nachts in einem Viertel der Reichen umherschlich.
Auf dem Weg das Flussufer entlang streifte Stone den Francis Scott Key Park, unterquerte die Francis Scott Key Bridge und erreichte dahinter ein diesem berühmten Komponisten errichtetes Denkmal. Nach Stones Empfinden war das ziemlich dick aufgetragen für einen Musiker, der Liedtexte geschrieben hatte, an die keine Sau sich mehr erinnerte. Der Himmel war schwarz wie Tinte, nur stellenweise gefleckt mit Wolkenschwaden oder vereinzelten Sternen; und dank des kürzlich von neuem über den nahen Reagan National Airport verhängten Nachtflugverbots störten keine Kondensstreifen die Schönheit des Firmaments. Stone spürte jedoch, dass dichter Bodennebel heranwogte. Nicht mehr lange, und er würde sich glücklich schätzen können, wenn er noch die Hand vor Augen sah.
Er näherte sich einem farbenfroh gestalteten Gebäude, das einem örtlichen Ruderverein gehörte, als ihn aus der Dunkelheit eine vertraute Stimme anrief.
»Oliver, bist du ’s?«
»Ja, Caleb. Sind die anderen schon da?«
Ein mittelgroßer Zeitgenosse mit einem Ansatz zum Kugelbauch trat in Stones Blickfeld. Caleb Shaw trug Garderobe aus dem 19. Jahrhundert, mitsamt einer Melone auf dem kurzen, vom Ergrauen bedrohten Schopf; eine altmodische Taschenuhr schmückte die Vorderseite seiner Strickweste. Er hatte lange Koteletten und einen schmalen, gepflegten Schnauzbart.
»Reuben ist auch schon hier«, sagte Caleb, »aber er muss gerade mal. Milton hab ich noch nicht gesehen.«
Stone seufzte. »Wundert mich nicht. Milton ist ein zerstreuter Professor.«
Reuben Rhodes sah nicht allzu gut aus, als er sich zu ihnen gesellte. Er war ein baumlanger, kräftig gebauter Kerl mit üppigem ergrauendem Haar und kürzerem, ansonsten aber ähnlich beschaffenem Bart. Seine Kleidung bestand aus einer schmuddligen Jeans und einem Flanellhemd, und an den Füßen trug er verschlissene Treter. Er drückte sich eine Hand auf die Körperseite. Reuben neigte zu Nierensteinen.
»Du solltest mal in der Klinik vorsprechen, Reuben«, empfahl Stone.
Der Lange furchte die Stirn. »Mir gefällt’s nicht, wenn Fremde in mir rumstochern, das hab ich in der Armee oft genug erlebt. Also leide ich lieber still vor mich hin, wenn keiner was dagegen hat.«
Während des Wortwechsels war Milton Farb zu ihnen gestoßen. Er blieb stehen, scharrte dreimal mit dem rechten und zweimal mit dem linken Fuß im Dreck und krönte die Darbietung mit einer Anzahl von Knurr- und Pfeiflauten. Dann rasselte er eine Reihe von Zahlen herunter, die für ihn offenbar große Bedeutung hatten.
Geduldig warteten die drei anderen Männer, bis Milton fertig war; sie alle wussten, dass ihr Kumpel, falls sie ihn bei seinem Zwangshandlungsritual unterbrachen, von vorn anfangen musste, und es war ohnehin schon spät.
»Hallo, Milton«, grüßte Stone, kaum dass das Knurren und Pfeifen verstummt war.
Milton Farb hob den Blick und grinste. Er trug einen bunten Sweater und eine frisch gebügelte Khakihose; über einer Schulter hing ein lederner Ranzen. Er maß ungefähr einsachtzig und trug eine Drahtgestellbrille. Sein ursprünglich dunkelblondes, mittlerweile jedoch sichtlich von Grau durchzogenes Haar baumelte ihm in naturwüchsiger Länge auf den Rücken und verlieh ihm die Erscheinung eines Alt-Hippies. Dennoch wirkte er jünger, als er war, weil in seinen feuchten Augen ein schelmischer Ausdruck funkelte.
Milton tatschte auf den Lederranzen. »Ich hab was Gutes dabei, Oliver.«
»Na, dann wollen wir mal«, meinte Reuben, der sich nach wie vor die Seite hielt. »Ich muss morgen zur Frühschicht.«
Während das Quartett sich auf den Weg machte, huschte Reuben zu Stone und steckte ihm etwas Geld in die Hemdtasche.
»Das muss nicht sein, Reuben«, sagte Stone. »Ich kriege Knete von der Gemeinde.«
»Ja, aber ich weiß, dass sie dich schlecht dafür bezahlen, dass du Unkraut jätest und Grabsteine putzt, auch wenn sie dir ’n Dach überm Kopf geben.«
»Aber du kannst doch selbst kaum was entbehren.«
»Jahrelang hast du mir geholfen, weil ich niemanden beschwatzen konnte, mir Arbeit zuzuschustern.« Reubens Stimme wurde lauter. »Seht euch doch mal an, was für ein bunter Haufen wir sind. Wann sind wir eigentlich so erbarmungswürdig alt geworden?«
Caleb lachte, während Milton einen Moment entgeistert dreinschaute, bis er begriff, dass Reuben bloß Spaß machte.
»Das Alter kommt schleichend, aber wenn es da ist, kriegt man die Auswirkungen mit voller Wucht zu spüren«, sagte Stone und musterte seine Gefährten: drei Männer, die er seit Jahren kannte und die gute und schlechte Zeiten mit ihm durchlebt hatten.
Reuben war von West Point abgegangen, hatte sich in Vietnam während dreier Dienstzeiten mit Ruhm bekleckert und war am Ende mit jedem Orden und jeder Ehrung ausgezeichnet worden, die das Militär zu bieten hatte. Anschließend teilte man ihn der DIA zu, dem militärischen Geheimdienst. Doch schließlich schmiss Reuben der DIA die Brocken hin und wandelte sich zum lautstarken Protestler gegen den Krieg im Allgemeinen und den Vietnamkrieg im Besonderen. Als das Vaterland sich nicht mehr für die »kleinen Scharmützel« in Südostasien interessierte, wurde Reuben zum Mann ohne Daseinszweck. Für einige Zeit lebte er in England, kehrte jedoch in die Vereinigten Staaten zurück. Von da an blieben ihm kaum noch Möglichkeiten der Lebensführung, da er alle Brücken hinter sich abgebrochen hatte – und wegen beträchtlichen Drogenkonsums. Dann hatte er das Glück gehabt, Oliver Stone kennen zu lernen, der ihn dabei unterstützte, wieder Ordnung in sein Leben zu bringen. Derzeit stand Reuben auf der Gehaltsliste einer Lagerfirma, bei der er Lastwagen entlud und statt des Gehirns die Muskeln trainierte.
Caleb Shaw hatte zwei Doktortitel, in Politikwissenschaft und Literatur; spezialisiert hatte er sich auf die Literatur des 18. Jahrhunderts, fand persönlich jedoch Trost darin, sich nach der Mode des 19. Jahrhunderts zu kleiden. Genau wie Reuben war Caleb während des Vietnamkriegs, in dem er seinen Bruder verlor, als Protestler aktiv gewesen. Auch bei der Watergate-Affäre, die die Nation den letzten Rest politischer Unschuld gekostet hatte, erhob Caleb laut die Stimme gegen die Regierung. Ungeachtet aller akademischen Reputation war er seiner Exzentrizität wegen längst aus den etablierten Kreisen der Wissenschaft und Forschung ausgegrenzt worden. Heute hatte er einen Job in der Raritätenabteilung der Kongressbibliothek. Seine Mitgliedschaft in der Organisation, deren Treffen für diese Nacht anberaumt worden war, hatte er im Lebenslauf verschwiegen, als er seine Bewerbung einreichte. Regierungsbehörden mochten keine Leute, die sich mit Verschwörungstheoretikern einließen, deren Zusammenkünfte mitten in der Nacht stattfanden.
Milton Farb zeichnete sich durch eine wahrscheinlich höhere geistige Brillanz aus, als die drei anderen Männer zusammen sie besaßen, wenngleich er häufig die Mahlzeiten vergaß, Paris Hilton für ein Hotel in Frankreich hielt und glaubte, Geld zu besitzen, solange er eine Scheckkarte besaß. Er verfügte über die angeborene Fähigkeit, riesige Zahlen im Kopf zu addieren, und ein fotografisches Gedächtnis – was er las oder sah, vergaß er nie mehr – und musste als Wunderkind gelten. Seine Eltern hatten eine Kirmesbude besessen und waren stets umhergezogen, sodass Milton zu einer vielbeachteten Attraktion wurde, da er die riesigsten Zahlen schneller im Kopf addierte als jeder andere mit dem Taschenrechner, und den Inhalt jedes Buches, das man ihn durchblättern ließ, ohne zu stocken vollständig wiedergeben konnte.
Jahre später, nachdem er Schule und Studium in Rekordzeit absolviert hatte, arbeitete er für die Nationale Gesundheitsbehörde in der Forschung. Die einzige Misslichkeit, die ihn an einem erfolgreichen Leben hinderte, war eine zunehmende Zwangsstörung mit starken paranoiden Symptomen, deren Ursache vermutlich in seiner unorthodoxen Kindheit inmitten des Jahrmarktrummels gesucht werden musste. Zu Miltons Pech machten diese Macken sich gern zum ungeeignetsten Zeitpunkt bemerkbar. Nachdem er vor einigen Jahren einen Drohbrief an den Präsidenten der Vereinigten Staaten geschickt hatte und daraufhin vom Secret Service unter die Lupe genommen worden war, fand seine Laufbahn bei der Gesundheitsbehörde ein rasches Ende.
Stone war Milton zum ersten Mal in einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie begegnet, in der Stone als Pfleger arbeitete, während Milton sich als Patient dort aufhielt. Im Verlauf seines Klinikaufenthalts verstarben Miltons Eltern und ließen ihn ohne eine Kopeke zurück. Inzwischen jedoch war Stone auf Miltons außerordentliche intellektuelle Fähigkeiten aufmerksam geworden und überredete seinen zutiefst niedergeschlagenen Freund, einmal sein Glück bei Riskant! zu versuchen. Milton bewarb sich mit Erfolg für die Quizshow, und es gelang ihm – da gewisse Medikamente vorübergehend seine Zwangsstörung unterdrückten, als es ernst wurde –, in der Sendung sämtliche anderen Kandidaten an die Wand zu spielen und ein kleines Vermögen einzuheimsen. Jetzt besaß er eine Firma, die Websites für Großunternehmen entwarf.
Die Männer stapften hinunter zum Flussufer und gelangten zu einem alten, verlassenen Schrottplatz. In der Nähe wucherte, halb im Wasser, ein dichtes Gestrüpp. Aus diesem Versteck bargen die vier Freunde ein längliches Ruderboot, das kaum noch schwimmfähig anmutete. Ohne vom Zustand des Bootes abgeschreckt zu werden, entledigten sie sich ihrer Schuhe und Socken, stopften sie in ihre Taschen, ließen das Boot zu Wasser und stiegen hinein. Beim Rudern wechselten sie sich ab. Reuben legte sich am längsten und tüchtigsten ins Zeug.
Auf dem Fluss wehte eine kühle Brise. Verlockend schimmerten die Lichter Georgetowns – und weiter südlich die Washingtons –, verschwanden jedoch rasch, als der Nebel dichter wurde.
»Das Polizeiboot muss jetzt an der Brücke Vierzehnte Straße sein«, sagte Caleb. »Es hat ’nen neuen Dienstplan. Und alle zwei Stunden patrouillieren Hubschrauber über der Mall. Ich weiß es aus der Warn-Mail, die heute in der Bibliothek eingegangen ist.«
»Die Warnstufe ist am Morgen raufgesetzt worden«, sagte Reuben. »Bekannte von mir sagen, das alles wäre bloß Schaumschlägerei, um Brennans Wahlkampf zu unterstützen.«
Stone drehte sich um und blickte Milton an, der gleichmütig am Heck hockte. »Du bist heute so still, Milt. Ist alles in Ordnung?«
Schüchtern erwiderte Milton seinen Blick. »Ich hab ’ne neue Freundschaft geschlossen.« Alle schauten ihn erstaunt an. »Eine Freundin gefunden«, fügte Milton rasch hinzu.
Reuben versetzte ihm einen Klaps auf die Schulter. »Du alter Schlawiner.«
»Das ist ja geil, Milton«, sagte Stone. »Wo hast du sie kennen gelernt?«
»In der Klinik für Psychiatrie. Sie ist da auch Patientin.«
»Aha.« Stone wandte sich ab.
»Bestimmt läuft es echt gut mit euch beiden«, meinte Caleb diplomatisch.
Langsam ruderten sie unter der Key Bridge hindurch, hielten sich in der Mitte der Fahrrinne und folgten der südlichen Flussbiegung. Es beruhigte Stone, dass der dichte Nebel sie vom Ufer aus praktisch unsichtbar machte. Die Regierungsbehörden waren Gesetzesbrechern gegenüber wenig tolerant. Schließlich erblickte Stone ein Stück voraus wieder Land. »Ein bisschen rechts rüber, Reuben.«
»Das nächste Mal sollten wir uns lieber vor dem Lincoln-Denkmal verabreden«, beschwerte sich der Lange, der beim Rudern ächzte und schnaufte.
Das Boot umrundete die Westseite der Insel und fuhr in eine enge Wasserstraße ein, die den passenden Namen Little Channel trug. Hier war ein derart abgelegenes Fleckchen, dass man kaum glauben konnte, noch vor wenigen Minuten die Kuppel des Kapitols gesehen zu haben.
Am Ufer stiegen sie aus dem Boot und zogen es aus dem Wasser ins Gesträuch. Als die Männer dann im Gänsemarsch durch das Gehölz zum Hauptweg stapften, fielen Stones Schritte besonders schwungvoll aus. Für heute Nacht hatte er sich eine Menge vorgenommen.
KAPITEL 5
Endlich verließen die Besucher aus Lettland den Empfang, sodass Alex sich unverzüglich in ein Taxi setzte und zu einer Stammkneipe der Bundespolizei fahren ließ. Das Etablissement nannte sich »LEAP«. Einem Laien sagte diese Abkürzung wahrscheinlich gar nichts, den Mitarbeitern der bundespolizeilichen Organisationen aber war sie durchaus geläufig.
LEAP bedeutete »Law Enforcement Availability Pay«. Als Gegenleistung dafür, dass sie mindestens zehn Stunden täglich für eine Tätigkeit abkömmlich blieben, die einen Dienstausweis, eine Schusswaffe sowie überdurchschnittlichen Mumm erforderte, erhielten Bundesbeamte von ihrer jeweiligen Organisation ein Bereitschaftssonderdienstentgelt, das heißt, einen fünfundzwanzigprozentigen Zuschlag auf das Grundgehalt. Das Lokal »LEAP« zu nennen war ein genialer Schachzug der Inhaber gewesen, denn seit dem Tag der Eröffnung wurde es von Frauen und Männern frequentiert, die fast rund um die Uhr bewaffnet waren.
Alex durchquerte den Eingang der Bar und schob sich bis zur Theke durch. An der Wand dahinter hingen zu Dutzenden Ärmelabzeichen mit den Insignien der bundespolizeilichen Behörden. Gerahmte Zeitungsberichte über die heroischen Taten von FBI, DEA, ATF, FAMS und sonstigen derartigen Organisationen schmückten die restlichen Wände.
Als Alex die Frau sah, grinste er, obwohl er sich durch ihre Gegenwart nicht beeindrucken lassen und lieber cool bleiben wollte. »Beefeater-Martini mit Eis und nicht zwei, und auch nicht vier, sondern drei dicken Oliven«, sagte sie und schaute ihm mit einem Lächeln entgegen.
»Gutes Gedächtnis.«
»Ja, und es wird stark beansprucht, wenn man bedenkt, dass Sie nie etwas anderes bestellen.«
»Wie geht’s denn so bei den Rechtsverdrehern?«
Kate Adams war die einzige Alex bekannte Barkeeperin, die zugleich als Juristin beim Justizministerium arbeitete. Sie reichte ihm den Drink. »Prima. Und wie steht’s beim Secret Service?«
»Das Gehalt wird pünktlich gezahlt, und ich komme noch zu Atem. Mehr kann ich nicht verlangen.«