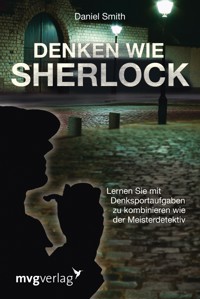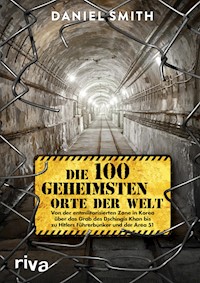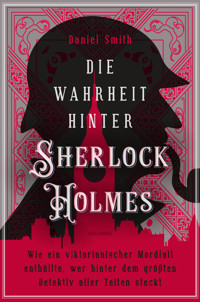
Die Wahrheit hinter Sherlock Holmes. Wie ein viktorianischer Mordfall enthüllte, wer hinter dem größten Detektiv aller Zeiten steckt E-Book
Daniel Smith
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Mord an einem jungen Offizier führte 1893 zu einem Prozess, der ganz Großbritannien in den Bann schlug und mit Joseph Bell und Henry Littlejohn zwei Pioniere der Forensik zusammenbrachte. Was bei dieser Gelegenheit bekannt wurde: Die beiden hatten Arthur Conan Doyle zur Erfindung von Sherlock Holmes und Doktor Watson inspiriert: Der berühmteste Detektiv der Welt hat seine geniale Kombinationsgabe realen Rechtsmedizinern mit innovativen Methoden zu verdanken. Dieses Buch erzählt von der faszinierenden Arbeit der beiden Männer und rollt einen spektakulären Fall auf, der Rechtsgeschichte schreiben und die Literaturgeschichte maßgeblich bereichern sollte.
- Holmes und Watson gab es wirklich
- True Detective! Die kongeniale Romanfigur basiert auf den viktorianischen Ermittlern Bell und Littlejohn!
- Sachbuch-Autor Daniel Smith rollt einen Mordfall von 1893 auf, der damals die Öffentlichkeit in Atem hielt und dessen Ermittler Doyle direkt zu Sherlock Holmes und Dr. Watson inspirierten
- »Ein fesselnder echter Kriminalfall, der ein ganz neues Licht auf die Erfindung des berühmtesten Detektivs der Literaturgeschichte wirft« Daily Mail
- »Faszinierend und fachkundig geschrieben: ein echter Mordfall, der die wahre Geschichte von Sherlock Holmes zum Leben erweckt.« Andrew Lycett, Autor von Conan Doyle: The Man Who Created Sherlock Holmes
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Daniel Smith
Die Wahrheit hinter Sherlock Holmes
Wie ein viktorianischer Mordfallenthüllte, wer hinter dem größtenDetektiv aller Zeiten steckt
Aus dem Englischenvon Felix Mayer
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und
enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte
Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung
durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung
oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in
elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und
zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlichgeschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- undData-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jeglicheunbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien erstmals 2018 unter dem TitelThe Ardlamont Mystery bei Michael O’Mara Books Limited, London. Copyright © Daniel Smith 2018, 2024Lizenzausgabe mit freundlicher Genehmigung
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind m Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe 2024 by Anaconda Verlag, einem Unternehmender Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotive: Adobe Strock / leo_d (Silhouette),Adobe Stock / Roverto (Hintergrund)
Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de
Satz und Layout: InterMedia – Lemke e. K., Heiligenhaus
ISBN 978-3-641-32424-7V001
www.anacondaverlag.de
Für Rosie, Charlotte und Ben
Inhalt
Prolog
1Die Holmes-Connection
2Verflochtene Schicksale
3Ein Gentleman und ein Gauner
4Verwicklungen
5Gemeinsam gegen das Verbrechen
6Die Leiche im Wald
7Eine exakte Wissenschaft
8Der dritte Mann
9Eine landesweite Sensation
10Zwei Männer in einem Boot
11Erdrückende Beweise
12Eine zweite Meinung
13Ein gewisser Zweifel
14Die Jury kehrt zurück
15Unverdrossen
16Noch mal davongekommen
17Wer einmal lügt …
18Eine verschleierte Liebhaberin?
19Nachspiel
Bibliografie
Danksagungen
Register
»Selbst die zwielichtigsten und verruchtesten GassenLondons haben kein so grässliches Sündenregister wiedie beschauliche und heitere Provinz. Denken Sie nuran all die teuflischen Grausamkeiten, an das Böse, dassich dort überall verbirgt und jahraus, jahrein imVerborgenen sein Werk verrichtet.«
Sherlock Holmes, Das Haus bei den Blutbuchen
Prolog
Ardlamont Estate, Argyllshire, Schottland10. August 1893
Es war kein Tag zum Jagen. Donnerschläge rollten durch das unaufhörliche Prasseln des Regens, Blitze jagten über den Himmel, und über der ganzen Gegend lag ein typisch schottischer Nebel. Doch davon ließen sich die drei unerschrockenen Männer, die hier auf die Pirsch gingen, nicht abhalten.
Kurz nach sieben Uhr morgens verließen sie das behagliche Ardlamont House, einen prachtvollen georgianischen Bau, der wie eine Oase inmitten des schroffen, mehrere Hundert Hektar großen Terrains der Halbinsel Cowal lag. Angeführt wurde das Grüppchen von Alfred Monson, der seit Beginn des Sommers auf dem Anwesen wohnte. Begleitet wurde er von einem gewissen Mr Scott, der zwei Tage zuvor in Ardlamont eingetroffen war, und Cecil Hambrough, einem schneidigen jungen Leutnant der Armee. Hambrough war erst zwanzig Jahre alt, und sein Vater hatte ihn drei Jahre zuvor zur Erziehung in Monsons Obhut gegeben, der der Sohn eines angesehenen Pfarrers mit tadellosen Verbindungen war.
Vermutlich bildete die kleine Schar einen seltsamen Anblick. Hambrough war die imposanteste Erscheinung der drei: über einen Meter achtzig groß, kräftig, von ansehnlicher Statur, mit ausgeprägter Kinnpartie, blauen Augen und dichtem, blondem Haar – ein Mann von »typisch saxonischer Schönheit«, wie die Zeitungen später schrieben. Monson seinerseits war von reiner aristokratischer Abstammung und stand in der Blüte seines Lebens. Er war dreiunddreißig Jahre alt, von gepflegtem Äußeren, glatt rasiert, stets elegant gekleidet und verströmte eine Aura von Intelligenz und Höflichkeit.
Scott dagegen war weniger eindrucksvoll. Den Nachbarn war er als ein Londoner Ingenieur vorgestellt worden; er kleidete sich ordentlich – ein Bowler thronte stolz auf seinem Kopf –, wirkte jedoch ein wenig ungehobelt. Er schien unberechenbar, und die Menschen, denen er auf seiner Reise begegnete, wussten nicht, was sie von ihm halten sollten. Vielleicht lag das daran, dass er sich in Ardlamont und der weiteren Umgebung nicht wirklich unbeschwert bewegte, an seinem etwas unordentlich wuchernden Schnurrbart oder daran, dass er Londoner Dialekt sprach. Jedenfalls entsprach er nicht der damals geläufigen Vorstellung von einem Gentleman.
Mrs Monson hatte, zusammen mit den drei kleinen Kindern und der Gouvernante, Ardlamont am frühen Morgen verlassen, um das Schiff nach Glasgow zu nehmen. Die drei Männer waren allesamt nur wenig später aufgestanden, trotz des Missgeschicks, das sie am Vorabend erlebt hatten. Sie waren im Mondlicht zum Fischen hinaus auf die Ardlamont Bay gefahren und dabei nur knapp einer Tragödie entkommen, als das Boot, in dem Monson und Hambrough saßen, leckschlug und die beiden daraufhin um ihr Leben schwimmen mussten. Doch trotz der Gefahr, der sie ausgesetzt gewesen waren, kamen sie – zusammen mit Scott, der an Land geblieben war – guter Dinge wieder zu Hause an und tranken noch bis spät in die Nacht darauf, dass sie wohlbehalten wieder zurück waren.
Als James Wright, der Butler des Hauses, kurz nach sieben Uhr aufstand, traf er im Speisezimmer Cecil Hambrough an und brachte ihm ein Glas Milch und ein Stück Gebäck. Kurz darauf verließen Monson, Hambrough und Scott das Haus für ihren morgendlichen Zeitvertreib. Sie nahmen die Straße, die am Haus vorbeiführte, überquerten eine ansteigende offene Fläche und verschwanden in dem angrenzenden Waldstück. Sie hatten sich zu einer Reihe formiert, als wollten sie Hasen aus dem Unterholz aufscheuchen.
Gegen neun Uhr waren Monson und Scott zurück im Haus, wo Wright sie an der Tür zum Speisezimmer antraf. Keiner der beiden hatte ein Gewehr bei sich, aber Scott hielt ein paar Hasen auf dem Arm, die, wie er behauptete, Hambrough erlegt habe. Dann teilte er Wright mit, dass ihr junger Begleiter auf sich selbst geschossen habe. »In den Arm, Sir?«, fragte der Butler beunruhigt. Nein, lautete die Antwort. In den Kopf. Er liege draußen im Wald, so Monson. Tot.
Monson führte den entsetzten Wright zum Schauplatz der Tragödie; mit ihnen kamen Whyte, der Gärtner, und Carmichael, der Kutscher. Hambroughs Leichnam lag auf der Böschung eines Grabens. Sein Kopf war zur linken Schulter gedreht, aus einer Wunde hinter seinem rechten Ohr rann Blut und versickerte in der Erde. Sein rechter Arm lag neben dem Oberkörper, der linke über der Brust. »Was sollen wir denn jetzt tun?«, fragte Monson aufgeregt.
»Am besten holen wir einen Arzt«, erwiderte der Butler mit versteinertem Gesicht.
Dann rollten Wright, Whyte und Carmichael die Leiche in einen Teppich, schafften sie aus dem Wald ins offene Gelände und brachten sie mit einem Karren zum Haus. Dort half Wright mit, den Leichnam ordentlich zu kleiden, bevor der ortsansässige Arzt eintraf. Das erschien als der angemessene Umgang – um ein wenig Schicklichkeit zu bewahren angesichts des Aufruhrs, den dieser grässliche und plötzliche Tod verursachte.
Die Liebhaber von Kriminalliteratur – einem Genre, das zu jener Zeit in voller Blüte stand – erinnerte der mysteriöse Tod von Cecil Hambrough möglicherweise an eine Geschichte rund um den berühmtesten fiktionalen Detektiv aller Zeiten, Sherlock Holmes. Zwei Jahre zuvor hatte das Strand Magazine Arthur Conan Doyles Erzählung Das Geheimnis von Boscombe Valley veröffentlicht. Darin zeigt ein junger Mann den Tod seines Vaters an – in dessen Gesellschaft er kürzlich noch gewesen war. Die Leiche liegt in einem Wald, »ausgestreckt auf dem Boden«. Der Sohn wird sogleich verdächtigt und verhaftet, die Fundstelle als Tatort behandelt. In Ardlamont dagegen ging man davon aus, dass Cecil Hambrough durch einen Unfall zu Tode gekommen war, und verfuhr daher mit möglichen Beweisstücken eher nachlässig. Damit begann einer der berühmtesten Kriminalfälle der Viktorianischen Zeit, ein bis heute ungelöstes Rätsel, das bei allen Beteiligten und vielen anderen Menschen verheerende Schäden hinterließ.
Besonders im Rampenlicht standen dabei zwei ehrenwerte Edinburgher Bürger, beides herausragende Persönlichkeiten der Medizin und Pioniere der Forensik: Dr Joseph Bell und Dr Henry Littlejohn. Darüber hinaus waren sie, wie der Zufall es wollte, die wichtigsten Vorbilder für die Figur des Sherlock Holmes. Zwar wurden sie weitaus später zu den Ermittlungen hinzugezogen, als Holmes das jemals gutgeheißen hätte, lieferten aber dennoch entscheidende Beweise für das, was in Ardlamont geschehen war. Cecil Hambroughs Tod stürzte die beiden in eine erbitterte Auseinandersetzung zwischen Vernunft und Wissen auf der einen Seite und Zweifel und den Abgründen der menschlichen Seele auf der anderen. Hier wurde dieser Kampf, den Sherlock Holmes während seiner glorreichen fiktionalen Laufbahn unzählige Male austrug, in der echten Welt ausgefochten.
Das mysteriöse Geschehen von Ardlamont – nicht weniger verblüffend als die Fälle, die Sherlock Holmes zu lösen hatte – machte Bell und Littlejohn zum entscheidenden Bindeglied zwischen der erdachten, von Gaslaternen erleuchteten Welt der Baker Street 221b und den faszinierenden Gefilden der kriminalistischen Ermittlung in der echten Welt, in einer Zeit, die als das erste goldene Zeitalter forensischer Ermittlungen gilt. Aber weil sich dieser Fall im echten Leben zutrug, stand – für alle Beteiligten – sehr viel mehr auf dem Spiel.
1
Die Holmes-Connection
»Die Welt ist voller Offensichtlichkeiten, die niemand je bemerkt.«
Sherlock Holmes, Das Geheimnis von Boscombe Valley
1893 hatte die Begeisterung für Sherlock Holmes höchste Höhen erreicht. Es schien, als sei die ganze Welt dem führenden »beratenden Detektiv« verfallen – mit einer beachtlichen Ausnahme: seines Schöpfers, Arthur Conan Doyle.
Der Grund für Doyles zwiespältiges Verhältnis zu seiner Figur war sein Bestreben, als mehr angesehen zu werden als nur ein Schreiberling von Kriminalgeschichten. Sein großer Traum war es, ausladende historische Romane zu schreiben, als eine Art Walter Scott seiner Zeit. Die Geschichten rund um Sherlock Holmes gingen ihm fatalerweise leicht von der Hand; gut bezahlte Bagatellen, die ihn von ernsthafteren Arbeiten wie den Romanen Micah Clarke und White Company abhielten. Während er am laufenden Band Geschichten mit Holmes’ Meisterleistungen ablieferte, um die gierige Leserschaft des Strand Magazine zufriedenzustellen, wuchs sein Frust darüber, dass man ihn in eine bestimmte Schublade steckte. Würde ihm dieses vermaledeite Blatt nur nicht so viel Geld nachwerfen, damit er immer noch mehr von diesen Reißern schrieb!
Um sich von der Tyrannei seines fiktionalen Geschöpfs zu befreien, sah Doyle, wie ein geistig umnachteter Krimineller, nur einen Ausweg. Er plante, Holmes an einem Wasserfall in den Alpen in den Tod zu stoßen. Noch bevor das Jahr zu Ende ging, sollte die Tat vollbracht werden. In der Geschichte Das letzte Problem sollte Holmes am Reichenbachfall in den Schweizer Alpen in die Tiefe stürzen, und dieser Sturz sollte ihm zum Verhängnis werden. Ein literarisches Ereignis, das eine gewaltige Erschütterung darstellen und zahllose Leser sprachlos machen würde. Und so kam es auch: Nachdem die Geschichte veröffentlicht worden war, versammelten sich in London vor dem Redaktionsgebäude des Strand Magazine zahlreiche junge Männer, die zum Zeichen ihrer Trauer schwarze Armbinden trugen.
Doch gerade als Doyle seinen berühmtesten Sohn in die Geschichte eingehen lassen wollte, rückten die beiden Männer, an die Holmes so stark angelehnt war wie an sonst niemanden, massiv ins Bewusstsein der Öffentlichkeit: zwei Beteiligte in dem Prozess, der über Jahre hinweg der am meisten diskutierte Mordprozess in der wirklichen Welt war, dem Verfahren gegen Alfred Monson. Das ohnehin schon fieberhafte Interesse daran wurde nun noch dadurch gesteigert, dass einer dieser beiden, Joseph Bell, kurz zuvor als einflussreichstes Vorbild des allseits geschätzten Bewohners der Baker Street 221b »geoutet« worden war. Dass nicht auch Henry Littlejohn in dieser Rolle gesehen wurde, belegt, wie nüchtern Bell und Littlejohn bei ihren Ermittlungen zusammenarbeiteten. Aber wie war es dazu gekommen, dass sich die Wege von Bell, Littlejohn und Doyle gekreuzt hatten?
Ihre gemeinsame Geschichte beginnt im Jahr 1876 an der Universität von Edinburgh, als Doyle dort sein Studium der Medizin aufnimmt. Bell und Littlejohn gehörten zu diesem Zeitpunkt bereits zu den angesehensten Mitgliedern der Fakultät.
Bell, geboren 1837 in Edinburgh, stammte aus einer renommierten Medizinerfamilie. Daher war es nahezu unausweichlich, dass er beruflich in die Fußstapfen seiner Altvorderen trat, und darüber hinaus besaß er (als Praktiker wie auch als Lehrer) ein natürliches und geradezu atemberaubendes Gespür für dieses Fach. 1859 schloss er sein Studium an der medizinischen Fakultät der Universität ab und arbeitete anschließend bei Professor James Syme – einem der großen Vorreiter der Chirurgie jener Zeit – als Assistenzarzt. Schon bald, im Alter von nur sechsundzwanzig Jahren, wurde er damit betraut, an der Universität Kurse in systematischer und operativer Chirurgie zu koordinieren.
Beachtlicherweise ließ er auch nach diesem fulminanten Beginn seiner Laufbahn nicht in seinem Eifer nach. Mitte des 19. Jahrhunderts war Edinburgh ein Zentrum der fortschrittlichen Medizin sowie sozialer Reformbewegungen, und als immer mehr Altgediente wie Syme in den Ruhestand gingen, wurde Bell nach und nach eine der treibenden progressiven Kräfte. Nicht nur bildete er seine Studenten auf höchstem Niveau aus, sondern er war auch darum bemüht, die Arbeitsbedingungen in der Medizin weiterzuentwickeln und zu verbessern. So setzte er sich etwa ganz besonders für die Krankenschwestern ein; er erkannte, wie wichtig sie waren, um die Patienten bestmöglich zu versorgen, und betrachtete sie daher nicht mehr, wie es bis dahin üblich gewesen war, als niedere Handlangerinnen. Seine Bestrebungen, der professionellen Pflege mehr Anerkennung zu verschaffen, machten ihn zum Freund und Vertrauten von Florence Nightingale, und 1887 widmete er ihr sogar sein Buch Some Notes on Surgery for Nurses (»Chirurgie für Krankenschwestern«). Darüber hinaus war er Präsident des Royal College of Surgeons in Edinburgh, trat dafür ein, dass Frauen an der medizinischen Fakultät zugelassen wurden, war Leitender Chirurg am Royal Hospital for Sick Children (das 1860 eröffnet wurde, nachdem er selbst und etliche seiner Kollegen, darunter Henry Littlejohn, jahrelang dafür gekämpft hatten) und gab nicht zuletzt fast fünfundzwanzig Jahre lang das Edinburgh Medical Journal heraus. Abgesehen von der Medizin war er ein treuer Kirchgänger und Friedensrichter und bekleidete den Rang eines stellvertretenden Leutnants (war also der handverlesene Assistent des persönlichen Statthalters der Queen im County Edinburgh). Kurz gesagt, er war in vielerlei Hinsicht aktiv, stets beseelt von dem aufrichtigen Bestreben, die Lebensbedingungen seiner Mitbürger zu verbessern.
Henry Littlejohn war zwar elf Jahre älter als Bell, aber keineswegs weniger umtriebig. Auch er war aus Edinburgh gebürtig, doch sein Weg zur Medizin war bei Weitem nicht so vorgezeichnet wie bei Bell. Sein Vater war Bäckermeister, und als siebtes von neun Kindern hätte Henry durchaus in der Menge untergehen können. Doch seine Leidenschaft für die Medizin setzte sich durch, und 1847 schloss er an der Universität von Edinburgh sein Studium ab. Im Anschluss arbeitete er ein Jahr lang auf dem europäischen Festland, kehrte dann in seine Heimatstadt zurück und trat eine Stelle als Assistenzarzt in der Pathologie des Krankenhauses Edinburgh Royal Infirmary an.
Bei dieser Tätigkeit lernte Littlejohn den Tod gründlich kennen, in all seinen unterschiedlichen und oft grauenvollen Formen. Daher lag es nahe, dass er 1854 Amtsarzt der Polizei von Edinburgh wurde, was sich als äußerst zeitraubende Stelle erwies. Nicht nur war er verantwortlich für die medizinische Versorgung sämtlicher Beamter und Häftlinge, sondern auch eine der ersten Anlaufstellen für Polizisten, die in schwerwiegenden Angelegenheiten ermittelten, seien es Unfälle oder Verbrechen. Regelmäßig zog man ihn zu Rate und bat ihn, forensische Untersuchungen durchzuführen – zu einer Zeit, in der die Forensik noch in den Kinderschuhen steckte – oder Obduktionen vorzunehmen. Auch an den schottischen Gerichten ging er ein und aus, wo er Beweise vorlegte und seine Expertenmeinung vortrug, in Fällen aller Art, von verheerenden Zugunglücken über sexuelle Übergriffe bis zum Kindsmord. Er war bei buchstäblich jedem bedeutenden Kriminalprozess dabei, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Edinburgh geführt wurde, und erhielt dadurch einen umfassenden Einblick in Schottlands dunkle Seiten, den nur wenige Menschen im selben Maß bekamen und um den ihn noch weniger Menschen beneideten.
Seine Arbeit als Polizeiarzt machte ihn stadtweit bekannt, und seine Berühmtheit wuchs noch, als er 1862 zum ersten Gesundheitsdezernenten der Stadt Edinburgh ernannt wurde, mit der Aufgabe, für die Gesundheit und die Sicherheit der allgemeinen Bevölkerung zu sorgen. Diese neu geschaffene Stelle war auch eine Reaktion auf den Einsturz eines Mietshauses an der High Street, der im Jahr zuvor fünfunddreißig Todesopfer gefordert hatte. Obwohl Littlejohn durch seine Tätigkeit bei der Polizei ohnehin bereits stark beansprucht war, ging er seine neue Aufgabe mit außergewöhnlichem Tatendrang an; ja, hier sollte er sogar die Arbeit leisten, für die er dann vor allem bekannt wurde.
1865 veröffentlichte er eine richtungweisende Studie, Report on the Sanitary Conditions of the City of Edinburgh (»Bericht über die hygienischen Zustände in der Stadt Edinburgh«). Trotz seines staubtrockenen Titels löste dieser Zustandsbericht eine Generalsanierung der Stadtlandschaft aus, die geradezu einer Revolution gleichkam. In lebhaften Farben schilderte Littlejohn die Armut und die Verwahrlosung, in der die Bewohner lebten, erläuterte, welchen überfüllten, dreckigen Lebensraum die Stadt darstellte, und legte ausführlich dar, wie all diese Faktoren dazu führten, dass immer mehr Menschen in schlechtem gesundheitlichem Zustand waren. Dieser Bericht gab den Anstoß dafür, dass die kommunalen Behörden 1867 den Edinburgh City Improvements Act verabschiedeten, ein Gesetz, das die Räumung von Elendsvierteln vorsah, den Bau eines neuen und deutlich wirkungsvolleren Abwassersystems sowie die Errichtung breiter Hauptstraßen, die Edinburgh noch heute zu einer besonders vornehmen und attraktiven Metropole machen. Wie nur wenige andere kann Henry Littlejohn für sich in Anspruch nehmen, das Gesicht der Stadt, in der er lebte, nachhaltig verändert zu haben.
Doch damit war die Reihe seiner bedeutenden Errungenschaften noch nicht beendet. So sagte er etwa den Infektionskrankheiten den Kampf an, die die arme Bevölkerung der Stadt, welche durch die Zeitläufte dazu gezwungen war, auf engstem Raum zu leben, schon seit vielen Jahren heimsuchten. Zu diesem Zweck gründete er nicht nur ein Krankenhaus für Menschen, die an diesen Krankheiten litten, sondern sorgte auch federführend für eine Gesetzesänderung, in deren Folge jeder Fall einer Infektionskrankheit den Behörden gemeldet werden musste. Darüber hinaus war er leitender Berater des Board of Supervisors, des Gremiums, das ab 1873 die oberste städtische Behörde für öffentliche Gesundheitsfürsorge war. Und als wäre das alles noch nicht genug, war er Vorsitzender der Schottischen Gesellschaft zur Verhütung von Gewalt gegen Kinder und gründete die Schottische Gesellschaft zur Reform des Bestattungswesens. Den schlagendsten Beweis für die Auswirkungen dieser Maßnahmen liefert ein Blick auf die nackten Zahlen: Von den 1860er-Jahren bis zur Jahrhundertwende fiel die Sterblichkeitsrate in der Stadtbevölkerung von 34 pro tausend Einwohnern auf 14.
Sowohl Bell als auch Littlejohn leisteten dem Gemeinwesen unschätzbare Dienste und waren auf dem Gebiet der Medizin vielfache Wegbereiter – Männer von dem Schlag, wie man sie braucht, um ein Empire zu errichten. Und für den jungen Arthur Conan Doyle waren sie darüber hinaus inspirierende Lehrer, die zu geistigen Höchstleistungen fähig waren. Insbesondere Joseph Bell würzte seine Vorlesungen mit schwindelerregenden Beispielen deduktiver Schlussfolgerungen, die Doyle sich eifrig notierte und später in die Figur des Sherlock Holmes einfließen ließ. Littlejohn seinerseits hielt außerhalb des akademischen Betriebs Vorträge über Forensik und brachte so seinen Zuhörern ein Thema nahe, das seiner Einschätzung nach bis dahin weitgehend außer Acht gelassen worden war.
Littlejohn war der geborene Unterhaltungskünstler. Auch im fortgeschrittenen Alter bewahrte er sich seine schlanke und jugendliche Gestalt und war mit seiner charakteristischen Kleidung – Zylinder und Gehrock – überall in der Stadt leicht zu erkennen. Außerdem war er mit einem ansteckenden Sinn für Humor und einem schalkhaften Funkeln in den Augen gesegnet. So machte er sich etwa gern einen Spaß daraus, sich zwischen zwei Straßenbahnhaltestellen zu postieren und dann auf den vorüberfahrenden Wagen aufzuspringen, nur um unaufmerksamen Beobachtern einen Schrecken einzujagen. Das machte er so häufig, dass die Straßenbahnfahrer irgendwann wussten, dass sie nicht langsamer zu werden brauchten, wenn er in Sichtweite kam, da sie sicher sein konnten, dass er unbeschadet an Bord klettern würde, auch wenn die Passanten glaubten, hier ereigne sich gerade ein Unglück.
Auch im Vorlesungssaal zeigte sich seine Neigung zur Selbstinszenierung. Als ausgewiesener Fachmann auf den Gebieten der Pathologie, der Toxikologie und anderen gerichtsmedizinischen Feldern begann er 1855, Vorlesungen in forensischer Medizin zu halten (also jenem Zweig der Medizin, der sich der Untersuchung von Kriminalfällen widmet). Hatte er mit gerade einmal zwanzig Studenten begonnen, so hatten seine Vorträge in den 1880er-Jahren einen solchen Bekanntheitsgrad erlangt, dass regelmäßig über zweihundertfünfzig Zuhörer kamen. Er stützte sich auf seine persönlichen Erfahrungen, die er bei polizeilichen Ermittlungen und Strafprozessen gemacht hatte, und trug im Rahmen seiner Ausführungen die aktuellsten Gedanken und Theorien vor. So war er etwa ein großer Fürsprecher der kriminalistischen Verwendung von Fingerabdrücken – einer Technik, die damals noch in den Anfängen steckte – und setzte sich schon früh für die Beweisführung mithilfe von Fotografien ein. Sein breit gefächertes Wissen vermittelte er anschaulich und humorvoll, und er suchte stets nach neuen Wegen, um seine Vorlesungen lebhaft zu gestalten. Besuche von Gerichtsverhandlungen und Exkursionen zu echten Tatorten zählten sowohl für Littlejohn selbst als auch für seine Studenten zu den Höhepunkten.
Zwar hat Doyle nie öffentlich bestätigt, dass er Littlejohns Vorlesungen gehört hat, doch es ist eigentlich kaum vorstellbar, dass er sich die Gelegenheit hat entgehen lassen, in der Edinburgher Surgeons’ Hall diese Vorträge über forensische Medizin zu hören. Außerdem war Littlejohn eng mit Bell befreundet, und Bell war für Doyle während dessen Studienzeit in Edinburgh sein wichtigster Mentor. Auch wenn Doyle nicht selbst den Weg zu Littlejohns Vorlesungen gefunden hätte – was äußerst unwahrscheinlich ist –, so hätte Bell ihm deren Besuch mit Sicherheit nahegelegt. Und während Littlejohn vielleicht der mitreißendere der beiden Dozenten war, so war Bell für sein ganz eigenes theatralisches Auftreten bekannt, das die Studententage von Doyle und etlicher seiner Zeitgenossen bereicherte.
Wegen seines schmalen, spitz zulaufenden Gesichts, seines glänzenden, gepflegten weißen Haars und seiner blauen Augen mit dem durchdringenden Blick wurde Bell häufig mit einem Adler verglichen. Dieser Vergleich war auf seltsame Weise zutreffend, angesichts seiner außergewöhnlichen Art, sich auf die Fakten und die Wahrheit herabzustürzen, als wären sie seine Beute. Er war der festen Überzeugung, ein Arzt müsse seine Beobachtungsgabe fortlaufend schärfen, damit ihm auch nicht das kleinste Detail entging, das möglicherweise bei der Diagnosestellung helfen könnte. Er selbst hielt sich konsequent an diese Maxime, und seine Schemata für deduktive Herleitungen wurden legendär.
Dr Harold Jones, ein Zeitgenosse Doyles, berichtete Jahre später davon, wie Bell seine Schützlinge ermunterte: »Nutzen Sie Ihre Augen […] Nutzen Sie Ihre Ohren, Ihr Gehirn, Ihre geschärfte Wahrnehmung, und nutzen Sie Ihre Fähigkeit zur Deduktion.« Bei einer denkwürdigen Vorlesung ließ er einmal einen Patienten hereinführen und forderte einen der Studenten auf, eine Diagnose zu stellen. Der arme Bursche mühte sich ab, um die korrekte Antwort zu finden, und kam zu dem Schluss, der Mann leide an einer Erkrankung der Hüftgelenke. Bell lehnte sich in seinem Sessel zurück und stützte das Kinn auf die aneinandergepressten Fingerspitzen. »Hüfte – pah!«, sagte er in einem Ton, der jedes Selbstbewusstsein auslöschen musste. »Dass der Mann hinkt, hat nichts mit der Hüfte zu tun, sondern mit den Füßen. Hätten Sie genau hingesehen, so hätten Sie die Schlitze in den Schuhen bemerkt. Sie stammen von einem Messer und liegen dort, wo der Schuh am stärksten gegen den Fuß drückt. Dieser Mann hat Hühneraugen, Gentlemen, und durchaus kein Hüftleiden. Aber er ist nicht wegen seiner Hühneraugen hier. Seine Beschwerden sind weitaus schwerwiegender. Was Sie hier sehen, Gentlemen, ist ein Fall von chronischem Alkoholmissbrauch. Die gerötete Nase, das aufgedunsene, schwammige Gesicht, die blutunterlaufenen Augen, das Zittern in den Händen und die zuckenden Gesichtsmuskeln, das rasche Pulsieren in den Arterien an den Schläfen – all das sind Anzeichen hierfür. Jedoch muss diese Schlussfolgerung von konkreten und unanfechtbaren Beweisen bestätigt werden. In diesem Fall wird meine Diagnose dadurch bestätigt, dass aus der rechten Manteltasche des Patienten der Hals einer Whiskyflasche herausragt […] Denken Sie immer daran, Ihre Schlussfolgerungen durch Tatsachen zu bekräftigen.«
Ein anderes seiner Spielchen begann damit, dass er im Hörsaal ein Reagenzglas mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit herumgehen ließ. Dabei handele es sich, so Bell, um eine stark wirkende Substanz von äußerst bitterem Geschmack, und um die Beobachtungsgabe jedes einzelnen Studenten zu testen, bat er sie, die Flüssigkeit einer nach dem anderen zu kosten. Da er aber, so betonte er, Wert auf Fairness lege, verlange er von ihnen nichts, was er nicht auch selbst tun würde. Daraufhin tauchte er einen Finger in das Gebräu, steckte ihn sich in den Mund und zog ein angewidertes Gesicht. Alle im Raum taten es ihm gleich, sodass sich schon bald sämtliche Gesichter rundherum auf die unterschiedlichsten Arten verzogen. Während Bell die Studenten beobachtete, musste er innerlich grinsen. »Gentlemen, Gentlemen«, sagte er, »tief betrübt muss ich feststellen, dass bis jetzt keiner von Ihnen die Kraft der Wahrnehmung, die Gabe der Beobachtung entwickelt hat, von der ich so häufig spreche. Denn hätten Sie mich aufmerksam beobachtet, so hätten Sie bemerkt, dass es mein Zeigefinger war, den ich in dieses widerwärtige Gebräu gesteckt habe, dass es aber mein Mittelfinger war – o ja! –, der seinen Weg in meinen Mund gefunden hat.«
Bell hatte so großes Vertrauen in seine Beobachtungsgabe, dass er sich sogar darauf verließ, wenn unwiderlegbare Beweise vorlagen. So berichtete er etwa gerne davon, wie er einmal vor einer Gruppe aufmerksamer Studenten einige vorläufige Schlüsse bezüglich des Gesundheitszustandes eines Patienten gezogen hatte. Er verkündete seiner versammelten Zuhörerschaft, dass der eher klein gewachsene Mann, der in leicht angeberischer Haltung hereinstolziert war, vermutlich Musiker in einem Highland-Regiment sei. Das Stolzieren, so Bell, sei charakteristisch für Dudelsackspieler, und das allgemeine Auftreten des Mannes weise auf eine militärische Prägung hin. Und angesichts seiner geringen Körpergröße scheine es naheliegend, dass er Musiker sei. Als er den Patienten fragte, ob er mit seiner Einschätzung richtigliege, war er kurzzeitig vor den Kopf gestoßen, als der Mann sagte, er sei Schuhmacher. Bell war jedoch davon überzeugt, dass sein erstes Urteil zutreffend war, und bat zwei seiner Assistenten, den Mann in ein Nebenzimmer zu bringen. Nachdem er seine Zuhörer entlassen hatte, ging er zu dem Patienten und bat ihn, den Oberkörper freizumachen. Da entdeckte er unter der linken Brust ein kleines, blaues D, das in die Haut gebrannt war – D für »Deserteur«. Das war die Erklärung dafür, dass der Mann seine militärische Vergangenheit unterschlagen hatte.
Der Lehrer Bell und der Student Doyle knüpften rasch Kontakt, und Bells Techniken machten auf den jungen Mann nachhaltigen Eindruck. Etwa bei diesem Gespräch, von dem Bell später berichtete:
Einmal war er besonders fasziniert. Ich betrat das Zimmer, setzte mich und sagte: »Guten Morgen, Pat«, denn es war unübersehbar, dass der Patient Ire war. »Guten Morgen, Herr Professor«, erwiderte er. »Hatten Sie heute Morgen einen angenehmen Weg über den Golfplatz?«, fragte ich. »Denn Sie sind ja von Süden in die Stadt gekommen.« »Ja«, sagte Pat. »Hat der Herr Professor mich denn gesehen?« Conan Doyle konnte nicht nachvollziehen, woher ich das wusste, obwohl es geradezu lächerlich einfach war. An einem regnerischen Tag wie jenem färbt die rötliche Erde der unbegrünten Abschnitte des Golfplatzes auf die Schuhe ab, und Spuren davon bleiben daran haften. Und diese rötliche Erde gibt es im Umkreis von mehreren Meilen nirgendwo sonst. Dieser Fall und noch ein paar andere stießen bei Doyle auf größtes Interesse, und er fing an, sich auf ähnliche Weise zu üben, was natürlich genau das war, was ich mir von ihm und meinen anderen Studenten wünschte.«
Aber auch Bell war umgekehrt von seinem Studenten schwer beeindruckt. An den jungen Doyle erinnerte er sich so: »Ich sah in ihm immer einen der besten Studenten, die ich je hatte. Er war über die Maßen interessiert an allem, was mit der Diagnosestellung zu tun hatte, und wurde nie müde, all die Details aufzuspüren, nach denen wir suchten.« Dass Bell seinen Schützling nicht nur zu den Besten unter den Medizinstudenten jener Zeit zählte, sondern ihn auch aktiv förderte, zeigt sich daran, dass er Doyle in seiner Ambulanz anstellte. Das ermöglichte Doyle, die Techniken seines Lehrers aus nächster Nähe zu studieren, und je mehr er davon kennenlernte, desto beeindruckter war er. Bell erinnerte sich so an diese Zeit: »Doyle machte sich ständig Notizen. Er wollte alles aufschreiben, was ich sagte. Wenn der Patient das Sprechzimmer verlassen hatte, bat er mich oft, meine Beobachtungen zu wiederholen, damit er sicherstellen konnte, dass er sie korrekt notiert hatte.«
1880 verließ Doyle Edinburgh und arbeitete kurz als Schiffsarzt auf einem Walfänger, der in der Arktis kreuzte, wobei ein Sturz über Bord ihn fast das Leben kostete. Ein zweiter Einsatz auf einem Fracht- und Passagierschiff nach Westafrika war ein nicht weniger turbulentes Abenteuer: Das Schiff wurde durch Stürme schwer beschädigt, Doyle erkrankte an Typhus, und als das Schiff wieder den sicheren Hafen von Liverpool erreichte, ging der Rumpf in Flammen auf. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Doyle sich anschließend für ein beschaulicheres Dasein entschied: als Allgemeinarzt in Southsea in der Nähe von Portsmouth an der englischen Südküste. Doch das Leben als Arzt genügte ihm nicht. Zum einen liefen seine Geschäfte nicht so gut, dass er seiner finanziellen Sorgen ledig geworden wäre. Aufgrund seiner Herkunft – sein Vater war Illustrator und hatte seine Karriere durch Alkohol und psychische Probleme ruiniert – war Geld für Doyle ein wichtiger Punkt. Als er 1883 seine Steuererklärung einreichte, aus der hervorging, dass er so wenig verdiente, dass er nicht steuerpflichtig war, schickte ihm das Finanzamt die Unterlagen zurück, auf denen der Vermerk »höchst unbefriedigend« prangte. Doyle reichte die Unterlagen erneut ein, versehen mit dem Kommentar: »Stimme vollauf zu.«
Doch nicht nur verschaffte ihm sein Beruf nicht die gewünschte finanzielle Sicherheit, sondern er hegte auch den starken Wunsch, seinen Lebensunterhalt mit dem Schreiben zu verdienen. Er hatte bereits erste Erfolge verzeichnen können und noch als Student seine erste Erzählung veröffentlicht (im Chambers’s Edinburgh Journal). 1885 spielte er zum ersten Mal mit dem Gedanken, sich an Detektivgeschichten zu versuchen. Er liebte dieses Genre – insbesondere den legendäre Ermittler Dupin, die Schöpfung von Edgar Allen Poe –, und obwohl es in der literarischen Welt noch kein Ansehen genoss, ahnte Doyle, dass er eine gewisse Begabung dafür hatte. Während er Ideen für einen Detektivroman sammelte, schwirrte immer wieder Joseph Bell durch seine Gedanken. »Ich dachte dabei an meinen ehemaligen Lehrer Joe Bell«, schrieb er später, »an sein Adlergesicht, an sein eigenartiges Auftreten, an seine unheimlichen Methoden, mit denen er Details aufspürte. Wäre er ein Detektiv, würde er dieses faszinierende, aber unorganisierte Geschäft mit Sicherheit zu einer exakten Wissenschaft machen.«
Ein Jahr später hatte er die Grundidee zu einer Kriminalgeschichte – in deren Zentrum Joseph Bell stand – im Wesentlichen formuliert und entwickelte sie zu Sherlock Holmes’ erstem Fall, dem Roman Eine Studie in Scharlachrot, der 1887 in Beeton’s Christmas Annual erschien. 1890 bekam Holmes in dem Roman Das Zeichen der Vier seinen zweiten Auftritt. Als Doyle dann die Abenteuer von Sherlock Holmes in die Form von Erzählungen brachte, die ab 1891 im Strand Magazine erschienen, explodierte die Begeisterung für den Meisterdetektiv geradezu. Schon bald war Doyle der am besten bezahlte Schriftsteller des Landes, und alles rund um seine literarische Schöpfung stieß auf gesteigertes Interesse. Dazu gehörte auch die Frage, ob es für Holmes ein Vorbild in der Wirklichkeit gab.
Falls Doyle versuchte, die Katze im Sack zu lassen, war er dabei ausgesprochen glücklos. Als 1892 die ersten zwölf Erzählungen in dem Sammelband Die Abenteuer des Sherlock Holmes erschienen, widmete er das Buch »Meinem ehemaligen Lehrer Joseph Bell«, der es im Gegenzug in der Zeitschrift TheBookman wohlwollend besprach. Auch wer kein Meisterdetektiv war, konnte die Verbindung zwischen dem Autor, seiner Schöpfung und seinem früheren Mentor leicht erkennen. Bereits etliche Monate zuvor, in einem Interview mit Raymond Blathwayt für The Bookman vom Mai 1892, hatte Doyle einen Hinweis darauf gegeben, wer ihn zu der Figur des Sherlock Holmes inspiriert hatte: »Sherlock Holmes ist sozusagen die literarische Verkörperung meiner Erinnerungen an einen Medizinprofessor an der Edinburgh University, der oft im Wartezimmer saß, keine Miene verzog und schon eine Diagnose stellte, wenn die Patienten gerade hereingekommen waren und noch kein Wort gesagt hatten.« Im selben Monat gestand Doyle Bell in einem Brief, dass er ihn in seinen Werken verewigt hatte:
Mein lieber Bell,
meinen Sherlock Holmes verdanke ich ganz ohne Zweifel Ihnen, und obwohl mir die Geschichten erlauben, ihn in die unterschiedlichsten erzählerischen Zusammenhänge zu stellen, glaube ich doch nicht, dass sein analytisches Vorgehen eine wie auch immer geartete Übertreibung der Techniken darstellt, die ich an Ihrer Arbeit in der Ambulanz beobachten konnte. Um die Trias aus Ableitung, Schlussfolgerung und Beobachtung herum, die Sie mir so nachhaltig eingeschärft haben, habe ich versucht, eine Persönlichkeit zu erschaffen, die immer so weit geht, wie es möglich ist – und gelegentlich auch darüber hinaus –, und ich bin von Herzen froh, dass das Ergebnis Sie zufriedenstellt, der Sie alles Recht hätten, der schärfste Kritiker zu sein.«
Wer mit Bells Praktiken einigermaßen vertraut war, konnte auch an den Geschichten selbst ablesen, dass er für Holmes Pate gestanden hatte, wie etwa in folgendem Beispiel: erst eine Probe von Bells deduktivem Denken, die schriftlich festgehalten wurde, und dann ein Gespräch zwischen Holmes und seinem nicht weniger scharfsinnigen Bruder Mycroft aus der Erzählung Der griechische Dolmetscher aus dem Jahr 1893. Bell wurde, wie üblich, ein Patient vorgestellt, von dem er nicht das Geringste wusste. Dann entwickelte sich folgendes Gespräch:
Bell: Nun, mein Guter, ich sehe, Sie haben gedient.
Patient: Jawohl, Sir.
Bell: Erst vor Kurzem entlassen?
Patient: So ist es, Sir.
Bell: In einem Highland-Regiment?
Patient: Jawohl, Sir.
Bell: Als Unteroffizier.
Patient: Jawohl, Sir.
Bell: Stationiert in Barbados.
Patient: Jawohl, Sir.
Bell: Wie Sie sehen, Gentlemen, haben wir es hier mit einem Mann zu tun, der anderen respektvoll begegnet. Allerdings hat er den Hut nicht abgenommen. Das ist in der Armee nicht üblich, und wäre er schon vor längerer Zeit aus dem Dienst entlassen worden, hätte er sich inzwischen die zivilen Umgangsformen angeeignet. Er strahlt eine gewisse Autorität aus und ist offenkundig Schotte. Und Barbados, weil er an Elefantiasis leidet, einer Erkrankung, die man sich auf den westindischen Inseln zuzieht, nicht jedoch in Großbritannien.
Zwar hat Doyle diesen Dialog nicht direkt abgeschrieben und in Der griechische Dolmetscher verwendet, aber die Parallelen sind unübersehbar. In einer Szene der Geschichte sitzen Sherlock und Mycroft in einem Erker in Mycrofts exklusivem Londoner Club.
»Wer die Menschen erforschen will, könnte keinen besseren Ort als diesen hier finden«, sagte Mycroft. »Sieh dich nur um: all diese herrlichen Exemplare! Etwa dort die beiden Männer, die gerade auf uns zukommen.«
»Der Billardmarkör und der andere?«
»Die meine ich. Was fällt dir an dem anderen auf?«
Die beiden Männer waren gegenüber dem Fenster stehen geblieben. Nur an einem von ihnen entdeckte ich Anzeichen, die auf Billard hinwiesen, ein paar Kalkspuren über der Westentasche. Der andere war sehr klein und von dunklem Teint, hatte den Hut in den Nacken geschoben und trug ein paar Päckchen unter dem Arm.
»Ein ehemaliger Soldat, wie mir scheint«, meinte Sherlock.
»Der erst kürzlich aus dem Dienst entlassen wurde«, merkte sein Bruder an.
»Hat offenkundig in Indien gedient.«
»Und zwar als Unteroffizier.«
»In der Artillerie, würde ich sagen.«
»Und er ist Witwer.«
»Aber er hat ein Kind.«
»Kinder, mein Lieber, Kinder.«
»Aber meine Herren«, warf ich lachend ein. »Das ist jetzt ein bisschen zu viel des Guten.«
»Nun«, erwiderte Holmes, »das war nun wirklich nicht schwer. Ein Mann mit diesem Auftreten, dieser autoritären Ausstrahlung und diesem sonnengegerbten Gesicht ist offenkundig Soldat, höherrangig als ein Gefreiter, und er war noch bis vor Kurzem in Indien.«
»Dass er erst kürzlich den Dienst quittiert hat, zeigt sich daran, dass er noch immer seine Kommissstiefel trägt, wie man diese Schuhe nennt«, bemerkte Mycroft.
»Er hat nicht den Gang eines Kavalleristen und pflegt den Hut leicht geneigt zu tragen, worauf die hellere Haut auf einer Seite seiner Stirn hinweist. Für einen Pionier ist er zu schmächtig. Also war er in der Artillerie.«
»Und seine von Trauer geprägte Miene lässt erkennen, dass er jemanden verloren hat, der ihm lieb und teuer war. Dass er seine Einkäufe selbst besorgt, legt nahe, dass es sich dabei um seine Frau handelt. Wie Sie sehen, hat er Spielsachen gekauft. Unter anderem eine Rassel, was belegt, dass eines der Kinder noch sehr klein ist. Vermutlich starb die Frau im Wochenbett. Das Bilderbuch, das er unter dem Arm trägt, lässt darauf schließen, dass er noch für ein zweites Kind zu sorgen hat.«
Sherlock ist offenkundig Bell hoch x. Der erste, der – im Juni 1892 – diese Verbindung erkannte, war Harry How, ein gewiefter Journalist des Strand Magazine, der immer auf der Suche nach dem nächsten Scoop war. Doyle informierte Bell umgehend, dass er entlarvt worden war und sich für das gewaltige Interesse wappnen sollte, das ihm schon bald entgegenschlagen würde; so sollte er etwa »mit wahnwitzigen Briefen treuer Leser« rechnen, die ihn bitten würden, ihnen zu helfen, »ihre unverheiratete Tante vor dem sicheren Hungertod zu bewahren, weil mordlustige Nachbarn sie im Dachboden eingesperrt und die Tür verplombt« hätten.
Wie Bell mit dieser plötzlichen Berühmtheit umging, ist nicht überliefert. Gegenüber Freunden und Angehörigen ließ er anklingen, dass er diesen Trubel eher lästig fand, und einige der dümmlicheren Seiten der Holmes-Begeisterung stellten seine Geduld vermutlich arg auf die Probe. Doch störte ihn das Geschehen auch nicht so sehr, dass er sich gegenüber der Presse nicht in Interviews über die Parallelen zwischen ihm und dem großen Detektiv geäußert hätte. Außerdem verfasste er 1892 eine Einleitung zu einer Neuausgabe von Eine Studie in Scharlachrot. Und auch hinter den Kulissen schmierte er weiterhin die Sherlock-Holmes-Maschine, indem er Doyles Bitte nachkam und ihm bei der Entwicklung der Handlungen half. Einmal schlug er eine Geschichte vor, in der der Mörder Keime verwendete, mit Verweis darauf, ihm sei ein echter Fall bekannt, der sich mehr oder weniger so zugetragen habe. Doyle lehnte die Idee ab, da das Publikum noch nicht reif für so eine grauenerregende Story sei. (1917 sollte er das Thema dann aber in der Erzählung Der sterbende Sherlock Holmes wieder aufgreifen.) »Der Kluge von uns beiden ist Doyle. Diese Ehre gebührt nicht mir«, sagte Bell in einem Interview über seinen Anteil an der Figur Sherlock Holmes. Doch das war natürlich nur falsche Bescheidenheit.
Als dann das allgemeine Interesse an dem mysteriösen Todesfall von Ardlamont seinen Höhepunkt erreicht hatte, beschloss Bell, die Öffentlichkeit davon zu unterrichten, dass er nicht nur das medizinische Alter Ego von Sherlock Holmes war, sondern auch schon seit Jahrzehnten im echten Leben an der Ermittlung in Kriminalfällen mitwirkte. »Seit mittlerweile über zwanzig Jahren bin ich nun im Dienste der Staatsanwaltschaft rechtsmedizinisch tätig«, sagte er in einem Interview mit der Pall Mall Gazette und fügte hinzu: »Doch darüber kann ich ihnen wenig berichten. Es wäre unangemessen, Dinge publik zu machen, die zu den vertraulichen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft gehören sowie all jener, die an diesen Vorgängen beteiligt sind […]«. Also hatte das reale Vorbild für Holmes noch mehr mit dem Detektiv gemeinsam, als man bis dahin vermutet hatte. »Alle Methoden der Deduktion, der Schlussfolgerung und dergleichen, die in den Dienst der Behörden zu stellen meine Aufgabe ist, sind ganz simple, banale Vorgänge«, erklärte er mit dem für ihn typischen Understatement. Dann legte er dar, wie die Beobachtungsgabe, die Doyle während seiner Zeit an der Universität so oft am Werk hatte sehen können, auch eine polizeiliche Untersuchung voranbringen konnte:
Das nicht zu überschätzende Gewicht unscheinbarer Unterschiede, die schier endlosen Bedeutungsmöglichkeiten von Kleinigkeiten. Die allermeisten Menschen, Vorfälle und Kriminalfälle ähneln einander im Großen und Ganzen. So besitzen etwa die meisten Menschen einen Kopf, zwei Arme, eine Nase, einen Mund und eine bestimmte Anzahl von Zähnen. Es sind die kleinen Unterschiede – die für sich genommen belanglos sind –, wie etwa ein herabhängendes Augenlid oder dergleichen, durch die sich die Menschen voneinander unterscheiden.
Schließlich nannte er den Grund dafür, dass er ein Werkzeug der Polizei geworden war: seine Freundschaft mit Henry Littlejohn. »Ich muss an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Dr Littlejohn der Berater der Staatsanwaltschaft in medizinischen Belangen ist. Weil er bei dieser Arbeit gerne einen zweiten Mann an seiner Seite hat und wir sehr eng befreundet sind, haben wir nun in über zwanzig Jahren eine Unzahl von Fällen begleitet. Schon lange ist es für ihn eine Selbstverständlichkeit, mich zu Ermittlungen hinzuzuziehen. Ich selbst habe keinerlei offizielle Verbindungen zur Staatsanwaltschaft.«
Auffällig ist, dass Doyle bereitwillig zugab, welchen Einfluss Bell auf die Erschaffung der Figur des Sherlock Holmes hatte, aber zu Littlejohns Lebzeiten niemals dessen Verdienste würdigte. Es wäre abwegig zu glauben, dass Littlejohn in Doyles Vorstellungskraft, während dieser die Idee eines literarischen Detektivs entwickelte, keine bedeutende Rolle gespielt haben soll. Zweifelsohne war Bell in Edinburgh Doyles wichtigster Lehrer und Berater, aber Bell und Littlejohn verband eine wahrhaft enge Freundschaft; so schenkte Littlejohn etwa in späteren Jahren Bell einen großen Silberbecher mit der Gravur »In Erinnerung an eine unverbrüchliche Freundschaft«. Und weil Doyle nicht nur einer von Bells Lieblingsstudenten war, sondern auch sein Assistent, muss er auch mit Littlejohn regelmäßig in Kontakt gewesen sein. Auch als Student, der sich mit Kriminalistik und Verbrechen beschäftigte, hätte er mit Sicherheit aktiv den Kontakt zu dem Mann gesucht, der immerhin offiziell das Amt des Polizeiarztes bekleidete und der führende Kopf der schottischen Rechtsmedizin war. Und schließlich musste ihm bekannt sein, dass Bell ihn regelmäßig bei seiner Arbeit für die Polizei begleitete. Kurz gesagt, Littlejohn war ohne Zweifel das zweite wichtige Vorbild für Sherlock Holmes.
Während Bell das Modell für Holmes’ logische Schlussfolgerungen lieferte, stellte Littlejohn den Prototypen eines rebellischen Vorreiters der Forensik dar. Im Jahr 1900 schrieb Harold Jones in einem Artikel für das mittlerweile eingestellte Magazin Tit-Bits: »Während Joseph Bell der echte Sherlock Holmes ist, hatte noch ein zweiter Professor aus Edinburgh sozusagen die Finger im Spiel. Joseph Bell ließ in Doyle das Bild von Holmes’ Persönlichkeit reifen; der zweite Mann, der ihm, möglicherweise ohne es zu wissen, vorführte, wie er diese Persönlichkeit kriminalistischen Untersuchungen anpassen konnte, war Sir Henry Littlejohn.« Doch Doyle selbst verwies, soweit überliefert ist, nur ein einziges Mal auf den Polizeiarzt, und zwar in einer Rede, die er 1929 in Nairobi vor Absolventen der Universität von Edinburgh hielt und über die kaum berichtet wurde. Laut einem Bericht im East African Standard stellte Doyle Überlegungen zu den ungenügenden Methoden der Detektivarbeit an, wie er sie in seiner Jugend in so vielen Werken der Kriminalliteratur kennengelernt hatte, und sagte dann, dass »weder Joe Bell noch Littlejohn die Dinge auf diese Art und Weise angegangen« seien. Ihrer beider Methoden, so Doyle zu seinen Zuhörern, hatten ihn dazu veranlasst, Detektivgeschichten zu schreiben, in denen der Ermittler vom Standpunkt eines Wissenschaftlers ausging.
Doch weshalb würdigte Doyle Littlejohn keines Wortes und verwies gleichzeitig laufend und nachdrücklich auf Bell? Bestanden zwischen Doyle und Littlejohn persönliche Animositäten? Wollte Doyle aus irgendeinem Grund vermeiden, dass sich auch der Polizeiarzt im Ruhmesglanz seines literarischen Helden sonnte? Denkbar wäre es. Möglicherweise hatte das Schweigen, mit dem er Littlejohn belegte, aber auch edlere Motive. Wenn es sich nicht um mutwillige Täuschung handelte, war es dann vielleicht ein Ablenkungsmanöver mit den besten Absichten? Wollte er Bell ins Rampenlicht schieben, damit Littlejohn unbeachtet blieb? Für Bell waren kriminalistische Ermittlungen ja nicht mehr als ein Hobby, er war, wie er selbst sich nannte, »der zweite Mann«, oder anders gesagt: der nicht amtliche beratende Detektiv. Für Littlejohn stand weitaus mehr auf dem Spiel, denn die kriminaltechnischen Untersuchungen waren ein Teil seines beruflichen Aufgabengebiets. Hätte der Schatten von Sherlock Holmes über ihm geschwebt, so hätte das seine Arbeit unvermeidlich verkompliziert. Und das wäre ein gewichtiger Grund gewesen, seine Verbindung zu Holmes zu verschweigen. Bell und Doyle waren beides aufrichtige Männer, die alles in ihrer Macht Stehende getan hätten, um zu gewährleisten, dass Littlejohns Arbeit, die ja täglich über Leben und Tod entschied, nicht von einer öffentlichen Hysterie beeinträchtigt wurde, die einer fiktionalen Figur galt. Jedenfalls waren es starke Bande, die Littlejohn, Bell, Doyle und Holmes miteinander verbanden.
Als Cecil Hambrough im August 1893 tot in einem Waldstück in Ardlamont lag, waren Littlejohn, Bell und Doyle einander schon oft begegnet und hatten miteinander um Ansehen und Erfolg gewetteifert. Jeder war, auf seine Weise, mit den finstersten Winkeln des menschlichen Geistes bekannt geworden, und alle standen unter Beobachtung der Öffentlichkeit. Doch selbst wenn sie all ihre Verstandeskraft und Einbildungsgabe zusammengeworfen hätten, hätten sie sich niemals das Drama ausmalen können, das sich nun entfalten sollte.
2
Verflochtene Schicksale
»Bisweilen findet man unter Adlern eine Aaskrähe.«
Sherlock Holmes, Shoscombe Old Place
Im Jahr 1890 hatte Cecil Hambrough allen Grund, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Er war 1873 als Windsor Dudley Cecil Hambrough zur Welt gekommen und war der Sohn und Erbe von Major Dudley Hambrough. Er war jung, gutaussehend und voller Lebenshunger, und eines Tages würde er – so seine Hoffnung – das Oberhaupt seiner wohlhabenden und angesehenen Familie sein.
Die Hambroughs stammten von der vor der englischen Südküste gelegenen Isle of Wight und hatten dort in dem herrschaftlichen, im gotischen Stil gehaltenen Steephill Castle residiert, etwas außerhalb des aufstrebenden Badeortes Ventnor. Mit seiner eindrucksvollen quadratischen Festungsmauer und seinem hohen Rundturm wirkte dieses außergewöhnliche Gebäude, als sei es Hunderte von Jahren alt, doch in Wirklichkeit war es deutlich jünger. Das Anwesen von Steephill war im Lauf der Jahre durch die Hände mehrerer adliger Familien gegangen, und als Wohnhaus hatte dabei stets ein kleines Cottage auf dem Gelände gedient (das allerdings durchaus komfortabel war). Um 1830 herum hatte John Hambrough, Cecils Urgroßvater, der sein Vermögen als Banker sowie durch etliche raffinierte Immobiliengeschäfte gemacht hatte, das Anwesen gekauft.
Hambrough ließ das Cottage sowie etliche andere Gebäude abreißen, um Platz für das Schloss seiner Träume zu schaffen. Die Wände der Bibliothek und des Studierzimmers zierte eine Vertäfelung aus Eichenholz mit ausgefallenen Schnitzereien, das prunkvolle Billardzimmer wurde von einem Fenster mit Buntglas erhellt, und im Speisezimmer prangte ein übergroßer Kamin aus Marmor, dessen Abzug durch eine Decke aus gebohnertem Kiefernholz führte. Über der Zufahrt erhob sich ein Bogen, in den Hambroughs Initialen sowie die seiner Ehefrau Sophie Townsend gemeißelt waren. Hambrough hatte Erfolg im Leben gehabt und wollte sein Licht nicht unter den Scheffel stellen; angeblich hatte der Neubau eine Viertelmillion Pfund gekostet (heute knapp dreizehn Millionen Euro), und die Arbeiten hatten über zwei Jahre gedauert.
Doch der Familie blieb ein tragisches Schicksal nicht erspart. John Hambrough bekam die Früchte seiner Arbeit nie zu Gesicht, denn 1835 erblindete er, kurz vor der Fertigstellung des Gebäudes. Gleichwohl wurde Steephill schon bald einer der Hauptschauplätze des Insellebens und zog zahlreiche illustre Besucher an, unter anderem Queen Victoria und Prinz Albert sowie Elisabeth, die Kaiserin von Österreich-Ungarn, die das Schloss im Sommer 1874 mietete. Sie genoss ihren Aufenthalt auf der Insel so sehr, dass sie bei einem Londoner Silberschmied einen Pokal in Auftrag gab, der dem Sieger des alljährlich ausgetragenen Pferderennens von Ventnor überreicht werden sollte. Der erste Sieger war eine Stute namens Beauty, die einst Cecils Vater Dudley gehört hatte; er hatte sie jedoch verkauft, weil er sie für zu langsam hielt. Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass er auf das falsche Pferd setzte.