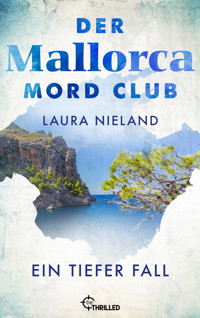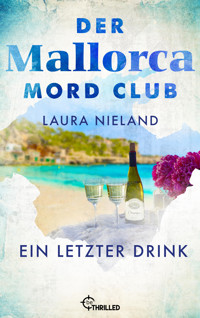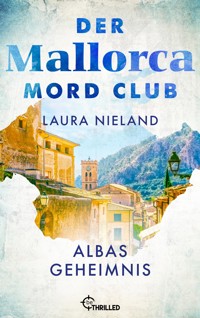Die Wahrheit zwischen den Farben
Laura Nieland
Copyright © 2024 Litur Verlag
Covergestaltung von Nadine DelaCoverabbildung von ezstudiophoto, Feoktistova / Adobe StockLektorat: Marie Döling – www.writeinpieces.jimdofree.comKorrektorat: Marie Döling – @write_in_piecesISBN E-Book 9783000787157www.litur.de
Inhaltsverzeichnis
Die Wahrheit zwischen den Farben
Danksagung
Die Wahrheit zwischen den Farben
Kutschen donnerten über Paris' Asphalt, sodass der Staub wie Nebelschwaden über den Straßen waberte. Es war ein Tag im Sommer, der jedem anderen glich, und doch schien er besonders. Kein Wölkchen wagte es, die Perfektion des azurblauen Himmels zu stören. Über der Île de la Cité erhob sich Notre Dame wie eine Königin auf ihrem Thron, umringt von Bäumen, deren üppiges Grün ihrer grauen Fassade huldigte, während auf der Pont Neuf geschäftiges Treiben herrschte. Die Damen trugen ihre Kleider spazieren. Ihre Frisuren türmten sich auf ihren Köpfen wie Kunstwerke, gemeißelt aus Porzellan. Mit ihren Fächern wedelten sie sich eine Brise ins Gesicht, die sie an diesem heißen Tag gebrauchen konnten, bevor sie durch die Schnürung ihrer Kleider in Ohnmacht fielen.
Die Luft war geschwängert vom Hufschlag der Pferde, dem Knarren der Kutschen und den Gesprächen der Herrschaften. Unter ihnen, unter der Brücke, die wie eine Burgmauer über der Seine schwebte, verlief ein Weg am Quai de Conti. Dort spürte man nichts von dem Treiben über ihnen.
Boote ankerten am Steg, der unter dem Quai verlief, trieben träge in der Sonne und wurden von den Wellen des Flusses geschaukelt. Verliebte Pärchen schlenderten mit Blick auf die Île de la Cité, kicherten, während die leicht nach Fisch stinkende Luft besser roch als je zuvor.
Dort an der Seine, unter dem duftenden Blauregen, der die Wand zum Quai de Conti hinaufkletterte, saß ein Maler. Wie jeden Tag. Vom ersten Sonnenstrahl, der sich im Wasser spiegelte, bis zum letzten, der die Stadt mit rotgoldener Farbe übergoss. Stundenlang verharrte er, malte voller Leidenschaft mit einem steten Lächeln im Gesicht.
Trotz seiner Blindheit, erfreute er sich einer großen Beliebtheit bei Touristen und Herrschaften, die so manches Mal Porträts von sich anfertigen ließen. Nach getaner Arbeit bestaunten sie das Werk voller Entzücken, unterhielten sich noch einige Minuten mit dem Künstler und gaben ihm anschließend einige Centimes. Manchmal ließen gut betuchte Herrschaften auch mehrere Franc in die Mütze fallen.
Der Mann freute sich über jedes Klingeln, viel mehr aber noch über die Menschen, die mit ihm sprachen und seine Arbeit bewunderten. Was ihn jedoch gänzlich entzückte, war das Gefühl, wenn die Leute seine Malerei verstanden.
Für ihn war es eine Leidenschaft, Kunst zu erschaffen. Es erfüllte ihn. Gleichermaßen verlangte die Kunst nach ihm wie ein Säugling nach der Brust der Mutter. Doch das Schwere daran war das Missverständnis der Menschen und die immergleiche Frage, die ihn begleitete: Waren seine Bilder etwas wert, wenn die Menschen nicht verstanden, was er versuchte, ihnen zu sagen?
Viel zu oft hatte er gehört, wie der Maronen-Verkäufer sich darüber brüskiert hatte, dass ein Blinder nicht malen könne, besonders keine Porträts. Er nannte ihn einen Betrüger, Stümper und an ganz schlimmen Tagen sogar einen Wahnsinnigen.
Zwar war der Maler, der den ehrenwerten Namen Manuel Epiphane trug, blind, aber nicht unfähig, zu sehen. Und schon gar nicht war er taub. Er lauschte dem Flüstern des Windes und den Vögeln, die ihm regelmäßig einen Besuch abstatteten.
»Mein lieber Herr«, erklang eine Frauenstimme. »Ich habe nicht viel Geld, aber … würden Sie ein Porträt von mir anfertigen?«
Manuel blickte auf, der silberne Schein seiner Augen reflektierte das Sonnenlicht, während ein Lächeln auf seine Lippen trat. »Bitte.« Er deutete auf den Schemel vor ihm. »Wenn Sie kein Geld haben, müssen Sie mir keines geben. Kunst sollte auch für die sein, die es sich nicht leisten können.«
Zögerlich lächelte die Frau, nicht sicher, ob sie dieser Bitte Folge leisten sollte. Ihr graues Kleid, das sicherlich einst weiß gewesen war, war übersät von Flicken verschiedener Farben und Stoffe, die sie irgendwie hatte aufbringen können. Geld für ein neues Kleid war nie ausreichend gewesen. Sobald sie sich auf dem wackeligen Hocker niederließ, legte sie ihre Hände in den Schoß.
»Wie heißen Sie, meine Liebe?«, fragte Manuel, während er nach seinen Farben tastete. Vor die Schälchen geritzte Zeichen halfen ihm, sich zu orientieren.
Die Frau beobachtete ihn gebannt bei der Auswahl seiner Farben, noch immer irritiert, aber auch neugierig. »Sophie Madeleine«, sagte sie mit einem Klang in der Stimme, als würde sie jeden Moment in Tränen ausbrechen.
Manuel, der im Laufe seiner Kindheit blind geworden war, wusste sehr wohl, wie Menschen aussahen. Wie verschieden sie waren, welche Schönheit jeder einzelne besaß. Doch das wahre Ausmaß dieser Schönheit hatte er erst richtig sehen können, nachdem er erblindet war.
Mit einem Lächeln auf den Lippen lauschte er dem Star, der sich auf der Mauer über ihm niedergelassen hatte. Er hörte ihm so genau zu, dass das geschäftige Treiben zu einem Rauschen im Hintergrund verblasste.
»Wo leben Sie, Madame?«
»Oh«, flüsterte Sophie Madeleine und errötete. »In einem kleinen Appartement, zusammen mit meiner Mutter und meinen vier Kindern.«
»Vier Kinder«, wiederholte Manuel. Sein Gesicht erstrahlte. Er liebte Kinder, ihre Reinheit, ihre Unschuld.
»J-ja, Monsieur.«
Langsam entstand ein Bild in der Dunkelheit vor Manuels Augen. Wie er es entstehen ließ, war ein Geheimnis, das er nur mit der Leinwand teilte.
Er malte ein junges Gesicht mit roten Lippen und einer Stupsnase. Die Augen waren groß wie die eines Rehs. Ihre Haare glänzten und fielen lang über ihre Schulter, umspielten ihre Brust. Das Kleid, das sie trug, war weiß.
Ein Räuspern ertönte und ließ Manuel die Brauen heben. »Monsieur, ich möchte nicht unhöflich sein, aber wie gelingt es Ihnen, zu malen, wenn Sie doch … wenn Sie -«
»Obwohl ich blind bin?« Manuel lächelte. »Nun, das ist eine Sache der Übung, Madame.«
Die Frau blinzelte. »Monsieur, Sie haben mich falsch verstanden.« Sie nestelte an dem Stoff ihres Kleides. »Wie schaffen Sie es, mich zu malen? Sie können mich nicht sehen.«
Manuel führte den Pinsel unbeirrt weiter über das Papier. »Ich kann Sie sehr gut sehen, Madame. Nicht Ihr Äußeres, aber das ist nicht von Belang.« Er machte eine kurze Pause, überlegte, ob er ihr mehr offenbaren sollte. »Ich weiß, dass Sie jeden Tag vor dem Morgengrauen aus dem Haus verschwinden, während Ihre Kinder und Ihre Frau Mutter, die voller Gebrechen scheint, noch schlafen. Ihr Mann ist im Krieg gefallen, nicht?«
»Ja, woher -« Ein eisiger Schauer erfasste Sophie Madeleines vom Sommer erhitzten Körper. Der Wunsch, aufzuspringen und fortzurennen, erfasste sie. Aber sie blieb, mehr angewurzelt als aus freien Stücken.
»Sie bieten Ihre Dienste bei den Herrschaften an. Kochen, Kammerpflege.« Manuel färbte den Hintergrund des Porträts in eine goldene Farbe. »Wenn Sie dann einige Francs verdient haben, kaufen Sie einen Laib Brot, den Sie oft mit den Bettlern in den Straßen teilen. Den Rest heben Sie für Ihre Familie auf, ehe Sie in die Innenstadt laufen, um Schuhe zu putzen. Weitere wenige Francs, die Sie und Ihre Familie ernähren.«
Sophie Madeleines Kehle schnürte sich zu. Mit offenem Mund starrte sie auf den Maler, dessen Augen wahllos in ihren Höhlen umherirrten und doch so viel mehr zu sehen schienen als andere Menschen.
»Ich weiß, dass Sie sich rührend um ihre Frau Mama kümmern.« Manuel lachte verzückt. »Es ist mir immer eine Freude, Herrschaften wie Ihnen mit meiner Kunst zu beglücken. Ich treffe nicht oft auf Menschen, die wahre Schönheit beherbergen.«
Ein weiteres Mal errötete Sophie Madeleine.
Um sie herum hatte sich bereits eine Traube neugieriger Zuschauer versammelt. Verkäufer, aber auch reiche Herrschaften, die voller Staunen auf das Gemälde der Frau blickten, das so gar nicht aussah wie sie und dennoch seinen Reiz barg.
Ganz zum Ärgernis des Maronen-Verkäufers. »Humbug«, grunzte der. »So ein Betrüger! Und sieh dir an, wie sie ihm verfallen. Wie Ratten dem Käse.« Empört strich er über seinen Schnurrbart und schüttelte den Kopf.
Der Maler ignorierte die Gehässigkeiten des Verkäufers und präsentierte das Gemälde der Madame und den Zuschauern. Während die umstehenden Herrschaften Applaus spendeten, entglitt Sophie Madeleine ein Laut des Entzückens. Für einen Augenblick, flüchtig wie ein Augenaufschlag, war sie enttäuscht.Nicht, weil die Frau auf dem Gemälde nicht so aussah wie sie, sondern vielmehr, weil sie gern so aussehen würde. Lediglich in den Augen des jungen Mädchens, die sie entfernt an ihr kindliches Ich erinnerten, erkannte sie sich wieder. Aber sie hatte verstanden, was der Maler gesehen hatte.
Auf wackeligen Beinen sprang sie auf, nahm das Bild an sich und bedankte sich so inbrünstig wie noch nie zuvor. Nichts hatte sie zuletzt so sehr erfreuen können wie dieses Stück Kunst, das sie nun stolz in den Händen trug. Es schien, als durchdrangen die Sonnenstrahlen ihre Brust und stießen auf ihr Herz, das vor lauter Kummer und Leid verkümmert war.
»Danke«, sagte sie und gab trotzdem einen Großteil ihres hart verdienten Geldes dem Maler, der, so war sie sich sicher, es ebenfalls gut gebrauchen konnte.
»Ich danke Ihnen«, sagte der Maler, verbeugte sich und sandte ebenfalls einen leisen Dank gen Himmel aus.
Die Damen und Herren ignorierend, die hinter vorgehaltenen Händen und mit spitzen Zungen über sie sprachen, schritt sie die Treppen zur Brücke empor und verschwand wie ein Geist im grellen Sonnenlicht.
»Ein wirklich talentierter Künstler sind Sie«, ertönte die Stimme eines jungen Mannes.
Manuel sah auf, während er geschäftig seine Pinsel reinigte. »So?«